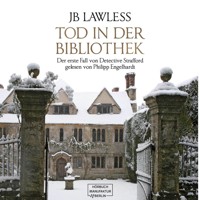8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Detective Strafford ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Klassischer kann ein Krimi kaum beginnen: Ein Pfarrer liegt tot in der Bibliothek eines irischen Herrenhauses. Die Anzahl der Verdächtigen ist eher klein. Wer aus der Familie hat den Pfarrer auf dem Gewissen? »Die Leiche liegt in der Bibliothek«, sagte Colonel Osborne. »Hier entlang bitte.« Bei der Leiche handelt es sich um einen Kirchenmann, Father Tom, dem übel mitgespielt wurde. Glaubt man dem Colonel, war er in der Gegend sehr beliebt. Seine Tochter Lettie hingegen mochte ihn nicht besonders. Und da sind noch Sylvia Osborne, die zweite Frau des Colonels und 25 Jahre jünger als er, der gutaussehende Sohn Dominic und der leicht debile Stallbursche Fonsey. Ist der Mörder in diesem kleinen Kreis zu finden? Während der Schnee immer weiter fällt, versucht Detective St John Strafford frierend, dem Mörder des Pfarrers auf die Spur zu kommen. Ein klassischer Whodunit vor wunderbar winterlicher Kulisse im ländlichen Irland und ein Muss für alle Agatha-Christie-Fans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Ähnliche
JB Lawless
Tod in der Bibliothek
Der erste Fall von Detective Strafford
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über JB Lawless
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Winter 1957
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Sommer 1947
24. Kapitel
Winter 1957
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Sommer 1967
28. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Winter 1957
Ich bin Priester, Herr im Himmel – wie kann mir so etwas passieren?
Ihm war aufgefallen, dass das Licht nicht funktionierte, aber er hatte sich nichts dabei gedacht. Doch als er den Korridor zur Hälfte durchquert hatte, packte ihn – genau an der Stelle, wo es am dunkelsten war – etwas an der linken Schulter, irgendein Tier oder ein großer, schwerer Vogel, und trieb ihm eine einzelne Kralle tief in den Hals, rechts, gleich über dem Rand seines Zelluloidkollars. Er spürte nur den blitzschnellen, kraftvollen Stich, dann wurde sein Arm taub bis in die Fingerspitzen.
Ächzend taumelte er weg von seinem Angreifer. Hinten in seinem Rachen entstand ein Geschmack, eine Mischung aus Galle und Whiskey, und da war noch etwas anderes, es schmeckte metallen, nach Kupfer, es war der Geschmack von Todesangst. Auf seiner rechten Seite breitete sich etwas Warmes, Klebriges aus, und er fragte sich kurz, ob sich das Geschöpf auf ihn übergeben hatte. Er torkelte weiter zum Treppenabsatz, wo eine einzelne Lampe brannte. Er strich sich über die Brust und hielt die Hände vor das Gesicht. Im Lichtschein wirkte das Blut daran beinahe schwarz.
Sein Arm war immer noch taub. Schwankend erreichte er die oberste Stufe der Treppe. Ihm war schwindelig, und er fürchtete zu stürzen, aber er hielt sich mit der linken Hand am Geländer fest und schaffte es durch das gewundene Treppenhaus hinunter in die Eingangshalle. Dort blieb er stehen, schwankend und keuchend wie ein verletzter Stier. Es war ganz still jetzt, bis auf das dumpfe, langsame Pochen in seinen Schläfen.
Eine Tür. Er riss sie auf, in der verzweifelten Hoffnung auf eine Zuflucht. Mit der Schuhspitze blieb er an einer Teppichkante hängen, sodass er, schlaff und schwer, der Länge nach hinfiel und sich dabei die Stirn auf dem Parkettboden aufschlug.
Reglos lag er im Halbdunkel, das Holz, das nach Bohnerwachs und altem Staub roch, glatt und kühl an seiner Wange.
Der Lichtfächer auf dem Boden hinter seinen Füßen klappte abrupt zu, als jemand hereinkam und die Tür schloss. Ein Geschöpf, dasselbe oder ein anderes, beugte sich atmend über ihn. Fingernägel oder Klauen, er konnte es nicht sagen, machten sich an seinem Schoß zu schaffen. Auch da war es klebrig, aber nicht von Blut. Die Klinge blitzte auf, schnitt kalt und tief in sein Fleisch.
Er hätte geschrien, aber seine Lunge ließ ihn im Stich. Er hatte keine Kraft mehr. Mit ihm selbst schwand auch der Schmerz, bis da nur noch eine kriechende Kälte war. Confiteor Deo … Er kippte auf den Rücken und gab einen rasselnden Seufzer von sich. Eine Blutblase schwoll zwischen seinen leicht geöffneten Lippen an, schwoll und schwoll und platzte schließlich mit einem kleinen Plopp, ein lustiges Geräusch in der Stille, das er allerdings nicht mehr hören konnte.
Das Letzte, was er sah oder zu sehen meinte, war ein schwaches Licht, das aufflackerte und die Dunkelheit kurz gelblich färbte.
1
Die Leiche liegt in der Bibliothek«, sagte Colonel Osborne. »Hier lang bitte.«
Detective Inspector Strafford war kalte Häuser gewohnt. Er hatte seine frühe Kindheit in einem stattlichen, kargen Herrenhaus zugebracht, das diesem sehr ähnelte, und dann hatte man ihn zur Schule in eine Einrichtung geschickt, die noch größer und grauer und kälter gewesen war. Er wunderte sich oft über die drastischen Unbilden und Leiden, die Kinder ohne den leisesten Protest hinnehmen sollten. Als er Osborne jetzt durch den breiten Gang folgte – von der Zeit polierte Steinfliesen, ein Geweih an einer Holzplatte, düstere Porträts von Osborne-Vorfahren zu beiden Seiten an der Wand –, kam es ihm vor, als sei die Luft hier drinnen noch eisiger als draußen. In einem gähnenden Steinkamin glommen drei feuchte, in einem Dreifuß arrangierte Torfsoden mürrisch vor sich hin, ohne eine spürbare Wärme von sich zu geben.
Seit zwei Tagen schneite es ununterbrochen. An diesem Morgen schien der ungewohnte Anblick des ausgedehnten unberührten Weiß rundherum die Menschen in stilles Staunen zu versetzen. Sie behaupteten, so etwas sei noch nie da gewesen, sie hätten noch nie ein solches Wetter erlebt, es sei der schlimmste Winter seit Menschengedenken. Aber das sagten sie jedes Jahr, wenn es schneite, und auch in den Jahren, in denen es nicht schneite.
In der Bibliothek schien schon sehr lange niemand mehr gewesen zu sein. Heute wirkte sie, als hätte man Schindluder mit ihr getrieben, empört, weil ihre Einsamkeit so plötzlich und grob gestört worden war. Die verglasten Bücherschränke an den Wänden starrten kalt vor sich hin, und hinter den trüben Scheiben standen die Bücher in stummem Groll Schulter an Schulter. Die Koppelfenster saßen in tiefen Laibungen aus Granit, und das unwirklich harte weiße Licht des Schnees schien grell durch die vielen kleinen mit Blei eingefassten Scheiben. Strafford hatte die Architektur des Hauses schon skeptisch beäugt. Kunstgewerbliches Blendwerk, hatte er sofort gedacht und im Geiste die Nase gerümpft. Er war nicht gerade ein Snob, aber er mochte es, wenn man alles ließ, wie es war, und nicht ausstaffierte zu etwas, was es nie hoffen konnte zu sein.
Andererseits, wie stand es mit ihm selbst? War er denn völlig authentisch? Ihm war der überraschte Blick nicht entgangen, mit dem Colonel Osborne ihn von Kopf bis Fuß begutachtet hatte, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Colonel Osborne oder sonst jemand im Haus ihm sagen würde, dass er nicht gerade wie ein Polizist aussah. Daran war er gewöhnt. Die meisten Menschen meinten es als Kompliment, und er bemühte sich, es auch so aufzufassen, auch wenn er sich immer vorkam wie ein Trickbetrüger, der gerade aufgeflogen war.
Genau genommen meinten die Leute, dass er nicht aussah wie ein irischer Polizist.
Detective Inspector Strafford, mit Vornamen St John – »Das wird so ähnlich wie ›sinjin‹ ausgesprochen«, wurde er nicht müde zu erklären –, war fünfunddreißig und sah zehn Jahre jünger aus. Er war groß und dünn – schlaksig wäre wohl das rechte Wort –, hatte ein schmales, kantiges Gesicht, Augen, die in bestimmtem Licht grün aussahen, Haare von keiner besonderen Farbe. Eine Strähne neigte dazu, ihm wie ein schlaffer, schimmernder Flügel über die Stirn zu fallen, und er schob sie immer mit einer charakteristischen schnellen und steifen Geste, die alle vier Finger seiner linken Hand beanspruchte, zurück. Er trug einen Dreiteiler, der wie seine gesamte Kleidung mindestens eine Nummer zu groß zu sein schien, eine fest geknotete Krawatte, eine Taschenuhr an einer Kette – sie hatte seinem Großvater gehört – sowie einen grauen Gabardine-Trenchcoat und einen grauen Wollschal. Den weichen schwarzen Filzhut hatte er abgenommen und hielt ihn an der Krempe in der Hand. Seine Schuhe waren durchweicht vom geschmolzenen Schnee – er schien die Pfützen nicht zu bemerken, die sich unter ihm auf dem Teppich bildeten –, und auch die Aufschläge seiner Hose waren dunkel vor Nässe.
Es war nicht so viel Blut zu sehen, wie man in Anbetracht der beigebrachten Verletzungen hätte erwarten müssen. Bei genauerer Betrachtung stellte er fest, dass jemand das meiste aufgewischt hatte. Auch am Körper des Priesters hatte man sich zu schaffen gemacht. Er lag auf dem Rücken, die Hände auf der Brust gefaltet, die Füße, in großen schwarzglänzenden Priesterschuhen, ordentlich nebeneinander. Es fehlte nur noch ein Rosenkranz um die Finger.
Erst mal still sein, sagte sich Strafford, später würde noch genug Zeit für die heiklen Fragen sein.
Auf dem Boden stand ein hoher Messingkerzenhalter, oberhalb des Kopfs des Priesters. Die Kerze war ganz heruntergebrannt, an allen Seiten war das Wachs heruntergelaufen. Groteskerweise sah es aus wie ein gefrorener Champagnerbrunnen.
»Verrückte Sache, nicht?« Der Colonel berührte den Ständer mit der Schuhspitze. »Mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen, das kann ich Ihnen sagen. Als hätte jemand eine schwarze Messe gefeiert oder so etwas.«
»Mhm.«
Strafford war noch nie etwas von einem Mord an einem Priester zu Ohren gekommen, nicht in diesem Land, zumindest nicht seit dem Bürgerkrieg, der geendet hatte, als er noch ein Kleinkind gewesen war. Es würde einen mächtigen Skandal geben, wenn die Einzelheiten bekannt wurden, falls sie überhaupt bekannt wurden; an so etwas wollte er gar nicht denken, noch nicht.
»Harkins hieß er, sagen Sie?«
Colonel Osborne, der den Toten stirnrunzelnd betrachtete, nickte. »Father Tom Harkins, ja – oder einfach nur Father Tom, so haben ihn alle genannt.« Er blickte zum Detective auf. »Sehr beliebt hier in der Gegend. Ein echtes Original.«
»Ein Freund der Familie also?«
»Ja, ein Freund des Hauses. Er kommt oft vorbei – kam oft vorbei, sollte ich wohl sagen – von Scallanstown aus, wo er gewohnt hat. Sein Pferd ist hier untergestellt – ich bin Master der Jagdhunde von Keelmore, und Father Tom hat sich nie einen Ausritt entgehen lassen. Eigentlich wollten wir gestern reiten gehen, aber dann hat es so geschneit. Er kam trotzdem vorbei und blieb zum Essen, und wir haben ihm angeboten, hier zu übernachten. Ich konnte ihn ja bei diesem Wetter nicht wieder vor die Tür schicken.« Sein Blick wanderte zurück zu der Leiche. »Aber wenn ich ihn mir jetzt so ansehe und was dem armen Kerl zugestoßen ist, da bereue ich doch bitter, dass ich ihn nicht heimgeschickt habe, Schnee hin oder her. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer ihm so etwas Schreckliches antun sollte.« Er hustete leicht und zeigte verschämt mit einem wackelnden Finger auf den Schritt des Toten. »Ich habe ihm, so gut es ging, die Hose zugemacht, um den Anstand zu wahren.« So viel also zur Unversehrtheit des Tatorts, dachte Strafford mit einem stillen Seufzen. »Da sehen Sie, dass sie – nun ja, sie haben den armen Kerl kastriert. Barbaren.«
»›Sie‹?«, fragte Strafford mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Sie. Er. Ich weiß es nicht. So was haben wir früher oft zu sehen bekommen, als die für ihre sogenannte Freiheit gekämpft haben und es auf dem Land eine Menge Mordgesellen gab. Ein paar von denen sind wohl immer noch unterwegs.«
»Sie glauben also, der – oder die – Mörder kam von außen ins Haus?«
»Also, ich bitte Sie, Sie glauben ja wohl nicht, dass jemand hier aus dem Haus so etwas tun würde?«
»Dann ein Einbrecher? Irgendwelche Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen – ein eingeschlagenes Fenster, ein kaputtes Türschloss?«
»Kann ich nicht sagen, das habe ich noch nicht überprüft. Ist das nicht Ihre Aufgabe, nach Hinweisen zu suchen und so weiter?«
Colonel Osborne war dem äußeren Eindruck nach Anfang fünfzig, schlank und ledern, mit einem kurz geschnittenen Schnurrbart und stechenden eisblauen Augen. Er war mittelgroß und wäre noch größer gewesen, hätte er nicht solche O-Beine gehabt – wahrscheinlich, wie Strafford zynisch vermutete, von den ganzen Jagden zu Pferd. Außerdem hatte er einen merkwürdigen Gang, wankend, wie ein Orang-Utan, der etwas an den Knien hat. Er trug hochglanzpolierte braune Budapester, Hosen aus Cavalry-Twill mit scharfen Bügelfalten, ein Jagdsakko aus Tweed, ein kariertes Hemd und eine getupfte Fliege in einem gedeckten Blau. Er roch nach Seife und Tabakrauch und Pferden. Seine Haare waren schütter. Er hatte ein paar rotblonde Strähnen eingeölt und streng von den Schläfen aus nach hinten gekämmt, wo sie am Hinterkopf aufeinandertrafen und leicht abstanden, wie die Schwanzspitze eines exotischen Vogels.
Er hatte als Offizier der Inniskilling Dragoons gekämpft, in Dunkerque irgendetwas Beachtenswertes geleistet und einen Orden dafür bekommen.
Er entsprach ganz einem bestimmten Typ, dieser Colonel Osborne, einem Typ, mit dem Strafford durch und durch vertraut war.
Schon seltsam, dachte er bei sich, dass jemand sich die Zeit nahm, sich so korrekt anzukleiden und herzurichten, während die Leiche eines erstochenen und kastrierten Priesters in seiner Bibliothek lag. Aber die Form musste natürlich gewahrt werden, unter allen Umständen – während der Belagerung von Khartum war jeden Tag, häufig auch im Freien, der Nachmittagstee serviert worden –, das war der Kodex des Stands des Colonels, zu dem auch Strafford selbst gehörte.
»Wer hat ihn gefunden?«
»Meine Frau.«
»Aha. Hat sie gesagt, ob er so dagelegen hat, also mit gefalteten Händen?«
»Nein, das war ich, ich habe ihn ein bisschen hergerichtet.«
»Aha.«
Verdammt, dachte Strafford, verdammter Mist!
»Aber ich habe ihm die Hände nicht gefaltet – das muss Mrs Duffy gewesen sein.« Er zuckte mit den Achseln. »Sie wissen ja, wie die sind«, fügte er leise und mit vielsagendem Blick hinzu.
Mit »die« meinte er natürlich die Katholiken, das war Strafford klar.
Der Colonel zog ein silbernes, mit Monogramm versehenes Zigarettenetui aus der Brusttasche der Innenseite seines Jacketts, drückte mit dem Daumen auf den Verschluss, öffnete das Etui auf der flachen Hand und präsentierte zwei fein säuberlich geordnete vollständige Reihen Zigaretten, jede von einem Gummiband festgehalten. Es war die Marke Senior Service, wie Strafford automatisch registrierte. »Wollen Sie?«
»Nein, danke.« Strafford betrachtete immer noch die Leiche. Father Tom war ein kräftiger Mann gewesen, mit starken Schultern und einem breiten Brustkorb. In den Ohren hatte er wollene Haarbüschel – Priester, die ja keine Frau hatten, neigten dazu, solche Dinge zu vernachlässigen, dachte Strafford bei sich. Dabei fiel ihm ein: »Und wo ist sie jetzt, Ihre Frau?«
»Hm?« Osborne starrte ihn einen Augenblick an und blies zwei Stoßzähne aus Zigarettenrauch aus der Nase. »Ach ja. Sie ist oben und ruht sich aus. Ich habe ihr ein Glas Portwein mit Brandy verabreicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, in was für einem Zustand sie ist.«
»Natürlich.«
Strafford klopfte mit dem Hut sanft gegen seinen linken Oberschenkel und sah sich zerstreut um. Alles war irgendwie unwirklich, der große, quadratische Raum, die hohen Bücherschränke, der feine, aber ausgeblichene anatolische Teppich, die sorgfältig arrangierten Möbel, und dann die Leiche, die so penibel hergerichtet worden war, mit offenen, glasigen Augen, den Blick vage nach oben gerichtet, als wäre derjenige, dem sie gehörten, gar nicht tot, sondern würde verwirrt über etwas grübeln.
Und außerdem war da der Mann, der auf der anderen Seite der Leiche stand, in seiner gebügelten Hose und dem karierten Baumwollhemd mit der gekonnt gebundenen Fliege, seinem militärischen Schnurrbart und den kalten Augen. Durch das Fenster hinter ihm traf ein funkelnder Lichtstrahl auf die Rundung seines glatten, gebräunten Schädels. Das wirkte alles viel zu theatralisch, besonders mit diesem unnatürlichen grellweißen Licht, das von außen ins Innere drang. Es sah zu sehr aus wie die letzte Szene eines Salonstücks, kurz bevor der Vorhang fiel und das Publikum sich zum Applaus bereit machte.
Was war hier letzte Nacht vorgegangen, dass dieser Mann nun tot und verstümmelt dalag?
»Sie sind aus Dublin hergekommen?«, fragte Colonel Osborne. »Tückisch, die Fahrt, vermute ich? Die Straßen sind spiegelglatt.« Er hob eine Augenbraue und senkte die andere. »Sie sind allein gefahren?«
»Man hat mich angerufen, da bin ich rübergefahren. Ich habe hier unten Verwandte besucht.«
»Verstehe«, brummte der Colonel und räusperte sich. »Wie war der Name noch mal? Stafford?«
»Strafford, mit r.«
»Verzeihung.«
»Keine Sorge, diesen Fehler machen alle.«
Colonel Osborne nickte, runzelte die Stirn, dachte nach. »Strafford«, murmelte er. »Strafford.« Er nahm einen langen Zug an seiner Zigarette und kniff wegen des Rauchs ein Auge zu. Er versuchte, den Namen irgendwo einzuordnen. Der Detective bot ihm keine Hilfe an.
»Es kommen bald noch mehr Leute«, sagte er. »Guards, in Uniform. Ein Team von Kriminaltechnikern. Und ein Fotograf.«
Colonel Osborne starrte ihn beunruhigt an. »Von den Zeitungen?«
»Der Fotograf? Nein – das ist einer von unseren Leuten. Um … um den Tatort fotografisch festzuhalten. Sie werden ihn kaum bemerken. Aber wahrscheinlich berichten trotzdem alle Blätter, und auch das Radio. Dagegen kann man nichts machen.«
»Wohl nicht«, sagte Colonel Osborne verdrießlich.
»Es liegt allerdings nicht in unserer Hand, wie die Meldung genau aussehen wird.«
»Wie das?«
Strafford zuckte mit den Schultern. »Sie wissen sicherlich so gut wie ich, dass in diesem Land nichts, was in den Zeitungen erscheint, vorher nicht – nun ja, gründlich geprüft wurde.«
»Geprüft? Von wem denn?«
»Von denen da oben.« Der Detective zeigte auf die Leiche zu ihren Füßen. »Immerhin wurde hier ein Priester ermordet.«
Colonel Osborne nickte und schob den Unterkiefer zur Seite, als würde er kauen. »Von mir aus können die prüfen, wie es ihnen beliebt. Je weniger davon herauskommt, umso lieber ist es mir.«
»Ja. Sie könnten Glück haben.«
»Glück?«
»Vielleicht kommt ja auch gar nichts heraus. Ich meine, vielleicht werden die Umstände – sagen wir mal schöngefärbt? Das wäre nichts Ungewöhnliches.«
Dem Colonel entging die Ironie der letzten Bemerkung; das Schönfärben von Skandalen war eher die Norm als etwas Ungewöhnliches. Er blickte wieder auf die Leiche hinunter. »Trotzdem, schreckliche Geschichten. Weiß Gott, was die Nachbarn sagen werden.«
Wieder beäugte er den Detective fragend von der Seite. »Strafford. Seltsam, ich dachte, ich kenne alle Familien hier in der Gegend.«
Damit meinte er natürlich alle protestantischen Familien, wie Strafford durchaus bewusst war. Protestanten machten etwa fünf Prozent der Bevölkerung der noch relativ jungen Republik aus, und davon gelang es nur einem Bruchteil – den »Pferdeprotestanten«, wie das katholische Irland sie höhnisch bezeichnete –, an ihren Anwesen festzuhalten und mehr oder weniger so zu leben, wie sie es in der Zeit vor der Unabhängigkeit getan hatten. Daher war es kaum überraschend, dass sie alle davon ausgingen, sich gegenseitig zu kennen oder zumindest voneinander zu wissen, über ein komplexes Netzwerk von Verwandten, Angeheirateten, Nachbarn und eine Kohorte uralter Feinde.
Doch in Straffords Fall war Colonel Osborne offensichtlich mit seiner Weisheit am Ende. Der Detective beschloss amüsiert, nachzugeben – was konnte es schon schaden?
»Roslea«, sagte er, als wäre das ein Codewort, was es, wenn er es sich recht überlegte, auch war. »Drüben bei Bunclody, an der Grenze des County.«
»Ach ja.« Der Colonel runzelte die Stirn. »Roslea House? Ich glaube, ich war einmal dort, es ist Jahre her, auf einer Hochzeit oder so. Ist das Ihr …?«
»Ja. Meine Familie lebt noch dort. Beziehungsweise mein Vater. Meine Mutter ist jung gestorben, und ich war ein Einzelkind.« Ein Einzelkind: Das hörte sich für seine Erwachsenenohren immer seltsam an.
»Ja, ja«, brummte Colonel Osborne nickend. Er hatte nur halb zugehört. »O ja.«
Strafford merkte dem Mann an, dass er nicht beeindruckt war – in der Nähe der Gemeinde von Roslea gab es überhaupt keine Osbornes, und wo es keine Osbornes gab, da konnte es für Colonel Osborne nichts anderes von Interesse geben. Strafford stellte sich vor, wie sein Vater in sich hineinlachte. Stillvergnügt betrachtete der die Überheblichkeit seiner Glaubensgenossen, die umständlichen Rituale des Standes und der Privilegien beziehungsweise der eingebildeten Privilegien, mit denen sie in diesen angespannten Zeiten lebten oder versuchten zu leben.
Während er über diese Dinge nachdachte, staunte Strafford wieder über die Absurdität der Lage: Wie konnte es sein, dass ein katholischer Priester, »ein Freund des Hauses«, tot in einer Blutlache in Ballyglass House lag, dem Stammsitz der Osbornes, im alten Baronat von Scarawalsh im County Wexford? Also wirklich, was würden die Nachbarn dazu sagen?
Jemand klopfte vorne an der Haustür.
»Das wird Jenkins sein«, meinte Strafford. »Detective Sergeant Jenkins, mein Stellvertreter. Es hieß, er sei auf dem Weg.«
2
Jedermann fiel an Sergeant Jenkins zuerst auf, wie flach sein Kopf war. Die Oberseite schien glatt abgeschnitten worden zu sein, wie das stumpfe Ende eines gekochten Eis. Wie sollte auch nur das kleinste Gehirn in einer so flachen Höhlung Platz haben, fragten sich die Leute. Er versuchte, diesen Schönheitsfehler zu verbergen, indem er sich die Haare dick mit Pomade einrieb und sie oben aufbauschte, aber dadurch ließ sich niemand zum Narren halten. Angeblich hatte ihn die Hebamme bei der Geburt auf den Boden fallen lassen, aber diese Erklärung war nicht recht glaubhaft. Merkwürdigerweise trug er nie einen Hut, vielleicht weil er annahm, dass ein solcher seine sorgsam aufgeplusterten Haare platt drücken und die versuchte Tarnung zunichtemachen würde.
Er war jung, noch keine dreißig, ernsthaft und in seinem Beruf sehr engagiert. Außerdem war er intelligent, aber nicht ganz so intelligent, wie er glaubte, wie Strafford häufig und mit ein wenig Mitleid feststellen musste. Wenn etwas gesagt wurde, was er nicht verstand, wurde Jenkins still und wachsam, wie ein Fuchs, der die sich nähernde Jagdmeute wittert. Bei der Polizei war er nicht beliebt, Grund genug für Strafford, ihn zu mögen. Beide waren sie Außenseiter, was Strafford nicht störte, zumindest nicht sehr, während Jenkins es hasste, ausgegrenzt zu werden.
Wenn die Leute ihm sagten – und daran hatten sie aus irgendeinem Grund ihre Freude –, er brauche eine Freundin, guckte er finster, und seine Stirn färbte sich rot. Es war auch nicht besonders hilfreich, dass er mit Vornamen Ambrose hieß. Das allein war schon schlimm genug, wurde aber noch durch die Tatsache verstärkt, dass ihn alle, außer ihm selbst, Ambie nannten: Strafford musste zugeben, dass es schwierig war, respektiert zu werden, wenn man einen Schädel hatte, der flach wie ein umgedrehter Teller war, und dazu noch Ambie Jenkins hieß.
Zufällig kam Jenkins gleichzeitig mit den Kriminaltechnikern an. Sie folgten ihm auf den Fersen die Stufen zum Eingang hinauf und zogen Atemwolken hinter sich her.
Das Team bestand aus Hendricks, dem Fotografen, ein stämmiger junger Mann mit Hornbrille, buschigen schwarzen Augenbrauen und scheußlichen Aknenarben, einem Überbleibsel aus seiner Jugend, Willoughby, dem Experten für Fingerabdrücke – zumindest nannte er sich Experte –, dessen grau-rosa Haut und zitternde Hände eindeutige Anzeichen dafür waren, dass er heimlich trank, und ihrem Chef, dem Kettenraucher Harry Hall – man rief ihn immer mit vollem Namen, sodass es klang wie ein Doppelname. Er erinnerte Strafford mit seinen herabhängenden Schultern, dem dicken Hals und den gelben, vorstehenden Eckzähnen immer an einen Seeelefanten.
Strafford hatte schon mit den dreien zusammengearbeitet; privat kannte er sie als Lew, Curly und Mo. Sie standen in dem steingefliesten Vorraum, stapften sich den Schnee von den Stiefeln und bliesen sich in die Fäuste. Harry Hall, dem ein Zigarettenstummel mit zwei Zentimeter gekrümmter Asche daran an der Unterlippe klebte, beäugte das Geweih und die nachgedunkelten Porträts an der Wand und lachte sein Raucherlachen.
»Seht euch bloß mal um hier«, röhrte er pfeifend. »Als Nächstes tritt gleich Poirot persönlich auf.« Er sprach es wie Puorott aus.
Zusätzlich waren zwei uniformierte Guards in einem Streifenwagen gekommen, der eine groß, der andere klein, zwei Hornochsen, die gerade ihre Polizeiausbildung in Templemore hinter sich gebracht hatten und versuchten, ihre Unerfahrenheit und Unbeholfenheit hinter trotzigen Blicken und einem vorgereckten Kinn zu verbergen. Eigentlich gab es gar nichts für sie zu tun, deshalb ließ Jenkins sie im Vorraum aufstellen, zu beiden Seiten der Eingangstür. Dort sollten sie dafür sorgen, dass niemand ohne entsprechende Autorisierung hinein- oder hinausging.
»Was ist denn eine entsprechende Autori…?«, begann der Große, doch Jenkins fixierte ihn mit einem leeren Blick, der ihn zum Schweigen brachte. Aber nachdem Strafford Jenkins und die Jungs von der Forensik in die Bibliothek geführt hatte, sah der große Polizist den kleineren an und flüsterte: »Entsprechende Autorisierung, was soll das bitte sein?« Darauf kicherten sie beide so zynisch, wie sie es von den alten Hasen in der Polizei zu lernen versuchten.
Colonel Osborne stand immer noch neben der Leiche, stocksteif und erwartungsvoll. Harry Hall blickte sich auch hier vergnügt staunend um, betrachtete die Bücherregale, den Marmorkamin, die pseudomittelalterlichen Möbel.
»Das ist eine Bibliothek«, flüsterte er Hendricks fassungslos zu. »Das ist eine Scheißbibliothek, zum Henker, und es liegt eine Leiche drin!«
Die Kriminaltechniker widmeten sich niemals als Erstes der Leiche, das war ein ungeschriebenes Gesetz ihres Berufs. Hendricks war allerdings schon bei der Arbeit, die Blitzbirnen seiner Graflex zischten und ploppten, sodass alle Anwesenden ein, zwei Sekunden lang blind waren, nachdem er sie gezündet hatte.
»Kommen Sie doch mit auf eine Tasse Tee«, sagte Colonel Osborne.
Die Einladung war ausdrücklich an Strafford allein gerichtet, aber das war Sergeant Jenkins entweder nicht aufgefallen oder es war ihm egal – Jenkins hatte manchmal etwas Dreistes. Jedenfalls folgte er den beiden Männern aus dem Zimmer. In der Küche blickte Osborne ihn durchdringend an, sagte aber nichts. Jenkins strich sich die Haare am Hinterkopf glatt; von einem Möchtegern-Engländer in Schnürschuhen und Fliege ließ er sich nicht ins Abseits drängen.
»Kommen die dort drinnen klar?«, fragte Colonel Osborne Strafford und nickte in Richtung der Bibliothek.
»Sie sind sehr vorsichtig«, antwortete Strafford trocken. »Normalerweise machen sie nichts kaputt.«
»Nein, ich wollte damit nicht sagen … ich habe mich nur gefragt …« Er runzelte die Stirn und ließ den Wasserkessel in der Spüle volllaufen. Draußen vor dem Fenster waren die schwarzen Äste der Bäume beladen mit Schneestreifen, die glänzten wie Kristallzucker. »Das kommt mir alles vor wie ein böser Traum.«
»Das geht den meisten Leuten so. Gewalt wirkt immer unangebracht, das ist ja auch kaum verwunderlich.«
»Haben Sie das schon oft gesehen? Mord und solche Sachen?«
Strafford lächelte milde. »Solche Sachen gibt es nicht – ein Mord ist immer einzigartig.«
»Ich verstehe, was Sie meinen«, sagte Osborne, obwohl er das offensichtlich nicht tat.
Er stellte den Wasserkessel auf den Herd, musste Streichhölzer suchen, fand sie schließlich. Er öffnete mehrere Schranktüren und blickte hilflos in die Fächer – er hatte im Lauf der Jahre wohl nicht allzu viel Zeit in der Küche verbracht. Osborne nahm drei große Tassen von einem Regal und stellte sie auf den Tisch; zwei davon hatten einen Sprung, der seitlich hinunterlief wie ein feines schwarzes Haar.
»Wann wurde der Tote gefunden …?«, begann Jenkins, unterbrach sich aber, als er merkte, dass die beiden Männer an ihm vorbeiblickten. Er wandte sich um.
Eine Frau war geräuschlos eingetreten.
Sie stand in einem niedrigen Eingang, der zu einem anderen Teil des Hauses führte, eine Hand verkrampft auf Höhe der Taille über die andere gelegt. Sie war groß – sie musste sich in der Türöffnung ein wenig bücken – und ausnehmend schlank. Ihr Teint war blassrosa, wie Magermilch, in die man einen einzigen Tropfen Blut gemischt hatte. Ihr schmales Gesicht glich dem einer Madonna von einem der unbedeutenderen alten Meister, mit dunklen Augen und einer langen spitzen Nase mit einem kleinen Höcker an der Spitze. Sie trug eine beigefarbene Strickjacke und einen wadenlangen Rock, der ihr ein wenig schief von der jungenhaft schmalen Hüfte hing.
Sie war nicht schön, dafür war irgendwie nicht genug von ihr vorhanden, dachte Strafford, aber dennoch rührte etwas an ihrem zerbrechlichen, melancholischen Äußeren eine Saite in ihm an, sodass ein lautloses, trauriges kleines pling erklang.
»Ah, da bist du ja, meine Liebe«, sagte Colonel Osborne. »Ich dachte, du schläfst.«
»Ich habe Stimmen gehört.« Die Frau blickte ausdruckslos zwischen Strafford und Jenkins hin und her.
»Das ist meine Frau«, sagte Osborne. »Sylvia, das sind Inspector Strafford, und …?«
»Jenkins«, sagte der Polizist mit Nachdruck und einer Spur Unmut. Er verstand einfach nicht, warum sich die Leute seinen Namen nicht merken konnten – immerhin hieß er nicht Jones oder Smith. »Detective Sergeant Jenkins.«
Sylvia Osborne bedachte die Männer nicht mit einem Gruß, sondern trat nur aus der Türöffnung heraus und rieb sich die Hände. Sie wirkte so verfroren, dass es schien, als wäre ihr in ihrem ganzen Leben noch nicht warm gewesen. Strafford runzelte die Stirn; er hatte zuerst angenommen, sie sei Osbornes Tochter oder vielleicht eine Nichte, aber gewiss nicht seine Frau – Strafford schätzte sie auf mindestens zwanzig, wenn nicht fünfundzwanzig Jahre jünger als ihren Mann. In dem Fall, so dachte er, musste sie seine zweite Frau sein, da es erwachsene Kinder gab. Was wohl aus der ersten Mrs Osborne geworden war?
Der Kessel auf dem Herd gab ein schrilles Pfeifen von sich.
»Auf der Treppe ist mir jemand begegnet«, sagte Mrs Osborne, »ein Mann. Wer ist das?«
»Wahrscheinlich einer von meinen«, antwortete Strafford.
Sie sah ihn verständnislos an, dann wandte sie sich wieder ihrem Mann zu. Er goss gerade kochendes Wasser in eine große Teekanne aus Porzellan.
»Wo ist Sadie?«, fragte sie.
»Ich habe sie zu ihrer Schwester geschickt«, sagte Osborne kurz angebunden. Er warf Strafford einen kurzen Blick zu. »Die Haushälterin. Mrs Duffy.«
»Warum hast du das gemacht?«, fragte seine Frau verwundert und legte ihre bleiche Stirn in Falten. Alle ihre Bewegungen waren langsam und angestrengt nachdrücklich, als befände sie sich unter Wasser.
»Du weißt doch, was für ein Waschweib sie ist.« Osborne wich ihrem Blick aus, dann murmelte er halblaut: »Nicht, dass ihre Schwester nicht auch eines wäre.«
Mrs Osborne sah vor sich hin und stützte den Kopf in die Hand.
»Ich verstehe das nicht«, sagte sie schwach. »Wie konnte er denn in die Bibliothek kommen, wenn er die Treppe hinuntergefallen ist?«
Wieder sah Osborne zu Strafford hin, mit einem beinahe unmerklichen schnellen kleinen Kopfschütteln.
»Das wird Inspector Straffords Mann wahrscheinlich herausfinden wollen«, sagte er etwas zu laut zu seiner Frau und sprach sanfter weiter. »Möchtest du eine Tasse Tee, Liebes?«
Sie schüttelte den Kopf, wandte sich immer noch apathisch wirkend um und ging durch die Tür hinaus, durch die sie gekommen war. Die Hände hatte sie noch vor dem Bauch verschränkt, die Ellbogen an den Körper gepresst, als drohe sie zusammenzubrechen und müsse sich mit Kraft aufrecht halten.
»Sie glaubt, es war ein Unfall«, sagte Osborne leise, als sie weg war. »Ich dachte mir, es hat keinen Sinn, sie aufzuklären – die Wahrheit erfährt sie sowieso früh genug.«
Er reichte die Teetassen herum und behielt die ohne Sprung für sich.
»Hat jemand in der Nacht etwas gehört?«, fragte Sergeant Jenkins.
Colonel Osborne sah ihn missmutig an, augenscheinlich überrascht, dass jemand, der eindeutig den unteren Rängen angehörte, sich für befugt hielt, das Wort zu ergreifen, ohne zuerst die Erlaubnis seines Vorgesetzten einzuholen.
»Ich selbst habe jedenfalls nichts gehört«, antwortete er schroff. »Dominic vielleicht. Also mein Sohn.«
»Und die anderen im Haus?«, insistierte Jenkins.
»Soweit ich weiß, hat niemand etwas gehört«, meinte der Colonel steif und starrte in seine Tasse.
»Und wo ist Ihr Sohn jetzt?«, fragte Strafford.
»Er führt den Hund aus«, sagte Osborne. Sein Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass selbst ihm das gelinde gesagt unvereinbar vorkam: Hier ein Toter, da ein Hund, der ausgeführt werden musste.
»Wie viele Leute waren gestern Nacht im Haus?«, wollte Strafford wissen.
Osborne richtete den Blick zur Decke und bewegte die Lippen, während er leise zählte.
»Fünf«, sagte er, »Father Tom eingeschlossen. Und die Haushälterin war natürlich auch noch da. Sie«, er nickte zum Boden, »hat unten ein Zimmer.«
»Das wären also Sie, Ihre Frau, Ihr Sohn und Father Harkins.«
»Genau.«
»Ich zähle vier, Sie sagten aber, es wären fünf gewesen, ohne die Haushälterin?«
»Und meine Tochter, habe ich sie gar nicht erwähnt? Lettie.« Etwas huschte kurz über sein Gesicht, wie ein Wolkenschatten über einen Berghang an einem stürmischen Tag. »Ich bezweifle, dass sie irgendetwas gehört hat. Sie schläft immer sehr tief. Manchmal kommt es einem sogar so vor, als würde sie nichts anderes tun, als zu schlafen. Sie ist siebzehn«, fügte er hinzu, als würde das nicht nur die Schlafgewohnheiten des Mädchens erklären, sondern noch einiges darüber hinaus.
»Wo ist sie jetzt?«, fragte Strafford.
Colonel Osborne trank einen Schluck und verzog das Gesicht, ob des Geschmacks des Tees – er war ihm so stark geraten, dass er beinahe schwarz war – oder ob des Gedankens an seine Tochter, wusste Strafford nicht. Doch darüber würde er später nachdenken. Es gehörte zu seinen Faustregeln, in einem Mordfall nichts außer Acht zu lassen. Er legte beide Hände flach vor sich auf den Tisch und schob sich hoch.
»Ich würde gerne das Zimmer sehen, in dem Father Harkins gestern Nacht geschlafen hat.«
Auch Jenkins war aufgestanden. Colonel Osborne blieb sitzen und blickte zu den beiden auf. Seine bislang schroffe und misstrauische Art geriet einen Augenblick ins Wanken, und er wirkte zum ersten Mal unsicher, schwach und ängstlich.
»Es ist wie in einem bösen Traum«, wiederholte er. Fast flehentlich sah er die beiden Männer an, die über ihm standen. »Das wird wahrscheinlich vorübergehen. Wahrscheinlich wird alles bald allzu real.«
3
Colonel Osborne hatte die Polizisten aus der Küche in die Eingangshalle geführt, und sie standen am Fuß der Treppe. Strafford bewunderte im Stillen das elegant geschwungene Geländer, als Harry Hall aus der Bibliothek geschlurft kam und sich hinter vorgehaltener Hand eine Zigarette anzündete. »Haben Sie mal eine Minute?«, fragte er Strafford.
Der Detective betrachtete die ungeschlachte Gestalt vor sich und versuchte, seine Abneigung nicht zu zeigen. Nicht, dass dies irgendwelche Folgen gehabt hätte: Die beiden Männer hatten schon vor langer Zeit erkannt, dass sie einander nicht mochten. Aber sie waren zu der stillschweigenden und umsichtigen Übereinkunft gekommen, dass dies keinen schädlichen Einfluss auf ihre Arbeit nehmen sollte – sie waren einander nun wirklich nicht wichtig genug, um zu streiten.
Colonel Osborne und Sergeant Jenkins waren auf den unteren Treppenstufen stehen geblieben und warteten.
Die Spannung zwischen Strafford und dem Kriminaltechniker war spürbar. Colonel Osborne runzelte verwundert die Stirn und blickte fragend von Harry Hall zu Strafford und von Strafford zu Jenkins.
Schon seltsam, dachte Strafford, wie am Schauplatz eines Gewaltverbrechens alle möglichen nebensächlichen kleinen Streitereien in übertriebenem, verstärktem Maße ausbrachen, so wie bei einem Waldbrand kleine Feuer an Stellen rund um den Brandherd aufflammten, die noch gar nicht bedroht gewesen zu sein schienen.
»Na gut.« Strafford wandte sich zu den beiden Männern, die auf der Treppe auf ihn warteten. »Jenkins, gehen Sie doch schon mit Colonel Osborne hoch und sehen sich das Schlafzimmer an. Ich komme gleich nach.«
Sie gingen zurück in die Bibliothek, Harry Hall voran. Hendricks war damit beschäftigt, einen neuen Film in seine Kamera einzulegen, während Willoughby, ausgerüstet mit Gummihandschuhen, neben der Tür kniete und lustlos den Türgriff mit einem weichen Rotmarderpinsel einstaubte. Harry Hall zog nachdenklich an seiner Zigarette.
»Schon bizarr, der Fall hier«, sagte er halblaut.
»Finden Sie? Ich dachte mir auch schon so etwas«, antwortete Strafford. Harry Hall zuckte nur mit den Schultern. Es wunderte Strafford immer, dass seine Ironie anderen so häufig verborgen blieb.
»Er wurde oben niedergestochen und hat es irgendwie hier runter geschafft«, sagte Harry Hall. »Wahrscheinlich hat er versucht, vor seinem Angreifer zu fliehen. Ich vermute, er ist hier reingekommen und dann gestürzt – er hatte schon eine ganze Menge Blut verloren – und lag hier, als man ihm das Gemächt abgeschnitten hat, Eier, Schwanz, mit allem Drum und Dran. Das haben wir übrigens nicht gefunden. Offenbar hat sich das jemand als Souvenir mitgenommen. Ein sauberer Schnitt, mit einer rasiermesserscharfen Klinge. Profiarbeit.«
Er widmete sich wieder seiner Zigarette – es zischte, als er daran zog – und betrachtete die Leiche auf dem Boden. Strafford fragte sich zerstreut, wie jemand eine ausreichende Anzahl von Kastrationen vorweisen konnte, um die Bezeichnung Profi verdient zu haben.
»Man sieht, dass ihn jemand sauber gemacht hat«, fuhr Harry Hall fort. »Das Blut am Boden wurde aufgewischt, aber erst, nachdem es schon getrocknet war. Was für eine Plackerei.«
»Und wann hat die Plackerei wohl stattgefunden?«
Der große Mann zuckte mit den Schultern. Er war gelangweilt, nicht von diesem Fall, sondern von seiner Arbeit im Allgemeinen. Bis zum Ruhestand hatte er noch sieben Jahre. »Wahrscheinlich gleich heute Morgen, nachdem das Blut getrocknet war. Der Teppichboden auf der Treppe wurde auch abgewaschen – die Flecken sind aber noch drin.«
Kurz standen sie schweigend da und starrten den Toten an. Hendricks saß auf der Armlehne eines Sessels, seine Kamera auf dem Schoß: Seine Arbeit hier unten war beendet, und er machte eine Pause, bevor er oben weiterfotografierte. Hendricks war derjenige der drei, der am beflissensten wirkte, dabei war er eigentlich der Faulste.
Willoughby kniete immer noch neben der Tür und trug Pulver auf. Wie die anderen beiden wusste auch er, dass der Tatort gründlich verunreinigt worden war und sich ihre Arbeit sehr wahrscheinlich als Zeitverschwendung erweisen würde. Nicht, dass es ihm wichtig gewesen wäre.
»Die Haushälterin«, sagte Strafford und schob sich dabei mit vier steifen Fingern den Haarflügel von den Augen, »sie wird es gewesen sein, die sauber gemacht oder sich zumindest nach Kräften bemüht hat.«
Harry Hall nickte. »Auf Anweisung von Colonel Bogey, nehme ich an?«
»Sie meinen Osborne?«, fragte Strafford mit der Andeutung eines Lächelns. »Wahrscheinlich. Alte Soldaten sehen nicht gerne Blut, heißt es: Das bringt zu viele Erinnerungen zurück oder so ähnlich.«
Wieder schwiegen sie. Harry Hall sagte noch leiser: »Hören Sie, Strafford, das da ist nicht gut. Ein toter Pfarrer in einem Haus voller Evangelen? Was werden die Zeitungen dazu sagen?«
»Wahrscheinlich dasselbe wie die Nachbarn«, antwortete Strafford geistesabwesend.
»Die Nachbarn?«
»Was? Ach so, der Colonel macht sich Sorgen, dass es einen Skandal geben könnte.«
Harry Hall schnaubte.
»Das liegt allerdings durchaus im Bereich des Möglichen«, sagte er.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, murmelte Strafford.
Sie standen da, Harry Hall bearbeitete den letzten Rest seiner Zigarette, und Strafford strich sich nachdenklich über seinen schmalen Kiefer. Dann ging er hinüber zu Willoughby. »Und?«
Willoughby erhob sich mühsam von den Knien und verzog das Gesicht. »Dieser Rücken«, keuchte er, »der bringt mich noch mal um.« Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn und auf der Oberlippe; es war fast Mittag, und er brauchte dringend etwas zu trinken. »Natürlich gibt es Fingerabdrücke«, sagte er, »vier, fünf unterschiedliche, einer davon blutig. Man kann wohl mit Sicherheit behaupten, dass er von Hochwürden stammt.« Er grinste und zog dabei den Mund auf einer Seite nach oben, sodass es eher wie Zähnefletschen aussah. »Muss ganz schön kräftig gewesen sein, der Kerl, dass er es vom Treppenabsatz bis hier runter geschafft hat.«
»Vielleicht hat ihn jemand getragen.«
Nun zuckte Willoughby mit den Schultern; er langweilte sich genauso wie die beiden anderen. Alle drei langweilten sie sich: Sie langweilten sich, froren und wollten nichts lieber als hinaus aus diesem großen, ausgekühlten, düsteren verdammten Haus und zurück in ihr behagliches Quartier in der Pearse Street. Sie waren Dubliner: Auf dem Land bekamen sie die Flatter, zumindest Harry Hall und Hendricks, denn Willoughby hatte sie ja schon.
»Was ist mit dem Kerzenständer?«, fragte Strafford.
»Was soll damit sein?«
»Sind Fingerabdrücke drauf?«
»Hab ich noch nicht überprüft. Ich hab ihn mir nur kurz angesehen – ist offenbar sauber abgewischt worden.«
Harry Hall trat zu ihnen und zündete sich noch eine Zigarette an. Er rauchte Woodbines, nicht weil sie billig, sondern weil sie stark waren – »der beste Schleimlöser«, sagte er immer und hustete rasselnd zum Beweis.
»Und wie gehen wir jetzt damit um?«, fragte er.
»Wie wir ›damit umgehen‹?«
»Sie wissen schon, was ich meine. Das gibt einen Haufen Probleme. Da kann sich manch einer übel die Finger verbrennen.«
Strafford betrachtete die Nikotinflecken an den fleischigen Händen des dicken Mannes.
»Hat jemand den Krankenwagen gerufen?«, fragte er.
»Vom Wexford General aus ist einer unterwegs«, antwortete Harry Hall. »Aber keine Ahnung, wann die ankommen, bei dem Wetter.«
»Das ist doch nur Schnee, Herrgott«, sagte Strafford etwas gereizt. »Was haben nur alle ständig damit?«
Harry Hall und Willoughby tauschten Blicke; selbst der mildeste Ausbruch wurde Strafford als weiterer Beweis für seinen aristokratischen Dünkel und seine allgemeine Geringschätzung für die Menschen um ihn herum ausgelegt. Ihm war bekannt, dass sein Spitzname Lord Snooty war, nach einer Figur aus einem Schülercomic. Das wäre ihm egal, allerdings trug sein Ruf als Schnösel zu den Schwierigkeiten in seinem Beruf bei.
»Wir sind jedenfalls fertig hier«, meinte Harry Hall.
»Gut«, antwortete Strafford. »Danke. Ich weiß, Sie konnten nicht viel tun, in Anbetracht der …«
»Wir haben getan, was wir konnten«, unterbrach ihn Harry Hall schroff und kniff die Augen zusammen. »Das schreiben Sie hoffentlich auch so in Ihren Bericht.«
Strafford seufzte. Er hatte diese drei Komiker satt und wünschte ihren Aufbruch ebenso sehnlich herbei wie sie selbst. Harry Hall entfernte sich von ihm und half den anderen beiden, ihre Ausrüstung zusammenzupacken, alle drei mit Leidensmiene. Der Detective ging zur Tür und drehte sich zu Harry Hall um.
»Ist Doctor Quirke informiert worden, dass eine Leiche zu ihm unterwegs ist?«
Doctor Quirke war vor Kurzem zum Staatlichen Pathologen ernannt worden.
Harry Hall warf Willoughby wieder einen Blick zu und grinste.
»Er ist verreist«, sagte Harry Hall.
»Ach ja? Und wohin?«
»Er ist in den Flitterwochen!«, sagte Hendricks. »Hossa!«
Und dann zündete er eine Blitzbirne, einfach so zum Spaß.
4
Statt nach oben zu gehen und sich anzusehen, wo man den Priester angegriffen hatte, spazierte Strafford ein wenig in den unteren Räumlichkeiten herum, um sich zu orientieren. Das war bei ihm immer so, wenn er ein Verbrechen untersuchte. Er musste die Geografie des Ortes im Kopf haben, wissen, wo die Tat begangen worden war. So bekam er ein Gefühl für den Schauplatz und konnte sich hineinversetzen, um eine andere Perspektive zu bekommen. Manchmal fügte er sich in solchen Situationen auch selbst in die Szene ein, wie eine ausgeschnittene Pappfigur im Modell eines Bühnenbildners, ohne sich zu bewegen; vielmehr wurde er bewegt. Diese Vorstellung gefiel ihm, er wusste auch nicht genau, warum. Gott spielen, hätte seine Freundin, seine Ex-Freundin, gesagt und dazu wie so häufig die Miene verzogen.
Es gab zwei Salons, einen rechts und einen links von der Eingangstür. Nur in dem auf der linken Seite waren Hinweise darauf zu finden, dass er bewohnt wurde. Im Kamin brannte ein Holzfeuer, Bücher und Zeitungen lagen verstreut, Tassen, Untertassen und Gläser standen auf einem niedrigen Tisch, und über der Lehne eines Sessels hing ein Tartanschal. Wie vertraut ihm das alles war, die schäbige Einrichtung, das leichte Durcheinander, der schwache Geruch von Moder und Feuchtigkeit, den alle alten Häuser verströmten. In solchen Räumen hatte er die Jahre seiner Kindheit verbracht; alte Eindrücke saßen immer tief.
Er stellte sich in den Erker eines der beiden großen Fenster, die auf kahle Bäume, den schneebedeckten Rasen und die gewundene zerfurchte Zufahrt hinunter zur Hauptstraße blickten. In der Ferne war ein Hügel, auf dessen Kuppe Schnee lag; es sah unwirklich adrett und pittoresk aus, wie eine Dekoration auf einer Weihnachtstorte. Das musste Mount Leinster sein, dachte er. Am Himmel dahinter hingen bleierne lila Wolken – es kam noch mehr Schnee.
Strafford klopfte sich mit den Nägeln zweier Finger gegen die Vorderzähne. Das tat er immer, wenn er zerstreut oder in Gedanken vertieft oder beides war.
Harry Hall hatte recht, der Fall war bizarr und hatte das Potenzial, ihm eine Menge Scherereien zu machen, wenn er nicht höllisch aufpasste und geschickt vorging.
Wie dieses geschickte Vorgehen aussah oder welche Scherereien ihm genau drohten, konnte er nicht sagen, noch nicht. Aber Priester wurden schlichtweg nicht ermordet, und ganz gewiss nicht an Orten wie Ballyglass House; die katholische Kirche – die Mächtigen, anders ausgedrückt – würde sich einmischen, und man würde die Sache zweifellos vertuschen und der Öffentlichkeit irgendeine plausible Lüge präsentieren. Die einzige Frage war, wie tief man die Fakten vergraben würde.
Ja, eine bizarre Sache. Er wusste sehr wohl, warum Hackett – Detective Chief Superintendent Hackett, sein Vorgesetzter in Dublin – ihm den Fall anvertraut hatte. »Sie wissen doch, wie dort der Hase läuft«, hatte Hackett an diesem Morgen am Telefon gesagt. »Die sprechen Ihre Sprache, mit Ihnen werden sie reden. Viel Glück.«
Aber in diesem Fall würde er mehr als nur Glück brauchen, woran er sowieso nicht glaubte. Jeder war seines Glückes Schmied, sonst schmiedeten es andere für einen, und das waren meistens Idioten.
Irgendetwas, ein uralter Instinkt, sagte ihm, dass er nicht allein war, dass er beobachtet wurde. Zaghaft wandte er den Kopf und sah sich im Zimmer um. Da entdeckte er sie; sie musste schon die ganze Zeit über da gewesen sein. In diesen alten Häusern musste man nur stillhalten und ruhig bleiben, um mit dem Hintergrund zu verschmelzen, wie eine Eidechse auf einer Steinmauer. Sie hatte es sich unter einer braunen Decke auf einem alten Sofa vor dem Kamin gemütlich gemacht, die Knie zur Brust gezogen, den Daumen im Mund. Ihre großen Augen wirkten riesig – warum hatte es so lange gedauert, bis er ihren durchdringenden Blick gespürt hatte, mitten zwischen seinen Schulterblättern?
»Hallo«, sagte er. »Es tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen.«
Sie nahm den Daumen aus dem Mund. »Ich weiß. Ich habe Sie beobachtet.«
Er sah nur Gesicht und Hände, der Rest von ihr war unter der Decke verborgen. Sie hatte eine breite Stirn, ein spitzes Kinn und Augen so groß wie bei einem Lemur. Ein Schopf ungebärdiger, drahtiger und, wie es aussah, nicht eben frisch gewaschener Locken umrahmte ihr Gesicht.
»Ist das nicht eklig«, sie betrachtete ihren Daumen, »wie die Haut ganz schrumpelig und weiß wird, wenn man daran lutscht? Schauen Sie mal«, sie hielt den Daumen hoch, damit er es sehen konnte, »der sieht aus, als hätte man ihn gerade aus dem Meer gezogen.«
»Sie sind sicherlich Lettie«, sagte er.
»Und Sie? Nein, lassen Sie mich raten. Sie sind der Kriminalpolizist.«
»Genau. Detective Inspector Strafford.«
»Sie sehen gar nicht aus wie ein …« Sie hielt inne, als sie seinen entnervten Gesichtsausdruck bemerkte. »Wahrscheinlich erzählen Ihnen die Leute die ganze Zeit, dass Sie nicht wie ein Polizist aussehen. Sie hören sich auch nicht an wie einer, mit diesem Akzent. Wie heißen Sie?«
»Strafford.«
»Mit Vornamen, meine ich.«
»Also, ich heiße St John.« Er konnte seinen Namen nie laut aussprechen, ohne verlegen zu werden.
Das Mädchen lachte.
»St John! Das ist ja fast so schlimm wie meiner. Sie nennen mich Lettie, aber eigentlich heiße ich Lettice, ob Sie es glauben oder nicht. Stellen Sie sich mal vor, einem Kind einen so altmodischen Namen wie Lettice zu geben. Nach meiner Großmutter, aber trotzdem.«
Mit verschmitzt zusammengekniffenen Augen musterte sie ihn genau, als würde sie damit rechnen, dass er jeden Moment ein Kunststück vollführte, zum Beispiel einen Kopfstand machte oder levitierte. Aus seiner eigenen Jugend wusste er noch, dass ein neues Gesicht im Haus immer Veränderung und Aufregung versprach – zumindest Veränderung, denn Aufregung war etwas so Seltenes in einem Haushalt wie dem ihren und früher auch dem seinen, dass sie nur die Ausgeburt einer überbordenden Fantasie sein konnte.
»Beobachten Sie gerne andere Leute?«, fragte er.
»Ja. Man glaubt gar nicht, was die alles anstellen, wenn sie glauben, dass niemand sie sieht. Die Dünnen bohren immer in der Nase.«
»Ich hoffentlich nicht.«
»Irgendwann hätten Sie wahrscheinlich damit angefangen.« Sie hielt inne. »Das ist doch echt spannend – eine Leiche in der Bibliothek! Haben Sie den Fall schon gelöst? Bestellen Sie uns alle vor dem Abendessen ein, um die Handlung zu erklären und den Namen des Mörders zu offenbaren? Ich setze auf die Weiße Maus.«
»Die …?«
»Meine Stiefmutter Sylvia, die Königin der Kopfjäger. Haben Sie sie schon gesehen? Vielleicht haben Sie es ja gar nicht gemerkt, denn sie ist quasi durchsichtig.«
Sie warf die Decke zurück, erhob sich vom Sofa, streckte sich und stöhnte. Sie war groß für ein Mädchen, dachte er, schlank, mit dunklem Teint und leichten O-Beinen: die Tochter ihres Vaters. Im geläufigen Sinne war sie überhaupt nicht hübsch, und das wusste sie, aber die Tatsache, dass sie es wusste, die sich in ihrer clownesken Trägheit offenbarte, verlieh ihr paradoxerweise einen gewissen schmollenden Charme. Sie trug Reithosen und eine schwarze Reitjacke aus Samt.
»Sie wollten gerade ausreiten?«, fragte Strafford.
Das Mädchen ließ die Arme sinken. »Was? Ach so, weil ich das anhabe. Nein, ich mache mir nichts aus Pferden – übel riechende Viecher, sie brennen durch, beißen oder beides. Mir gefällt nur die Kluft; sie macht sehr schlank und ist außerdem bequem. Die hier war von meiner Mutter – also von meiner richtigen Mutter, die ja tot ist. Ich musste sie allerdings ein bisschen abnähen lassen. Sie war ziemlich groß.«
»Ihr Vater dachte, Sie schlafen noch.«
»Ach, der steht in aller Herrgottsfrühe auf und findet, jeder, der das nicht tut, ist«, und nun imitierte sie Colonel Osborne überraschend überzeugend, »ein verfluchter Nichtstuer, verdammich. Ehrlich, er ist ein alter Heuchler.«
Sie hob die Decke wieder auf, legte sie sich um die Schultern und trat zu ihm ans Fenster, um die verschneite Landschaft zu betrachten.
»Herrje«, meinte sie, »dieses vereiste Ödland. Sehen Sie, da wurden noch mehr Bäume im Wäldchen gefällt.« Sie wandte sich Strafford zu. »Sie wissen sicherlich, dass wir arm wie Kirchenmäuse sind? Das Brennholz ist zur Hälfte verbraucht, und das Dach kann jeden Tag einstürzen. Es ist das Haus Usher.« Nachdenklich stockte sie und rümpfte die Nase. »Warum hält man Kirchenmäuse eigentlich für arm? Und wie kann eine Maus überhaupt reich sein?« Sie fröstelte und zog die Decke fester um sich. »Mir ist sooo kalt!« Wieder sah sie ihn neckisch von der Seite an. »Aber Frauen haben natürlich immer kalte Hände und Füße. Dafür sind Männer ja da, um uns aufzuwärmen.«
Ein Schatten bewegte sich vor dem Fenster, und Strafford blickte gerade noch rechtzeitig hinaus, um draußen einen ungeschlachten Jungen in Gummistiefeln und Lederjacke mit einem schwerfälligen Stechschritt durch den Schnee vorbeilaufen zu sehen. Er hatte Sommersprossen und einen dichten, wirren Haarschopf, so dunkelrot, dass er beinahe bronzefarben wirkte. Die Ärmel seiner Jacke waren zu kurz, und seine frei liegenden Handgelenke schimmerten weißer als der weiße Schnee auf allen Seiten.
»Ist das Ihr Bruder?«, fragte Strafford.
Das Mädchen lachte kreischend.
»Hach, das ist ja köstlich«, rief sie und schüttelte den Kopf, sodass ihr Lachen sich in ein Gurgeln verwandelte. »Ich kann es gar nicht erwarten, Dominic zu erzählen, dass Sie ihn mit Fonsey verwechselt haben. Wahrscheinlich zimmert er Ihnen erst mal eine – er ist furchtbar jähzornig.«
Der Junge war mittlerweile außer Sicht.
»Wer ist Fonsey?«, fragte Strafford.
»Er hier«, sie zeigte in seine Richtung, »der Stalljunge, so würde man ihn wohl bezeichnen. Er kümmert sich um die Pferde, zumindest soll er das. Eigentlich ist er selbst halb ein Pferd. Wie heißen noch mal diese Wesen aus dem alten Griechenland?«
»Kentauren?«
»Genau. So einer ist Fonsey.« Sie gab wieder das kehlige Schluckauf-Lachen von sich. »Der Kentaur von Ballyglass House. Er hat ein bisschen was an der Birne«, sie legte sich einen Finger an die Schläfe und machte eine Schraubbewegung, »also passen Sie auf. Ich nenne ihn Caliban.«