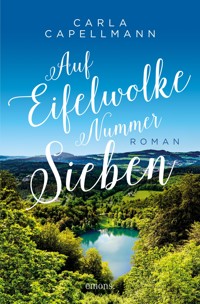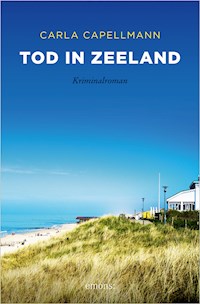
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mörderisches Karma an der zeeländischen Küste. Eigentlich will Freddie auf dem Yogaseminar in Domburg an der zeeländischen Nordseeküste den Kopf frei bekommen, um in Ruhe über ihre Beziehung zu Jan nachzudenken. Doch noch bevor sie den ersten Sonnengruß machen kann, stolpert sie über eine Tote. Und ausgerechnet Jan soll mit der Frau ein Verhältnis gehabt haben. Als ihr die örtliche Polizei einen Mord aus Eifersucht unterstellt, sieht sich Freddie gezwungen, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei gerät sie zwischen vermeintlich friedlichen Yogis immer tiefer in einen mörderischen Schlamassel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Carla Capellmann lebt im Rheinland und ist wie ihre Ermittlerin Informatikerin. Mit analytischem Blick, viel Herz und einem Augenzwinkern nimmt sie in ihrem Debütroman die Eigenheiten der Yogaszene aufs Korn. Sie liebt Wortspiele, und diese prägen ihren einmaligen Humor. Walcheren und die zeeländische Küste kennt sie seit ihrer Kindheit und von zahlreichen Radtouren.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: iStockphoto.com/Manninx
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-706-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Prolog
Atemübungen – ademhalingsoefeningen
Jeder Mensch hat eine vorbestimmte Anzahl an Atemzügen, und sie wollte ihre auskosten, jeden einzelnen davon. Das Tanzen hatte ihren Herzschlag erhöht, und auch das Wiedersehen hatte sie aufgewühlt – ihn allerdings noch mehr. Sie lächelte, rief sich sogleich zur Ordnung. Wie gut, dass das Seminar die Kleshas behandelte. Diese fünf Grundübel des Seins führten dazu, dass man litt, sie wucherten wie Unkraut, wenn man sie ließ.
Bewusst atmete sie ein, lenkte die Luft erst in ihren Bauch, dann in den Brustraum, ließ sie in umgekehrter Reihenfolge entweichen. Sie fühlte, wie sie saß, spürte den Bodenkontakt ihrer Sitzhöcker.
Ein Augenblick der Stille.
Erneut atmete sie ein.
Als der Impuls zum Ausatmen kam, ließ sie die Luft ausströmen, sachte, behutsam. Ihre Schultern senkten sich, der Oberkörper richtete sich auf. Sie lächelte, ihr ganzer Körper, nein, ihr ganzes Sein war ein Lächeln. Bahya Kumbhaka, das Innehalten nach dem Ausatmen.
Sie streckte den Hals, senkte das Kinn und schob es Richtung Halskuhle, zog den Bauchnabel nach oben und fühlte sich leicht. Wenn sie den Nabel noch etwas stärker einsaugte, würde sie ersticken.
Einmal hatte sie es beinahe erlebt. Der Drang, sich selbst zu verschließen, war so stark gewesen, dass sie für einen Moment das Gefühl gehabt hatte, nicht mehr loslassen zu können. Yoga konnte gefährlich sein und einen verletzen, wenn man nicht achtsam war. Auf die richtige Haltung kam es an. Die richtige Haltung zu sich selbst.
1
Achtsamkeit – mindfulness
Freitagabend
»Wenn wir im Sommer mal nach Holland gehn, wo die Klipper-Klapper-Windmühlen stehn …« Miriam schmetterte ihr Lieblingslied für Fahrten an die Nordsee voller Inbrunst und drückte aufs Gas.
Ich verzog das Gesicht. »Nur weil wir Belgien hinter uns haben, musst du das Lied nicht schon wieder singen. Außerdem stimmt es nicht.«
»Wenn wir im Sommer mal zum Yoga gehn und beim Üben wacklig auf dem Kopfe stehn.« Miriam schmunzelte. »Du wirst sehen, meine Süße, Yoga am Meer wird auch dich zur Yogini machen.«
»Wenn schon, dann höchstens zur yoginietje«, brummte ich. »Und das auch nur, falls Yogis frikandel speciaal essen dürfen. Sonst streike ich.«
»Das könnte dir so passen.«
»Keine herrliche Hackfleischbratwurst mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln?« Ich stöhnte übertrieben. »Bekomme ich wenigstens ein Softeis mit nootjes?«
»Die kleine Yogini will ein Eis mit Krokant.« Miriam lachte.
Argwöhnisch sah ich sie an, doch ein paar Strähnen hatten sich aus dem Knoten gelöst, zu dem sie ihr Haar wie immer gesteckt hatte, und ich konnte nur erkennen, dass sie auf die Straße schaute. Hinter Antwerpen lief der Verkehr zwar wieder, aber es war immer noch viel los. Jetzt setzte Miriam den Blinker und ordnete sich links ein. Wir nahmen die große Kampfkurve auf die A58. Das letzte Autobahnstück für heute.
Ich ließ das Seitenfenster herunter. Sofort zerrte der Fahrtwind an meinen Haaren, und ich freute mich, dass ich sie gerade erst hatte kurz schneiden lassen. So eine Gewollt-durcheinander-verwuschelt-Frisur war einfach genial, wenn man auch ungewollt ständig mit Sturmfrisur herumlief. Nur an den Pony hatte ich mich noch nicht gewöhnt, aber den wehte der Wind ja jetzt aus dem Gesicht.
Die frische Luft tat gut. Ich schnupperte. Es roch nach Meer, obwohl der Wunsch da sicher mehr Herrscher über den Geruchssinn war als die Nase. Und der Wunsch war es auch, der mich jedes Mal denken ließ, dass es jetzt nur noch ein Klacks bis Domburg war. Zugegebenermaßen ein ziemlich lang gezogener Klacks namens Zuid-Beveland. Doch auch diese Halbinsel hatte irgendwann ein Ende.
Ausfahrt 38. Middelburg-Oost.
Ich fischte den Flyer aus dem Handschuhfach. »Fünf Tage Cahaya-Yoga im ›Zeeuwse ZeeOm‹.«
»Ich freue mich so auf die Meisterin.« Miriam wechselte auf die Verzögerungsspur und strahlte mich an. »Du hast vielleicht ein Glück. Zum ersten Mal Yoga und dann gleich bei Cahaya selbst.«
»Mich interessiert vielmehr, wo genau in Domburg dieses Yogazentrum liegen soll.« Ich wedelte mit dem Flyer. »Jetzt war ich schon so oft auf Walcheren, aber ich bin noch nie über ein OM gestolpert, geschweige denn ein zeeländisches.«
»Lass dich überraschen«, sang Miriam in bester Rudi-Carrell-Manier.
»Aber es ist schon in Strandnähe, oder? Schließlich heißt es hier: ›den Körper kräftigen, den Geist dehnen, mit den Wellen unseren eigenen Atemrhythmus entwickeln. Yoga am Meer ist mehr.‹«
»Ist es auch.« Miriam hielt mir die Hand hin zum Abschlagen. »Das wird so schön. Es ist auch gar nicht mehr weit. Sieh nur, da ist schon Oostkapelle.«
Ganz yogagemäß tuckerten wir durch den Ort. Achtsam, den Schildern der Dreißiger-Zone entsprechend. Am liebsten wäre ich hier schon ausgestiegen, hätte mir ein Hollandrad gepackt und wäre durch den Wald nach Domburg geradelt. Miriam schien es ähnlich zu gehen. Als wir die letzten Häuser passiert hatten und es an einem Kreisverkehr in den Wald ging, bog sie einfach ab. Hatte ich irgendwas übersehen?
»Hey«, protestierte ich. »Nach Domburg geht es weiter geradeaus.«
Ungerührt lenkte Miriam den Wagen auf einen großen, gut gefüllten Parkplatz. »Endstation. Alle aussteigen bitte.«
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?« Demonstrativ schaute ich mich um. »Hier ist doch nichts – außer deutschen Autos.«
»Raus mit dir, Freddie. Wir sind spät dran.« Miriam stieg aus und griff nach Yogatasche und Rollkoffer.
»Wohnen wir im Wald? Ich dachte, das ist Naturschutzgebiet. Oder sind wir in Hütten direkt am Meer untergebracht?« Ich sprang aus dem Wagen. »Mensch, Miri, das ist ja toll! In so einem Strandhaus wollte ich immer schon mal übernachten.« Vor Freude grinste ich vermutlich, als wäre ich erleuchtet. Da machte es mir nicht mal was aus, dass ich meine Schuhtasche nicht finden konnte. Irgendwas vergaß man ja immer. Ich nahm mein Gepäck und eilte Miriam nach.
Hinter der Hecke, die den Parkplatz zu einer Seite hin begrenzte, ragte ein Holzturm in die Höhe, eine Kreuzung aus Hochsitz und Ritterturm. Erstaunt warf ich dem Teil einen zweiten Blick zu. Waren wir bei »Was passt nicht dazu? Der Leuchtturm von Westkapelle, Domburgs Wasserturm, dieses Gebilde?«.
Wir erreichten das Ende des Parkplatzes, rechts ein Toilettenhaus, links ein leerer Fahnenmast, dazwischen ein Kiesweg, der in den Wald führte.
»Hm, ab hier sollte es eigentlich ausgeschildert sein.« Miriam betrachtete den Pfahl, dessen Pfeile alle zurück in Richtung Straße zeigten. Dort lagen offenbar ein Reiterhof, ein Mini-Camping und ein Café. Nichts mit Yoga, kein »ZeeOm«.
»Lass uns Richtung Strand gehen.« Entschlossen marschierte ich los. »Erst kommt der Wald, dann die Dünen, dann das Meer. OM. ›ZeeOm‹.«
»Google sagt auch, wir sollen in den Wald gehen.« Miriam holte mich ein und warf alle zwei Schritte einen prüfenden Blick auf ihr Smartphone. »Noch zweihundert Meter«, sagte sie jetzt. »An der Weggabelung links, dann sind wir da.«
Die Sträucher und Büsche zu unserer Seite lichteten sich, hinter einem Wassergraben erhob sich eine Burg. Ich kam mir vor wie im Märchen. Eine echte Burg mit Türmen, Wassergraben und Brücke.
»Tadadata!«, rief Miriam und zeigte zur Burg. »Das ›Zeeuwse ZeeOm‹.«
»Wahnsinn. Wir machen Yoga auf einer Burg.« Ich stellte meine Tasche ab, kramte das Handy aus dem Rucksack und schoss ein Foto. »Das glaubt mir keiner.«
»Damit hast du nicht gerechnet, was?« Miriam frohlockte. »Ich mache aus meiner kleinen Informatikerin schon noch eine Yogaprinzessin. Und jetzt pack das Handy weg. Nicht dass es dich in Versuchung führt.«
»Schon gut. Ich habe es versprochen. Das ist unser Wochenende. Fünf Tage Funkstille. Eine Auszeit, in der ich an mir arbeite. Ich vertraue ihm, rufe nicht an, schicke keine Nachricht, aber das muss ich einfach festhalten.« Ich legte Miriam den Arm um die Schulter, ging leicht in die Knie, damit wir beide aufs Bild passten, und machte ein Selfie von uns mit der Burg im Hintergrund. Dann schnappte ich mir meine Tasche und folgte Miriam.
An der Waldwegkreuzung nahmen wir den Weg nach links – zur Burg. Noch bevor wir die Brücke über den ersten Wassergraben erreicht hatten, schlug uns ein fröhliches Stimmengewirr entgegen. Holländische Wortfetzen konnte ich nicht ausmachen. Wie Domburg schien auch Yogaburg fest in deutscher Hand zu sein.
»Schau doch, auf den Wimpeln sind Wellenlinien und ein OM-Zeichen.« Miriam deutete auf eine Girlande aus bunten Fahnen, die zwischen den beiden vorderen Türmen gespannt war. »Die sind ja süß.«
Die bunten Wimpel verliehen der Burg etwas von einer Kindergeburtstagsfeier. Irgendwie hatte ich bei Yoga mehr Ernsthaftigkeit erwartet, doch mir sollte es recht sein. Lächelnd ging ich über die Brücke. Vielleicht waren die Unmengen von Leuten in Flatterkostümen, die eine große runde Bank im Innenhof belagerten, ja gar nicht zum Yoga, sondern zu einem Casting für Rapunzel gekommen? Langhaarige waren jedenfalls mehr als genug dabei. Und immer noch mehr traten aus dem Hauptgebäude über eine zweite Brücke hinzu.
»Meldest du uns an, Freddie? Ich würde gern ein paar Leuten Guten Tag sagen und suche uns danach schon mal einen Platz im Kursraum.« Miriam steuerte auf eine Gruppe von bunt gekleideten Frauen zu, die sich vor der Tür zu einem der beiden am Innenhof gelegenen Seitengebäude begrüßten und in immer wieder neuen Paarungen um den Hals fielen.
»Welkom Cahaya!«, stand auf dem Plakat, das über dem Eingang hing. Ob eine von den Umarmerinnen die berühmte Yogameisterin war? Ich wandte mich ab und ging über die zweite Brücke zum Hauptgebäude.
»Deine Atemzüge sind gezählt!«
Wenn das Graffitigeschmiere quer über der Eingangspforte wenigstens orange statt schwarz gewesen wäre. So erinnerte es mehr an einen Ort des Kampfes und blutrünstige Burgzeiten als an ein Zentrum zur geistigen Erbauung. Ich zuckte mit den Achseln und trat ein.
In der Empfangshalle begrüßte mich eine deckenhohe rotgoldene Figur, ein Elefant auf einem Thron, der mich – wie früher der Burgherr – von oben herab gnädig anlächelte. Ich sah mich suchend um. Aus einem Laden gleich rechts vom Eingang klang Meditationsmusik. Die Rezeption befand sich zu meiner Linken. Nur noch eine kleine Schlange wartete, der Hauptanreisesturm schien vorbei zu sein.
Ich stellte mich an und schaute mich weiter um. Im hinteren Teil der Halle befanden sich mehrere Sofas und Sitzkissen, die aber im Moment größtenteils verwaist waren. Jetzt erhoben sich auch die letzten Yoginis und verschwanden in einem der beiden Flure, die zu beiden Seiten der Halle abgingen.
Mein Blick wanderte zurück zum Tresen. Das Einchecken schien wohl mit Methoden aus der Vorzeit durchgeführt zu werden. Es ging so langsam voran, als würde jeder Teilnehmername in Stein gemeißelt. Ich seufzte.
Von hinten versetzte mir jemand einen Stoß. Als ob es dadurch schneller ging. Genervt wandte ich mich um.
»Oh, Entschuldigung«, säuselte meine Hinterfrau. »Meine Meditation fängt gleich an.«
»Meine auch«, murmelte ich und drehte mich wieder zur Rezeption. Nein, ich würde mich nicht aufregen, ich würde geduldig hier stehen und mich über nichts und niemanden ärgern. War das nicht meditieren? Quasi im Stand. Und das aus dem Stand. Nur leider nicht am Strand.
Erneut streifte etwas meine Wade. »Hey!« Ich fuhr herum, aber dieses Mal war es nicht die Dränglerin. Die trippelte neben der Schlange auf und ab. Statt ihrer stand jetzt eine zierliche blonde Frau hinter mir, die so leicht und zart wirkte wie der Seidenschal auf ihren Schultern. Eine Elfe mit einem kleinen Mädchen.
Die Kleine hielt mir ihre Giraffe hin. »Affe«, verkündete sie strahlend.
»Gir-Affe«, korrigierte ich, nahm das Stofftier entgegen und ging in die Hocke. »Weißt du, warum die Giraffe Gier-Affe heißt?«
Die Kleine schüttelte den Kopf.
»Weil sie den Hals nicht vollbekommen kann.«
Das Mädchen guckte mich verständnislos an.
»Okay. Dafür bist du noch zu klein.« Ich erhob mich wieder.
»Lein«, krähte es von unten.
»Arusha?« Ein hagerer Jesus-Typ kam aus dem Gang neben der Rezeption auf uns zu und starrte die Mutter des Giraffenkinds an, als hätte er eine Offenbarung, die er lieber nicht gehabt hätte. Und das lag garantiert nicht daran, dass ihre Flipflops mit den riesigen aufgesetzten Holzblüten aussahen, als wäre sie mit ihnen direkt einem Lotusteich entstiegen. Er griff nach ihrem Arm und zog sie von den Wartenden weg. Die Kleine nahm mir die Giraffe aus der Hand und stolperte hinter ihrer Mutter her.
»Ich darf doch?« An mir vorbei hastete die Eilmeditation zum Tresen und drückte dem Empfangsyogi einen Zettel in die Hand.
Ein Augenblick der Unachtsamkeit, das sollte mir vermutlich eine Lehre sein. Ich nahm mir vor, die Rezeption nicht mehr aus den Augen zu lassen. Ergeben widmete ich mich der Kontemplation und achtete auf Kleinigkeiten.
Der Empfangsyogi trug eine Wollmütze. In einem Ohr blitzten Ohrstecker und Ohrring. Die Mütze war grau, was stärker auffiel, als es jede andere Farbe getan hätte. Für einen Yogi eine ungewöhnliche Wahl, aber er war auch noch sehr jung. Während ich hier alt wurde.
Endlich war es so weit: Die Drängeltante griff sich ihren Zimmerschlüssel und enteilte der Langsamkeit bei der Zimmervergabe.
Ich trat an den Tresen. »Frederike Weihs und Miriam Winter. Cahaya-Yoga. Ein Doppelzimmer. Am liebsten in einem der Türme.«
Der Yogi glotzte mich an.
»Spreek je Duits?«, versuchte ich es. »Or English?«
Langsam nickte er und ließ seinen Zeigefinger über die Liste gleiten, bis er endlich bei W ankam. »Weihs«, las er. »Winter.« Er klang, als müsste er sich zwingen, in dieser Welt zu bleiben.
Ich stöhnte leise.
Schließlich hob er den Kopf, nickte und schob mir einen Schlüssel zu. »Kamerzevenentwintig. Sektion C. Habt ihr Bettwäsche und Handtücher nötig?«
»Ja.« Ich konnte nicht anders und grinste breit. Bettwäsche nötig haben war einfach zu süß. Damit er auch was zu lachen hatte, setzte ich meine niederländischen Sprachbrocken ein. »Zeker doch.«
»Das macht dann tien Euro per Person.«
Während ich das Geld aus meinem Portemonnaie suchte, stapelte der Yogi zwei Laken auf den Tresen und verschwand dann in einem Kabuff.
»Ist das unser Zimmerschlüssel?« Miriam trat neben mich, nahm den Schlüssel sowie die Laken. »Ich muss dringend wohin. Ist es okay, wenn ich vorgehe?«
Ich nickte.
»Sorry.« Endlich war der Mann zurück und hielt mir zwei Exemplare entgegen, die aussahen, als würden sie noch vor dem nächsten Schleudergang auseinanderfallen. »Wir haben allein kleine Handtücher.«
Mit Mühe unterdrückte ich ein Kichern – allein kleine Handtücher –, ich liebe holländisches Deutsch. Da machte es auch nichts, dass das hier wohl kein Wellnessurlaub werden würde.
Der Rezeptionist nahm das Geld, zählte es, strich die Scheine glatt und bettete sie in eine Schublade. Dieser Mensch brauchte definitiv keine Entschleunigungsübungen.
»Und die Bettwäsche?«
Verwirrt sah er mich an.
»Überzüge für Kopfkissen und Decken wären nicht schlecht.« Ich legte all mein nicht vorhandenes Wissen über Yoga-Hypnose in den Blick und schaute dem Empfangsyogi in die Augen. So lange, bis er sich erneut in den Nebenraum aufmachte und mit zwei weiteren Laken, dieses Mal in Rosa, sowie einem knallgelben Kopfkissenbezug und einem pinkfarbenen mit Nijntje, dem kleinen Häschen, darauf zurückkam. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Wortlos klemmte ich mir Bettwäsche und Handtücher unter den Arm und machte mich auf den Weg.
Zum Trakt C ging es durch einen lang gezogenen Flur. Ich passierte eine Tür, links und rechts davon Regale mit Flipflops und Birkenstocksandalen. »Stilte a.u.b. – meditatie/Ruhe bitte – Meditation«, stand auf einem Schild, das auf der angelehnten Tür klebte. Neugierig linste ich in den Raum. Wahrhaftig! Die Eilmeditation hatte sich bis in die erste Reihe vormeditiert. Grinsend wandte ich mich ab und landete in den Armen eines Nachzüglers.
»Let op. Immer hübsch aufgepasst.« Ein verführerisches Grübchen zeigte sich, der Typ streifte seine Flipflops ab und verschwand im Raum.
»Achtsam sein.« Eine Stimme drang durch die immer noch offen stehende Tür. »Schau nach vorn. Sieh mit ruhigem Blick. Nimm wahr und werte nicht.«
Meinten die mich? Ich ging weiter und lauschte mit einem Ohr der Stimme, die mir über den Flur folgte.
»Höre die Stille. Lausche dem Lärm. Verschließe dich nicht.«
Ich knallte gegen eine Glastür. Na klasse! Verschließe dich nicht. Hatte die Tür nicht zugehört?
Ich rieb mir die Stirn. An der Wand klebte ein Blatt, dessen grellrote Buchstaben den Blick auf sich zogen: »Sei mit allen Sinnen. Be with all your sins. Sin with all your senses.«
Ich las die holländische Fassung, die englische, las die Worte ein zweites Mal. Sündige mit allen Sinnen?
Das meinten die jetzt aber nicht ernst, oder?
Im Zimmer erwartete Miriam mich in Yogakleidung. Kritisch musterte sie sich im Spiegel und zupfte das eng anliegende Kleidchen über der Leggings zurecht. Dann zog sie ein weites T-Shirt darüber, als wollte sie ihre Rundungen verbergen. Vielleicht gehörte der Mehrlagenlook aber auch einfach nur zu einer schicken Yogini dazu.
»Muss ich mich auch fein machen?« Ich feixte und konnte gerade noch ihrem Knuff ausweichen.
»Hast du denn was anderes dabei als deine Laufsachen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Na, was fragst du dann?«
Rasch zog auch ich mich um, nahm meinen Rucksack, und schon hasteten wir zurück in den Innenhof.
»Das Seminar findet in einem der ehemaligen Kutschenhäuser statt«, erklärte Miriam eifrig. »Das andere ist wohl zum Wellnessbereich umgebaut worden und soll sehr schön sein. Da müssen wir unbedingt auch mal hin.«
»Mir würde ein Strandspaziergang reichen«, murrte ich halbherzig.
»Warten wir ab, ob du nach der ersten richtigen Yogastunde immer noch so wild auf Bewegung bist.« Miriam drückte die Tür zum Yogakutschenhaus auf.
Unser Seminarraum hieß Hanuman und lag im Erdgeschoss. Ich stoppte am Eingang und staunte über die Unmengen an Flipflops und Schlappen in den Regalen neben der Tür, zu denen sich gleich ein Paar Laufschuhe gesellen würde. Wenigstens waren die Oberfenster im Gang auf Kipp gestellt. Sonst würde es hier sicher bald lecker riechen.
»Wow, sind die genial.« Miriam zeigte auf ein Paar Korkflipflops, an denen jeweils eine violette Riesenblüte prangte. Das hätte ich mir denken können, dass ihr die Blumenflipflops der Elfe aus der Empfangshalle gefielen.
Ich spähte an ihr vorbei in den Raum und zuckte zurück. Unsere Yogaräumlichkeit war riesig und vollständig mit Yogamatten ausgelegt, auf denen sich die Yogis und Yoginis häuslich mit Decken, Kissen und Wasserflaschen eingerichtet hatten. Vorn befand sich ein kleines Podest mit einer Yogamatte, vor der ein Mikrofon stand. An der uns gegenüberliegenden Seite des Saals sorgten hohe Fenster für Licht und, so hoffte ich, auch Luft. Ein solches Fenster in der hinteren Hälfte des Raums steuerte Miriam jetzt an. Zögernd folgte ich ihr.
»Das wird morgen bestimmt leerer«, beruhigte Miriam mich und ließ mir die Matte am Fenster. »Beim Satsang kommen oft Leute dazu, die das Seminar nicht gebucht haben und einfach neugierig sind.«
Ich stellte meinen Rucksack vor mir ab und setzte mich im Schneidersitz auf die Matte. Wenn man es denn als solchen bezeichnen konnte: Meine Knie ragten steil nach oben, mein Oberkörper kippte nach hinten. Notgedrungen umschlang ich meine Beine mit den Händen, um wenigstens etwas Halt zu haben.
»Besorg dir lieber ein Kissen, dann sitzt du bequemer. Die anderen holen sich welche aus dem kleinen Raum hinter der Rückwand.«
Ich drehte mich um und entdeckte eine Tür in der Holzvertäfelung. Jetzt schon froh über die Bewegung, stand ich wieder auf und ging nach hinten, wobei ich sorgsam darauf achtete, keine fremde Matte zu berühren. Mit dem dicksten Sitzkissen, das ich finden konnte, kehrte ich wenig später zurück. Ich ließ es auf meinen Platz fallen und hockte mich darauf.
Miriam war in ein Gespräch mit ihrer Mattennachbarin vertieft. Was hatte sie vorhin gesagt, was das hier war? Sitsang? Nein, Sattsang. Verstohlen zog ich das Smartphone aus dem Rucksack, stellte es rasch auf lautlos, damit es mich nicht verriet, und googelte nach »Yoga Sattsang«.
»Satsang« hieß es richtig. »Ein Zusammensein von Menschen, die durch gemeinsames Hören, Reden, Nachdenken und Versenkung in die Lehre nach der höchsten Einsicht streben«, sagte Wikipedia. Das konnte ja heiter werden. Ich übte schon einmal das Versenken und ließ den Kopf auf die Knie sinken.
Das Stimmengewirr wurde lauter, ich schaute auf. Ein Tross von mehreren Personen schob sich herein. Das musste der feierliche Einzug der Hohepriesterin sein.
Eine kleine Frau schritt durch den Raum. Ihr schwarzes Haar schimmerte und unterstrich ihre helle Haut. Sie war eine jener Frauen, deren Alter schwer zu schätzen war, vielleicht war es auch das Yoga, das sie jung hielt, jedenfalls konnte sie genauso gut fünfunddreißig wie fünfundfünfzig sein, in ihrer Haremshose und der weiten Bluse, beides in einem satten Blau.
»Cahaya trägt immer Violett«, flüsterte Miriam mir zu.
»Das ist kornblumenblau«, protestierte ich.
Miriam rollte mit den Augen. Was Farben betraf, waren wir uns selten einig. Eine von uns hatte da einen Stich im Auge – und das war sicherlich nicht ich.
»Violett«, murmelte Miriam. »Das betont ihre Augenfarbe.«
»Violette Augen? Du meinst, sie hat Veilchen?«
»Pst.« Die Frau schräg vor uns drehte sich um und warf uns einen tadelnden Blick zu.
»Es hat doch noch gar nicht angefangen«, wehrte Miriam ab, aber die Frau zeigte uns schon wieder ihren Rücken. Kerzengerade saß sie da, die Beine im Meditationssitz verschränkt, ihre Handrücken ruhten auf den Knien, Zeigefinger und Daumen berührten sich und formten ein staunendes Oh. Wie konnte man so sitzen?
Die Yogameisterin erreichte das Podest, betrat es und stellte sich an den vorderen Rand. Die Hände vor der Brust sah sie in die Runde. Schaute einen nach dem anderen an. Nickte immer wieder, als sei sie zufrieden mit dem, was sie sah. Schließlich blickte Cahaya mich an. Ihre Augen strahlten in einem tiefen Blauton. Natürlich war das Blau! Das Meer an einem Sommersonnentag. Versenken, versinken, sich treiben lassen. Gehalten werden.
Wimpernschlag.
Cahaya sah zum Nächsten.
Für einen Moment noch saß ich still da. Dann war ich wieder zurück im Hier und Jetzt. Das sollte doch gut sein, fühlte sich aber ganz und gar nicht so an. Ich streckte die Beine aus, stützte mich mit den Händen ab und sah mich unauffällig im Raum um. Alle saßen ruhig und entspannt. Andächtige Gesichter, vor die Brust gehobene Hände.
»Namasté. Ich grüße euch.« Cahaya hob die Hände zur Stirn, senkte sie vor die Lippen, ans Herz und ließ sie dann auseinanderfließen. Sie setzte sich auf die Matte, die auf dem Podest lag.
Erst jetzt bemerkte ich den Mann neben ihr auf der kleinen Bühne. Er hockte nicht auf dem Boden, sondern saß auf einem Stuhl! Nein, er saß nicht, er lümmelte darauf herum, die Arme vor dem Bauchansatz verschränkt. Fehlte nur noch, dass er sich eine Zigarette anzündete. Ganz lässiger Rockstar, allerdings einer von denen, die in die Jahre gekommen waren. Jetzt räkelte er sich und ließ den Blick über die Menge schweifen.
Mit einem leisen Stöhnen setzte ich mich auf die Fersen. Eine Wohltat. Mindestens so gut wie ein Stuhl. Herausfordernd warf ich dem Typen einen Blick zu, den er zwinkernd erwiderte.
Ich beugte mich zu Miriam hinüber. »Wer ist denn das?«
»Claude, der Coole«, raunte sie.
»Heißt der wirklich so?«
Miriam lachte. »Warte nur, bis du sein OM gehört hast.«
Der Stockrücken vor uns richtete sich noch weiter auf – so das denn möglich war – und zischte empört.
Ich spürte den unbändigen Drang zu kichern. Vielleicht hatte Yoga ja doch Unterhaltungswert. Das Kichern unterdrückte ich allerdings, denn Cahaya erklärte gerade, dass sie in diesem Seminar auf die fünf Grundübel allen Leidens eingehen werde. Gemeinsam würden wir uns auf den Weg der Erkenntnis begeben. Den Trübungen mit Licht begegnen. In unsere Schatten gehen. Und sehen. Sehen erfordere Klarheit. Und Klarheit Liebe. Das falsche Wissen loslassen.
Ich war mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstand. Das hörte sich an, als wäre es besser, nichts zu wissen als das Falsche. Aber woher sollte man wissen, was falsch war und was richtig? Unwillkürlich dachte ich an Jan. Meinte Cahaya damit, dass es richtig war, ihm zu misstrauen? Sollte ich ihn loslassen? Oder sollte ich ihm glauben, dass nichts mit dieser Selma lief?
»Lasst unsere Herzen leicht werden.« Cahaya zog einen Holzkasten zu sich heran und entriegelte ihn. Ein paar leiernde Töne erklangen.
Fragend sah ich zu Miriam.
»Das ist ein Harmonium«, flüsterte sie. »Darauf begleitet sie sich.«
Die Yogameisterin nickte einem Yogi zu. Der schaltete Laptop und Beamer an.
»OMGAMGANAPATAYENAMAHA«.
Von links nach rechts flimmerten die Worte über die Leinwand, gefolgt von einem leuchtend bunten Elefanten. Anmutig und dickbäuchig. Ein lang gezogener Ton erklang, der auch dem erhobenen Rüssel des Elefanten hätte entstammen können. Ich sah, wie Cahaya das Harmonium auseinanderzog und erneut zusammenschob. Der Ton schwoll an und klang dann wieder ab. Cahaya entlockte dem Instrument einen weiteren Trompetenton und lachte.
»Ganesha, oder auch Ganapati, ist voller Energie und hilft uns, Hindernisse zu beseitigen. Das Mantra, das wir jetzt singen werden, bedeutet etwa Folgendes: Oh, Ganesha, der du einen großen Körper hast, einen gebogenen Rüssel und die Helligkeit von Millionen von Sonnen, bitte räume alle Hindernisse aus dem Weg.«
Ich grinste. Mit Ganesha als Gottheit konnte ich mich anfreunden. Der sah aus, als wüsste er, wie man das Leben nehmen musste.
»OMGAMGANAPATAYENAMAHA«, sang Cahaya vor, und die Gemeinde sang nach. Dazu der Geruch von Räucherstäbchen.
Ich kam mir zunehmend vor wie in einer Kirche. Gut, das Ambiente unterschied sich, dennoch schienen mir die Mantren wie eine, wenn auch alternative, Litanei. Latein gegen Sanskrit getauscht.
Die meisten Yogis sangen voller Inbrunst mit. Der gerade Rücken vor uns schwang wie ein Pendel von einer Seite zur anderen. Direkt vor Cahaya sprang ein Yogi auf. Ich erkannte den Jesusjünger aus der Eingangshalle. Wild warf er sein langes Haar hin und her. Als wäre er auf einem Rockkonzert – oder beim Vortanzen für die Hauptrolle bei »Jesus Christ Superstar«. Nun breitete er auch noch die Arme aus, allerdings nicht, um die Gemeinde zu segnen, wie ich befürchtet hatte, sondern um sich wie ein Kreisel zu drehen.
Eine zierliche Frau wirbelte nach vorn. Ihr leuchtender Schal tanzte durch die Luft. Eine orange-rote Elfe – Arusha, die Mutter des Giraffenkinds. Der Jesusjünger hielt inne und gaffte sie an. Dann tanzte er weiter. Beinahe, als sei er vom Teufel besessen, sprang er plötzlich auf die Elfe zu, die ihn nicht wahrzunehmen schien. Völlig in sich versunken wiegte sie sich zur Musik. Im letzten Moment wich er ihr aus, drängte sich jedoch immer wieder an sie heran. Wie Balzen sah das nicht aus, eher wie ein Verdrängungskampf, als wolle jeder von ihnen direkt vor der Meisterin tanzen.
Ich wunderte mich. Ein wenig mehr Achtsamkeit, auch beim Tanz, hätte ich schon erwartet, aber vielleicht fehlte mir sogar fürs Zuschauen der richtige Spirit.
Inzwischen hatten sich auch andere um mich erhoben und bewegten sich zur Musik. Einer der wenigen Männer hüpfte in bester Tanzbärmanier. Erleuchtung schien nicht automatisch zu Musikalität und Rhythmusgefühl zu führen.
Jetzt tapste auch noch das Giraffenmädchen über die Yogamatten und geriet zwischen die Fronten. Fast hätte der Jesusjünger die Kleine getreten, er stoppte jedoch gerade noch rechtzeitig ab. Das Mädchen plumpste auf den Po und klatschte vergnügt in die Hände. Wollte sie denn keiner in Sicherheit bringen?
Ich stand auf und kämpfte mich durch die Tanzenden zur Bühne vor, aber eine andere Frau erreichte das Kind zuerst, nahm es auf den Arm und ging mit ihm zur Tür. Ich überlegte, ob das nicht auch für mich eine gute Gelegenheit war zu gehen. Den Zimmerschlüssel hatte ich in der kleinen Tasche meiner Laufhose, allerdings kam ich von hier aus nicht an meinen Rucksack, und mein Smartphone lag ungeschützt auf der Matte.
Bevor ich der Frau in den Flur folgte, winkte ich Miriam zu und zeigte auf das Handy. Sie nickte, legte es auf die Fensterbank und zog auch den Rucksack näher zu sich heran.
»Affe!« Die Kleine schmiegte ihre Wange an die Schulter der Frau und strahlte mich an.
Ich lächelte zurück. »Hey. Meine kleine Freundin mit dem langen Hals. Du bist wirklich ausdauernd.«
Die Frau drehte sich zu mir um und nickte. »Ja, aber jetzt wird es Zeit.«
»Soll ich ihre Mutter holen?«
»Danke, nicht nötig. Meine Schwester wird sicher gleich kommen, um ihr einen Gutenachtkuss zu geben.« Die Frau strubbelte dem Kind durchs Haar und suchte nach ihren Schuhen.
Ein Problem, das ich nicht hatte. Rasch schlüpfte ich in meine Laufschuhe und verabschiedete mich.
Als ich die Tür zu unserem Zimmer öffnete, schlug mir abgestandene Luft entgegen. Hier würde nicht einmal der yogische Geist durchatmen können.
Ich ging zum Fenster, das direkt gegenüber der Tür lag, und öffnete es. Unter mir schimmerte der Wassergraben in der Abenddämmerung. Dahinter lag eine Wiese, die sich bis zum Wald erstreckte. Ich nahm noch einen Atemzug, dann schnappte ich mir die Bettwäsche, die ich auf den Tisch in der Ecke geworfen hatte, und bezog das obere Stockbett.
Obwohl der Raum schmal geschnitten war, ließen die hellgelb gestrichenen Wände ihn nicht eng oder beklemmend wirken. Die Bilderserie eines fröhlichen Strichmännchens in verschiedenen Yogahaltungen auf der dem Bett gegenüberliegenden Wand ließ mich grinsen. Diese Übungen sahen aus, als würden sie Spaß machen.
Während ich das Kissen in den quietschgelben Bezug stopfte, sah ich mich nach einem Kühlschrank um. Den fehlenden Fernseher würde ich nicht vermissen, aber etwas zu trinken wäre mir schon recht gewesen.
Ich warf das Sonnenkissen aufs Bett. Als Ausgleich dafür, dass Miriam Wange an Wange mit Nijntje ruhen musste, überzog ich auch noch das untere Bett. Dann trat ich in die kleine Diele, packte meine Tasche aus und hängte die Jammerlappen von Handtüchern ins Bad.
Wieder im Zimmer betrachtete ich mein Sonnenbett und überlegte, ob es ähnlich schlafverhindernd wirken würde wie die taghellen Nächte im Norden.
Die Tür ging auf.
»OMBHURBHUVAHASVAHA …« Singend kam Miriam ins Zimmer. »Und, wie hat es dir gefallen? War doch schön, oder? Oh, du hast die Betten gemacht, super, danke. Mann, bin ich müde.«
»Willst du schon schlafen? Ich dachte, wir nehmen noch einen Schlummertrunk in einem Strandpavillon zu uns.«
»Du bist lustig. Weißt du, wie spät es ist?«
»Auf keinen Fall später als halb zehn. Wieso?«
»Hast du die Hausordnung nicht gelesen?« Miriam zeigte zur Tür. »Sobald es dunkel wird, werden die Yogamatten hochgeklappt, und es geht ins Bett.«
»Wie bitte?« Ungläubig ging ich zu dem Aushang und las: »In diesem Haus leben wir im Einklang mit der Natur. Wir richten unseren Wach-Schlaf-Zyklus nach dem Sonnenlauf. Am Morgen begeben wir uns schweigend zum Sonnengruß. Wir hören auf unser inneres Ich und gehen achtsam mit unseren natürlichen Ressourcen um.«
»Ja genau, und bevor wir schlafen gehen, füllen wir sie erst noch einmal auf.« Miriam zauberte zwei Flaschen Bier aus ihrem Koffer und zwinkerte mir zu. »Hier, ein isotonisches Sportgetränk. Morgen wird es anstrengend.«
»Anstrengend?« Ich lachte. »Ich dachte, wir machen Yoga.«
»Du wirst es schon noch merken.«
Wir öffneten die Flaschen und stießen an. Mit meinem Kopfkissen im Rücken machte ich es mir auf der Fensterbank bequem, während Miriam zu Nijntje in die Betthöhle kroch.
Ich wusste auch nicht, warum ich jetzt wieder an Jan denken musste. Vielleicht war es das warme Bier, das mich an unseren Ausflug Anfang des Sommers erinnerte. Er hatte die Bierdosen in den Fahrradtaschen verstaut, in seine normale Kleidung gewickelt, um sie vor den Erschütterungen zu schützen, und dann waren sie doch explodiert. Nur eine einzige Dose hatte den Transport überstanden, und die hatten wir uns auf dem Gipfel geteilt. Da hatte er noch nicht in Essen gearbeitet und ich keinen Grund zur Eifersucht gehabt.
»Hey, warum bist du denn auf einmal so still?« Miriam sah mich kurz an. »Jetzt sag nicht, du denkst an den, von dem ich denke, dass du an ihn denkst.«
»Doch.« Ich nickte.
»Wir hatten doch ausgemacht, dass du genau das nicht tust. Keine Zweifel, keine Kontrollanrufe. Aus den Augen, aus dem Sinn. Fünf Tage im Hier und Jetzt.«
»Na klasse. Jetzt machst du auch schon diese Sprüche, über die man hier im Haus ständig stolpert. Aus den Augen, aus dem Sinn – Schluss mit der Sünde. Was soll ich denn machen, wenn ich an ihn denken muss?«
»Ich meinte nur, du sollst nicht grübeln, aber wie du willst. Ich bin schon still.«
»Ist bestimmt auch höchste Schweigezeit«, grummelte ich. »Wann geht es eigentlich morgen los?«
»Sechs Uhr dreißig.«
»Aufstehen oder frühstücken?«
»Weder noch. Halb sieben beginnt das Seminar.«
»Das meinst du jetzt nicht ernst.«
Miriam zuckte nur mit den Schultern und verschwand mit einem gemurmelten »Ich zieh mich dann mal um« im Bad.
»Wann sollen wir denn dann frühstücken?«, rief ich ihr hinterher.
Miriam steckte ihren Kopf noch einmal heraus. »Nach der Yogastunde.«
Entgeistert sah ich sie an. »Aber vorher bekomme ich zumindest einen Kaffee, oder?«
»Hm, ja, also Tee und heißes Wasser gibt es auf jeden Fall. Und der Brunch soll richtig gut sein.«
Damit zog sie die Tür zu. Kurz darauf hörte ich das Wasser rauschen.
Ich gähnte und überlegte. Wenn ich den Handywecker auf Viertel vor sechs stellte, sollte die Zeit für uns beide im Bad reichen. Ich zog meinen Rucksack, den Miriam auf dem Tisch deponiert hatte, zu mir heran und öffnete das Reißverschlussfach, in dem ich das Smartphone aufbewahrte, doch es war leer. Miriam hatte das Handy bestimmt auf der Fensterbank vergessen. Wahrscheinlich war es inzwischen schon so aufgeladen von der positiven Energie im Yogaraum, dass ich es den ganzen nächsten Monat nicht mehr ans Stromnetz hängen musste. Ich grinste, ging in den Vorraum und klopfte an die Badezimmertür.
»Miri? Ich bin kurz runter, mein Handy holen. Du hast es im Seminarraum liegen lassen, oder?«
Als keine Antwort kam, verließ ich das Zimmer.
Der Flur lag still vor mir. Keine gedämpften Stimmen, keine Musik. Nicht einmal eine Wasserspülung. Entweder waren die Wände tatsächlich einer Burg würdig, oder die Leute hielten sich alle an die Hausregeln und schliefen.
Obwohl Yogigeister vermutlich tiefenentspannt und daher kaum zu wecken waren, wollte ich lieber keinen aus seinem Schlaf schrecken und schlich mich leise zum Empfang. Auch hier war alles ruhig. Nur im Hinterraum brannte noch Licht. Ich ging zum Yogakutschenhaus und probierte die Klinke. Problemlos öffnete ich die Tür und trat ein.
Ein leises Knacken ließ mich herumfahren. Die Tür hinter mir war ins Schloss gefallen. Unwillkürlich zog ich daran und stellte erleichtert fest, dass sie sich auch jetzt öffnen ließ und mir eine unfreiwillige Nacht im Seminarbereich erspart bleiben würde. Nicht nur, dass ich aus dem Alter heraus war, wo ich auf einer Isomatte bestens schlief, nein, noch dazu roch es hier auch nicht sonderlich gut.
Ich runzelte die Stirn und schnupperte. Abgestandener Tabakqualm? Es gab schon perverse Räucherstäbchensorten.
Während ich darauf wartete, dass sich meine Augen an das grünliche Licht der Notbeleuchtung gewöhnten, lauschte ich in den Gang. War es in der Burg schon ruhig gewesen, kam mir die Stille hier so erhaben vor, dass ich mich fast nicht weitertraute. Als wäre jede noch so kleine Bewegung ein Sakrileg. Einer solchen Stille musste man mit Respekt begegnen. Und nicht mit leise schmatzenden Turnschuhen.
Ich schalt mich albern, aber ich zog sie aus und stellte sie in eins der leeren Schuhregale. Auf Zehenspitzen und Socken schlich ich zur Tür des Seminarraums und öffnete sie. Die Außenbeleuchtung schimmerte durch die hellen Vorhänge vor den Fenstern, ließ mich aber nicht genug erkennen. Ich tastete nach einem Schalter, fand ihn und machte das Licht an.
Blinzelnd sah ich mich um. Offenbar hatten die Yogis nach dem Tanz alles hergerichtet für die Meditation am nächsten Morgen. Sogar Kissen und gefaltete Decken befanden sich bereits auf den Matten. Das sah so ordentlich aus, als wären wir beim Militär und nicht beim Yoga. Nur in der ersten Reihe war eine Decke über die Matte gebreitet, ganz so, als läge da jemand. Ich schaute genauer hin.
Da lag wirklich jemand.
Lange blonde Haare lugten unter der Decke hervor. War eine der Yoginis versehentlich eingeschlafen, oder wollte sie hier übernachten? Durfte man das?
Ich ging nach vorn. Das war doch die Mutter des Giraffenkinds. Hatte sie dem Mädchen nicht noch einen Gutenachtkuss geben wollen? Ich beugte mich zu ihr hinunter, um sie zu wecken, und sah ihr Gesicht.
Die Zunge hing aus dem Mund.
Geöffnete Augen. Gebrochener Blick.
»Oh mein Gott«, flüsterte ich.
Das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich zwang mich zu einem weiteren Blick. Ja, die Frau war eindeutig tot. Um ihren Hals war ein Gurt geschlungen. Darunter lugte ein Zipfel ihres Schals hervor.
Mühsam atmete ich ein und wieder aus. Plötzlich klickte es leise hinter mir. Mein Kopf fuhr herum. Nein, da war niemand. Nur Matten, Kissen, Decken. Ein dumpfes Geräusch! Aus dem Materialraum. War der Täter noch da? Ich hielt die Luft an.
Da – ein leises Quietschen. Ohne weiter abzuwarten, rannte ich los, riss die Tür des Seminarraums auf, dann die des Kutschenhauses und raste über den Innenhof zum Empfang.
Hinter mir hörte ich Schritte.
»Stopp!«, verlangte eine Männerstimme.
Ich warf mich gegen die Eingangstür des Haupthauses und sprintete zur Rezeption. Mit einem Klacken sprangen die Deckenlampen an. Der Empfangsyogi kam aus dem Hinterraum.
»Hilfe!«, rief ich und hoffte, dass er schnell genug reagieren und sich meinem Verfolger in den Weg stellen würde.
»Max!«, keuchte es hinter mir. »Pak ze!«
Der Empfangsyogi trat einen Schritt vor. Was sollte das denn? Gehörten die beiden zusammen?
»Ik heb je!« Von hinten fasste eine Hand meine Schulter, ein Arm legte sich um meinen Hals. Instinktiv packte ich zu, beugte mich vor und nahm den Schwung mit, sodass mein Verfolger über meinen Rücken flog – und unsanft auf dem Boden vor mir landete: der Jesusjünger.
»Ich habe sie nicht umgebracht«, japste ich und ließ seinen Arm los.
»Wieso umgebracht?« Der Yogi stöhnte leise und rieb sich die Schulter.
»Umgebracht?«, echote Max. »Dood? Wie in: getötet?«
»Das ist doch ein Trick. Lenk nicht ab.« Der Jesusjünger ließ die Augen nicht von mir, als fürchtete er, dass ich ihn erneut auf die Matte knallen würde, dabei lag er noch, wenn auch nicht auf einer Matte. Jetzt rappelte er sich langsam auf.
»Im Seminarraum liegt eine Tote, erwürgt. Ich dachte, der Mörder wäre hinter mir her.«
»Moment mal.« Der Jesusjünger erhob sich und zeigte zum Kutschenhaus. »Ich habe dich doch gerade in Hanuman gesehen. Da soll eine Tote liegen?«
Ich nickte.
»Schau nach, Max. Ich passe auf, dass sie nicht abhaut.«
»Hey«, protestierte ich. »Wir müssen die Polizei rufen. Die Frau ist erwürgt worden. Du kennst sie. Ich glaube, sie heißt Arusha.«
Er erstarrte. Nur sein Adamsapfel sprang auf und ab.
»Wat? Nee toch?«, stotterte Max.
Die Typen machten mich wahnsinnig. Mussten sie noch im Angesicht des Todes derartig langsam sein? »Oh Mann, wollt ihr nicht endlich die Polizei rufen? Und im Übrigen sollte mal jemand den Leiter des Ladens hier informieren.«
Der Jesusjünger nickte dem Empfangsyogi zu. Dann sah er mich lauernd an. Aber vielleicht wirkte es auch nur wegen der tief liegenden Augen so. »Ich heiße Prem und bin der Leiter des Yogazentrums. Ist sie … ist Arusha wirklich tot?«
Erstes Übel – Avidya (Nichtwissen)
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind.
Wir sehen sie so, wie wir sind.
2
Kalte Füße – koude voeten
Samstagmorgen
Mit einem Ruck fuhr ich auf. Mein Herz raste, meine Füße waren kalt, die Zehen krümmten sich, verkrampften. Die leblosen Augen, der Blick, der nichts mehr erfasste – ich rang nach Luft, atmete mühsam ein und wieder aus.
Durch das Fenster fiel das erste schwache Licht des Tages. Noch war es matt, genügte aber, um mir deutlich zu machen, dass Aufwachen nicht reichte, um dem Alptraum ein Ende zu bereiten. Ich rieb meine Füße aneinander, beugte mich über den Rand der Matratze und sah zu dem Bett unter mir.
Miriam lag auf der Seite. Auch für sie war es eine lange Nacht geworden. Einen Moment lauschte ich auf ihre Atemzüge, die so unglaublich friedlich klangen, doch mir war klar, dass ich keine Ruhe mehr finden würde.
Behutsam kletterte ich aus dem Bett und schlich ins Bad. Es zog mich nach unten. Vielleicht würde das Tageslicht mir helfen, eine andere Sicht auf die Dinge zu gewinnen. Vielleicht gab es sogar schon Neuigkeiten, und der Mörder hatte in der Nacht gefasst werden können.
Ich wusch mich und schlüpfte in meine Trainingssachen. Um nicht barfuß über den Flur gehen zu müssen, zog ich meine Stoppersocken an. Als ich nach der Befragung durch die Polizei letzte Nacht endlich hatte aufs Zimmer gehen dürfen, hatten meine Schuhe nicht mehr im Regal vor dem Yogaraum gestanden. In dem Durcheinander konnte mir niemand sagen, ob die Spurensicherung sie konfisziert hatte. Warum hatte ich ausgerechnet die Tasche mit den Sandalen zu Hause stehen lassen müssen?
Immer noch fröstelnd warf ich mir meinen kuscheligen Kapuzenpullover über und verließ das Zimmer.
Am Ende des Flurs stand der Aufzug offen. Ich stieg ein, drückte die Taste für das Erdgeschoss. Langsam ruckelten die Türen aufeinander zu, und die Kabine setzte sich in Bewegung. Mit ihr meine Gedanken. Obwohl ich wusste, dass es kein natürlicher Tod gewesen sein konnte, drang mein Hirn darauf, vermutlich weil es noch im Abstrus-träum-Modus war, und ersann immer absurdere Erklärungen: Konnte man sich so sehr entspannen, dass das Herz einfach aufhörte zu schlagen? Gab es eine Yogaübung, bei der man sich einen Gurt um den Hals schlang? Mord auf der Yogamatte – das konnte nicht wahr sein.
Abrupt kam der Aufzug zum Stehen. Noch bevor die Türen ganz geöffnet waren, hörte ich Stimmen, die aus der Empfangshalle durch den Flur drangen.
Im Eingangsbereich standen einige Yogis und Yoginis. Wortfetzen schwirrten durch die Luft, Fragen flogen umher. Als hätte man einen Vogelschwarm aufgescheucht.
Ich schob mich an den Early-Yoga-Birds vorbei nach draußen. Ein Flatterband versperrte den Zugang zum Kutschenhaus. Dahinter stand ein junger Polizist und sorgte dafür, dass auch tatsächlich niemand hineingelangte. Über seine Schulter spähte ich durch die geöffnete Tür in den Seminarraum, sah die leeren Yogamatten. Für einen Moment froren Bild und Ton ein, und das Gesicht der Toten legte sich darüber. Ich musste mich zwingen, ruhig weiterzuatmen. Nach ein paar tiefen Zügen ging es wieder.
Ich wandte mich an den Polizisten. »Weiß man schon Näheres?«
Er schüttelte den Kopf. »Dazu darf ich nichts sagen.«
»Ich habe sie gefunden«, erwiderte ich leise. Als würde mich das berechtigen, weitere Informationen zu erhalten, Informationen, die ich brauchte, um loslassen zu können.
»Ah, bist du Frederike Weihs?«
Ich nickte.
»Die Kollegen möchten mit dich sprechen. Moment.« Der Polizist zog ein Handy aus seiner Gürteltasche. »Ich ruf sie an. Dann holt dich jemand.«
Während er telefonierte, sah ich mich erneut um. Ein Yogi mit Rastazöpfen verteilte Zettel an die Early Birds, kam dann auch zu mir und drückte mir einen Zettel in die Hand, auf dem stand: »Namasté! Alle Kurse werden fortgeführt. Cahaya-Yoga vormittags am Strand, nachmittags im Zelt auf der Wiese. Euer ›ZeeOm‹-Yogateam.«
Nach und nach verzogen sich die Frühaufsteher-Yogis. Unruhig blickte ich ihnen nach. Yogaübungen oder womöglich still zu sitzen und zu meditieren konnte ich mir jetzt weniger denn je vorstellen.
Eine junge Frau kam aus dem Haupthaus und eilte über die Brücke auf mich zu. Jeans, eine Lederjacke über dem Top, das blonde Haar zum Pferdeschwanz gebunden. »Frederike Weihs? I am Inspecteur Zoe Vermeer. Please follow me.« Schon drehte sie auf dem Absatz um und startete wieder durch. Ihr Pferdeschwanz wippte energisch, genauso wie die ganze Frau. Nur keinen Schritt und kein Wort zu viel verlieren.
Ich folgte Miss Effizient ins Hauptgebäude, gab mir aber keine Mühe, zu ihr aufzuschließen. Im Grunde war es mir ganz recht, dass sie vorausging und mir nicht schon auf dem Weg Fragen stellte oder gar unnötige Konversation betrieb.
An der Rezeption vorbei bogen wir in einen Gang, der offensichtlich noch nicht renoviert worden war. Die Inspecteurin klopfte an eine Tür und ging hinein, ohne auf eine Antwort zu warten. »CYO«, las ich auf dem Türschild – Chief Yoga Officer? Stirnrunzelnd trat ich in den Raum. Es schien der Vorraum zum Yogachefsitz zu sein, fehlte nur die Sekretärin, aber die hätte auch gar keinen Platz gehabt. So kahl, wie die Wände im Gang waren, so voll hingen sie hier: Zeitungsartikel, Zertifikate, Yogadiplome – ausgestellt auf Prem Piet Brand. Der Jesusjünger war wohl ein wahrer Meister der verschiedenen Yogaarten. Und des perfekt getimten Auftritts. Miss Effizient hob gerade die Hand, um an die Tür des eigentlichen Bürozimmers zu klopfen, als diese aufging und sich Prem zeigte. Er stand seitlich zu uns und schüttelte den Kopf, sodass seine Haare flogen. Dem holländischen Wortschwall konnte ich nur vereinzelte Brocken entnehmen. »Doorgaan met de seminars«, »Cahaya«, »India«. Prem bemerkte uns und brach ab.
Eine Männerstimme erklang. Der Kommissar, wie ich annahm, wurde durch die Tür verdeckt. Verdeckte Ermittlungen? Aus den Teilstücken, die ich verstand, reimte ich mir zusammen, dass die Polizei sich bemühte, den Yogabetrieb so wenig wie möglich zu stören. Und dass sie eine Gästeliste wollten.
»Hebt u de lijst hier?«, hakte Inspecteurin Vermeer ein.
»Nee, bij de receptie.« Prem sah mich an, zögerte, machte einen Schritt auf mich zu, faltete seine Hände, hob sie zur Stirn und ließ sie vor die Brust sinken. »Namasté. Es tut mir leid, dass ich dich gestern Abend über den Gang gejagt habe, aber ich dachte wirklich, du wärst der Schmierfink, der uns seit einiger Zeit ärgert. Also, nichts für ungut. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann …« Nun beugte er sich auch noch vor und senkte den Kopf, als wartete er auf meine Absolution.
»Meneer Brand?« Miss Effizient schob sich zwischen mich und Prem. »De lijst, alstublieft.«
Die beiden verschwanden in den Flur.
»Guten Morgen.« Der verdeckte Ermittler trat hinter der Tür hervor. Sportlicher Typ, kantiges Kinn, dunkle Haare. Wenn er nicht einen hellgrauen Anzug getragen hätte, hätte er tatsächlich was von diesem früheren »Tatort«-Kommissar gehabt, von dem ich mir den Namen nicht merken konnte. Scheelefreud, nein, Stehl-den-Freund. Ohne Dreitagebart. Dafür mit einem leichten, aber wirklich nur ganz leichten holländischen Akzent.
»Frau Weihs?« Er hob eine Augenbraue. »Frederike Weihs, richtig?«
Ich nickte.
»Ich bin Hoofdinspecteur Julian Doorn von der Polizei in Middelburg. Sie haben die Tote gefunden?«
»Ja.« Ich räusperte mich. Mein Gott, ich piepste, als wäre ich ein Mäuschen. Verlegen schaute ich zu Boden. Mein Blick fiel auf meine Füße. Oh nein, mit den Socken sah ich aus wie der letzte Schlafyogi. Da half es auch nicht, dass Stehl-den-Freund mich freundlich anlächelte. Erneut senkte ich den Blick und bemerkte seine Schuhe. Praktische Treter in Braun, und das zum grauen Anzug. Auch nicht besser als Socken.
»Bitte.« Er deutete auf das Bürozimmer und hielt mir die Tür auf.
Wortlos ging ich an ihm vorbei. Ein herber, leicht erdiger Geruch streifte mich. Wenn holländische Ermittler alle so gut rochen …
Stehl-den-Freund zog mir den Stuhl vor dem Schreibtisch zurecht, wartete, bis ich mich gesetzt hatte, und ging dann an einer mit Fotos übersäten Wand vorbei um den Tisch. Bilder vom Jesusjünger, allein, mit Cahaya und anderen Yogis. Ich stutzte. War das tatsächlich die Tote auf dem Foto in der Mitte?
»Ist das eine indische Gottheit?«
Verwirrt schaute ich zu Doorn.
Er deutete auf die andere Seite, wo eine Art Altar aufgebaut war und Blüten vor einer exotischen Tänzerfigur lagen. Ich hob die Schultern. Bislang beschränkten sich meine Kenntnisse der Yogagötter auf Ganesha – und der war es eindeutig nicht.
Stehl-den-Freund rückte das Telefon auf dem ansonsten nahezu leeren Schreibtisch zur Seite und setzte sich. »Sind Sie regelmäßig hier?«
»Um Himmels willen!« Kaum waren mir die Worte herausgerutscht, spürte ich auch schon, wie ich rot wurde.
Doorn musterte mich. In seinen schiefergrauen Augen funkelte es hell. Lachte er mich aus?
Hinter mir fiel die Tür energisch ins Schloss, Zoe Vermeer war hereingekommen. Kaffeeduft stieg mir in die Nase. Mit zwei Bechern bewaffnet, eilte sie zum Schreibtisch und stellte den einen vor Doorn ab. »War nicht so einfach, welchen aufzutreiben. Yogis drinken wohl keinen koffie.« Sie blickte auf den Wasserspender mit Edelsteinstab in der Ecke, schüttelte den Kopf, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich an die Seite des Tisches.
Doorn rückte den Becher in meine Richtung. »Möchten Sie?«
»Nein danke.« Verflixt, gegen die Erziehung meiner Mutter kam ich am frühen Morgen nicht an. Dabei hätte ich nur zu gern einen ordentlichen Kaffee gehabt. Ohne Koffein funktionierte mein Kopf nicht, aber jetzt war es zu spät. Wankelmütig wollte ich auch nicht erscheinen. Ich schob meine besockten Füße unter den Stuhl und legte die Hände sittsam auf den Schoß.
Doorn zog den Becher zurück. »Sie haben den Kollegen gestern Nacht gesagt, dass die Tür zum Yogaraum geschlossen war, als Sie in das Seminargebäude kamen. Wie war das mit den Fenstern?«
»Ich weiß nicht genau.« Für einen Moment schloss ich die Augen und versuchte mich zu erinnern. Vergebens. Ich öffnete sie wieder und hob bedauernd die Schultern. »Die Vorhänge waren zugezogen. Und es hat stickig gerochen, nach abgestandenen Räucherstäbchen oder so etwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fenster offen waren.«
Doorn schlug die Mappe vor sich auf. Ein Foto schlidderte über den Tisch und fiel vor mir auf den Boden. Arusha und … Ich runzelte die Stirn. War das Jan?
Miss Effizient bückte sich, aber ich war schneller, erwischte das Foto jedoch nur an der Ecke. Prompt segelte es wieder hinunter.
»Entschuldigung«, stotterte ich, »ich dachte … aber das kann nicht sein.« Ich hob das Bild auf und legte es auf den Schreibtisch, als könnte etwas Distanz helfen, aber er war es, eindeutig. Glücklich lachte mein Freund mich von dem Foto an, den Kopf an den von Arusha gelehnt. Auch sie lachte. Die Arme umeinandergelegt, wirkten die beiden wie ein frisch verliebtes Paar.
Ich biss mir auf die Unterlippe, zwang mich, noch einmal genau hinzusehen. Die Aufnahme konnte nicht allzu alt sein. Die Sonnenbrille in Jans Haaren hatte ich ihm erst vor Kurzem zum Geburtstag geschenkt. Ich schluckte. So gern hätte ich ihm geglaubt, dass er mich nicht betrog. Verdammt, ich war sogar auf dieses Seminar gefahren, um meine unbegründete Eifersucht – so dachte ich, und so hatte er es mir wieder und wieder versichert – mittels Yoga in den Griff zu bekommen. Jetzt hatte ich den Beweis, den ich mir gewünscht hatte – wenn auch vom Gegenteil.
»Sie kennen den Mann«, konstatierte Doorn das Offensichtliche und bewahrte mich so davor, in Tränen auszubrechen.
Auch wenn es nur Tränen der Wut gewesen wären – nicht vor der Polizei. Ich setzte mich aufrecht hin, atmete durch und nickte. »Mein Freund, Jan Luhdo. Woher haben Sie das Bild?«
Doorn sah mich an. Seine schiefergrauen Augen schimmerten dunkel. Vor Mitleid? Rasch schaute ich weg, blinzelte.
Der Inspecteur stand auf, füllte ein Glas mit Edelsteinwasser und stellte es vor mir auf den Tisch. Ich nahm einen Schluck. Trinken half gegen Tränen. Wahrscheinlich bekamen sie das in Holland in der Fortbildung zur Zeugenbefragung beigebracht.
Wenn Arusha ein Foto von Jan mit sich herumtrug, herumgetragen hatte, musste sie wirklich verliebt gewesen sein. Hastig nahm ich einen weiteren Schluck und blickte auf meine Hände, die das Glas umklammerten.
»Sie wussten nicht, dass er auch hierhinfahren wollte?« Doorns Stimme klang ruhig, sachlich. So, als ginge es um nichts.
»Jan, hier?« Ich hob den Kopf. »Ganz bestimmt nicht. Er macht kein Yoga.«
»Ach nein?«