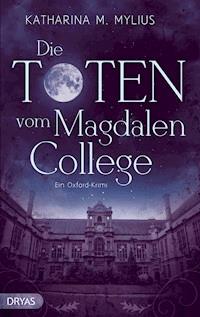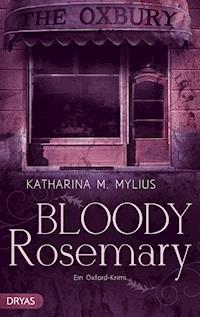Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Britcrime: Ein Oxford-Krimi mit Green und Collins
- Sprache: Deutsch
Der Trainer des Ruderclubs der Universität Oxford treibt tot in der Themse. Zunächst sieht es danach aus, als sei der Mann ertrunken. Doch dann verdichten sich die Hinweise, dass er hinterlistig ermordet wurde. Das Inspektoren-Duo Heidi Green und Frederick Collins ermittelt und findet heraus, dass sich der ehrgeizige Trainer mit seiner harschen Art viele Feinde gemacht hat. Dabei gerät ein Ruderer besonders ins Visier der Ermittler. Wenig später wird jedoch auch er tot aufgefunden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tödliches Blau
Ein Oxford-Krimi
von Katharina M. Mylius
Inhaltsverzeichnis
Donnerstag, 5. März
Freitag, 6. März
Samstag, 7. März
Sonntag, 8. März
Karte von Oxford
Das Bootsrennen zwischen Oxford und Cambridge
Danksagung
Impressum
Lesetipps
Für meine Eltern Inge und Thomas
Donnerstag, 5. März
Frederick Collins pfiff vergnügt seinen Lieblingssong von Aretha Franklin, während er sich die Schnürsenkel seiner Sportschuhe zuband. Er war heute besonders früh aufgestanden, denn er wollte vor Dienstbeginn eine große Runde im University Park joggen gehen. Jetzt saß er in der Diele seiner Altbauwohnung und konnte es kaum erwarten, die frische Frühlingsluft einzuatmen, die einem die Lungen richtig durchpustete und einen daran erinnerte, dass man mitten im Leben stand. Anfang März erwachte Oxford nach Monaten der Eintönigkeit endlich aus seinem Winterschlaf: Überall grünte es und die ersten Knospen streckten sich der Sonne entgegen, die sich nun immer öfter zeigte. Genauso wie Fredericks gute Laune.
Etwa vor einem Jahr hatte er sich von seiner Heimatstadt Liverpool nach Oxford versetzen lassen – in einer der dunkelsten Stunden seines Lebens. Seine Exfreundin hatte ihn monatelang betrogen und am Ende für einen anderen sitzen gelassen. Das Schlimmste daran war gewesen, dass er sich nach der schmerzhaften Trennung zu Hause verkrochen hatte. Aber seit letztem Herbst raffte er sich nun fast jeden Morgen auf und joggte eine Runde durch den Park. Und er traf sich einmal in der Woche mit einigen Polizeikollegen zum Fußballspielen und danach im Pub. Das tat ihm gut und das Training machte sich auch körperlich bemerkbar. Endlich fühlte er sich wieder wohler in seiner Haut.
Er stellte sich vor den großen Spiegel neben der Eingangstür, spannte seine Muskeln unter dem Laufshirt an, drehte sich einmal nach links und dann nach rechts und begutachtete sich dabei eingehend. Dann grinste er breit, denn ihm war durchaus bewusst, dass er sich gerade wie ein Muskelprotz aufführte. Schelmisch zwinkerte er seinem Spiegelbild zu, griff nach seinem iPod und dem Schlüsselbund und wollte gerade die Wohnungstür öffnen, als sein Handy klingelte. Er hatte eine leise Vermutung, wer ihn so früh am Morgen anrief. Sein Herz begann unwillkürlich schneller zu schlagen. In freudiger Erwartung ging er hinüber zu dem kleinen Glastisch, auf dem das Handy lag, und griff nach dem Gerät. Doch auf dem Display stand nicht der ersehnte Name, sondern »Sergeant Simmons – Thames Valley Police«.
Frederick seufzte enttäuscht und nahm das Gespräch an. »Guten Morgen, Simmons, was gibt’s?« Er hörte ein angestrengtes Schnaufen am anderen Ende der Leitung und machte sich ernsthaft Sorgen um den jungen Sergeant. »Simmons! Was ist passiert?«
»Inspector Collins«, Sergeant Simmons räusperte sich, »hab ich Sie geweckt?« Doch er ließ Frederick keine Zeit, um zu antworten. »Das tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, es ist noch sehr früh, und eigentlich will ich Sie nicht stören. Wissen Sie, ich hab mir lange überlegt, ob ich Sie anrufen soll oder nicht. Ich war mir nicht sicher …« Er stockte. »Ach, vergessen Sie einfach, dass ich mich gemeldet habe, Inspector! Es ist nicht so wichtig.«
Natürlich ist es das, dachte Frederick.
Sonst hätte Sergeant Simmons es niemals gewagt, ihn um diese Uhrzeit zu stören. Auch wenn der junge Sergeant manchmal etwas unbeholfen wirkte, hatte es bislang immer einen triftigen Grund gegeben, wenn er mit einem Anliegen direkt an Frederick herangetreten war. Er sah den schlaksigen jungen Mann vor sich, wie er nervös von einem Bein auf das andere trat, während er sich das Handy ans Ohr presste.
»Simmons, Sie haben mich nicht geweckt. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass Sie mich jederzeit anrufen können«, sagte er in beruhigendem Ton. »Wie kann ich Ihnen helfen?« Er hörte ein weiteres gequältes Schnaufen, dann Schweigen. »Simmons, Sie können sich mir anvertrauen«, versicherte er.
Doch Sergeant Simmons schien mit sich zu ringen.
Komm schon, Junge, jetzt spuck es aus, wollte Frederick ihn am liebsten drängen, aber er hielt sich zurück. Nach weiteren scheinbar endlosen Sekunden des Schweigens zeigte sein Vorgehen Erfolg.
»Also gut«, flüsterte Sergeant Simmons. Dann erklärte er mit zittriger Stimme: »Ich stehe hier gerade im Christ Church Meadow, genauer gesagt bei den Bootshäusern an der Themse. Wissen Sie, unten bei der Folly Bridge, in der Nähe des Head of the River Pub, dort, wo …«
Frederick wurde nun doch ungeduldig. »Simmons, jetzt sagen Sie schon: Weshalb rufen Sie mich so früh am Morgen an?«, unterbrach er ihn.
Sergeant Simmons legte erneut eine Pause ein, doch diesmal nur, um Luft zu holen. Dann berichtete er aufgeregt: »Eine Joggerin hat hier vor einer guten halben Stunde einen Mann aus der Themse gezogen. Sie hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, doch es war schon zu spät.«
»Er ist also ertrunken?«
»Es sieht danach aus.«
Frederick hörte Zweifel in der Stimme des jungen Sergeant und hakte daher nach: »Aber?«
»Ich weiß nicht, Inspector Collins, vielleicht irre ich mich, ach, ich irre mich bestimmt …«
»Inwiefern, Simmons? Inwiefern irren Sie sich?«
»Die Kollegen denken, dass es ein Unfall war.«
»Und Sie?«
»Mir kommt das etwas seltsam vor«, presste Sergeant Simmons unsicher hervor.
»Weshalb?«
»Ich weiß, wer der Tote ist. Sein Name ist Marcus Hind, er war mal Leistungssportler. In den letzten Jahren hat er das Ruderteam der Universität Oxford trainiert und war immer noch fit wie ein Turnschuh. So einer ertrinkt doch nicht einfach!«
Auch Profis sind vor Unfällen nicht gefeit, zumal sie dazu neigen, sich selbst zu überschätzen, wollte Frederick anmerken. Doch er hielt sich zurück und ließ Sergeant Simmons weitererzählen.
»Außerdem hat er eine Wunde am Hinterkopf und einige Schrammen an den Armen. Für mich sieht es so aus, als ob er rücklings über den Boden geschleift wurde.«
Aha, jetzt wurde es interessant. »Das heißt, die Schrammen sind nur an den Unterarmen?«, fragte Frederick.
»Ja.«
»Und die Wunde am Hinterkopf, wie groß ist die?«
»Sie ist auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen, weil der Tote so viele Haare hat. Ich war der Einzige, der sie bemerkt hat«, erzählte Sergeant Simmons mit Stolz in der Stimme. »Mir sind gleich seine großen Ohren aufgefallen. Wussten Sie, dass Menschen mit großen Ohren nachgesagt wird, besonders ehrgeizig zu sein? Ich habe das kürzlich in einem Artikel im Medical Science Magazine gelesen. Interessante Lektüre, sollten Sie unbedingt mal reinschauen.«
Frederick unterdrückte ein Seufzen. »Und weiter?«
»Jedenfalls habe ich mir seine riesigen Ohren angeschaut, weil ich eben diesen Artikel gelesen habe. Das passt ja auch zu seinem Charakter: Marcus Hind hatte selbst schon einige Preise als Ruderer bekommen und trainierte nun unser Universitätsruderteam. Er war bekannt für seinen unerbittlichen Ehrgeiz und hat der Mannschaft immer Bestleistungen abverlangt. Wenn die Teammitglieder nicht alles gegeben haben, soll er ausgerastet sein, und auch das eine oder andere Ruder ist dabei wohl schon zu Bruch gegangen. Na jedenfalls, ich habe ohne Übertreibung noch nie einen Menschen mit so großen Ohren gesehen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für Lappen sind! Da ist Jumbo nichts …«
»Simmons!«
»Schon gut. Als ich mir die Ohren so angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Haut hinter dem rechten seltsam schrumpelig aussah. Ich hab den Toten dann etwas gedreht und da ist mir eine etwa zehn Zentimeter lange Wunde am Hinterkopf aufgefallen. Wissen Sie, das war ’ne ziemliche Überwindung, ihn anzufassen. Erst hab ich gezögert, aber dann hab ich gedacht, das passt doch alles nicht zusammen und …«
»Sie haben sich sicherlich schon überlegt, woher die Wunde stammen könnte?«, versuchte Frederick, Sergeant Simmons’ Schilderungen abzukürzen.
»Allerdings. Zuerst dachte ich, dass er vielleicht den Mast eines Segelboots abbekommen haben könnte. Das würde einen Sinn ergeben. Aber dann hab ich mir gesagt: So einer wie der segelt doch nicht auf der Themse durch Oxford. Hier gibt es fast keinen Wind. Das wäre viel zu lahm für ihn gewesen. Der brauchte immer Action. Also hab ich den neuen Sergeant losgeschickt, um die Themse nach einem Boot abzusuchen. Und tatsächlich hat er ein führerloses Boot unten am Iffley Lock gefunden. Und zwar ein Ruderboot. Aber, Inspector Collins, Hind wird sich ja wohl kaum mit dem Ruder selbst auf den Hinterkopf geschlagen haben! Ich hab mir ein Ruder genommen und es selbst ausprobiert. Hier bei den Bootshäusern liegen unzählige herum«, sprudelte es aus Sergeant Simmons heraus.
Frederick stellte sich vor, wie der junge Sergeant mit einem Ruder herumfuchtelte und versuchte, seinen Hinterkopf zu treffen. Er bemühte sich, ein Lachen zu unterdrücken.
»Glauben Sie mir, Inspector Collins, das ist eigentlich nicht machbar.«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort.«
»Hind könnte sich die Wunde auch zugezogen haben, als er rückwärts auf das Boot gefallen ist. Allerdings habe ich es mir genau angesehen. Da gibt es weder scharfe Kanten noch lassen sich Sturz- oder Blutspuren finden. Wissen Sie, das ist so eins, in dem nur einer sitzen kann, bei dem die Ränder überall abgerundet sind, damit man ganz schnell übers Wasser gleiten kann. Vielleicht ist Hind auch an Land gestürzt, als er das Boot verlassen wollte. Aber das Ufer hier ist nicht befestigt und es gibt weit und breit nichts, auf das er sonst hätte fallen können. Verstehen Sie jetzt? Das ergibt alles keinen Sinn!« Sergeant Simmons schnaufte unglücklich.
»Ihrer Meinung nach könnte also Fremdverschulden im Spiel gewesen sein«, fasste Frederick zusammen.
»Gut möglich, Inspector Collins.«
»Und wieso fürchten Sie sich jetzt davor, die gesamte Mordkommission einzuschalten?«, wunderte sich Frederick. »Was Sie mir gerade erzählt haben, spricht doch eigentlich dagegen, dass es ein Unfall war. Ist es, weil die Kollegen Ihre Meinung nicht teilen?«
»Ja«, gab Sergeant Simmons zu. »Und Chief Inspector Meyers ist da ja auch sehr empfindlich.«
Frederick wusste genau, wovon der Sergeant sprach. Für den cholerischen Chief Inspector gab es nur schwarz oder weiß, eindeutig Mord oder nicht. Irrtümer waren unerwünscht. Wäre Frederick ein paar Jahre jünger gewesen, hätte er sich wohl auch von Meyers’ despotischer Art einschüchtern lassen. Aber inzwischen war er Mitte dreißig und fühlte sich dem Mann durchaus gewachsen.
»Wissen Sie was, Simmons, bleiben Sie, wo Sie sind! Ich komme zu Ihnen und schaue mir den Toten an«, schlug er vor. Er konnte hören, wie Sergeant Simmons aufatmete.
Dann überschlugen sich dessen Worte: »Aber nur, wenn es Ihnen wirklich nichts ausmacht, Inspector Collins. Ich wollte Sie nicht stören. Wissen Sie, ich kann verstehen, wenn Sie …«
»Ich bin in fünfzehn Minuten bei Ihnen.« Frederick legte auf, zog sich statt der Sportsachen rasch einen Pullover und eine Chino an, warf seine Lederjacke über und machte sich auf den Weg.
Heidi Green hatte gerade ihre Zwillinge Ann und Max in der Preschool abgegeben, als der Anruf ihres Partners Frederick Collins sie erreichte. Ein Toter in der Themse! Und dabei handelte es sich ausgerechnet um Marcus Hind. Der Mann war in Oxford bekannt wie ein bunter Hund. Das Ruderteam der Universität, das er trainiert hatte, nahm jährlich im Frühjahr einen erbitterten Kampf gegen seinen Erzrivalen, das Ruderteam der Universität Cambridge, auf. Das traditionelle Bootsrennen war einer der wichtigsten kulturellen Termine ihrer kleinen Stadt und zog nicht nur die Bürger Oxfords und Cambridges, sondern Besucher aus ganz England an die Themse. Dass Marcus Hind nun wenige Wochen vor dem Rennen tot aufgefunden worden war, war ein handfester Skandal.
Heidi schnallte das Polizeilicht auf das Dach ihres grünen Mini Cooper, stieg hastig ein und raste los, begleitet vom Klang der Sirene. Sie war in Oxford geboren und aufgewachsen und hatte schon das ein oder andere Unglück miterleben müssen, bei dem die Themse zur tödlichen Falle geworden war. Doch Frederick hatte angedeutet, dass es sich möglicherweise nicht um einen Unfall handelte. Hatte Marcus Hind sich vielleicht etwas angetan? Oder hatte jemand nachgeholfen?
Ob die Leiche wohl lange im Wasser getrieben hatte, bevor die Joggerin sie entdeckt hat, fragte Heidi sich. Eine ekelhafte Vorstellung! War Marcus Hind auch bei den Bootshäusern gestorben oder hatte ihn die Strömung, die zwar an diesem Abschnitt der Themse nur leicht, aber dennoch sichtbar war, mit sich getragen? War sein Körper erst später dorthin getrieben worden?
Was auch immer geschehen war, Heidi war dankbar, dass der Tote unten bei den Bootshäusern und nicht mitten in der Stadt gefunden worden war. Dadurch war vielen Augen der gruselige Anblick einer Wasserleiche erspart worden.
Während sie weiterfuhr, begann sie, die Umgebung des Fundorts im Kopf durchzugehen: Um die Bootshäuser herum zog sich der weitläufige Christ Church Meadow entlang der Themse. Dahinter lagen The Kidneys, ein Naturschutzgebiet mit hohen Sträuchern, Wiesen und Bäumen, und gegenüber die Recreation Grounds des Brasenose College und des Queen’s College. In der Gegend war es tagsüber äußerst ruhig, die nächsten Wohnhäuser standen weit entfernt. Nachts und in den Morgenstunden war es – bis auf den einen oder anderen Jogger – dort sogar menschenleer. Sie hielt es daher für sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendwelche Zeugen finden würden. Allerdings wusste sie, dass der Christ Church Meadow Walk von den Kameras des CCTV überwacht wurde. Sie würde Sergeant Simmons bitten, die entsprechenden Videobänder beim City Council anzufordern.
Endlich hatte sie ihr Ziel erreicht. Sie parkte in der Nähe des Head of the River Pub, nahm das Polizeilicht vom Dach, warf es auf den Beifahrersitz und verschloss den Wagen. Dann ging sie in Richtung des Pub. Einige Touristen in dicken Jacken hatten auf der großen Außenterrasse Platz genommen und aßen ihr English Breakfast, während sie sich die morgendlichen Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen ließen. Es mussten Touristen sein, denn ein Oxforder hätte sich zu dieser kalten Jahreszeit nie freiwillig dorthin gesetzt, auch wenn die Aussicht gerade jetzt etwas sehr Romantisches hatte. Über dem Wasser stand noch eine dünne Schicht weißen Dunsts, der an die frostigen Temperaturen der letzten Nacht erinnerte.
Heidi grüßte freundlich und hoffte, dass die Gruppe nichts von dem schrecklichen Fund mitbekommen hatte. Dann lief sie mit schnellen Schritten einen kleinen Trampelpfad hinter dem hellen Sandsteingebäude entlang. Über einen Holzsteg gelangte sie auf einen schmalen Weg, der zum Ufer der Themse führte.
Diese Gegend war für sie noch immer eine der idyllischsten Oxfords. Schon als Kind war sie oft mit ihrem Bruder und ihren Eltern hier gewesen und inzwischen kam sie mit ihrem Mann und den Zwillingen hierher, wenn es ihre Zeit erlaubte. Zu ihrer Linken standen die jahrhundertealten Bäume des Christ Church Meadow, des wunderschönen Parks, der zum gleichnamigen College gehörte. Zwischen den Baumkronen konnte sie die Spitze des Glockenturms der Christ Church Cathedral sehen, die im Sonnenlicht hell leuchtete. Dann sah sie nach rechts auf das dunkle Wasser der Themse, die sich langsam ihren Weg durch die Landschaft bahnte. Eine Entenfamilie kam auf Heidi zu geschwommen, wohl in der Hoffnung, dass sie etwas Brot bei sich hatte. Wenn sie mit ihren Zwillingen hierherkam, brachten sie tatsächlich immer trockenes Brot für die Tiere mit, denn die Kinder hatten große Freude daran, sie zu füttern.
Heidi lächelte bei dem Gedanken an die unbeschwerte Zeit, die sie hier schon mit ihrer Familie verbracht hatte. Auf einmal hörte sie Motorengeräusche hinter sich und erinnerte sich daran, weshalb sie an diesem Morgen hergekommen war. Sie drehte sich um. Ein Boot fuhr an ihr vorbei und erzeugte heftige Wellen. Die Entenfamilie quakte empört. Auf dem Boot schienen Schaulustige zu sein, denn es fuhr nun langsamer und ganz nah ans Ufer heran. Dort konnte Heidi in einigen Hundert Metern Entfernung eine weiße Plane erkennen, die wohl Marcus Hinds Leiche verdeckte.
Heidi lief schneller. Der Tod des Coachs hatte sich also schon herumgesprochen. Das überraschte sie nicht. Es war eine große Ehre, das Ruderteam der Universität zu trainieren, und dementsprechend war Marcus Hind in der Stadt hofiert worden. Man konnte fast sagen, er hatte zur Oxforder Prominenz gehört. Mit ihm als Coach hatte das Team im letzten Jahr Cambridge besiegt. Seitdem war Marcus Hind in Oxford so etwas wie ein Held – auch wenn die Rennsaison für ihn in diesem Jahr nicht so gut begonnen hatte. Sein Team hatte bislang nur zwei Rennen gewonnen. Die Presse sprach schon von einer Pechsträhne. Andere hatten darin ein gutes Omen dafür gesehen, dass Hind das Team beim wichtigsten Rennen des Jahres gegen Cambridge letztendlich zum Sieg führen würde. Doch nun war er tot. Heidi konnte es selbst noch nicht ganz glauben.
Sie entdeckte Sergeant Simmons, der aufgeregt das Gelände absperrte und verzweifelt versuchte, Schaulustige zu vertreiben, die sich neugierig um die Plane drängten. Etwas abseits unterhielt sich Frederick mit Stephanie Bradshaw von der Spurensicherung. Auch Dr Goldberg, der Pathologe, war offensichtlich bereits informiert worden, denn sein Wagen fuhr gerade vor. Heidi duckte sich, kletterte unter einer Absperrung hindurch und begrüßte dann ihre beiden Kollegen. Frederick und Stephanie Bradshaw nickten ihr freundlich zu.
»Bevor du fragst, Heidi«, sagte Stephanie Bradshaw als Erstes, »ja, es ist tatsächlich Marcus Hind, daran besteht kein Zweifel.« Sie holte tief Luft, bevor es aus ihr herausplatzte: »Dass der arrogante Kerl aber auch so kurz vor dem Rennen sterben musste! Ich konnte ihn zwar nicht ausstehen, doch ich war mir sicher, dass wir mit ihm als Coach dieses Jahr wieder gegen Cambridge gewinnen würden. Jetzt sieht es wohl schlecht aus für unser Team.« Sie schnaufte enttäuscht.
»Dasselbe habe ich auch schon gedacht«, gab Heidi zu. Sie bemerkte, wie Frederick sie mit einem kritischen Blick bedachte, und bekam ein schlechtes Gewissen.
Auch Stephanie Bradshaw schien der Blick aufgefallen zu sein, denn sie rief: »Collins, jetzt schauen Sie nicht so! Ich kannte Hind. Na ja, eigentlich kenne ich seine Frau Liz, wir sind in derselben Backgruppe.«
»Du bist in einer Backgruppe?«, fragte Heidi erstaunt. »Du backst Torten und so?«
»Ja, Heidi«, antwortete Stephanie Bradshaw schnell. »Wie auch immer, jedenfalls habe ich nie verstanden, wie Liz es mit einem solchen Kotzbrocken wie Marcus ausgehalten hat. Er war vom Ehrgeiz zerfressen, hat seine Kinder schon in den Sportverein geschleift, als sie noch ganz jung waren, und sie zu eiserner Disziplin erzogen. Und mit Liz ist er auch nicht gerade zimperlich umgegangen.«
Bevor Frederick etwas erwidern konnte, trat Dr Goldberg zu ihnen. Er ließ die Begrüßung aus und kam gleich zur Sache: »Wenn es recht ist, würde ich mir jetzt den Toten anschauen.« Dann fügte er genervt hinzu: »Aber nur, falls ich Sie nicht von Ihrem Geplauder abhalte.«
Heidi sah ihn überrascht an. Eigentlich war Dr Goldberg ein sehr umgänglicher Mensch. Wahrscheinlich war das seine Art, seinen Ärger über den Tod von Marcus Hind auszudrücken. Sie wusste, dass Dr Goldberg ein treuer Unterstützer des Ruderteams war, zumal er selbst an der hiesigen Universität studiert hatte. Bestimmt hatte er alle bisherigen Rennen verfolgt und fieberte seit Wochen dem Wettkampf zwischen Oxford und Cambridge entgegen.
Auch Stephanie Bradshaw schien irritiert. Sie zog die Augenbrauen hoch und sagte: »Ich bin hier fertig und werde mich mal im Gelände ringsum umschauen, vielleicht finde ich noch irgendwelche Spuren. Bis später dann!«
Heidi nickte ihr zu und folgte Dr Goldberg, der ohne ein weiteres Wort zu der weißen Plane hinüberging und sie mit einem heftigen Ruck zurückzog. Dann begutachtete er den Toten eingehend. Normalerweise hätte er jeden seiner Arbeitsschritte mit einem flapsigen Spruch kommentiert, aber heute schwieg er.
»Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schade es ist, dass Marcus Hind so kurz vor dem großen Rennen sterben musste«, versuchte Heidi, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, doch sie bekam nur ein genervtes Brummen als Antwort.
Vorsichtig stellte sie sich neben Dr Goldberg und zuckte plötzlich zusammen, als ihr Blick auf den Toten fiel. Sie hatte Marcus Hind oft auf Bildern in der Zeitung oder auch im Lokalfernsehen gesehen. Doch der Mann, der nun leblos vor ihr lag, sah vollkommen anders aus: Sein blasses Gesicht war schmerzverzerrt, die braunen Augen weit aufgerissen, als hätte er in den letzten Sekunden seines Lebens Höllenqualen erlitten. Das dunkle Haar wirkte durch die Nässe schwarz und ließ die Gesichtshaut noch heller erscheinen. Heidi betrachtete den hageren, aber durchtrainierten Körper. In Wirklichkeit war Marcus Hind kleiner, als die Fotos, die sie von ihm gesehen hatte, sie hatten vermuten lassen. Er trug ein Sportshirt und eine Jogginghose, beides in Dunkelblau. Das war die Farbe des Oxforder Ruderteams, das deswegen auch »Dark Blues« genannt wurde. Die Kleidung war schlammverschmiert und nass. Obwohl die Haut des Toten nicht so sehr aufgequollen war, wie Heidi es erwartete hatte, lief ihr bei der Vorstellung, dass der Mann im eisigen Wasser der Themse gelegen hatte, ein kalter Schauer über den Rücken. Sie verschränkte schützend die Arme vor der Brust.
»Die Zeugin hat ausgesagt, dass sie Hind gegen halb acht in der Nähe des Ufers treiben sah«, erläuterte Frederick. »Sie dachte, er würde noch leben, und ist beherzt ins Wasser gesprungen. Schließlich hat sie ihn hier ans Ufer gezogen und versucht, ihn wiederzubeleben. Doch dafür war es wohl schon zu spät. Dennoch hat sie den Notarzt gerufen, der wiederum Simmons verständigt hat.« Dann wandte er sich an Dr Goldberg: »Haben Sie schon etwas für uns?«
»Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass der Mann seit etwa zwei Stunden tot ist. Er lag nur kurz im Wasser, bevor die Dame ihn rausgezogen hat, vielleicht so zehn, fünfzehn Minuten. Seine Haut ist nicht besonders runzelig.«
»Wo ist sie überhaupt?«, mischte Heidi sich ein und sah sich um. »Also ich meine die Zeugin.«
»Der Notarzt hat sie mit ins Krankenhaus genommen, sie stand unter Schock und war völlig unterkühlt. Sobald es ihr wieder besser geht, wird sie eine ausführliche Aussage machen«, erklärte Frederick.
»Auf die Frau bin ich gespannt«, meinte Heidi. »Nicht jeder würde Anfang März in die Themse springen, um jemand anderen rauszuziehen. Sie hätte ja auch sofort den Rettungsdienst rufen können.«
»Ich nehme die Leiche jetzt mit«, informierte Dr Goldberg sie.
»Können Sie schon etwas dazu sagen, wie er gestorben ist?«, fragte Heidi eilig.
»Nein«, stieß Dr Goldberg unfreundlich hervor.
»Ist er erschlagen worden?«, versuchte Frederick sein Glück. »Oder was meinen Sie, woher stammen die Wunde am Kopf und die Schrammen an seinen Armen?«
Dr Goldberg seufzte. »Ja, die Kopfwunde scheint von einem Schlag zu stammen. Aber ich muss mir das erst genauer ansehen. Wie gesagt, ich nehme ihn jetzt mit.«
Fredrick ließ nicht locker: »Das heißt, wir können einen Unfalltod ausschließen?«
»Nein, das können wir nicht! Nicht, solange ich meine Untersuchungen nicht abgeschlossen habe.«
»Melden Sie sich sofort bei uns, sobald Sie neue Erkenntnisse haben!«, drängte Frederick.
Dr Goldberg blickte ihn herausfordernd an: »Geht es Ihnen nicht schnell genug?«
»So habe ich das …«, versuchte Frederick abzuwiegeln.
»Danke, Dr Goldberg!«, sagte Heidi schnell.
Doch der war bereits damit beschäftigt, Sergeant Simmons und einen weiteren Kollegen herbeizuwinken. »Meine Herren, bitte legen Sie die Leiche auf die Trage und bringen sie zu meinem Wagen!«, forderte er sie auf. Dann folgte er den beiden, ohne sich vorher von Heidi und Frederick zu verabschieden.
»Was ist dem denn über die Leber gelaufen?«, fragte Frederick kopfschüttelnd, als Dr Goldberg außer Hörweite war. »Er muss seine schlechte Laune ja nicht an uns auslassen.«
»Ach, nehmen Sie es ihm nicht übel, Collins«, erwiderte Heidi und sah dabei zu, wie Dr Goldberg ungeduldig die jungen Sergeants antrieb. »Der Tod von Marcus Hind bedeutet quasi, dass das Rennen gegen Cambridge für uns verloren ist.«
»Es ist doch nur ein Bootsrennen«, sagte Frederick.
»Und die Beatles waren nur ein paar Heulbojen«, konterte sie säuerlich, denn sie wusste, wie sehr ihr Kollege die Band aus seiner Heimatstadt verehrte. »Für Sie sind die Beatles heilig, für uns ist es das Bootsrennen gegen Cambridge«, erklärte sie mit einem Kloß im Hals. Das Ganze ging ihr näher, als sie es für möglich gehalten hätte. »Dass der Coach unserer Mannschaft so kurz vor dem Rennen tot aufgefunden wird, ist eine Katastrophe. Wir haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt.«
»Verstehe«, sagte Frederick versöhnlich.
Stephanie Bradshaw war gerade dabei, allerlei Fußabdrücke zu fotografieren, die deutlich im schlammigen Boden in Ufernähe zu erkennen waren. Heidi und Frederick warteten in einigen Metern Entfernung, bis sie fertig war.
»Und?«, fragte Heidi, nachdem Stephanie Bradshaw zu ihnen gekommen war.
»Spuren gibt es hier wie Sand am Meer, wie ihr sehen könnt.« Stephanie Bradshaw zeigte auf die vielen kleinen Fähnchen im Boden. »Aber ob die vom Täter stammen oder von der Frau, die Hind retten wollte, kann ich noch nicht sagen. Könntet ihr jemanden losschicken, um mir die Sachen zu besorgen, die sie bei der Rettungsaktion getragen hat?«
»Sicher«, antwortete Heidi und versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen.
Im Moment hatten sie einfach viel zu wenige Anhaltspunkte, um zu verstehen, was hier geschehen war. Sie wussten lediglich, dass Marcus Hind ab etwa Viertel nach sieben für ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten in der Themse getrieben hatte, bevor die Joggerin ihn rauszog. Was davor passiert und ob er überhaupt hier getötet worden war, war immer noch unklar, genauso wie die Todesursache. Er hatte zwar eine Verletzung am Hinterkopf, aber ob er dadurch gestorben oder ertrunken war, würden erst die Untersuchungsergebnisse von Dr Goldberg offenlegen. Solange der aber so schlechte Laune hatte, wollte sie lieber nicht bei ihm nachfragen. Sie hoffte, dass sein Ärger über den Tod des Coachs ihn antreiben und er umso rascher arbeiten würde.
»Und was ist mit dem Boot?«, wandte Frederick sich an Stephanie Bradshaw. »Hast du da vielleicht irgendwelche Spuren gefunden?«
»Welches Boot?«, fragte sie überrascht.
»Der neue Sergeant hat am Iffley Lock ein führerloses Boot gefunden«, erklärte er. »Anscheinend lag eine Jacke darin. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob sie Hind gehörte oder vielleicht dem Täter.«
»Okay, ich werde mir das gleich anschauen und melde mich dann bei euch«, versprach Stephanie Bradshaw und ging in Richtung Iffley Lock.
Ich denke, hier können wir erst mal nichts mehr tun«, stellte Frederick fest. »Lassen Sie uns zur Police Station gehen!«
»Da haben Sie wohl leider recht«, stimmte Heidi zu. »Wir können durch den Christ Church Meadow gehen. Der Hintereingang der Police Station ist nicht weit entfernt. Aber ich wollte vorher noch kurz mit Simmons sprechen.«
»Na, das trifft sich ja gut«, sagte Frederick. »Da kommt er gerade.«
»Meinen Sie mich?«, fragte Sergeant Simmons, der offenbar den letzten Satz gehört hatte.
»Ja, allerdings«, entgegnete Heidi. »Könnten Sie sich bitte die Bänder des CCTV hier im Park von heute Morgen besorgen und sie durchsehen?«
Sergeant Simmons murrte. »Wissen Sie eigentlich, wie viele Kameras hier stehen? Mindestens zwölf! Das dauert ja ewig und drei Tage! Wenn ich für jede Kamera drei Stunden brauche …«
»Simmons, das ist wirklich wichtig für uns«, unterbrach Heidi ihn und lächelte aufmunternd. »Sie schaffen das schon!«
»Es bleibt mir ja ohnehin nichts anderes übrig«, nuschelte der junge Sergeant. »Ich mache mich gleich auf den Weg.«
»Danke, Simmons!« Heidi wandte sich an Frederick: »Kommen Sie?«
Schweigend liefen sie nebeneinander her. Frederick war noch nie in diesem Teil des Meadow gewesen, Heidi hingegen kannte ihn offenbar wie ihre eigene Westentasche. Er blickte zu ihr hinüber und betrachtete das ovale Gesicht mit den wachen Augen, das von einer wilden braunen Lockenmähne umrahmt wurde. Obwohl sie drei Köpfe kleiner war als er, hatte sie eine einzigartige Präsenz. Sie erinnerte ihn ein wenig an eine Löwin. Auch sie war durchsetzungsfähig, hatte jedoch ein feines Gespür dafür, wann Gefahr drohte. Wenn es sein musste, konnte sie brüllen, um sich Respekt zu verschaffen. Gleichzeitig war sie sehr vorsichtig, blieb manchmal lieber im Hintergrund und beobachtete kritisch. Inzwischen hatte er auch ihre verletzliche Seite kennengelernt, die sie allerdings lieber versteckte und stattdessen ihre scharfen Krallen zeigte.
Frederick schmunzelte. Plötzlich fiel sein Blick auf eine alte Holzbank, die einladend am Wegrand stand.
Ein wunderschöner Ort zum Verweilen, dachte er, man fühlt sich wie auf dem Land und ist doch mitten in der Stadt. Er würde bald einmal hierher zurückkehren, beschloss er. Es waren diese versteckten Orte, die er nach und nach in Oxford entdeckte und die das kleine Städtchen für ihn so besonders machten. Zwar vermisste er vor allem das quirlige Nachtleben von Liverpool, doch der einzigartige Charme Oxfords hatte ihn längst eingenommen. Er konnte sich derzeit nicht vorstellen, nach Liverpool zurückzugehen. Und da gab es ja auch noch diese Frau …
Nach einer Weile bogen sie rechts auf den Poplar Walk ab, einen breiten Weg, der von hohen alten Bäumen gesäumt war. Kurz darauf nahmen sie eine Abkürzung, die sie direkt zum Hintereingang der Thames Valley Police Station führte. Gerade als die Kirchturmglocke der Christ Church Cathedral zehn Uhr schlug, erreichten sie das Revier.
Frederick fragte sich, was wohl in Heidis Kopf vorging. Normalerweise war sie kaum zu bremsen und hielt mit ihren Ansichten zu einem Fall nicht hinterm Berg, auch wenn sie zunächst einmal noch so absurd waren. Aber heute schien sie damit zu hadern, dass Marcus Hind tot war. Er war offenbar ein wichtiger Mann für Oxford gewesen, da er der Stadt über ihre Grenzen hinaus Ruhm verschafft hatte. Frederick fand es immer wieder erstaunlich, wie sich die Bürger Oxfords mit ihrer Stadt identifizierten und ihre Traditionen hochhielten. Und sie ließen es sich nicht nehmen, Oxford bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu feiern – mit einer Leidenschaft, die der von Italienern oder Spaniern gleichkam. Das war eigentlich kein Wunder, umgab die Stadt mit ihren verwinkelten Gässchen und den alten Colleges mit den unzähligen hohen Türmen doch ein fast südländisches Flair. Dass nun Marcus Hind tot war, der den Oxfordern mit einem Sieg über Cambridge einen Grund, sich zu freuen und stolz zu sein, hätte bescheren können, schien auch Heidi bis ins Mark getroffen zu haben.
»Ich bin mir sicher, dass Hinds Assistent auch einen guten Job machen wird«, versuchte Frederick Heidi aufzuheitern.
Sie sah ihn überrascht an. »Können Sie Gedanken lesen?« Es war einer dieser seltenen Momente, in denen sie leicht zu durchschauen war.
Er blickte ihr direkt in die grünen Augen. »Heute schon.«
Heidi lächelte gequält. »Trotzdem bleibt die Frage, wem Hinds Tod nützt. Dem Cambridge-Team ganz bestimmt.« Sie schluckte, dann meinte sie nachdenklich: »Unserem Team wohl kaum.« Ihre Stirn legte sich in Falten.
Da waren sie wieder, ihre Denkfalten. Sie waren ein gutes Zeichen. Anscheinend hatte Heidi den ersten Schock über den Tod des Coachs verwunden und war nun bereit, sich in die Ermittlungen zu stürzen. Das mochte Frederick an ihr – war einmal ihr kriminalistischer Instinkt geweckt, konnte nichts und niemand sie aufhalten. Sie würde nun unermüdlich ermitteln, bis der Täter hinter Gittern saß. Heidi brannte für die Polizeiarbeit, genauso wie er.
Er hielt ihr die Tür zu ihrem gemeinsamen Büro auf und sie betrat den Raum, ohne sich bei ihm zu bedanken. Sie war tatsächlich wieder ganz die Alte, in Gedanken offensichtlich nur noch bei dem Fall. Dabei vergaß sie alles um sich herum. Er nahm ihr den kleinen Fauxpas also nicht übel, im Gegenteil.
Heidi setzte sich an ihren Computer und tippte eilig etwas in die Tastatur. Dann rief sie: »Sehen Sie, Collins, das ist der Assistent! Sein Name ist Gerry Kirkwood.«
Frederick lehnte sich vor, sodass er den Bildschirm sehen konnte. Siegessicher lächelte ihm ein gut gebauter Dunkelhaariger entgegen.
»Kirkwood rückt jetzt nach«, erklärte Heidi. »Vielleicht wollte er Hind loswerden. Der Posten des Coach ist so begehrt wie ein Treffen mit der Queen.« Erneut legte sich ihre Stirn in Falten.
Frederick wartete geduldig ab, denn er kannte sie inzwischen gut. Er wusste, dass nun die Ideen aus ihr heraussprudeln würden.
»Wir sollten Simmons auf das Cambridge-Team ansetzen«, schlug Heidi vor. »Und dann sollten wir uns auch unser Team genauer anschauen, vielleicht wissen die was. Glaubt man den Zeitungen, dann hat Marcus Hind mehr Zeit mit dem Ruderteam verbracht als mit seiner eigenen Familie. Vor allem nach den Schlappen der letzten Wochen.« Sie holte kurz Luft.
Frederick nutzte die Pause, um anzumerken: »Dann sollten wir zuerst seine Frau befragen.«
Heidi nickte. »Stimmt, mit ihr sollten wir anfangen.« Sie griff nach dem Telefonhörer und drückte eine Schnellwahltaste.
Nach nur wenigen Sekunden hörte Frederick sie genervt stöhnen und er hatte eine Vermutung, wer am anderen Ende der Leitung sein könnte.
»Nein, das habe ich nicht gewusst«, sagte Heidi. »Kommen Sie doch bitte zum Punkt!« Sie lauschte eine Weile. »Nein, Simmons, das ist tatsächlich nicht gut.« Sie stockte. »Ich werde Stephanie Bradshaw Bescheid sagen.« Wieder hörte sie zu. »Okay.« Sie notierte sich etwas. »Ach, Simmons, ich möchte, dass Sie sich im Cambridge-Team mal etwas umsehen.« Wenig später stöhnte sie erneut. »Ja, das bedeutet, dass Sie nach Cambridge fahren müssen. Ich weiß, dass Sie mit der Auswertung der Videobänder erst einmal ausgelastet sind. Und ja, Sie müssen nicht gleich heute los, morgen reicht auch noch. Ich verstehe, dass Sie sich darauf vorbereiten wollen.« Nach einer Weile schnaufte sie und sagte dann deutlich lauter: »Nein, Simmons, ich wusste nicht, dass es keine direkte Zugverbindung zwischen Oxford und Cambridge gibt, und ich weiß auch nicht, ob Sie schneller dort sind, wenn Sie den Bus nehmen.«
Frederick konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Aus eigener Erfahrung wusste er, wie schwer es war, den redseligen jungen Mann auf höfliche Art und Weise zu stoppen.