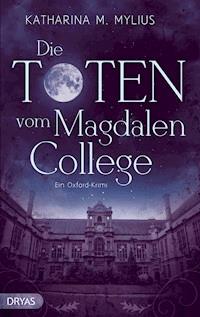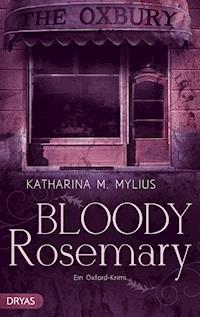
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Britcrime: Ein Oxford-Krimi mit Green und Collins
- Sprache: Deutsch
Die Sterneköchin Rosemary Hogan ist tot. Blutüberströmt wird sie in der Küche ihres Gourmetrestaurants in der Oxforder High Street aufgefunden, erstochen mit einem großen Grillspieß. Aber wieso hält sie einen Rosmarinzweig in der Hand? Schnell stellt sich heraus, dass die zänkische Metzgerstochter viele Feinde hatte. Ein delikater Fall für die Inspectors Heidi Green und Frederick Collins, denn bald wird ein weiterer Koch ermordet, was den Täter in der gehobenen Gastro-Szene Oxfords vermuten lässt. Auch die Mitglieder der elitären Dining Society des Queen's College rücken ins Visier der Ermittler. Ein Oxford-Krimi, der in die exklusive Welt der Gourmetküche führt, in der ganz eigene Regeln herrschen. Für neugierige Hobby-Köche gibt es im Anhang einige von der Autorin ausgewählte und ausprobierte traditionelle Rezepte aus Oxfordshire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
BLOODY ROSEMARY
Ein Oxford-Krimi
von Katharina M. Mylius
Inhaltsverzeichnis
27. August
28. August
29. August
30. August
31. August
1. September
Rezepte
Danksagung
Impressum
Lesetipps
Für Aidan, Le grá go deo
Mittwoch, 27. August
Heidi Green zog das weiße Handtuch unter ihren Füßen zurecht. Sie hatte ihre zweijährigen Zwillinge vor einer halben Stunde in der Nursery abgegeben und saß nun in der Rosensauna. Sie liebte den Duft von Rosen, es waren ihre Lieblingsblumen. Am allerliebsten mochte sie die Eden Rose. Mit ihrem Duft verband sie die Sommer in Deutschland, die sie als Kind in dem kleinen Winzerdorf am Haardtrand bei ihren Großeltern verbracht hatte. Wenn dort die Sonne morgens über den Weinbergen aufgegangen war, sie an einem Holztisch im Garten gemeinsam gefrühstückt hatten und der zitronige Duft der rosafarbenen Blütenpracht mit einer warmen Prise zu ihnen herübergeweht war, dann war es Sommer gewesen.
Genießerisch sog sie den Duft des Rosenaufgusses in sich ein und lehnte sich entspannt zurück. Es fühlte sich an wie ein kleiner Urlaub vom Alltag. Hier gab es keine vollen Windeln, kein Geschrei und keine Wäscheberge. Wochenlang hatte sie auf diesen Wellnesstag im Spa des Hotel Randolph hingefiebert. Auch, weil sie endlich einmal wieder etwas Zeit mit ihrer besten Freundin Louise verbringen wollte.
Louise hockte in einem feuerroten Bikini neben ihr und stöhnte gequält. „Hätte ich vorher gewusst, was das hier für eine Tortur ist, hätte ich dich niemals begleitet! Ich zerfließe gleich vor Hitze!“, beschwerte sie sich.
„Saunieren ist gut für die Bronchien“, entgegnete Heidi mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Sie war es von ihrer besten Freundin gewohnt, dass diese die Dinge gerne dramatisierte. „Das sagt Oma Frieda immer.“
„Deine deutsche Großmutter?“, fragte Louise.
„Ja, und weißt du was: In Deutschland trägt man in der Sauna keine Schwimmsachen.“
„Wirklich? Überhaupt nichts?“ Die ansonsten so abgeklärte Louise starrte sie ungläubig an.
„Das soll wohl besser für die Haut sein. Aber du hättest das bei deiner Haut eh nicht nötig.“ Anerkennend musterte Heidi den straffen Körper ihrer Freundin. Seit der Geburt von Ann und Max war ihr eigener Körper nicht mehr derselbe wie vorher. Doch niemals würde sie ihre beiden Lieblinge deshalb missen wollen.
„Dafür hast du deine Zwillinge“, erwiderte Louise, als ob sie ihre Gedanken lesen konnte, und strich sich eine Haarsträhne aus dem verschwitzten Gesicht, „und Rich.“
„Und du hast Ben.“
„Das ist vorbei.“
„Das tut mir leid.“ Heidi lächelte Louise aufmunternd zu.
Doch bevor sie etwas Tröstendes sagen konnte, erklärte Louise: „Aber heute Abend treffe ich mich mit Connor.“
„Connor?“ Heidi fiel es schwer, bei den wechselnden Verehrern ihrer Freundin auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
„Ja, das ist der Lehrer, der in der Sprachschule in der Nähe der Queen’s Street arbeitet. Aber zurück zu Ben – der hat mich doch tatsächlich für eine Jüngere verlassen!“
Heidi konnte sich nicht zurückhalten und platzte lachend heraus: „Wir sind doch erst Mitte dreißig, so jung kann sie ja gar nicht sein!“
Louise wollte protestieren, als es auf einmal an die Scheibe der gläsernen Tür klopfte.
„Ladys, entschuldigen Sie, dass ich Sie stören muss, aber hier draußen klingelt ununterbrochen ein Handy“, mokierte sich ein junger Angestellter des Hotel Randolph. Er hatte einen hochroten Kopf und Heidi war sich nicht sicher, ob es dem armen Kerl schlicht unangenehm war, sie beim Saunieren stören zu müssen, oder ob er in der hochgeschlossenen Uniform einfach unheimlich schwitzte. „Die übrigen Besucher unserer Einrichtung könnten sich dadurch gestört fühlen.“ Er machte eine Kopfbewegung hin zu einer älteren Dame mit strenger Hochsteckfrisur.
„Das wird mein Handy sein“, meinte Heidi zu Louise und wickelte sich ihr Saunahandtuch um. „Ich wette mit dir, das ist Sergeant Simmons, der seinen Radiergummi nicht finden kann.“
„Gehört das Handy Ihnen, Ma’am?“, fragte der junge Mann in Uniform, als sie die Tür öffnete.
Heidi nickte. „Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen, es auf lautlos zu stellen.“ Flink steuerte sie auf ihre Tasche zu, aus der ein lautes Klingeln und Surren zu hören war, und wurde dabei von der Dame mit Hochsteckfrisur mit ungnädigen Blicken bedacht. Sie schaute auf das Handydisplay, seufzte laut und nahm dann das Gespräch an. „Simmons, was gibt’s? Ich hoffe, es ist was Wichtiges!“
„Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie stören muss, Inspector Green. Ich weiß ja nicht, was Sie gerade machen, ich hoffe, dass es kein unpassender Moment ist. Aber ich muss wirklich dringend mit Ihnen sprechen. Mir wäre es auch lieber, wenn ich Sie nicht hätte anrufen …“
„Simmons, bitte kommen Sie zum Punkt!“, unterbrach Heidi ihn ungeduldig.
„In einem Restaurant in der High Street wurde eine Leiche gefunden“, rief er aufgeregt.
Heidi versteifte sich. „In welchem?“
„Im Oxbury. Chief Inspector Meyers will, dass Sie und Collins das übernehmen. Das Problem ist nur, dass ich Collins nicht erreichen kann.“
„Heute ist unser freier Tag“, erklärte Heidi frustriert.
„Der Tod macht niemals Urlaub.“
„Ich werde Sie an Ihrem nächsten freien Tag daran erinnern, Simmons!“
Frederick Collins gähnte laut und streckte sich. Obwohl er freihatte, hatte er sich vorgenommen, früh aufzustehen. Leider war daraus nichts geworden. Seit Monaten lag er nun schon jede Nacht wach, starrte an die Decke und quälte sich. Zwar gelang es ihm tagsüber, die Gedanken an seine Exfreundin zu verdrängen, nachts waren sie dafür umso präsenter. Zu nichts hatte er mehr Lust. Noch nicht einmal zum Kochen, dabei war das eine seiner großen Leidenschaften gewesen. Aber ab heute sollte alles anders werden.
Gestern nach Dienstschluss war er durch die historischen Markthallen des Covered Market geschlendert, hatte sich mit den Marktleuten unterhalten, frisches Gemüse und Fleisch gekauft und wollte nun endlich einmal wieder den Kochlöffel schwingen. Eine Marktfrau hatte ihm das Rezept für ein typisches Oxford Beef Stew verraten und er konnte es kaum abwarten, sich an dem Rinderragout zu versuchen. Ein Lächeln flog über sein Gesicht, als er daran dachte, dass er sich passend dazu im Off-Licence-Shop in St Clemens einen vollmundigen Saint-Émilion Grand Cru ausgesucht hatte.
Doch erst einmal wollte er joggen gehen. Er rollte sich aus dem Bett und schob den Vorhang zur Seite. Das einfach verglaste Fenster erinnerte ihn daran, dass das Haus über hundert Jahre alt war. Skeptisch blickte er hinaus. Der Himmel war grau und wolkenverhangen wie so oft in diesem August, doch es regnete nicht. Daher griff er in die antike Holzkommode, zog seine Sportsachen heraus und streifte sie über. Irgendwas stimmte mit den Klamotten nicht. Vielleicht hatte die alte Miss Goosebeck sie zu heiß gewaschen? Seine überfürsorgliche Vermieterin konnte es einfach nicht lassen, auch die Wäsche für ihn zu machen.
Frederick betrachtete sich im Spiegel, der neben dem King-Size-Bett an der Wand hing. Das T-Shirt spannte rundum und über dem Bund seiner Sporthose drückte sich eine Rolle hervor, dort, wo einmal alles flach und muskulös gewesen war. Er musste sich eingestehen, dass nicht die Kleider geschrumpft waren, sondern er sich hatte gehen lassen. Wie ein Schuljunge zählte er die Monate an seiner Hand ab: Vor vier Monaten war er nach Oxford gekommen. Die Pints und Pies, die er sich fast jeden Abend in seinem neuen Lieblingspub King’s Arms gegönnt hatte, hatten sich unübersehbar an seinem Körper festgesetzt.
In Liverpool hatte er regelmäßig Fußball gespielt und war zwei Mal in der Woche mit seinem Kollegen Matt joggen gegangen. Unten an den Docks waren sie gelaufen, vorbei am hohen Royal Liver Building. Er konnte die Rufe der Seevögel noch immer hören. Matt – wie es ihm wohl erging?
Frederick blickte auf die eiserne Wanduhr, es war kurz nach 10 Uhr. Matt saß wahrscheinlich in seinem Büro in den Merseyside Police Headquarters und beobachtete durch das Fenster, wie rote Doppeldeckerbusse Touristen vor den Museen des Albert Dock ausspuckten. Anfangs hatte Frederick öfter mal mit ihm telefoniert, doch als Matt ihm nur noch von seiner neuen Flamme vorgeschwärmt hatte, waren ihm die Gespräche immer schwerergefallen. Denn nach den Telefonaten hatten seine Gedanken nur um eines gekreist: Susan, seine absolute Traumfrau. Obwohl sie viel kleiner war als er, hatte er sich damals auf den ersten Blick in die zierliche Brünette verliebt. Es war ein Freitagabend gewesen, sie hatten beide an der Bar des Cavern angestanden und im Hintergrund hatte eine Beatles-Cover-Band „All you need is love“ gespielt.
Kitschiger als in jeder Liebesschnulze, dachte er verbittert, aber dort gibt es wenigstens ein Happy End. Nie würde er den Augenblick vergessen, in dem Susan ihn zum ersten Mal angelächelt hatte. Normalerweise sprachen die Frauen ihn an, das war schon immer so gewesen. Doch an diesem Abend hatte ihn keine andere Frau interessiert. Er war fasziniert von Susan gewesen, die ihn zunächst einfach ignoriert hatte. In ihrem trägerlosen weißen Top und mit den dunklen glänzenden Haaren hatte sie ihn im trüben Licht des heruntergekommenen roten Backsteingewölbes an eine südamerikanische Schönheit erinnert. Er hatte nicht lockergelassen, bis er endlich mit ihr ins Gespräch gekommen war.
Susans Augen waren nicht braun, wie er erwartet hatte. Sie hatten grün geleuchtet, wie zwei fein geschliffene Smaragde. Und sie hatte süßlich gerochen. Nach Vanille.
Verdammt, fluchte Frederick innerlich, während er seine neongrünen Turnschuhe schnürte, du musst etwas ändern. Sein Blick fiel auf den kleinen, verkrumpelten Zettel mit der Telefonnummer, der auf dem Nachttisch lag. Heute rufst du sie an. Dann griff er nach seinem iPod und den Schlüsseln, zog die Wohnungstür hinter sich zu, eilte die Treppe hinunter und lief los.
Schon nach kurzer Zeit wurde ihm der Atem knapp, doch das trieb ihn nur dazu an, weiterzulaufen. Schnaufend bog er in die Catte Street ein und stieß beinahe mit einem der Touristen zusammen, die die breite Straße entlang der Old Bodleian Library verstopften. Die alte Bibliothek war eine beliebte Touristenattraktion und auch Frederick war von den hohen spitzen Türmen und der reich verzierten Fassade angetan. Er versuchte der staunenden Menschenansammlung auszuweichen und lief auf die Radcliffe Camera zu, eine weitere historische Bibliothek. Sie war sogar die älteste Rundbibliothek Englands, wie er damals im Kunstunterricht in der Secondary School gelernt hatte. Sein Kunstlehrer Mr Stevens war ein Italienliebhaber gewesen und hatte es geschafft, ihn nicht nur für Kunstgeschichte und Architektur, sondern auch für Italien zu begeistern.
Neoklassizismus, Mitte achtzehntes Jahrhundert, mutmaßte er, als er an der Radcliffe Camera vorbeilief, denn die Kuppel der prachtvollen Rotunde saß auf einem Gemäuer mit herrschaftlichen Bögen und Säulen, die ihn an die römisch-griechische Architektur der Antike erinnerten. Überhaupt hatte Oxford das Flair einer italienischen Stadt wie Mailand oder Florenz, fand er.
Als er endlich die breite High Street erreichte, strömten ihm weitere Touristen entgegen. So macht das doch keinen Spaß, ärgerte er sich, als er fast zum Stehen kam. Er hatte Schwierigkeiten, sich an einer japanischen Reisegruppe vorbeizudrücken, und wollte gerade umkehren, als er auf einmal die Sirene eines Polizeiwagens hörte. Das grelle Gejaule mischte sich mit den schnellen Beats, die aus seinen Kopfhörern tönten. Der Wagen raste an ihm vorbei und kam vor einem hellgrün gestrichenen Gebäude zum Stehen. Über der gläsernen Eingangstür des alten Hauses stand auf einer weißen Stoffmarkise in dunkler Schrift „The Oxbury“.
Frederick kämpfe innerlich mit sich. Heute ist dein freier Tag, sagte er sich, dein erster freier Tag seit Wochen. Doch der Polizist in ihm siegte. Wenig später fand er sich mit zahlreichen Schaulustigen vor der Eingangstür des Oxbury wieder. Als er Heidi und Sergeant Simmons entdeckte, drückte er sich durch die dicht gedrängte Menge.
„Inspector Collins, da sind Sie ja! Ich versuche Sie schon die ganze Zeit auf Ihrem Handy zu erreichen“, rief Sergeant Simmons und musterte Fredericks verwaschene Klamotten. Dann fragte er unvermittelt: „Sind Sie etwa noch im Schlafanzug?“
„Wie bitte?“, erwiderte Frederick empört, während er die Stöpsel seiner Kopfhörer aus den Ohren zog.
„Ob das Ihr Schlafanzug ist“, rief Sergeant Simmons so laut, dass sich einige Köpfe nach ihm umdrehten.
„Natürlich nicht, Simmons!“ Frederick errötete. „Ich war joggen. Aber was ist hier eigentlich los?“, lenkte er ab.
„Morgen, Collins!“ Heidi nickte ihm freundlich zu, dann wurde ihre Miene ernst. „Der Küchenjunge hat vor einer Stunde die Leiche der Chefköchin gefunden, Rosemary Hogan. Ihr gehörte das Restaurant auch. Es ist übrigens eines der besten der Stadt, berühmt für seine exklusive Lokalküche, hat sogar zwei Sterne. Aber zum Fall: Selbstmord können wir ausschließen und es war wohl auch kein Raubmord, denn das Geld in der Kasse wurde nicht angerührt, meint Sergeant Simmons.“
Ein Mord in einen Sternerestaurant ohne Bereicherungsmotiv, dachte Frederick, das gibt es auch nur in einer wohlhabenden Stadt wie Oxford. In Liverpool hätte der Mörder mindestens die Abendkasse mitgenommen, da war er sich sicher.
„Jedenfalls gut, dass Sie hier sind, Collins. Meyers hat uns beiden nämlich diesen Fall zugeteilt“, schob Heidi hinterher und fügte überrascht hinzu: „Sie hören Jazz beim Joggen?“
Frederick nickte. „Django Reinhardt. Das sind die besten Beats, wenn man richtig schnell laufen will.“ Er schaltete seinen iPod aus.
„Ich wusste gar nicht, dass Sie laufen gehen.“
„Und Sie, waren Sie schwimmen?“, fragte Frederick, als er Heidis nasse Haare bemerkte.
„So ähnlich.“
Die Inneneinrichtung des Oxbury machte seinem Ruf alle Ehre. Die freigelegten steinernen Stützbalken des alten Hauses bildeten einen schönen Kontrast zu den schlicht weiß gestrichenen Wänden. Der großzügige Raum wirkte dadurch zugleich traditionell und exklusiv. Große runde Tische waren mit feinen, cremefarbenen Leinentischdecken eingedeckt, darauf waren quadratische Teller, edle Weingläser und Kristallkerzenständer kunstvoll dekoriert worden. In einer Ecke stand ein Flügel und an den Wänden hingen übergroße gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen einige bedeutende Sehenswürdigkeiten Oxfords zu sehen waren: das Christ Church College, der Carfax Tower, das Ashmolean Museum, das Oxford Castle, die Radcliffe Camera und der Covered Market.
Heidi stellte sich vor, wie romantisch es wohl wäre, hier mit ihrem Mann Richard abends bei Kerzenschein und Pianomusik zu dinieren. Früher hatte Rich sie öfter in teure Restaurants ausgeführt. Doch seitdem die Zwillinge auf der Welt waren, reichte ihre Zeit nur noch für den Heimlieferservice.
„Hier sind wir“, verkündete Sergeant Simmons, nachdem er sie durch eine Schwingtür hindurch in eine Großküche geführt hatte, und blieb abrupt stehen.
In der Küche war es kühl und Heidi fröstelte. Sie blickte sich um. Ringsherum strahlte ihr kalter Stahl entgegen, selbst von der Decke hingen stählerne Dampfabzugshauben tief in den Raum hinein.
„Dort vorne liegt sie“, hörte sie Sergeant Simmons’ helle Stimme sagen.
Sofort verging Heidi die Lust auf ein romantisches Dinner. Vor einem Ofen lag ein beleibter Körper in einer Blutlache. Die weiße Kochbekleidung der Frau hatte sich fast vollständig mit Blut vollgesogen. Es roch streng nach Reinigungsmitteln.
Was für ein grausamer Tod, gruselte es Heidi, in einer sterilen, kalten Küche einsam verbluten zu müssen.
Neben der Leiche kniete Stephanie Bradshaw von der Spurensicherung.
„Guten Morgen!“, begrüßten Heidi und Frederick sie.
„Guten Morgen, ihr beiden! Na, ihr seid mir ja mal ein Anblick!“ Sie grinste. „Das war’s dann wohl mit eurem freien Tag, was?“
Das ist wahr, antwortete Heidi in Gedanken, denn sie scherte sich in diesem Moment kein bisschen um ihre Haare, die sich fürchterlich kringelten, wenn sie nicht trocken geföhnt wurden. Zum Föhnen war sie im Hotel Randolph nicht mehr gekommen. Sie hatte sich in Windeseile geduscht, ihre Kleider übergezogen, war in ihren Mini gestiegen und hergerast. „Was hast du gefunden, Steph? Kannst du schon irgendwas sagen?“, fragte sie gespannt.
„So, wie es aussieht, wurde sie erstochen. Dort, in Höhe des Herzens, ist eine tiefe Einstichstelle“, antwortete Stephanie Bradshaw, während sie aufstand.
„Wo ist die Tatwaffe?“ Heidi blickte sich suchend um.
„Im Restaurant jedenfalls nicht“, erklärte Stephanie Bradshaw. „Als ich ankam, lag nur die Leiche da. Ich hab mir jeden Zentimeter vorgenommen, den Speiseraum, die Kühl- und Lagerräume und auch die Küche.“
„Irgendwelche Spuren?“, fragte Frederick.
„Wenn der Täter Spuren hinterlassen hat – und davon gehe ich einfach mal aus –, dann hat er sie fein säuberlich beseitigt. Hier in der Küche wurde alles blitzblank geputzt. Das erklärt auch den strengen Chlorgeruch. Deshalb vermute ich, dass ich Blutrückstände in dem Putzzeug dort drüben finden werde. Ich nehm die Sachen mit und geb euch später Bescheid.“
Heidi und Frederick traten näher an die Leiche heran, während Sergeant Simmons sich vorsichtig von ihr entfernte. Heidi wusste, dass der junge Sergeant von den Kollegen aufgezogen wurde, weil er kein Blut sehen konnte.
„Sagen Sie, Simmons, wo ist eigentlich der Küchenjunge?“, fragte sie daher.
„Draußen im Hof mit Sergeant Phillips.“
„Dann bereiten Sie ihn doch bitte darauf vor, dass wir ihn gleich befragen werden.“
„Wird sofort erledigt.“ Sergeant Simmons lächelte sie dankbar an und stolperte bei dem Versuch, so schnell wie möglich die Küche zu verlassen, über seine eigenen Füße.
Amüsiert schüttelte Heidi den Kopf und wandte sich wieder der Leiche zu. Zwischen Rosemary Hogans dicken, fleischigen Fingern der rechten Hand entdeckte sie ein Bündel Küchenkräuter.
„Was ist denn das für Grünzeug da?“ Heidi hatte wahrlich keinen grünen Daumen, ganz zu schweigen davon, dass sie irgendwelche Küchenkräuter voneinander unterscheiden konnte.
„Vielleicht Thymian?“, mutmaßte Stephanie Bradshaw.
„Rosmarin, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Rosmarinus officinalis ist“, erklärte Frederick und erntete dafür überraschte Blicke. „Was denn? Nach unserem letzten Fall habe ich mich ein wenig in die Pflanzenkunde eingelesen. Interessantes Gebiet.“
„Herkömmlicher Rosmarin also“, meinte Heidi und zwinkerte Stephanie Bradshaw zu. Dann betrachtete sie Rosemary Hogans rundes Gesicht genauer. Sie schätzte die Köchin auf Ende vierzig, soweit sich das in ihrem Zustand beurteilen ließ. Der Kopf mit den rotblonden Haaren war zur Seite geneigt und Heidi konnte eine Wunde erkennen, die sich vom Unterkiefer bis zum Hals zog. „Seht ihr die Verletzung da?“, fragte sie und deutete darauf.
„Sieht so aus, als ob der Mörder das Herz beim ersten Versuch verfehlt hätte“, vermutete Frederick.
„Und dann wurde die Dame doch noch erstochen, mit einem heftigen, tiefen Stoß mitten durch ihr vor Angst rasendes Herz“, ertönte melodramatisch eine dunkle Stimme.
Heidi drehte sich um. „Dr Goldberg!“, rief sie erfreut. Sie mochte den erfahrenen Pathologen, der bereits mit ihrem Vater über viele Jahre zusammengearbeitet und oft die entscheidenden Hinweise zur Auflösung kniffliger Kriminalfälle geliefert hatte.
Dr Goldberg fasste sich nachdenklich an seinen Bart. „Es muss ein recht langer, sehr spitzer Gegenstand gewesen sein.“ Er schaute sich forschend um. Besonders lange betrachtete er die Küchenutensilien, die an der Wand neben der Schwingtür hingen. „Nach meiner Erfahrung nimmt der Täter die Waffe entweder mit sich und versucht sie zu vernichten oder zu verstecken. Oder aber er lässt sie einfach am Tatort zurück, um diesen physischen Beweis seiner Tat von vornherein von sich abzuwenden“, erklärte er schließlich. „Und die ganz Gewieften reinigen die Waffe und legen sie an den Ort zurück, von dem sie ihr Mordwerkzeug genommen haben. Eine Großküche ist dafür ein wahres Paradies! Lasst mir alle Messer und was sonst noch so Spitzes hier herumhängt, in mein Labor bringen. Natürlich erst, sobald Miss Bradshaw mit ihrer Arbeit fertig ist.“
Heidi nickte.
„Ich bin schon durch, Dr Goldberg, leider ohne Ergebnis“, brummte Stephanie Bradshaw unzufrieden.
„Das habe ich mir gedacht.“ Dr Goldberg lächelte vielsagend. „Da war meiner Einschätzung nach ein ganz Penibler am Werk.“
„Dann mache ich mich jetzt an die Mülltonnen im Hof und bin dann weg. Schönen Tag noch allerseits.“ Stephanie Bradshaw verließ die Küche mit einer durchsichtigen Plastiktüte, in der allerlei Putzzeug steckte.
„Können Sie bereits einschätzen, wie lange Rosemary Hogan tot ist, Dr Goldberg?“, wollte Frederick wissen.
„Sie liegt schon die ganze Nacht hier, würde ich sagen, denn das Blut ist teilweise stark angetrocknet. Um den Todeszeitpunkt genauer zu bestimmen, müsste ich sie natürlich eingehend untersuchen.“
„Werden Sie sie gleich mitnehmen?“, hakte Heidi nach.
„Keine Geduld! Ganz der Vater!“ Dr Goldberg lachte. „Ich fange heute noch mit den Untersuchungen an, Heidi, und morgen früh könnt ihr bei mir vorbeikommen, da werde ich mehr wissen.“
Der dunkelhaarige Küchenjunge saß zusammengekauert vor der Hauswand, als Heidi und Frederick den Hinterhof des Oxbury betraten. Doch selbst in dieser Position konnte Frederick erkennen, dass der Junge zwar recht klein gewachsen war, dafür aber ein breites Kreuz und muskulöse Oberarme hatte. Neben ihm hockte eine ebenfalls dunkelhaarige Frau, die Frederick auf Anfang fünfzig schätzte. Auch sie war klein und hatte einen kräftigen Körperbau.
Die beiden sehen aus wie Mutter und Sohn, dachte Frederick.
Die Frau hatte einen Arm um den Jungen gelegt und versuchte, ihn zu beruhigen. Beide trugen weiße Kleidung mit einer schwarzen Schürze, der Junge hatte außerdem ein schwarzes Schiffchen auf dem Kopf, das etwas verrutscht war und ihn wie einen Matrosen aussehen ließ. Sergeant Phillips und Sergeant Simmons standen einige Meter entfernt und beobachteten die beiden. Als Simmons Heidi und Frederick kommen sah, zog er einen Notizblock hervor und kam zu ihnen herüber.
„Guten Morgen! Wir sind Inspector Green und Inspector Collins von der Thames Valley Police“, begrüßte Frederick die beiden Restaurantangestellten, ging in die Hocke und gab Heidi ein Zeichen, es ihm gleichzutun. Er wusste genau, wie sich der Junge fühlte. Als junger Sergeant hatte er in Toxteth, einem heruntergekommenen Teil Liverpools, seine erste Leiche in ihrem Blut gesehen. Damals hatte er sich sogar übergeben müssen und der Anblick der jungen Frau, die mit mehreren Messerstichen brutal getötet worden war, hatte sich unauslöschlich in sein Gehirn eingebrannt. „Es tut uns sehr leid, dass wir Sie stören müssen, aber wir würden Sie gerne zu dem Vorfall befragen. Dürfen wir mit Ihnen beginnen, Mr …?“
„Fisher“, schluchzte der Küchenjunge. „Samuel Fisher.“
„Mr Fisher, ist es richtig, dass Rosemary Hogan Ihre Chefin war?“, fragte Frederick vorsichtig.
Der junge Mann nickte.
„Wie lange arbeiten Sie schon im Oxbury?“
„Ich bin in meinem ersten Lehrjahr.“
„Arbeiten Sie gerne hier?“
Samuel Fisher schien überrascht. Er schaute auf und sah Frederick fragend an, sagte allerdings nichts. Sein Blick sprach jedoch Bände.
„Ich verstehe das jetzt mal als ein Nein“, folgerte Frederick.
„Es war nich einfach, für sie zu arbeiten“, mischte sich die Dunkelhaarige ein. „Nich nur für meinen Neffen.“
Sie sind also tatsächlich verwandt, wenn auch Tante und Neffe, dachte Frederick erfreut. Er hatte mit seiner Vermutung zumindest teilweise richtig gelegen. „Heißen Sie ebenfalls Fisher, Ma’am?“
„Nich mehr, Inspector, ich bin verheiratet und heiße jetzt Holloway, Vanessa Holloway.“
„Sie mochten Mrs Hogan also nicht, Mrs Holloway?“, bohrte Heidi nach.
Vanessa Holloway verzog ihre schmalen Lippen. „Sagen wer ma so: Mrs Hogan war ’ne sehr strenge Chefin. Sie war ’ne Perfektionistin und es war nich einfach, es ihr recht zu machen. Außerdem war sie sehr aufbrausend und konnte eklig werden, wenn sie mit was nich zufrieden war. Un sie war eigentlich nie zufrieden.“
„Seit wann haben Sie für Mrs Hogan gearbeitet, Mrs Holloway?“, fragte Frederick.
„Seit ungefähr zehn Jahren, seit der Eröffnung des Oxbury. Ich hab mich mit der Zeit immer weiter hochgeschafft. Inzwischen würd da nix mehr ohne mich laufen“, antwortete Vanessa Holloway stolz.
„Wie haben Sie es so lange im Oxbury ausgehalten, und weshalb haben Sie auch noch Ihren Neffen hierhergeholt, wenn Sie Rosemary Hogan doch nicht mochten?“, legte Heidi nach.
Vanessa Holloway zuckte mit den Achseln und antwortete dann: „Sie hat uns gut bezahlt. Es war ’n sicheres Einkommen, das Restaurant war sehr beliebt. Die Leute ham Monate im Voraus reserviert und ich hatt ja zum Glück nich so viel mit Mrs Hogan zu tun. Ihr Bereich war die Küche und ich hab im restlichen Restaurant für Ordnung gesorgt. So ließ sich das aushalten.“
„Aber Sie haben direkt mit ihr zusammengearbeitet, Mr Fisher?“, wollte Frederick wissen.
„Oh ja! Ich weiß schon gar nich mehr, wie viele unbezahlte Überstunden ich in den letzten Monaten gemacht hab, so viele waren das.“ Samuel Fishers Wangen röteten sich. „Un denken Sie nich, dass die Hogan mich dafür bezahlt oder sich auch nur einmal dafür bedankt hätte!“
„Sie waren also wütend auf sie?“, fragte Frederick.
Samuel Fisher schwieg zunächst. Dann sagte er: „Ich hab’s runtergeschluckt. Meine Tante hat immer zu mir gesagt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind und dass es irgendwann schon besser werd’n wird.“
Frederick blickte dem Jungen ins Gesicht. Der schien wirklich daran geglaubt zu haben.
„Wie lange waren Sie gestern Abend hier?“, fragte Frederick weiter.
Samuel Fisher seufzte laut. „Eigentlich schließ’n wir um 23.00 Uhr, aber ich musst noch bleiben. Alle anderen war’n schon längst weg, nur an mir bleibt immer die Drecksarbeit hängen. Ich musst Backbleche schrubben. Als ob ich das nich an ’nem anderen Tag als am Dienstagabend nach ’ner Vierzehnstundenschicht hätt erledigen können! Aber Mrs Hogan bestand drauf, dass ich so lange bleib, bis die Bleche sauber sin! Ich glaub, ich bin erst um Mitternacht hier rausgekommen.“
„Sie waren also allein hier mit Mrs Hogan?“ Frederick beobachtete den Jungen genau.
„Ja.“
„Und als Sie das Restaurant verlassen haben, hat Mrs Hogan noch gelebt?“, fragte Frederick und war sehr gespannt darauf, wie Samuel Fisher antworten würde.
„Als ich gegangen bin, hat sie gerade damit begonnen, das Iced Caramel Soufflé vorzubereiten. Da war sie noch sehr lebendig, das kann ich Ihnen versichern. Sie hat mich angeschrien, weil einige der Eierschalen kaputt war’n und sie die Eier nicht für das Dessert verwenden konnte. Als ob das meine Schuld gewesen wär!“ Wütend verzog er das Gesicht. „Ich hab mir ihre Standpauke angehört und bin danach abgehaun. Ich erinner mich, dass ich im Hof die Glocken des Magdalen Tower um Mitternacht hab schlagen hör’n.“
„Und sonst war niemand im Restaurant?“, fragte Heidi.
„Ich denke nicht.“
„Aber ich nehme an, das Restaurant war abgeschlossen“, schob sie hinterher.
„Der Vordereingang. Die Hintertür stand offen“, erinnerte sich Samuel Fisher.
„Wenn dort also jemand gewartet hätte, bis Sie gegangen waren, hätte er einfach durch die Hintertür in die Küche gelangen können“, kombinierte Heidi.
Samuel Fisher zeigte auf die blau gestrichene Holztür, durch die Heidi und Frederick von der Küche aus den Hof betreten hatten. „Ja, die steht eigentlich immer offen.“
„Und durch diese Tür sind Sie heute Morgen auch wieder in die Küche gelangt?“, fragte Frederick, während er die Tür betrachtete. Es waren keine Einbruchspuren zu sehen.
„Ja.“
„Stand sie da auch offen?“
Samuel Fisher nickte. „Mrs Hogan is immer schon vor mir da gewesen. Ich fang um 9 Uhr an.“
„Moment!“, warf Frederick ein. „Wenn Sie bereits um 9 Uhr hier waren, weshalb haben Sie uns erst eine halbe Stunde später benachrichtigt? Sie sagten doch, die Leiche wurde gegen 9.30 Uhr gefunden“, wandte er sich an Heidi.
„Um 9.28 Uhr ging der Anruf in der Zentrale ein“, mischte sich Sergeant Simmons ein.
Frederick überging den Einwurf und fragte: „Was um alles in der Welt haben Sie in der halben Stunde gemacht?“
Samuel Fisher zögerte, bevor er antwortete – etwas zu lange, fand Frederick. Außerdem blickte er ängstlich seine Tante an, die ihm daraufhin auffordernd zunickte.
Also überwand sich der Junge: „Ich … ich konnt erst ma nich glauben, dass sie tot is. Mit so was rechnet man ja nich. Ich musst an die frische Luft und bin im Hof auf und ab gelaufen. Ich wusst nich, was ich machen soll. Alles hat sich gedreht. Dann hab ich meine Tante angerufen und ihr erzählt, was passiert ist.“
„Ist das richtig, Mrs Holloway?“
„Ja. Er war völlig verwirrt. Ich hab erst gedacht, er hätt gestern zu viel getrunken oder so was. Aber dann bin ich sofort hergekommen. Ich wohn nich weit weg, in der Longwall Street. Und ich sage Ihnen, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich sie da hab liegen sehen in all dem Blut. Ich hab Sam dann dazu gebracht, Sie anzurufen“, erklärte Vanessa Holloway aufgeregt.
Frederick konnte ihr ansehen, wie sich die Bilder in ihrem Kopf noch einmal abspielten. Dennoch drängte sich ihm der Gedanke auf, dass die beiden in der Zwischenzeit die Küche hätten reinigen und die Spuren beseitigen können.
„Sagen Sie, Mrs Holloway: Was haben Sie gestern Abend gemacht, nachdem Sie das Restaurant verlassen haben?“, wollte Heidi wissen.
„Ich bin gleich heim.“
„Kann das jemand bestätigen?“
„Mein Mann. Er hat schon auf mich gewartet.“
„Das werden wir überprüfen.“
Vanessa Holloway nickte.
„Das wäre dann erst einmal alles“, sagte Frederick und bemerkte, wie Samuel Fisher erleichtert aufatmete. „Eine letzte Frage noch.“
Sofort verhärteten sich die Gesichtszüge des Jungen wieder.
„Könnten Sie uns bitte noch sagen, wo Mrs Hogan gewohnt hat?“
„Sie wohnte mit ihrem Mann unten an der Themse, Folly Bridge Nummer 1“, erklärte Vanessa Holloway. „Das ist in der Nähe des Head of the River Pub – das Haus auf der kleinen Halbinsel gegenüber.“
„Wollen wir zu Fuß gehen oder mit meinem Mini fahren?“, fragte Heidi. Doch noch bevor Frederick antworten konnte, frotzelte sie: „Sie sind ja eigentlich bestens zum Laufen ausgestattet!“
„Erinnern Sie mich bloß nicht daran, bitte!“ Beschämt blickte er auf seine verwaschenen Sportsachen hinunter.
„Soll ich Sie heimfahren, damit Sie sich umziehen können?“
„Wenn Sie mir versprechen, nicht so zu rasen“, neckte Frederick sie.
„Sie wissen genau, dass ich mich immer an die Höchstgeschwindigkeit halte!“
„Eben.“
Sie verabschiedeten sich von Sergeant Simmons und Sergeant Phillips. Dann verließen sie den Hinterhof des Oxbury durch einen schmalen Gang, der in die King Edward Street führte. Dort liefen gerade einige Schüler in Richtung Oxford Tutorial College. Heidi und Frederick folgten ihnen, denn Heidis alter dunkelgrüner Mini stand nur wenige Meter vom Eingang des College entfernt.
„Durch den Gang hätte jeder ungehindert in den Hinterhof und dann in die Küche gelangen können“, stellte Frederick fest. „Zumindest jeder, der wusste, dass die Hintertür des Restaurants immer offen steht.“
„Sie denken also, Samuel Fisher sagt die Wahrheit und hat nichts mit der Sache zu tun?“, folgerte Heidi.
Frederick rieb sich nachdenklich seinen Dreitagebart. „Die Oberarme, um mit solcher Wucht zuzustechen, hätte er. Das gilt aber auch für seine Tante. Und dass die beiden uns nicht sofort gerufen haben, macht sie nicht gerade weniger verdächtig.“
Heidi musste schmunzeln, als Frederick sich auf den Beifahrersitz des Minis zwängte. Er war mindestens drei Köpfe größer als sie und ein Mini war ganz offensichtlich nicht für einen Mann seiner Statur gemacht. Noch immer schmunzelnd steckte sie den Schlüssel ins Schloss und wollte den Wagen starten, doch er sprang nicht an. Sie versuchte es erneut.
„Das gibt’s doch nicht!“, fluchte sie laut.
„Na, na!“, versuchte Frederick sie zu beschwichtigen. „Probieren Sie es einfach noch mal ganz langsam.“
Sie drehte den Schlüssel erneut herum, doch nichts passierte. „Ich glaube, der Motor hat den Geist aufgegeben.“
„Wissen Sie was, ich jogge schnell zu meiner Wohnung und ziehe mich um, und Sie gehen schon mal los. Wir treffen uns dann vorm Head of the River Pub“, schlug Frederick vor.
„Sie wissen, wo der Pub ist?“
„Der Touristenmagnet? Aber sicher!“
Heidi schaute Frederick hinterher, der ungeduldig versuchte, sich an den Passanten vorbeizudrücken, die den Gehsteig der High Street entlangtrotteten. Sie mochte den Trubel und ließ sich einfach mittreiben. Außerdem fand sie es spannend, die Menschen zu beobachten, die mit wachen, interessierten Blicken die Schönheit ihrer Stadt in sich aufsogen. In der High Street reihten sich einige derprächtigsten Colleges Oxfords aneinander. Ihre reich verzierten Fassaden mit den hohen Erkern und Fenstern ließen bereits von außen erahnen, welch prunkvolle Innenhöfe sich hinter den dicken, steinernen Mauern versteckten.
Früher hatte sich Heidi gemeinsam mit Louise oft ein Spiel daraus gemacht zu erraten, woher die vielen Fremden wohl stammen könnten. Sie hatten sich in eines der gemütlichen Cafés in der High Street an ein großes Fenster gesetzt, eine hausgemachte Lemonade und ein Stück Old English Cider Cake mit extra viel Sahne bestellt und sich Lebensgeschichten zu den Fremden ausgedacht.
Ein wenig wehmütig griff Heidi zu ihrem Handy und wählte die Nummer ihrer Freundin. „Louise, es tut mir so leid, dass ich vorhin so schnell wegmusste!“
„Hun, ist schon in Ordnung, das ist nun mal dein Job.“
„Bist du noch in der Sauna?“
„Machst du Witze?“
„Ich weiß, dass wir eigentlich zusammen lunchen wollten, aber ich werde es leider nicht schaffen. Es gab tatsächlich einen Mord im Oxbury und wir müssen ermitteln. Aber dafür gehst du ja heute Abend schick aus mit … wie war noch mal sein Name?“
„Connor.“
„Richtig.“
„Ach, das mit Connor fällt ins Wasser. Heute ist einfach nicht mein Tag.“
„Was ist passiert?“
„Er hat wohl etwas Besseres vor.“
„Das kann ich mir nicht vorstellen.“
„Jedenfalls hat er gesagt, dass ihm was Wichtiges dazwischengekommen ist.“
„Und was?“
„Weiß ich nicht, er meinte nur, dass es ihm leidtut und er sich wieder meldet. Wahrscheinlich eine andere Frau.“
„Vielleicht ist seine Mutter krank?“
„Ich weiß nicht, was schlimmer wäre.“
„Habt ihr denn kein neues Date ausgemacht?“
„Ich wollte nicht.“
„Was?“
„Er sagt mir so kurzfristig ab und dann soll ich so tun, als ob nichts passiert wäre?“
„Schreib ihm und triff dich an einem anderen Tag mit ihm!“