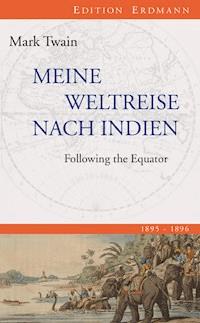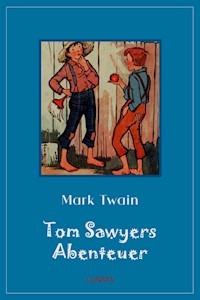
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Abenteuer von Tom Sawyer, eins der berühmtesten Kinderbücher der Weltliteratur. Waisenjunge Tom lebt bei seiner Tante Polly mit seinem Halbbruder Sid, Cousine Mary und dem schwarzen Sklaven Jim. Tom prügelt sich gern, schwänzt die Schule und hat nichts als Unsinn im Kopf. Sein bester Freund ist der heimatlose Herumtreiber Huckleberry Finn. Als die beiden Zeuge eines Mordes werden, fliehen sie auf eine abgelegen Insel auf dem Mississippi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Tom Sawyers Abenteuer
Mark Twain
Tom Sawyers Abenteuer
© 1888 by Mark Twain
Aus dem Englischen von Thomas Bürk
Illustrationen von W. Roegge
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Mark Twain
Erstes Kapitel
Ge-e-e Tom! – Tante Polly macht sich ihre Pflicht klar – Tom musiziert – Die Herausforderung
Tom!«
Keine Antwort.
»Tom!«
Keine Antwort.
Die alte Lady rückte ihre Brille etwas abwärts und schaute darüber weg im Zimmer herum; dann rückte sie sie wieder höher und sah darunter weg. Selten oder nie schaute sie durch die Gläser nach einem kleinen Ding wie ein Junge; es war ihre Staatsbrille, ihr Stolz, und nicht gemacht, um gebraucht zu werden, sondern des Stils wegen. Ein Pfannendeckel hätte ihr denselben Dienst getan.
Einen Augenblick schien sie durch dieses Stillschweigen überrascht, dann sagte sie, nicht zornig, doch laut genug, um von den Möbeln gehört zu werden: »Warte nur, wenn ich dich kriege –«
Sie sprach die Drohung nicht ganz aus, denn Sie hatte sich gebückt, um mit dem Besen unter das Bett zu stoßen und bedurfte ihres Atems, um jedem Stoß den gehörigen Nachdruck zu verleihen. Sie stöberte jedoch niemand auf als die Katze.
»Sah man jemals solch einen Jungen!«
Sie ging zur offnen Tür und suchte unter den Liebesapfelranken und dem Stechapfelkraut, die den Garten bildeten. Kein Tom. Sie erhob die Stimme und schrie: »Ohe–e–e Tom!«
Ein leises Geräusch erfolgte, sie wandte sich rasch um, eben zeitig genug, um einen kleinen Jungen bei der Jacke zu erwischen und seiner Flucht ein Ziel zu setzen.
»Ja so! ich hätte an jenes Kabinett denken sollen. Was hattest du dort zu tun?«
»Nichts!«
»Nichts? Sieh deine Hände an und befühle den Mund! Was hast du da?«
»Weiß nicht, Tante!«
»Aber ich weiß es. Eingemachtes ist es, sonst nichts. Wie viel hundertmal habe ich dir gesagt, wenn du das Eingemachte nicht stehen ließest, würde ich dir die Haut abziehen! Reich' mir jene Gerte her!«
Schon war die Gerte zum Schlag erhoben – die Gefahr war dringend. –
»Ha! Tante, sieh dich um!«
Die alte Dame drehte sich rasch um; im gleichen Augenblicke entwischte der Junge, kletterte über den hohen Gartenzaun und verschwand.
Einen Augenblick stand Tante Polly verblüfft, dann brach sie in ein leises Lachen aus: »Der Teufelsjunge! Kann ich denn nie klüger werden? Hat er mir nicht schon genug Streiche gespielt, um auf der Hut zu sein? Aber alte Narren sind die allergrößten. Man sagt nicht umsonst, ein alter Hund lerne keine neuen Kunststücke. Aber, du lieber Gott, seine Streiche sind alle Tage anders, und niemand kann wissen, was gerade kommt. Er scheint ganz genau zu wissen, wie weit er mich plagen darf, um mich in Harnisch zu bringen, und wenn es ihm dann gelingt, mich eine Minute zu unterbrechen, oder mich zum Lachen zu zwingen, so ist alles vergessen und ich könnte ihm auch nicht das mindeste tun. Gott weiß es und es ist die reinste Wahrheit, ich erfülle meine Pflicht nicht gegen diesen Jungen. Wer seiner Rute schonet, der hasset seinen Sohn, sagt die Bibel. Ich weiß, dass ich Sünde auf Sünde, und Strafe auf Strafe häufe, für ihn und mich. Er ist noch voll vom alten Satan, leider Gott! aber er ist auch meiner leiblichen verstorbenen Schwester Sohn, der arme Junge, und ich kann es nicht übers Herz bringen, ihn zu schlagen. So oft ich ihm etwas nachsehe, plagt mich das Gewissen, und wenn ich ihn strafen soll, möchte mein altes Herz schier brechen. Es ist eben so: Der Mensch vom Weibe geboren, lebt wenige Tage und ist voll von Sorge und Unruhe, wie die Schrift sagt. Er wird heute nachmittag die Schule schwänzen, und ich werde ihn zur Strafe dafür morgen tüchtig zur Arbeit anhalten müssen. Es ist zwar sehr hart, ihn an einem Sonnabend, wenn alle Jungen Ferien haben, zum Arbeiten zu zwingen; da er aber die Arbeit über alles hasst, und ich doch meine Pflicht einigermaßen gegen ihn erfüllen will, so muss es dabei bleiben, oder ich werde an seinem Verderben schuld sein.«
Tom indessen schwänzte die Schule und amüsierte sich vortrefflich. Er kam spät und eben noch früh genug nach Hause, um dem kleinen farbigen Jim vor Nachtessen noch das Holz für den nächsten Tag sägen und Späne machen zu helfen, wobei er ihm seine Großtaten erzählte, während letzterer drei Vierteile der Arbeit that.
Toms jüngerer Bruder (oder vielmehr Stiefbruder) Sid war mit der ihm zugeteilten Arbeit des Späneauflesens schon zu Ende, denn er war ein ruhiges Kind, und nicht ausgelassener abenteuerlicher Art.
Während Tom sein Nachtmahl verzehrte und gelegentlich Zucker stahl, nahm ihn Tante Polly ins Examen, und richtete, wie sie meinte, tief durchdachte und äußerst arglistige Fragen an ihn, um ihm gravierende Geständnisse zu entlocken. Wie so manch andere treuherzige, einfältige Seele, glaubte sie sich mit Talent für dunkle, mysteriöse Diplomatie begabt, und sie liebte es, auch ihre durchsichtigsten Absichten als ein Wunder tiefster List zu betrachten. Sie sagte: »Tom, es war so ziemlich warm in der Schule, nicht?«
»Ja Tante!«
»Mächtig warm, nicht wahr?«
»Ja Tante!«
»Hattest du keine Lust, schwimmen zu gehen?«
Etwas wie Furcht überlief Tom, ein Anflug von unbehaglichem Verdacht. Er forschte in Tante Pollys Auge, fand aber nichts. Somit sagte er: »Hm, nein, nicht sehr.«
Die alte Lady streckte die Hand aus und befühlte Toms Hemd.
»Jetzt ist es dir nicht mehr zu warm, wie ich sehe.« Und sie fühlte sich geschmeichelt, ausfindig gemacht zu haben, dass Toms Hemd trocken war, ohne dass jemand ihre Absicht gemerkt hätte. Aber Tom wusste nun, woher der Wind blies, und was zunächst kommen würde. Somit sagte er, um einer Frage zuvorzukommen: »Wir pumpten einander Wasser auf die Köpfe! Meine Haare sind noch ganz feucht. Willst du fühlen?«
Tante Polly war versteinert, dass ihr dieser Beweis entgangen und ihre List mißlungen war. Dann hatte sie einen neuen Einfall.
»Sag' einmal, Tom, musstest du dabei nicht den Hemdkragen abnehmen, den ich dir heute angenäht hatte? Knöpfe deine Jacke auf!«
Tom fühlte sich erleichtert. Er öffnete seine Jacke. Der Hemdkragen war fest angenäht.
»Ach was! Geh' weg! Ich war überzeugt, dass du die Schule geschwänzt und dich mit Schwimmen belustigt habest. Aber ich verzeihe dir, Tom. Verbrannte Katzen fürchten das Feuer. Für dieses Mal! Merke dir's!«
Sie war halb unzufrieden, dass ihr Scharfsinn sie getäuscht, und halb zufrieden, dass Tom sich einmal gehorsam gezeigt hatte.
Aber Sidney sagte: »Sonderbar, ich meinte, du habest den Kragen mit weißem Faden angenäht, und dieser hier ist schwarz.«
»Ja so! Ganz richtig. Der Faden war weiß! Tom?!«
Doch Tom wartete nicht auf den Rest. Er schlüpfte zur Türe hinaus, indem er sagte: »Warte Siddy, das sollst du mir bezahlen.«
Als er sich in Sicherheit fühlte, zog er zwei große Nadeln hervor, die er in den Aufschlägen seiner Jacke versteckt hatte, und von denen die eine mit weißem, die andere mit schwarzem Faden umwickelt war.
»Ohne Sid hätte sie es nicht gemerkt. Hol's der Teufel! Bald näht sie mit weißem, bald mit schwarzem Faden. Wenn sie nur bei einer Farbe bliebe! Wie kann ich wissen, ob Weiß oder Schwarz an der Reihe ist? Aber Sid soll dafür herhalten. Ich will ihn lehren!«
Tom war, wie man sieht, nicht der Musterknabe des Ortes. Es gab aber einen solchen und Tom kannte ihn sehr gut und hasste ihn.
Nach einigen Minuten hatte Tom jedoch seine Widerwärtigkeiten vergessen. Nicht dass sie ihm leichter oder weniger bitter vorgekommen wären, als man sie in vorgerückteren Jahren zu fühlen pflegt – nein, ein neues, mächtigeres Interesse besiegte sie für jetzt – gerade so wie Erwachsene erlittene Verluste im Eifer neuer Unternehmungen leicht verschmerzen. Es handelte sich um eine sehr bewunderte Novität im Pfeifen, in die ihn ein Neger eingeweiht, und die er jetzt ungestört zu probieren ein heiß Verlangen trug. Diese Neuerung bestand in einer eigentümlichen, vogelartigen Wendung, in einer Art von fließendem Wirbel, der durch kurzes, rasch aufeinanderfolgendes Andrücken der Zunge an den Gaumen – ohne die Melodie zu stören – hervorgebracht wird, und der meinen Lesern, wenn sie jemals Knaben gewesen sind, wohl bekannt sein dürfte. Fleiß und Eifer enthüllten ihm bald den Kunstgriff; – den Mund voll Harmonie und mit jubelndem Gemüt schritt er die Straße entlang. – Ein Astronom, der soeben einen neuen Planeten entdeckt hat, kann sich nicht erhabener fühlen, und wenn zwischen beiden starke, tiefe, ungetrübte Befriedigung in die Waagschale gelegt würde, dürfte sie sich leicht zu Gunsten des Knaben neigen.
Die Sommerabende waren lang. Noch dunkelte es nicht. Plötzlich hielt Tom mit Pfeifen inne. Ein Fremder stand vor ihm – ein Junge, kaum merklich größer als er selbst. Die Erscheinung eines Unbekannten, jeden Alters oder Geschlechts war ein Ereignis in dem armen kleinen Nest Petersburg. Der Junge war gut gekleidet, zu gut für einen Werktag. Es war zum Staunen. Zierlicher Hut, neue, blautuchene, modische Jacke und Beinkleider. Er trug Schuhe und es war doch nur Freitag. Sogar eine Halsbinde, ein hellfarbiges Band. Er sah so städtisch aus, dass es Tom in der Seele weh that. Er starrte das glänzende Wundertier an, und je mehr er die Nase über dessen Anzug rümpfte, desto schäbiger erschien ihm seine eigene Ausstattung. Keiner sprach. Wenn einer sich bewegte, bewegte sich der andere, aber immer von der Seite, im Kreise herum, Kopf gegen Kopf und Auge gegen Auge. Endlich sagte Tom: »Ich kann dich hauen!«
»Versuch's einmal!
»Freilich kann ich's!«
»Nein, du kannst nicht!«
»Doch ich kann!«
»Nein!«
»Ja! Ich kann!«
»Nein!«
»Ja!«
»Du kannst nicht!«
Unheimliche Pause. Dann Tom: »Wie heißt du?«
»Geht dich nichts an!«
»Ich will dir zeigen, ob!«
»So zeige!«
»Wenn du noch viel sagst, so will ich!«
»Viel, viel, viel, viel! Da!«
»O, du hältst dich für sehr Pfiffig! Wenn ich wollte, könnte ich dich prügeln mit einer einzigen Hand!«
»Warum tust du es denn nicht?«
»Wenn du mich narren willst, sollst du es sehen!«
»O, ich habe mehr gesehen, als das!«
»Du Zieraffe, du bildest dir wohl viel ein? Welch' abscheulicher Hut!«
»Gefällt er dir nicht? Schlag' ihn mir herunter! Wag' es nur – und wohl bekomm's!«
»Du lügst!«
»Du auch!«
»Du bist ein Lügner und ein Feigling!«
»Bumm! Geh' spazieren!«
»Höre auf oder ich werfe dir einen Stein an den Kopf!«
»Natürlich!«
»Jawohl!«
»So wirf! warum tust du es nicht? Gelt, du hast Furcht?«
»Nein!«
»Doch!«
»Nicht wahr!«
Eine weitere Pause. Näheres Fixieren. Näherrücken von der Seite. Endlich Schulter an Schulter. Tom sagt: »Geh' fort von hier!«
»Geh' du selbst!«
»Ich mag nicht!«
»Ich auch nicht!«
So standen sie, den einen Fuß im Winkel angestemmt, beide mit äußerster Gewalt gegeneinander drückend, das Auge voll glühenden Hasses, ohne dass der eine oder der andere einen Vorteil errang. Endlich, müde und abgemattet, ließen sie einander vorsichtig los und Tom sagte:
»Du bist ein Feigling, ein junger Hund. Ich werde es meinem großen Bruder sagen; der kann dich mit dem kleinen Finger abdreschen, und ich will ihm sagen, dass er es tut!«
»Etwas recht's, dein großer Bruder! Ich habe einen, der viel größer ist, und der den deinigen über jenen Gartenzaun werfen kann!«
(Beide Brüder existierten nur in der Einbildung.)
»Das ist wieder erlogen!«
Tom zog mit seiner großen Zehe eine Linie in den Sand.
»Ich verbiete dir, diesen Strich zu überschreiten, oder ich werde dich so zerhauen, dass du nicht mehr aufstehen kannst!«
Der neue Junge schritt sofort darüber hinweg.
»So! Haue jetzt!«
»Mach' mich nicht wild, und nimm dich in acht!«
»Schlag' zu!«
»Für zwei Cents würde ich es tun!«
Der neue Junge zog zwei Kupferstücke aus der Tasche und hielt sie Tom höhnisch unter die Nase.
Tom schlug sie ihm aus der Hand. Im Augenblick stolperten sie und wälzten sich im Kote, sich wie Katzen umklammernd, Haare und Kleider zerreißend, sich Gesicht und Nase zerquetschend und sich mit Staub und Ruhm bedeckend. Nach einigen Minuten tauchten aus dem Schlachtgewühl bestimmte Formen auf, und Tom erschien rittlings auf dem neuen Jungen sitzend und ihn mit beiden Fäusten bearbeitend.
»Hast du genug?«, sagte er.
Der Junge heulte vor Wut und suchte sich frei zu machen.
»Hast du genug?« und die Hiebe regneten fort.
Endlich ließ der Junge ein sehr kleinlautes »Genug« hören. Tom ließ ihn los und sagte: »So! das wird dich lehren, in Zukunft besser zu sehen, wen du zum Narren haben willst.«
Sich schnäuzend, weinend den Staub von den Kleidern abklopfend und sich unter Drohungen, was er Tom beim nächsten Zusammentreffen antun wolle, hie und da umwendend und die Faust schüttelnd, entfernte sich der neue Junge. Tom schnitt ihm dafür Gesichter und ging wohlgemut von dannen. Kaum hatte er aber den Rücken gedreht, so raffte der neue Junge einen Stein auf, traf Tom damit zwischen die Schultern und rann wie eine Antilope davon. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung, die er bei dieser Gelegenheit kennen lernte. Vor dem Tore Posto fassend, forderte er ihn auf, herauszukommen, wenn er das Herz habe. Dieser jedoch begnügte sich, hinter dem Fenster die Zunge gegen ihn herauszustrecken und dann zu verschwinden. Endlich erschien die Mutter seines Feindes, nannte Tom einen schlimmen, bösartigen, gemeinen Buben und jagte ihn fort. – Er ging, obwohl er seinem Feinde lieber noch länger aufgelauert hätte.
Es war ziemlich spät, als er nach Hause kam und durchs Fenster ins Zimmer kroch. Zu seinem Schrecken traf er die Tante im Hinterhalt. Als diese den Zustand seiner Kleider sah, ward ihre Absicht, seine Samstagferien in Gefangenschaft bei Zwangsarbeit zu verwandeln, zum felsenfesten Entschluss.
Zweites Kapitel
Starke Versuchung – Strategische Bewegungen – Die Harmlosen eingeführt
Samstag-Morgen war gekommen und ein heller, frischer, fröhlicher Sommermorgen war's. Jubel erfüllte jegliches Herz und wenn die Herzen jung waren, so brach er sich durch die Lippen Bahn. Fröhlichkeit thronte auf jedem Gesicht, jeder Schritt war elastisch. Die Akazien standen in voller Blüte und erfüllten die Lüfte mit ihren Düften. Der das Dorf beherrschende Cardiff-Hill erglänzte in frischem Grün, und die Entfernung war eben groß genug, um ihn den Blicken als ein ersehntes, ergötzliches, einladendes Land voll träumerischer Ruhe erscheinen zu lassen. Auf einem Nebenpfade erschien Tom mit einem Kübel voll Tünche und einem langgestielten Pinsel. Er überschaute den Zaun; alle Fröhlichkeit verließ ihn, und tiefe Melancholie bemeisterte sich seiner. Ein Bretterzaun, fast 100 Fuß lang und 9 Fuß hoch. Das Leben erschien ihm schal, das Dasein eine Bürde. Seufzend tauchte er den Pinsel ein und fuhr damit über die höchste Planke; zwei-, dreimal wiederholte er diese Operation und verglich dann den kleinen getünchten Fleck mit der unermeßlichen Ausdehnung des der Tünche noch harrenden Zaunes. – Entmutigt ließ er sich auf einem Baumkasten nieder.
Jim schlüpfte durch die Gartentür mit einem Blecheimer und sang ein Negerliedchen. Das Wasserholen vom Dorfbrunnen hatte früher Tom nie behagen wollen, nun schien es ihm gar nicht so übel. Er erinnerte sich, dass am Brunnen immer Gesellschaft zu treffen war. Knaben und Mädchen von allen Farben, weiße, Mulatten und Negerkinder waren immer da, ihre Reihe abzuwarten, und verkürzten sich die Zeit mit Faulenzen, Spielen, Tauschhandel, Zanken, Prügeln und Narrenpossen. Zudem erinnerte er sich, dass, obschon der Brunnen nur 150 Yards entfernt, Jim nie vor einer Stunde zurückkam und auch dann noch von jemand abgeholt werden musste.
Tom sagte: »Höre einmal, Jim, wenn du ein wenig tünchen willst, werde ich Wasser für dich holen!«
Jim schüttelte den Kopf und sagte: »Kann nicht, Master Tom! Die alte Missis sagte zu mir, ich müsse Wasser holen und dürfe mich nicht aufhalten, Narrenpossen zu treiben; – sie wisse wohl, dass Tom mich zum Tünchen werde verleiten wollen, ich soll aber meinem eigenen Geschäfte nachgehen, und sie werde das Tünchereigeschäft nicht aus dem Auge verlieren.«
»O, kümmere dich doch nicht um ihr Geschwätz, Jim! Es ist ihre Gewohnheit so. Gib mir den Eimer. Ich bleibe keine Minute aus. Sie erfährt es nicht!«
»O, ich darf nicht, Master Tom! Die alte Missis würde mir den Kopf abreißen. Ganz gewiss!«
»Sie! Sie prügelt niemand. Sie schlägt einen ein wenig mit dem Fingerhut auf den Kopf und wer fragt darnach? Sie führt schlimme Reden, aber Reden tut nicht weh, und schon gar nicht, wenn sie nicht dazu weint. Jim, ich gebe dir einen Marmel! Einen weißen, Jim!«
Jim begann zu schwanken.
»Einen weißen, Jim! Einen auserlesenen! Sieh'!«
»O, der ist wunderschön. Aber ich fürchte mich so vor der alten Dame!«
»Ich zeige dir auch noch meine kranke Zehe!«
Jim war mitleidig. Diese Aussicht überwältigte ihn. Er setzte seinen Eimer auf die Erde, nahm den weißen Marmel, und beugte sich, während Tom den Verband seiner kranken Zehe ablöste, mit ungeteiltem Interesse darüber. Auf einmal flog er mit seinem Eimer die Straße hinunter, Tom tünchte wütend darauf los, und Tante Polly zog sich mit einem Pantoffel in der Hand, triumphierend zurück.
Toms Arbeitswut verrauchte bald. Er dachte an die für diesen Tag ersonnenen lustigen Streiche und seine Trübsal nahm zu. Bald hatte er die Ankunft der freien, unbeschäftigten Knaben und ihren Spott über seine Zwangsarbeit zu erwarten. – Der Gedanke daran brannte ihn wie Feuer. – Er zog seine irdischen Reichtümer hervor und überzählte sie – Fragmente von Spielsachen, Marmel und derartiges Zeug, – genug, um vielleicht irgend eine andere Arbeit dafür zu erkaufen, aber keine halbe Stunde ungehemmter Freiheit. Er steckte seine schmalen Besitztümer wieder ein, und gab den Gedanken, die Jungen zu bestechen, wieder auf.
Aus diesem dunkeln, hoffnungslosen Brüten fuhr er plötzlich empor. Ein Einfall war ihm gekommen, eine große glänzende Idee dämmerte in ihm auf. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und machte sich ruhig ans Werk. Ben Rogers, der Junge, dessen Spott er am meisten fürchtete, kam in Sicht. Ben kam hüpfend und springend, – Beweis genug für sein leichtes Herz und seine hochgespannten Erwartungen. Er verspeiste einen Apfel und stieß von Zeit zu Zeit einen langen, melodiösen Schrei aus, dem ein tiefes Ding-dong-dong, Ding-dong-dong nachfolgte; denn er agierte ein Dampfboot.
In der Nähe Toms angekommen, mäßigte er seinen Kurs, nahm die Mitte der Straße, hielt weit Steuerbord und drehte unter großem Aufwand von Mühe und Pomp bei, denn er agierte den »Großen Missouri« und betrachtete sich als 9 Fuß Wasser ziehend. Er vereinigte in seiner Person Schiff, Kapitän und Signalglocke, und hatte in diesen Eigenschaften von seinem Sturmdeck aus die Befehle zu erteilen und zu vollziehen.
»Stopp, Sire! Kling-ling-ling!«
Er war rechts am Rande der Straße angekommen, und bog nun langsam gegen den Seitenpfad, wo endlich der »Große Missouri« nach manchem Kommandoruf, manchem Tschau-tschau-tschau der Räder, manchem Kling-ling der Glocke und manchem Ssch-sch-sch der Dampfhahnen vor Anker ging.
Tom fuhr in seiner Arbeit fort, ohne sich um das Dampfboot zu kümmern.
Ben sah zu, und rief dann: »Holla! Gelt, das gefällt dir nicht?«
Keine Antwort. Tom überschaute seinen letzten Anstrich mit künstlerischem Auge; noch ein schwungvoller, graziöser Pinselstrich, und gleiche Bewunderung der Arbeit.
Ben trat hart an ihn heran. Toms Mund wässerte vor Begierde nach dem Apfel, er ließ sich aber in der Arbeit nicht stören.
Dann sagte Ben: »Nun, alter Kamerad, musst du arbeiten? Nicht?!«
Tom wandte sich rasch um und sagte: »Wie, bist du da, Ben? Ich hatte dich nicht bemerkt!«
»Ja, ich gehe schwimmen. Möchtest du nicht auch? Aber du musst arbeiten. Gelt, du musst?«
Tom sah ihn kurz an und erwiderte: »Was nennst du arbeiten?«
»Was? ist vielleicht Tünchen keine Arbeit?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht! Was ich weiß, ist, dass ich Vergnügen daran finde.«
»O, du willst mir vorspiegeln, dass es dir gefällt?«
Der Pinsel fuhr auf und ab.
»Gefallen? Warum sollte es nicht? Glückt es vielleicht jedem Jungen, einmal einen Zaun tünchen zu dürfen?«
Das brachte die Sache in ein neues Licht. Ben, an seinem Apfel nagend, schwieg. Tom fuhr mit seinem Pinsel zierlich hin und her, trat einige Schritte zurück, um den Effekt zu beurteilen, half hie und da nach, kritisierte den Effekt wieder, während Ben zusah, und je länger, je mehr Interesse an der Geschichte fand.
Plötzlich sagte er: »Höre, Tom, lass mich ein wenig tünchen!«
Tom dachte nach; er war auf dem Punkte, seine Einwilligung zu geben, änderte aber seinen Vorsatz: »Nein, nein, ich darf es nicht wagen, Ben! Siehst du, Tante Polly ist ganz besonders auf diese Seite, der Straße zu, erpicht; ja, wenn es die Rückseite wäre, könnte es mir nicht darauf ankommen und sie würde nichts merken. Traurig aber wahr, sie hängt an diesem Zaun mit Leib und Seele; der Anstrich muss mit größter Sorgfalt ausgeführt werden, und ich wette, dass unter tausend, vielleicht zweitausend Jungen kein einziger zu finden ist, der es kann!«
»So, meint sie? Komm, lass mich einmal probieren. Nur ein klein wenig – wenn ich du wäre, Tom, würde ich dich lassen.«
»Lieber Ben, ich möchte es gerne, aber Tante Polly – sieh! Jim wollte, Sid wollte, aber sie wollte nicht. Siehst du nun, in welcher Klemme ich bin? Wenn du den Zaun verderbtest, oder irgend etwas vorkäme –«
»Unsinn! Ich werde Achtung geben. Lass mich nur probieren. Du sollst den Butzen meines Apfels dafür haben.«
»Nun ja! Da! Aber nein, Ben, ich fürchte –«
»Ich gebe dir den ganzen Apfel!«
Tom überließ ihm den Pinsel mit widerstrebender Miene, aber frohen Herzens. Und während das weiland Dampfboot »Der große Missouri« in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der weiland Künstler im nahen Schatten, baumelte mit den Beinen – kaute seinen Apfel und sann auf neue harmlose Opfer. An Material fehlte es nicht. Knaben gingen immer vorbei, sie kamen um zu spotten und blieben um zu tünchen.
Bevor Ben müde war, hatte Tom schon mit Billy Fisher für einen gut konditionierten Papierdrachen abgeschlossen; nach diesem kam Johney Milbs für eine tote Ratte und eine Schnur, um sie damit zu schwingen etc., Stunde um Stunde. Und um 4 Uhr nachmittags wälzte sich der morgens früh so arme Tom im Reichtum. Außer den oben erwähnten Sachen besaß er nun zwölf Marmel, ein Stück einer Maultrommel, eine Scherbe blauen Flaschenglases, um durchzuschauen, das Rohr einer Spule, einen unbrauchbaren Schlüssel, ein Stück Kreide, einen gläsernen Karaffenpfropf, einen Zinnsoldaten, ein paar Kaulquappen, 6 Raketen, eine junge einäugige Katze, einen messingenen Türknopf, ein Hundehalsband, aber keinen Hund dazu – ein Messerheft, 4 Stück Pomeranzenschale und ein altes zerbrochenes Schiebefenster.
Er hatte eine hübsche, angenehme Zeit dabei gehabt – an Gesellschaft hatte es nicht gefehlt, und der Zaun war mit drei Lagen übertüncht. Wenn er das Tünchergeschäft fortgesetzt hätte, wäre bald jeder Dorfjunge insolvent geworden.
Tom fand, dass, eins ins andere gerechnet, das Leben doch nicht so schal sei. Unbewusst hatte er eine große Triebfeder des menschlichen Strebens entdeckt: die nämlich, dass mit den in den Weg sich stellenden Schwierigkeiten zur Erreichung eines Zweckes die Anstrengungen sich steigern. Wäre er ein großer, weiser Philosoph gewesen, wie z. B. der Schreiber dieses Buches, so wäre ihm nun klar geworden, dass Arbeit das ist, was man tun muss, und Spiel dasjenige, wozu man nicht gezwungen ist. Er hätte begriffen, dass die Herstellung von künstlichen Blumen oder das Treiben eines Scherenschleiferrades Arbeit – hingegen das Besteigen des Mont-blanc und das »Alle Neune«-werfen beim Kegelspiel Unterhaltungen sind. Es gibt reiche Leute in England, welche im heißen Sommer 20 bis 30 Meilen täglich vierspännig fahren, nur weil die Erlaubnis dazu viel Geld kostet; wenn sie es aber tun müßten und man sie noch dafür bezahlen wollte, so hätte der Spaß bald ein Ende.
Tom brütete eine Zeitlang über den Wechsel seiner finanziellen Verhältnisse und ging dann zum Rapport ins Hauptquartier, d. h. nach Hause.
Drittes Kapitel
Tom als General – Triumph und Belohnung – Unbehagliches Glück – Auftrag und Versäumnis
Tom fand seine Tante in einem hübschen Hinterzimmer am offenen Fenster sitzend. Das Zimmer vereinigte in sich die Eigenschaften eines Schlaf-, Frühstück-, Speise- und Lesezimmers. Die würzige Sommerabendluft, die träumerische Stille, der Blumenduft und das einschläfernde Summen der Bienen hatten ihre Wirkung auf die Tante nicht verfehlt. Sie schlummerte über ihrem Strickstrumpf; ihre einzige Gesellschaft, die Katze, war in ihrem Schoße eingeschlafen. Die Brille war sorgfältig über ihre grauen Haare zurückgeschoben. Sie war mit sich selbst schon einig, dass Tom die Arbeit längst im Stiche gelassen, und staunte über die Sicherheit, mit der er sich ihr mit den Worten überlieferte: »Darf ich jetzt nicht spielen gehen, Tante?«
»Was, jetzt schon? Wieweit bist du mit deiner Arbeit?«
»Fix und fertig, Tante!«
»Lüge nicht, Tom! Du weißt, ich kann es nicht leiden!«
»Ich lüge nicht, Tante! Alles ist fertig!«
Tante Polly traute ihm nur halb; sie erhob sich, um selbst nachzusehen, und wäre zufrieden gewesen, wenn sie auch nur den fünften Teil von Toms Behauptung wahr gefunden hätte. Maßlos aber war ihr Erstaunen, als sie den Zaun nicht nur 3-4mal sorgfältig angestrichen, sondern auch noch einen weißen Extrastrich als Zugabe am Fuße desselben fand.
»Darf ich meinen Augen trauen? Daraus werde klug, wer kann! Wahr und wahrhaftig, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.« Sie schwächte ihr Lob jedoch durch den Nachsatz ab: »Jammerschade ist es nur, dass du so selten willst! Nun geh' spielen, bleibe aber nicht wochenlang aus, oder es setzt Hiebe!«
Diese Leistung Toms hatte sie so sehr überwältigt, dass sie ihn in die Speisekammer führte, den schönsten Apfel aussuchte und ihn ihm mit dem Bemerken zusteckte, es sei doch etwas ganz anderes, so etwas Gutes ehrlich und redlich zu verdienen, als es auf anderem, strafbarem Wege zu erlangen. Und während sie ihre Ermahnung mit einem passenden Bibelspruch schloss, stahl Tom eine Pfeffernuss und kniff aus.
Sid stieg eben die Treppe vom zweiten Stock herunter. Erdschollen waren reichlich zur Hand, und bald war die Luft davon erfüllt. Wie Hagelsturm umsausten sie Sid. Bevor Tante Polly sich von ihrer Überraschung erholen und herbeieilen konnte, hatten 6 oder 7 Schollen getroffen und Tom war über den Zaun auf und davon. Da war zwar die Türe, aber wie gewöhnlich hatte es Tom zu eilig um sie zu benutzen. Er war zufrieden, seine Rechnung mit Sid, des weißen und schwarzen Fadens wegen, ausgeglichen zu haben, und ungehindert sah er sich bald in Sicherheit hinter seiner Tante Kuhstall. Von da eilte er auf den Dorfplatz, wo eben, einem früheren Abkommen entsprechend, zwei Kompanien Schuljungen zum Treffen aufmarschiert waren. Tom war General der einen Armee, und sein Busenfreund Joe Harper befehligte die andere. Diese beiden Armeebefehlshaber beteiligten sich nicht am Handgemenge, das war unter ihrer Würde, und nur gut für die jüngere Brut; sie saßen mitsammen auf einer Anhöhe und leiteten die Feldoperationen durch Adjutanten. Nach schwerer Schlacht errang Toms Armee einen glänzenden Sieg. Die Toten wurden gezählt, die Gefangenen ausgewechselt; die Bedingungen der nächstfolgenden Feindseligkeiten und der Tag für die nächste Schlacht wurden festgestellt, worauf die Armeen sich in Reih und Glied sammelten, heimwärts zogen und Tom allein ließen.
An der Wohnung Jeff Thatchers vorbeigehend, sah er ein neues Mädchen im Garten; ein liebliches blauäugiges Geschöpf mit gelben, in zwei lange Zöpfe geflochtenen Haaren, im lichten Sommerrock und gestickten Höschen. Der sieggekrönte Held unterlag ohne einen Schuss. Das Bild einer gewissen Amy Lawrence verschwand spurlos aus seinem Herzen. Er hatte geglaubt, sie bis zum Wahnsinn zu lieben, er hatte sie angebetet; und ach, seine Leidenschaft erwies sich nun als eine leichte, vorübergehende Neigung. Monate lang hatte er um sie geworben, vor kaum einer Woche hatte sie ihm ihre Zuneigung gestanden; sieben Tage lang hatte er sich für den glücklichsten Jungen des Dorfes gehalten, und in einer Minute war sie, gleich einem vorübergehenden Besuche aus seinem Herzen verschwunden.
Verstohlenen Auges bewunderte er diesen neuen Engel, bis er sich von ihr bemerkt sah. Ohne sich den Anschein zu geben, als sei er von ihrer Nähe unterrichtet, begann er, mit allerlei läppischen Knabenpossen vor ihr zu paradieren, um ihre Bewunderung zu erregen, bemerkte aber während einiger gefährlicher gymnastischer Kunststücke, dass sie langsam ihrer Wohnung zuging. Tom näherte sich niedergeschlagen dem Zaun in der Hoffnung, dass sie noch verweilen würde. Sie blieb einen Augenblick auf der Treppe und näherte sich dann der Türe. Ein schwerer Seufzer entwand sich Toms Brust, als sie ihre Füße auf die Schwelle setzte. Plötzlich aber verklärte sich sein Gesicht, denn sie hatte, ehe sie in der Türe verschwand, eine Pensee über den Zaun geworfen.
Im Nu war er etwa einen Fuß breit von der Stelle, wo die Blume lag, dann beschattete er seine Augen mit der Hand und blickte starr die Straße hinunter, als ob irgend etwas sehr Interessantes dort zu sehen wäre. Dann las er einen Strohhalm auf, und versuchte, ihn mit weit zurückgebogenem Kopfe auf der Nase zu balancieren; und während der hierzu erforderlichen Bewegung näherte er sich unmerklich dem Blümchen. Endlich hatte er es unter seiner nackten Fußsohle. Er faßte es mit eingekniffenen Zehen, humpelte um die Ecke und verbarg ungesehen seinen Schatz auf dem Herzen, oder Magen, gleichviel; Tom war nicht sehr gelehrt in der Anatomie.
Dann kam er zurück und paradierte, wie zuvor, in der Hoffnung, das Mädchen werde seine Aufmerksamkeit gewahr werden. Es wurde Nacht, aber sie zeigte sich nicht. Zögernd wandte er sich endlich der Heimat zu; doch er tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie ihn vielleicht, hinter einem Fenster versteckt, beobachtet habe. Sein armes Hirn war voll Visionen.
Beim Nachtessen war er so aufgeregt, dass die Tante sich fragen musste, was es nur mit dem Jungen wieder sei. Sie schalt ihn, Sid mit Schollen beworfen zu haben, ohne den mindesten Eindruck zu erzielen. Er versuchte unter der Nase seiner Tante Zucker zu stehlen und wurde dafür auf die Finger geklopft.
»Warum schlägst du Sid nicht, wenn er Zucker nimmt?«
»Weil er mich nicht immer quält, wie du. Du würdest die Hand immer in der Zuckerbüchse haben, wenn ich nicht darüber wachte!«
Sie ging in die Küche. Sid, seiner Straflosigkeit sicher, griff mit solch triumphierender Miene nach der Zuckerdose, dass Tom es fast nicht ertragen konnte. Aber die Büchse entschlüpfte seinen Fingern und zerbrach. Tom war entzückt, und so sehr entzückt, dass er keinen Laut von sich gab. Er wollte nichts sagen, und sich still verhalten, bis Tante kommen und nach dem Täter fragen würde. Dann wollte er sprechen, und in dem Genuss, Sid geprügelt zu sehen, schwelgen. So groß war sein Jubel, dass er kaum an sich halten konnte, als die alte Dame kam und beim Anblick der Trümmer Zornesblitze über die Brille schleuderte. »Jetzt, jetzt kommt's«, dachte er, und im nächsten Augenblicke lag er auf dem Boden! Die mächtige Faust war zu neuem Schlage über ihm, erhoben und »Höre auf, warum schlägst du mich? Sid hat es getan!«
Verwirrt hielt Tante Polly inne und Tom erwartete linderndes Bedauern. Wieder zu Atem gekommen, sagte sie jedoch: »Hm! Es ist kein Streich verloren. Wenn nicht jetzt, so hast du es ein andermal verdient!«
Sofort aber peinigte sie das Gewissen und sie hätte ihm so gerne einige liebevolle, beschwichtigende Worte gesagt. Aber sie bedachte, dass das einem Schuldbekenntnis gleichkommen würde, und das verbot die Disziplin. Somit schwieg sie und ging ihren Geschäften mit bekümmertem Herzen nach.
Tom schmollte in einem Winkel, und stellte sich das erlittene Unrecht je länger je größer vor. Er wusste, dass seine Tante ihn in der Seele liebte, und dieses Bewusstsein verursachte ihm düstere Freude. Er wollte kein Zeichen von sich geben und keines bemerken. Er wusste, dass von Zeit zu Zeit ein bedauernder Blick durch einen Strom von Tränen auf ihn fiel, aber er wollte es nicht bemerken. Er dachte sich todkrank, seine Tante über ihn gebeugt und um ein einziges kleines Wort der Verzeihung flehend, – aber er wollte sein Gesicht der Wand zukehren und sterben, ohne dieses Wort gesprochen zu haben. Wie würde ihr da zu Mute sein?
Dann stellte er sich vor, wie es wohl sein würde, wenn sie ihn vom Flusse heimbrächten, tot, mit nassen Locken und stillem Herzen! Wie sie sich auf ihn stürzen, Schauer von Tränen vergießen und ihre Lippen heiße Gebete zu Gott entsenden würden, damit er ihr ihren Jungen wiedergäbe, und wie sie nie, niemals mehr böse mit ihm sein würde! Aber er wollte daliegen, weiß und kalt, ohne Lebenszeichen, ein armer kleiner Dulder, dessen Kümmernisse nun aus wären! So sehr übermannten ihn diese träumerischen Gefühle, dass ihm der Atem stockte, die Augen überliefen und die Tränen stromweise über seine Nasenspitze träuften. Einen solch' überschwänglichen Genuss fand er in diesem Hätscheln seines Kummers, dass er nicht ertragen konnte, was nur eine Spur von Fröhlichkeit und Vergnügen verriet, so zwar, dass, als sein Bäschen Marie nach einer ewig langen achttägigen Abwesenheit auf dem Lande durch die eine Tür ins Zimmer tanzte und Gesang und Sonnenschein mitbrachte, er aufstand, und durch die andere Tür, in finstere Wolken und Trübsal gehüllt, davon ging.
Er vermied die gewohnten Knabenspielplätze und suchte öde, mit seiner Gemütsstimmung harmonierende, entlegene Orte. Ein im Flusse liegendes Floß von Baumstämmen war einladend; er setzte sich auf den äußersten Rand und betrachtete die furchtbare Größe des Wassers, mit dem Wunsche, ohne Todeskampf ertrinken zu können. Dann gedachte er seiner Blume. Er zog sie hervor, zerknitterte und zerdrückte sie, und erhöhte dadurch seine traurige Glückseligkeit nicht wenig. Ob sie ihn wohl bedauern würde, wenn sie Kenntnis von seinem Elend hätte? Ob sie wohl Tränen vergießen und wünschen würde, ihm die Arme um den Hals zu legen und ihn trösten zu können? Oder würde sie sich teilnahmslos von ihm wenden, wie die ganze übrige schnöde Welt? Diese Vorstellungen bereiteten ihm ein so großes schmerzliches Vergnügen, dass er sie immer und immer wieder unter den verschiedensten Beleuchtungen an sich vorbeiziehen ließ, bis die nackte Wirklichkeit zuletzt allein übrig blieb. Dann stand er auf und wanderte fort in die Finsternis.
Gegen 10 Uhr erreichte er die abgelegene Straße, in welcher seine unbekannte Angebetete wohnte. Alles still, kein Laut schlug, an sein Ohr; nur der Schimmer einer Lampe drang durch die Vorhänge eines Fensters im zweiten Stock. Beherbergten diese Räume ihre geheiligte Person? Er kletterte über den Zaun, stahl sich leise durch die Gartengewächse bis zum Fenster. Lange und in tiefer Bewegung betrachtete er es; dann streckte er sich darunter auf die Erde nieder, die Hände auf der Brust zusammengefaltet, seine arme, zerknickte Blume in denselben. So wollte er sterben, allein in der kalten Welt, ohne Obdach über seinem heimatlosen Haupte, ohne eine freundliche Hand, ihm den Todesschweiß abzutrocknen, ohne ein über ihn gebeugtes, liebendes Gesicht im Todeskampf. So würde sie ihn beim ersten Blick in den neuen, fröhlichen Morgen finden. O! würde sie auch nur eine einzige Träne über seine kalte, leblose Form weinen, würde sie seinem so früh zerstörten jungen Leben nur einen einzigen Seufzer weihen?
Plötzlich öffnete sich das Fenster. Die schrille Stimme eines Dienstmädchens entweihte die heilige Stille und eine wahre Sintflut plätscherte auf die Reliquien des armen Märtyrers hernieder.
Fluchend sprang der gequälte Held empor. Ein Stein sauste, bald folgte das Klirren einer zerschmetterten Scheibe, eine kleine, flüchtige Gestalt überstieg den Zaun und verlor sich in rasender Eile im Dunkel. Bald darauf stand Tom ausgekleidet im Schlafzimmer und untersuchte seinen durchnässten Anzug beim Scheine eines Talgstummels. Sid erwachte; die Lust zu einigen beißenden Bemerkungen verging ihm beim ersten Blick in Toms unheilverkündendes Auge. Ohne sich der Belästigung des Nachtgebetes zu unterziehen, schlief Tom ein und Sid nahm gebührende Notiz von dieser Unterlassungssünde.
Viertes Kapitel
Geistige Seiltänzerei – Besuch der Sonntagsschule – Der Superintendent – Paraden – Tom als Löwe
Über einer ruhigen Welt erhob sich die Sonne und begrüßte das friedliche Dorf mit ihren segensreichen Strahlen.
Das Frühstück war vorüber und Tante Polly hielt Familienandacht. Sie begann mit einem, aus einer Reihe von Bibelstellen bestehenden, durch eigene Ergüsse zusammengekitteten Gebet. Dann folgte eines der blutigen Kapitel des mosaischen Gesetzbuches, das sie, wie vom Sinai herunter, vorlas.
Tom aber gürtete seine Lenden, und bereitete sich, seine Schulaufgaben zu machen. Sid war damit schon vor mehreren Tagen fertig geworden. Tom raffte all' seine Energie zusammen, um fünf Bibelsprüche auswendig zu lernen, und hatte sie klugerweise aus der Bergpredigt gewählt, weil er keine kürzeren finden konnte. Nach Verlauf einer halben Stunde hatte er einen unbestimmten Begriff von seiner Aufgabe, aber nicht mehr, denn seine Gedanken durchwanderten das ganze Gebiet menschlichen Fühlens und seine Hände waren beschäftigt mit allerhand zerstreuenden Treibens. Mary ergriff das Buch, um ihn zu überhören und er suchte sich einen Weg durch den ihn umgebenden Nebel zu bahnen.
»Selig sind die A–A–«
»Armen –«
»Ja, die Armen a–a–«
»Am Geiste –«
»Am Geiste. Selig sind die Armen am Geiste, denn sie – denn sie –«
»Denn ihrer –«
»Denn ihrer. Selig sind die Armen am Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. – Selig sind die Trauernden, denn sie – denn sie –«
»So–«
Denn sie s–«
»Sol–«
»Denn sie sol– ach ich weiß nicht!«
»Sollen –«
»Ja, Sollen! Denn sie sollen – denn sie sollen – hm – sol– hm – sol– sollen trauern, denn sie – hm – Selig sind die da sollen – die da – hm – die da trauern sollen – denn sie sollen – sollen – was sollen sie, Mary? Warum sagst du mir es nicht? Wie kannst du so gemein sein?«
»O, Tom, du armer Dummkopf, ich will dich ja nicht plagen. Aber du musst von vorne anfangen. Verliere den Mut nicht, Tom; du wirst es schon fertig bringen und dann sollst du auch etwas recht Schönes von mir bekommen. So, nun fange wieder an!«
»Gut, Mary, aber was ist es, Mary? Sage mir, was es ist?«
»Du wirst es schon sehen. Du weißt, wenn ich sage, es ist schön, so ist es schön.«
»Ich glaube dir, Mary. Nun denn, so will ich wieder dran!«
Und er ging wieder dran – und unter dem doppelten Antriebe der Neugierde und des zu erwartenden Lohnes mit solchem Eifer, dass er einen glänzenden Erfolg errang. Mary gab ihm ein funkelneues Taschenmesser im Wert von zwölf und einem halben Cent; und das Entzücken darüber erschütterte sein ganzes Wesen bis in die Fundamente. Zwar war es unmöglich, irgend etwas mit dem Messer zu schneiden; dessen ungeachtet war es ein echtes Bowie-Messer, und darin eben lag ein unschätzbarer Wert; denn es ging ein Gerücht unter den Jungen des Westens, dass auch falsche, nachgemachte Bowie-Messer in den Handel kämen. Tom probierte es zuerst am Glasschranke und war eben im Begriff, den Sekretär zu attackieren, als er abberufen wurde, um sich zur Sonntagsschule anzukleiden.
Mary gab ihm ein Zinnbecken mit Wasser und ein Stück Seife. Er ging vor die Türe und setzte das Becken auf eine kleine Bank, tauchte die Seife ins Wasser und legte sie daneben. Dann stülpte er die Hemdsärmel zurück, goss das Wasser behutsam auf die Erde, ging in die Küche und begann sich mit dem hinter der Tür hängenden Handtuch das Gesicht abzureiben. Doch Mary nahm ihm das Tuch weg.