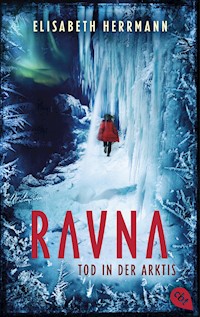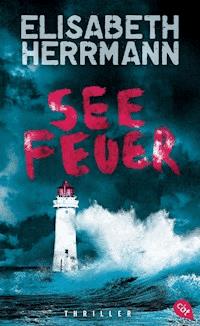9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
Ein Mord, eine geheimnisvolle junge Frau in Tel Aviv und Anwalt Joachim Vernau im Visier eines gnadenlosen Killers.
Berlin, 2015. Anwalt Vernau erwacht im Krankenhaus und kann sich an nichts mehr erinnern. Dafür ist er der Held von Berlin: In einer U-Bahnstation hat er mehrere Männer in die Flucht geschlagen, die einen älteren Herrn bedrängt haben. Aber wer ist die junge Frau mit dem Davidstern, die seitdem durch seine Erinnerung geistert? Und was hat sie mit den schrecklichen Morden zu tun, die sich wenig später ereignen? Als Vernau der schönen Unbekannten zu nahe kommt, wendet sich das Blatt: plötzlich steht er unter Mordverdacht. In letzter Sekunde kann er das Land verlassen, sein Ziel: Tel Aviv. In der brodelnden Metropole am Mittelmeer sucht er nach dem einzigen Menschen, der ihn entlasten kann – und wird hinabgezogen in den Strudel eines vergessenen Verbrechens, das sich vor über dreißig Jahren in einem Kibbuz in Israel ereignet hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Berlin, 2015. Anwalt Joachim Vernau erwacht im Krankenhaus und hat keine Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Er erinnert sich nur vage an eine geheimnisvolle junge Frau, Rachel, die er kurz zuvor getroffen hat. Ein Jugendfreund könnte Licht ins Dunkel bringen. Doch statt seiner Erinnerung findet Vernau einen Toten und gerät unter Mordverdacht. Er muss sofort das Land verlassen. In Haifa, Jerusalem und Tel Aviv sucht er nach dem einzigen Menschen, der seine Unschuld beweisen kann. Aber Rachel ist auch die Einzige, die ein Motiv haben könnte. Denn vor dreißig Jahren hat sich in einem Kibbuz im Norden Israels eine Tragödie abgespielt. Der mysteriöse Tod ihrer Mutter hängt mit vier jungen Deutschen zusammen, die damals dort gearbeitet haben. Und einer von ihnen war … Vernau. Ist der Mord in Berlin Rachels späte Rache? Die Spur führt zurück in den Kibbuz, und Vernaus Suche nach Rachel wird zu einer mörderischen Jagd nach der Wahrheit. Ist seine Zeugin eine eiskalte Killerin? Und für welche Fehler in der Vergangenheit soll Vernau büßen?
Weitere Informationen zu Elisabeth Herrmann
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
ELISABETH HERRMANN
Totengebet
Kriminalroman
Für Shirin
Haifa, 7. Oktober 1987
Um kurz vor halb sieben ging die Sonne unter.
Rebecca saß auf der Holzbank neben dem schmalen Bahnsteig, den Blick starr auf die Betonbrücke gerichtet, die in einem weiten Schwung die Gleise überspannte und direkt von der Straße in den Hafen führte. Sie wusste, dass sie spätestens in ein paar Minuten wieder den Platz wechseln musste, um nicht aufzufallen. Seit heute Mittag saß sie hier, und nun, da der Horizont in glühendes Rot getaucht war und der heiße Wind langsam abkühlte, hatte die Hoffnung Zeit genug gehabt, sich in tiefe Sorge zu verwandeln.
Ab und zu fuhr ein Auto über die Brücke. Am Hafeneingang wurde es angehalten, und der Fahrer konnte nach einem kurzen Plausch mit den Sicherheitskräften und dem Vorzeigen der Papiere und Tickets passieren. Manchmal tauchten auch Fußgänger auf. Meist Rucksacktouristen mit ihrem hoch aufgetürmten Gepäck, gekrönt von Schlafsack und Isomatte. Sie kamen einmal pro Stunde mit dem Zug und alle dreißig Minuten mit dem Bus.
Nur ihr Liebster, der kam nicht.
Die erste Fähre nach Limassol auf Zypern hatten sie schon verpasst. Und auch die zweite würde ohne sie abfahren. Was dann? Eine dritte gab es nicht. Sie würde mit ihrer Tasche, in der sie alles für die Flucht untergebracht hatte, bei ihrer Tante Rose anklopfen müssen. Es war nicht weit, nur ein paar hundert Meter, wenn man aus dem kleinen Bahnhof auf den staubigen Vorplatz hinaustrat und sich nach rechts wandte. Sie wohnte in der deutschen Kolonie, direkt an der Ben-Gurion-Straße. Aber Rebecca fürchtete sich davor. Nicht weil die alten Häuser am Hafen verfallen und die Gassen dunkel waren. Auch nicht vor dem, was Tante Rose sagen würde, wenn sie von dem weißen Kleid und dem Schleier erführe, beides in Papier eingeschlagen und ganz unten in ihrer Reisetasche vergraben. Sie fürchtete sich, weil ein Aufbruch bedeutet hätte, dass ihr Plan gescheitert war und sie das Kleid und den Schleier gleich auf dem Bahnhofsvorplatz verbrennen konnte.
Dabei hatten sie alles so gut vorbereitet. Schon vor Wochen, heimlich und in aller Stille. Seit klar war … Rebeccas Hand legte sich auf ihren Bauch. Noch war er flach, aber in wenigen Wochen würde jeder im Kibbuz sehen können, was passiert war.
»Ist alles in Ordnung?«
Erschrocken sah sie hoch. Der Mann, der den ganzen Tag schon hinter dem Fahrkartenschalter saß, hatte zwischen zwei Zügen sein Kabuff verlassen. Er wollte sich ein wenig die Beine vertreten und hatte zufällig mitbekommen, dass sie seit vier Stunden weder nach Tel Aviv noch nach Akko oder Naharija gefahren war. Sie saß einfach nur da wie bestellt und nicht abgeholt. Ausgesetzt. Sie trug ihre besten Sachen – eine dunkelblaue Baumwollbluse und den knielangen Rock, beides selbst genäht, frisch gewaschen und gebügelt. Die Haare gescheitelt und nach hinten gebunden. Am Handgelenk das Bat-Mizwa-Geschenk ihres Vaters, eine kleine Timex, um den Hals den goldenen Davidstern ihrer Großmutter. An ihrer Erscheinung lag es ganz sicher nicht, dass der Mann sie ansah wie eine Gestrandete. Vielleicht war es ihre Haltung: die Arme verschränkt, etwas vornübergebeugt, die Ecken suchend. Seht nicht zu mir her, nehmt mich nicht wahr, ich bin eine Unsichtbare, die gerade an der größten Herausforderung ihres Lebens scheitert. Ganz langsam tropfte die bleierne Gewissheit in ihre Verzweiflung, dass etwas passiert sein musste.
»Ich warte auf jemanden.«
Der Fahrkartenverkäufer holte ein Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche seines Hemdes und zündete sich eine an. Er war hager und nicht sehr groß. Die dunklen Augen in seinem Beamtengesicht lagen tief in den Höhlen, er sah nicht gesund aus. Prompt bekam er nach dem ersten Zug einen Hustenanfall. Zwei Soldaten, die sich ein paar Schritte weiter weg in den Schatten der Mauer gestellt hatten, ihre Maschinenpistolen an die Wand gelehnt, vermutlich auf dem Weg nach Norden an die Grenze zum Libanon, drehten sich zu ihnen um. Sie wechselten ein paar Worte, der eine lachte leise. Was sie wohl dachten beim Anblick des jungen Mädchens mit der Reisetasche zu Füßen?
»Wohin soll’s denn gehen?«, fragte der Verkäufer, nachdem er sich wieder beruhigt hatte.
»Tel Aviv«, log sie.
»Der letzte Zug fährt um acht.«
Sie wusste, wie spät es war. Noch eineinhalb Stunden. Die würde sie ihm geben. Danach musste sie zu Tante Rose aufbrechen und ihr ein Märchen erzählen. Die alte Dame war bestimmt schon außer sich vor Sorge, weil ihre minderjährige Nichte seit den Mittagsstunden wie vom Erdboden verschluckt war. Was sollte sie ihr bloß sagen? Dass sie in den falschen Bus gestiegen und eingeschlafen war? Das würde als Entschuldigung nicht ausreichen.
Ein Mann ging über die Brücke. Etwas an ihm kam Rebecca bekannt vor, aber er war nicht ihr Liebster. Ihr Puls begann zu rasen. Konnte man sie von dort oben sehen? Was, wenn jemand aus Jechida sie durch Zufall hier antreffen würde, bevor sie es auf die Fähre schafften?
Wo bist du?, dachte sie verzweifelt. Weißt du denn nicht, was ich ohne dich durchstehe? Unser schöner Plan, scheitert er etwa schon hier, an diesem Bahnhof, die Brücke zum Hafen in Blickweite? Bis jetzt war doch alles gut gegangen. Er hatte den Kibbuz schon gestern Abend verlassen. Heute Morgen war sie kurz an seiner Baracke gewesen und hatte mit klopfendem Herzen hineingespäht. Seine Sachen waren weg, das Bett abgezogen. Ihr Herz hatte jubiliert. Er macht es wahr! Wir verschwinden wie Romeo und Julia, aber wir werden überleben und eine Zukunft haben.
Die Euphorie hatte ihr den Abschied nicht schwer gemacht. Sie war im Kibbuz geboren und aufgewachsen. Eine Tochter der Pioniere, die die Pflöcke ihrer Claims ebenso fest in die Erde gerammt hatten wie ihre Überzeugungen. Deshalb wusste sie auch, wie ihre Zukunft aussehen würde, wenn sie jetzt nicht den entscheidenden Schritt tat.
Es war leichter gewesen, als sie befürchtet hatte. Ein letzter Blick auf die Baustelle, ein Gruß, ein harmloser Ruf in Richtung der anderen, die an der Betonmischmaschine standen, Sand und Zement in Säcken zum Pool karrten, ein Moment der Wehmut, dass sie die Fertigstellung nicht mehr erleben würde. Dann schnell zurück in ihr Zimmer. Das kleine Apartment bewohnte sie seit ihrem vierzehnten Lebensjahr, wie alle anderen Jugendlichen im Kibbuz, die mehr in den Kinderhäusern und Gemeinschaftsräumen aufgewachsen waren als unter einem Dach mit ihren Eltern. Ein letzter Blick auf ihr Zuhause und das Bett … Sie hatte das Kissen hochgenommen und geglaubt, noch seinen Duft darin zu riechen. Ihr brennendes Herz, die Atemlosigkeit angesichts dessen, was sie vorhatten … Dann hatte sie die Tür hinter sich zugezogen und sich auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht. Dass sie dabei ausgerechnet ihrer Mutter begegnen musste, damit hatte sie nicht gerechnet. Ein Besuch bei Tante Rose in Haifa, soso. Weiß sie Bescheid, dass du kommst? Hast du dich ausgetragen im Dienstplan? Wann kommst du zurück? Kein echtes Interesse lag in diesem Verhör. Fährst du allein? Wer holt dich ab? Rebecca hatte kein Problem damit, ihre Mutter anzulügen. Es gehörte dazu, dieses fein austarierte Wechselspiel von offizieller und inoffizieller Version ein und desselben Vorgangs, und es ödete sie an. Sie war auf dem Absprung, heraus aus dem Schutz, aber auch aus der Kontrolle der Kibbuzniks. In Jechida hatte es sich gut angefühlt. Hier, auf dem Bahnsteig, fühlte sie sich unter den Augen der fremden Leute und deren unausgesprochenen Spekulationen hilflos. Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben allein.
»Entschuldigen Sie bitte.«
Hastig stand sie auf, nahm die Tasche und betrat das schmale Gebäude. Linker Hand war ein Kiosk, der Zeitungen, Limonade und Kaffee verkaufte. Außer ihr befanden sich nur noch die müde Verkäuferin und zwei Männer im Warteraum, die sich leise unterhielten. Sie trugen den Habit orthodoxer Juden und wären gewiss die Letzten, denen ein verzweifelter Teenager auffallen würde. Der Fahrkartenverkäufer draußen auf dem Bahnsteig sah ihr nach. Ob er sich an sie erinnern würde? Bestimmt.
Wo bist du? Warum kommst du nicht?
Tränen schossen ihr in die Augen, aber sie hatte in den letzten Stunden mit einer fast übermenschlichen Anstrengung verhindert, die Fassung zu verlieren. Die Übelkeit zog ihr den Magen zusammen.
Sie rannte auf die schmale Tür zwischen Ticketschalter und Fahrplan zu und schaffte es in letzter Sekunde, sich über das Waschbecken zu beugen. Sie würgte, hustete, kotzte sich die Seele aus dem Leib. Endlich war der Anfall vorüber. Sie richtete sich auf und betrachtete ihr geschwollenes rotes Gesicht im Spiegel.
Rebecca Kirsch, siebzehn, einziges Kind der Eheleute Kirsch aus dem religiösen Kibbuz Jechida, hatte sich mit einem deutschen Saisonarbeiter eingelassen und bekam ein Kind von ihm.
Wasser, viel Wasser. Als sie sich wieder ansah, war ihr Gesicht tropfnass. Tante Rose würde sofort auffallen, dass etwas nicht stimmte. Wohin? Himmel, wohin nur? Sie schloss die Augen und lehnte sich an die Wand, rutschte hinunter, blieb einfach sitzen in diesem winzigen, stinkenden Raum.
Sie gab sich fünf Minuten stilles Weinen. Die Lautsprecherdurchsage kündigte die Ankunft des Zuges aus Akko an. Jemand rüttelte an der verschlossenen Tür und verlangte erst bittend, dann wütend, schließlich verzweifelt, dass geöffnet wurde. Rebecca riss einen halben Meter Toilettenpapier ab und tupfte sich damit die Tränen weg. Der Mann vor der Tür verschwand. Das kleine Fenster über dem Klo stand auf Kipp. Sie hörte das Ächzen der Lok und die Scharniere der Zugtüren. Hastige Schritte, ein paar Abschiedsrufe.
Es gab Ärzte in Tel Aviv. Irgendwo hatte sie davon gehört. Zu denen gingen verzweifelte Frauen, die in einer ähnlichen Lage waren wie sie. Seit Rebecca wusste, dass sie schwanger war, hatte die Welt sich selbst mit einem gewaltigen Ruck angehalten. Nichts ging mehr. Alles um sie herum war unwichtig geworden, wie eingefroren. Es gab nur noch sie und ihre Sünde. Die verfolgte sie wie ein Schatten, stahl sich in ihre Gedanken, wühlte in ihrer Seele, nahm ihr die Luft zum Atmen. Sie wachte morgens auf, und der erste Gedanke war: Vater schlägt mich tot. Sie ging in den großen Speisesaal, wo die anderen lachten und scherzten, und es war, als ob bei ihrem Anblick die Gespräche verstummten und die Blicke sie verfolgten bis hin in die letzte Ecke, in die sie sich verkroch. Sie saß im Unterricht, aber sie war mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie arbeitete an den Nachmittagen, aber sie machte Fehler, die ihr vorher nicht passiert waren, weil sie nicht bei der Sache war. Ihre Hände zitterten. Ihre Gedanken waren wie flatternde schwarze Krähen in ihrem Kopf. Ich bin schwanger. Ich bin eine Schande, mein Kind wird ein Bastard sein und seine Kinder auch. Bis ins zehnte Glied wird meine Schuld sie verfolgen …
Sie ging ihm aus dem Weg. Er wartete. Sie wich ihm aus. Er folgte ihr. Sie versuchte so zu tun, als wäre nichts. Er ließ sich nicht täuschen. Eines Abends erwischte er sie auf dem Nachhauseweg.
»Willst du Schluss machen mit mir?«
Die Qual in seinem Blick, die Furcht vor der Wahrheit, die Frage, ob sie sich nur etwas vorgemacht hatten oder ob tatsächlich jenes Wunder geschehen war, das man Liebe nannte – in seinen Armen war alles vergessen. Nie zuvor hatte sie so eine Zuversicht gespürt, dass mit diesem Mann an ihrer Seite alles, wirklich alles gut werden würde.
Und jetzt saß sie auf dem Bahnhofsklo in Haifa und heulte sich die Augen aus. Er war nicht gekommen. Sie erinnerte sich an ihren letzten Kuss und sein Versprechen. »Morgen feiern wir deinen Geburtstag und unsere Hochzeit.«
Zypern war die schnellste Lösung. Kein Rabbi würde eine schwangere Jüdin und einen Christen segnen. Sie brauchten eine standesamtliche Eheschließung außerhalb Israels.
»Danach fliegen wir nach Deutschland. Du wirst sehen, alles wird gut. Vertrau mir.«
Ich vertraue dir, aber es wird von Stunde zu Stunde schwerer …
Mühsam kam Rebecca wieder auf die Beine. Ihr wurde schwindelig. Ihr Kreislauf und dazu dieser Gestank nach Klostein und Pisse. Sie wühlte in ihrer kleinen Handtasche nach dem Kamm und hielt das Kuvert in den Händen. Vorsichtig zog sie es heraus und öffnete es. Zwei Ferry Tickets kamen zum Vorschein, zusammen mit einem handgeschriebenen Brief. Ein Gedicht. Er hatte ihr die Zeilen übersetzt, und mit ihnen war in ihrem Herzen ein Garten erblüht.
Du bist mein Mond, und ich bin deine Erde …
Wie fremd diese Worte klangen. Und wie vertraut sie ihr bald werden würden. Sie hatte Angst vor Deutschland und vor diesen Leuten, bei denen sie vorläufig unterkommen würden. Ihr Liebster hatte nicht viel über seinen Vater erzählt. Verbitterung und Verachtung prägten sein Bild, die Mutter stand als passive Figur eher am Rand. Nur für ein paar Tage, hatte er gesagt. Dann suchen wir uns eine Wohnung. Und wenn das Kind erst mal auf der Welt ist, werden auch deine Leute anders über mich denken.
Wie gerne würde ich dir glauben.
Sie faltete das Blatt sorgfältig zusammen und steckte es mit den Tickets zurück in den Umschlag. Seltsam. Das Gedicht gab ihr Kraft. Egal was kommen würde, er wäre an ihrer Seite.
Wieder legte sie die Hand auf ihren Bauch. Er war straffer, kaum merklich gewölbt. Sie versuchte, sich im Spiegel anzulächeln, und freute sich, als es ihr gelang. Nur die Wangen waren noch gerötet und die Augen auch. Ihr Gesicht war etwas runder geworden, die Bräune von der Arbeit auf den Feldern stand ihr. Der strenge Scheitel machte sie erwachsener. Sie hob die Hand und berührte ihr Spiegelbild. Ich bin schön, dachte sie erstaunt. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich schön. Glück und Zuversicht waren wieder da.
Entschlossen nahm Rebecca die Tasche, entriegelte die Tür und durchquerte den Wartesaal. Trübes Licht warf Schatten in die Ecken. Der Mann hinter dem Fahrkartenschalter zog gerade den Vorhang zu. Die müde Verkäuferin räumte den Tresen ab.
Sie trat vor die Tür und blieb vor der Treppe stehen, die hinunter zu dem Vorplatz und der Bushaltestelle führte. Von hier aus ging der Blick nach Osten, hinauf zu den Bergen des Karmel und dem weiten violetten Abendhimmel. Die ersten Sterne leuchteten am Firmament. Vom Hafen kam das eiserne Gebrüll der Kräne. Jedes Mal, wenn die Container auseinandergesetzt wurden, hallte es wie Donner. Sie lief über den Platz zur Brücke, um von dort aus einen Blick auf den Ort ihrer Sehnsucht zu werfen. In halber Höhe überquerte sie die Gleise. Dahinter erhoben sich Verwaltungsgebäude und Lagerhallen. Grelles Licht erhellte den Kai. Links die grauen Schiffe der Kriegsmarine, rechts der Zugang zu den Fähren. Am Ende der Brücke die Fahrkartenkontrolle. Kurz erwog sie, einfach weiterzulaufen. Sie war so weit gekommen, dass es kein Zurück mehr gab. Aber was sollte sie allein auf Zypern? Sie hatte noch nicht einmal Geld für ein Flugticket. Ihr Liebster hatte versprochen, sich darum zu kümmern. Ich bin ein sparsamer Mensch, hatte er mit einem Grinsen gesagt und sie an sich gezogen. Zumindest seit ich dich kenne …
Rebecca drehte um. Wenn sie sich an der Bushaltestelle auf die Bank setzte, hatte sie nicht nur den Bahnhof im Blick, sondern auch alle, die das Gebäude betreten oder verlassen wollten. Und den Zugang zum Hafen. Jetzt, nach Einbruch der Dunkelheit, war das wichtig. Sie hatte gerade das Ende der Brücke erreicht, als ein Bus von der Straße abbog und inmitten einer Wolke von Staub und Dieselgestank an der Haltestelle ankam. Es war der letzte Express von Tiberias am See Genezareth. Auf dem Weg nach Haifa hielt er nur zweimal: in New Jechida, der Kreuzung weit außerhalb des Kibbuz’, und in Naharija.
Die Fahrgäste stiegen aus. Einige liefen direkt auf das Bahnhofsgebäude zu, andere sahen sich um und überquerten dann hastig die Straße, um in den engen Gassen ihrer Wege zu gehen. Es war niemand unter ihnen, den sie kannte. Auch ihr Liebster nicht.
Sie machte sich auf den Rückweg, wich den ersten Ankommenden am Fuß der Brücke aus und wollte gerade auf die Haltestelle zuhalten, als ein Nachzügler den Bus verließ. Wie angewurzelt blieb sie stehen. Es war nicht der gutaussehende, breitschultrige Junge mit dem strahlenden Lächeln, den sie erwartet hatte. Dort, an der Haltestelle, stand jemand, mit dem sie im Leben nicht gerechnet hatte. Groß, hager, leicht gebeugt und, obwohl sie alle der gleiche Jahrgang waren, umgeben von der düsteren Aura des vorzeitig Gealterten. Uri. Die Spaßbremse. Der Eigenbrötler. Egal wo er im Kibbuz auftauchte, erstarb das Lachen. Was hatte er in Haifa zu suchen, dieser gerne in einem Atemzug mit Sodom und Gomorrha genannten Hafenstadt?
Er wischte sich die Hände sorgfältig mit einem Taschentuch ab und sah sich um. Sein Blick blieb an ihr hängen, und wie sie da stand, die Reisetasche in der Hand, paralysiert von seiner Erscheinung, fühlte sie sich, als ob er ein unsichtbares Netz über ihr ausgeworfen hätte, aus dem es kein Entrinnen gab. Alles um sie herum lief in Zeitlupe weiter. Wie sich die Türen schlossen und der Bus über den Platz kroch. Wie die letzten Reisenden in schnellem Schritt die Abfahrtszeit des Zuges mit der auf ihrer Armbanduhr verglichen. Wie zwei Autos, ein Käfer und ein Sabra Carmel, die Brücke über die Gleise zum Hafen hinauffuhren. Wie sie atmete. Ein. Pause. Aus. Pause.
Wie er das Taschentuch einsteckte und langsam auf sie zukam. Er war hier wegen ihr. Irgendetwas Kaltes, Böses in ihr wisperte, dass ihr einsames Warten und das Auftauchen dieses Mannes etwas miteinander zu tun hatten.
Plötzlich schnellte das Leben in Rebecca zurück. Er durfte sie nicht erwischen. Unter gar keinen Umständen. Sie rannte los in Richtung Straße. Er folgte ihr. Gerade sprang die Ampel um, und der Verkehr setzte sich wieder in Bewegung. Sie achtete nicht darauf. Grelles Hupen und das Kreischen von Bremsen gellten in ihren Ohren, als gleich zwei Autos unmittelbar vor ihr eine Vollbremsung machten. Hastig schlängelte sie sich zwischen den Stoßstangen hindurch und gelangte auf den sicheren Gehweg. Dort drehte sie sich um.
Er stand auf der anderen Seite und ließ sie nicht aus den Augen.
Himmel hilf! Es war sowieso schon alles zu spät. Wenn er wusste, warum sie hier war … Sie rannte weg von der Durchfahrtsstraße in die schmale Gasse des alten, heruntergekommenen Hafenviertels. Einige Geschäfte hatten noch geöffnet. Im Schein der Gaslaternen boten Händler Gewürze und Nüsse an, über offener Glut qualmten Fleischspieße und tränkten die Luft mit einem Gemisch von Holzkohle und verbranntem Fett. Die Augen der Männer folgten ihr, als sie nach links abbog und sich in einem Hauseingang versteckte.
Vorsichtig stellte sie die Tasche ab. Uri war gekommen, um sie zu holen. Aber sie würde keinen Fuß mehr in den Kibbuz setzen. Niemals, solange ihr Liebster nicht an ihrer Seite war. Ängstlich sah sie sich um und erschrak, wo sie gelandet war.
Stromleitungen hingen wie Lianen über dem bröckelnden Putz der Häuser. Hinter einigen Fenstern brannte Licht, die meisten waren dunkel. Der Verfall grassierte, viele Araber hatten ihre Häuser in der Unterstadt verlassen und waren in bessere Gegenden weiter oben am Hang des Karmel gezogen. Ein Mädchen hatte schon bei Tag nichts in diesem Viertel verloren. Nach Einbruch der Dunkelheit war es geradezu tabu. Vorsichtig trat sie aus dem Hauseingang und spähte um die Ecke.
Er stand direkt vor ihr. Sie fuhr zurück, als wäre sie in vollem Lauf gegen eine Glaswand geprallt.
»Komm mit«, sagte er.
Sie wollte weglaufen, aber sein Arm schnellte vor und packte sie.
»Lass mich los! Was soll das?«
So nah war sie ihm, dass sie seinen säuerlichen Atem riechen konnte. Wieder stieg die Übelkeit in ihr hoch. Sie taumelte. Er nutzte den Moment der Schwäche, um sie mit sich um die Ecke in den schmalen Hauseingang zu ziehen. Mit ausgebreiteten Armen stützte er sich links und rechts von ihr ab und nahm ihr so jede Möglichkeit zur Flucht. Sie stolperte über ihre Tasche und sackte auf den Stufen zusammen.
»Du wirst jetzt mit mir kommen.«
Rebecca schüttelte den Kopf.
»Keine Widerrede. Danke dem Schöpfer, dass ich dich gefunden habe.«
Sie sah hoch. »Ich verfluche ihn. Hörst du? Ich verfluche ihn, wenn du mich nicht sofort gehen lässt!«
Mit Wucht trat sie ihm gegen das Schienbein, aber er wich aus. Zu schwach, zu verzweifelt. Die Flucht, das Warten, die Ungewissheit hatten ihr zugesetzt. Sie zitterte. Sein Gesicht lag im Dunkeln. Nur die Augen glühten, wild und bedrohlich. Auf einmal bekam sie Angst. Sie war doch schon verloren. Was ging ihn das eigentlich an?
Hektisch raffte sie die Tasche an sich, um sie sich wie einen Schutzschild vor den Bauch zu halten.
»Noch kannst du zurück, Rebecca. Ich helfe dir.«
»Ich will deine Hilfe nicht!«
»Ich bin deine einzige Chance. Komm mit mir.« Er hob die Hand und wollte ihr Haar berühren, doch sie schlug sie mit aller Kraft weg.
Es brachte ihn aus der Balance, aber nicht genug, um aufzuspringen und abzuhauen.
»Ich werde keinen Schritt mit dir gehen. Lass mich in Ruhe.«
»Du bist allein.«
»Nein, das bin ich nicht.«
Sie wollte sich an ihm vorbeizwängen, wieder hielt er sie fest.
»Was machst du hier eigentlich? Ich denke, du bist im Einsatz«, fauchte sie. »Bist du vom Militär desertiert, bloß um mich abzufangen?«
»Ich habe zwei Tage Sonderurlaub. Und wenn es die nicht gegeben hätte, ja, dafür wäre ich auch abgehauen, mit allen Konsequenzen.«
»Lass mich los, oder ich schreie!«
»Ach ja?« Sein Griff wurde härter.
Es tat weh. Doch Rebecca biss die Zähne zusammen. Niemals würde sie ihm zeigen, wie ihr wirklich zumute war.
»Wer soll dir denn hier zur Hilfe kommen? Wer?« Er zog sie an sich. »Ich bin der Einzige, dem du noch trauen kannst.«
Sie roch billiges Rasierwasser. Eifersucht. Waffenöl. Hass. Schweiß. Wut.
»Du bist verrückt. Ich dir trauen? Du träumst. Lass mich gehen. Ich kann nichts dafür, dass ich eine Zukunft habe und du nicht.«
Seine Hände um ihre Arme waren wie Schraubzwingen. Sie stöhnte auf, doch er ließ nicht locker. Im Gegenteil.
»Kapierst du’s nicht? Es ist aus! Du hast keine Zukunft! Sie ist vorbei! Hier und jetzt ist deine Zukunft vorbei.«
Er presste sie an sich. Sie bekam kaum noch Luft.
»Was habt ihr mit ihm gemacht?«
Er ließ sie so abrupt los, dass sie nach hinten stolperte und beinahe gestürzt wäre. Sie taumelte, und wieder landete sie in seinen Armen. Am liebsten hätte sie ihm aufs Hemd gekotzt, so sehr hasste sie ihn.
»Ist ja gut«, sagte er leise und streichelte ihr übers Haar. »Ich kann dich verstehen. Aber sei jetzt ein braves Mädchen und komm mit mir nach Hause.«
»Ich kann nicht. Ich liebe ihn.«
Sie sah hoch. In der Dunkelheit glühten seine Augen wie schwarze Kohlen. Er ist verrückt, dachte sie. Ich wusste schon immer, dass er verrückt ist und man einen weiten Bogen um ihn machen muss. Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das eher wie eine Grimasse aussah.
»Er kommt nicht mehr. Er hat dich verraten. Siehst du das denn nicht? Wo willst du hin? Du hast keine Chance, Rebecca. Keine.«
»Woher willst du das wissen?«
»Dein geheimer Liebhaber ist weg. Aber nicht mit dir.«
Wenn Worte wie Keulenschläge wären, müsste sie jetzt in die Knie gehen.
»Was sagst du da?«
»Es tut mir leid.«
»Was?«, schrie sie und ging auf ihn los. Mit beiden Fäusten schlug sie auf ihn ein, er wehrte sie ab. »Du lügst! Du dreckiger, hinterhältiger Lügner!«
Uri nahm ihre Hände und hielt sie fest. Die Berührung war so unerträglich, dass sie sich losriss und ein paar Schritte davonstolperte. Ihr Magen krampfte sich zusammen.
»Er ist mit einer anderen abgehauen. Unter den volunteers gibt es kein anderes Thema. Rebecca, wenn du jetzt mitkommst, können wir zwei das noch geradebiegen.«
»Ich liebe ihn, und er mich. Wir werden heiraten, und ich werde mit ihm nach Deutschland gehen.«
»Nach Deutschland«, schnaubte er. »Mit einem goj.«
Das letzte Wort spuckte er beinahe aus. Angesichts dieser Verachtung fiel es ihr so leicht wie nie zuvor, ehrlich zu sein.
»Ich bin schwanger. Ich erwarte ein Kind.«
Er antwortete nicht. Sie hob die Tasche auf und klopfte den Dreck ab.
»Ein … Ein Kind?«
Etwas in seinen Augen zerbrach. Beinahe konnte sie hören, wie die Glut in ihm sich in knackendes Eis verwandelte.
»Du bist …«, flüsterte er. Rebecca hatte ihn noch nie so fassungslos gesehen. »Du hast … mit ihm …«
»Ja, hab ich. Und deshalb lass mich jetzt gehen. In deinen Augen bin ich doch eine Hure. Und der weint man keine Träne nach.«
Fast konnte er einem leidtun. Er fuhr sich durch die Haare, ging ein paar Schritte auf und ab, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen.
»Ich werde die Fähre nehmen, notfalls auch allein. Du kannst nichts daran ändern. Wenn es meine Eltern interessiert, dann sag ihnen, dass ich sie achte. Du musst es aber nicht, denn ich weiß, was ich ihnen antue. Leb wohl.«
Nun war es heraus. Wenn Uri es wusste, würde sich bald der ganze Kibbuz das Maul über sie zerreißen. Vielleicht fand sie ja ein billiges Hotel, in dem sie übernachten konnte. Eine Rückkehr nach Jechida war ausgeschlossen, ein Bett bei Tante Rose ebenso. Also musste sie weitergehen, einfach die Gasse entlang, obwohl sie keine Ahnung hatte, wohin in diesem Labyrinth sie führen würde. Schritte folgten ihr.
»Bleib stehen.«
Sie ging weiter.
»Rebecca! Bleib stehen!«
Uri überholte sie, stellte sich ihr in den Weg und sank auf die Knie. Sie war so verblüfft, dass sie innehielt.
»Ich liebe dich, Rebecca. Heirate mich. Ich werde deinem Kind ein Vater sein. Ein guter Vater.«
»Was?«
»Heirate mich, Rebecca!«
Hastig sah sie sich um. Weiter vorne schien die Gasse in eine Straße zu münden. Wenn sie sich links hielt, würde sie über kurz oder lang zurück zum Bahnhof kommen. Dort waren Menschen. Hier schien es, als ob die Ruinen ausgestorben wären und nur die Ratten in den Kellern den seltsamsten, verwirrtesten Heiratsantrag aller Zeiten gehört hatten.
»Nein.«
Sie schob sich an ihm vorbei. Er sprang auf und lief rückwärts neben ihr her.
»Du hast keine Chance. Nimm mich. Niemand wird etwas erfahren. Ich schwöre es dir. Das Kind bekommt einen guten Namen, und du wirst eine ehrbare Frau.«
»Nein! Es gibt bereits einen Vater.«
»Rebecca, hör auf mich. Kehr um. Ich kann dir alles bieten. Ich habe dich geliebt von Kindesbeinen an und werde dich immer lieben. Es ist mir egal, ob du befleckt bist oder nicht …«
»Befleckt?«, schrie sie. Er zuckte zusammen, aber es war ihr egal. »Ich bin nicht befleckt! Ich bin gesegnet. Gesegnet durch eine Liebe, wie du sie nie erfahren wirst. Nie! Und jetzt verschwinde!«
Als sie weiterlief, folgte er ihr wie ein Hund.
»Rebecca …« Er schien nachzudenken. Hoffentlich. Es war unfassbar, wie er sich aufführte. »Hör mich an!«
»Du bist mit einer anderen verlobt, hast du das schon vergessen?«, höhnte sie. »Wie schnell wirfst du eigentlich all deine Begriffe von Ehre und Anstand über Bord? Wage es nicht, mich auch nur noch ein Mal befleckt zu nennen.«
Tatsächlich hob er die Hände, als ob er aufgeben würde. Sie blieb stehen. Wenn er jetzt zur Einsicht kam, könnten sich hier ihre Wege trennen.
»Ich werde dich heiraten und dich und das Kind retten. Ich verspreche es dir hiermit hoch und heilig. Jetzt komm mit.«
Kapierte er es nicht? Es war so lächerlich, was er sich da ausmalte. Sie vor Schande zu bewahren, indem er sie heiratete. Ihr Liebster würde sicher bald kommen. Etwas hatte ihn aufgehalten, aber er würde sie nicht im Stich lassen. Niemals.
»Rebecca, das hier ist kein Ort für dich. Ich bringe dich nach Hause.«
Sie bemühte sich, ihre Stimme sanft und freundlich klingen zu lassen. »Hast du mir nicht zugehört?«
»Doch. Ich liebe dich. Ich werde alles tun, was du verlangst.«
Sie trat einen Schritt auf ihn zu. Sein hageres Gesicht war gezeichnet von Sorge und etwas anderem, das sie kaum zu definieren wagte. Ein Wissen, vor dem sie sich fürchtete, das ihr Angst einjagte.
»Was ist los?«, fragte sie. »Woher wusstest du, dass ich in Haifa bin?«
Er wich ihrem Blick aus.
»Was macht dich so sicher …« Sie stieß ihre Faust gegen seine magere Schulter, und er wich eine Schritt zurück. Sofort boxte sie ihn noch einmal, wieder und wieder. »Was ist passiert? Was habt ihr mit ihm gemacht?«
Selbst als sie ihn schüttelte, wehrte er sich nicht, sondern erduldete schlaff wie Gummi ihre steigende Brutalität. So kannte Rebecca sich nicht. Am liebsten hätte sie die ganze Wahrheit aus ihm herausgeprügelt.
»Woher weißt du, dass er nicht mehr kommt? Woher? Verdammt! Rede mit mir! Was hast du …«
Schwer atmend ließ sie von ihm ab. Alles schien sich plötzlich um sie zu drehen
»Es tut mir ja so leid«, sagte er. »Bitte glaub mir, es tut mir schrecklich leid.«
Durch den Tränenschleier bekam sie mit, wie er sich straffte und die Entschlossenheit in ihn zurückzukehren schien. Panik stieg in ihr auf. Panik und nicht zu Ende gedachte Sätze. Er kommt nicht, was habt ihr, woher weißt du, wer ist sie, aus, aus, was soll ich, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Erneut drehte sie sich um und rannte los. Sie musste raus aus diesen schwarzen Gassen, hinaus ins Licht, zu Menschen, die sie schützen konnten.
»Rebecca!«, schrie er und lief ihr hinterher. »Bleib stehen! Um Himmels willen, bleib stehen!«
Beinahe wäre sie hingefallen, als sie viel zu schnell nach links abbog und in fünfzig Metern Entfernung die breite Straße sah, die das Hafenviertel vom Bahnhof trennte. Die Luft wurde knapp, so schnell war sie noch nie gerannt. Hinter ihr konnte sie die Schritte ihres Verfolgers hören. Ihr Herzschlag trommelte in der Brust.
»Hilfe!«, schrie sie, aber niemand würde sie hören, keiner würde die Polizei rufen.
»Rebecca!«
Mit zwanzig Metern Vorsprung erreichte sie die Straße, kaum Zeit für ein paar knappe, keuchende Atemzüge.
Er verlangsamte sein Tempo, blieb stehen und hob die Hände, als ob er aufgeben würde. »Er kommt nicht mehr.«
Sie sah Uri an, und in diesem Moment traf sie die Erkenntnis, dass er recht hatte. Sie lief gerade gegen eine schwarze Wand. Es gab nichts und niemanden mehr, der sie retten konnte.
Ein Lkw donnerte die Straße hinunter. Er hatte grün und verlangsamte sein Tempo nicht. Rebecca schloss die Augen, ballte die Fäuste und dachte an ihren Liebsten. Wie in Trance lief sie auf die Straße. Den Schrei hinter ihr hörte sie nicht mehr.
1
29 Jahre später
Schmerz. Wuchtig, übermächtig.
Sie beugt sich über mich. Das lange Haar fällt ihr ins Gesicht, dieses schöne schmale Gesicht, ich sehe ihre weit aufgerissenen Augen. Angst. Schock.
Mit der Hand berührt sie meine Schulter. Sie sagt etwas, schreit mich an, aber ich kann sie nicht hören. Das Dröhnen in meinem Kopf wird lauter. Jemand reißt sie weg. Ihre Lippen formen das Wort NEIN.
»Nein!«
Wieder ein Schlag, dann ein Sturz ins Nichts.
Ich fahre hoch, verfange mich in einer Schnur. Etwas sticht in meinen Handrücken wie ein Skorpion. Eine Nadel. Im schwachen Licht gedimmter Neonröhren erkenne ich ein Krankenzimmer. Die Tropfflasche baumelt am Galgen. Ich falle zurück auf das harte Kopfkissen. Was ist passiert? Ich will mich erinnern, aber es gelingt mir nicht.
Ein Gesicht. Ihr Gesicht. Blass, mit hohen Wangenknochen und dunkelblauen Augen. Immer wieder taucht es auf aus der Tiefe meines Betäubungsschlafs wie ein Foto, das langsam in der Dunkelkammer Gestalt annimmt. Vom Schemen zur Schärfe. Einige Sommersprossen auf der geraden Nase, die braunen Haare streng zurückgekämmt. Jung sieht sie aus. Jung und sehr verletzlich. Ihr Mund ist der eines Knaben. Ist sie es? Ist sie es nicht? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Blasse Lippen, scharf konturiert. Sie verziehen sich zu einem unsicheren Lächeln.
Ihr Name. Ich darf ihn nicht vergessen. Ihr Name ist …
»Rebecca?« Meine Stimme klingt wie zerriebenes Glas.
»Nein«, sagt sie leise. »Ich bin Rachel.«
Rachel.
»Ganz ruhig. Alles wird gut.«
Ihre Worte tropfen kühl in mein Blut. Alles wird gut.
»Was ist passiert?«
Die junge Frau lächelt mich an. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es beunruhigt mich. Die Grenze zwischen Fiebertraum und Wirklichkeit verwischt. Ständig schiebt sich ein anderes Gesicht vor ihre Züge. Eines, das ich nie vergessen habe, obwohl es so lange her ist.
Sie trägt einen kleinen goldenen Davidstern an einer Kette. Ich will die Hand heben und ihn berühren, ich kenne ihn, er erinnert mich an etwas, doch dann verschwimmt er vor meinen Augen. Alles hebt und senkt sich.
»Nicht jetzt. Ruh dich aus.«
Ihre Worte kommen von weit her, wie aus einem anderen Raum. Ich sehe ihr Gesicht nur noch schemenhaft, als stünde sie auf der anderen Seite eines Fensters, an dem starker Regen hinabrinnt.
»Rachel?« Mühsam setze ich mich auf. »Rebecca?«
Die Übelkeit schießt in mir hoch. Ich reiße mir die Nadel aus der Hand und taumele auf eine Tür zu, hinter der sich glücklicherweise das befindet, was ich gehofft habe: das Badezimmer.
Abwaschbar, steril, unbenutzt – hellgraue Kacheln, eine Dusche, in der ein weißer Plastikstuhl steht, ein Waschbecken, die Toilette. Ich versuche das Unvermeidliche so geräuscharm wie möglich hinter mich zu bringen. Was zum Teufel ist passiert? Im Spiegel sieht mich ein entfernter Verwandter an, der nicht durch, sondern gegen die Wand gelaufen ist. Eine blutige Schramme zieht sich quer über meine Stirn. Das linke Auge ist fast komplett zugeschwollen und schillert in allen Schattierungen zwischen Gelb und Violett. Beim Atmen schmerzt der Brustkorb. Ich trage eine Halskrause. Entweder bin ich vor einen Lkw gelaufen oder … Rachel … Warum nennt sie sich jetzt so?
Ein Schrei. »Lasst ihn los!«
Der Schlag kommt von hinten.
Nacht.
Kaltes klares Wasser. Viel.
Ich brauchte ein paar Minuten, bis ich das Gefühl hatte, ihr wieder gegenübertreten zu können. Dann öffnete ich die Tür und blinzelte, weil das helle Licht blendete. Sie stand am Fenster, und die Erleichterung darüber, dass ich sie nicht geträumt hatte, hielt so lange an, bis sie sich umdrehte.
»Hi«, sagte Marie-Luise.
Bis auf uns beide war der Raum leer. Immer noch keuchend von der Anstrengung, mich auf den Beinen zu halten, lehnte ich am Türrahmen.
»Wo ist sie?« Ich war abgrundtief enttäuscht.
»Wer?«, fragte die Frau am Fenster und kam auf mich zu.
Sie hielt eine Zeitung in der Hand, die sie mehr auf meinen Nachttisch warf, als sie darauf abzulegen. Eben noch hatte ein Engel an meinem Bett gesessen, und nun stand meine ehemalige Kanzleipartnerin vor mir. Der Unterschied war ungefähr so groß wie der zwischen Filterkaffee und Espresso und fiel eindeutig zu Marie-Luises Nachteil aus. Sie bekam mit, dass ich von echter Freude weit entfernt war.
»Hier ist niemand. Außer uns beiden, meine ich. Es ist auch keiner aus deinem Zimmer rausgekommen.«
»Aber …« Ich glaubte sogar, einen Hauch ihres Parfums zu riechen. Etwas, das an weiße Blumen erinnerte, an Reinheit und Frische. »Du musst sie gesehen haben. Eine Frau, Mitte, Ende zwanzig. Dunkle Haare, schlank …«
»Tut mir leid.« Marie-Luise ließ sich auf den abwaschbaren Stuhl fallen, auf dem eben noch Rachel gesessen hatte. Oder Rebecca, mit der ich sie verwechselt haben musste. Oder schlicht und ergreifend eine Wahnvorstellung. »Was verabreichen Sie dir denn hier? Gibt’s das auch für Frauen?«
Ratlos starrte ich sie an.
»Okay, war ein Witz. Du bist ja wirklich angeschlagen. Siehst aus wie ein glückloser Boxer. Wie geht es dir?«
»Sie war hier.«
»Schon gut.« Marie-Luise, rothaarig, einen Kopf kleiner als ich und gekleidet, als ob ihre nächste gesellschaftliche Verpflichtung eine Anti-Abschiebe-Demo wäre, zumal sie eher nach dem Tabak ihrer letzten heimlich gerauchten Selbstgedrehten roch als nach weißen Blumen, reichte mir die Zeitung. »Lies. Titelseite.«
Vorsichtig, fast misstrauisch nahm ich ihr das Blatt ab und ging zurück zu meinem Bett.
»Anwalt greift ein – Schläger gefasst!« Die Buchstaben tanzten fast vor Aufregung. »Antisemitischer Übergriff vereitelt. Der Charlottenburger Strafverteidiger Joachim V. stellte sich schützend vor einen Berliner Mitbürger, als jugendliche Hooligans ihn zunächst provozierten und dann auf ihn einschlagen wollten. Das Opfer Rudolph Scholl, ein angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlins, war gerade auf dem Weg in die Synagoge in der Pestalozzistraße, als die Täter ihm auflauerten. Zeugen riefen die Polizei. Die Täter wurden gefasst. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr als 20.000 politisch motivierte Straftaten registriert. Mit Abstand die meisten Delikte begingen Neonazis sowie sonstige, diffus rechts orientierte Kriminelle …«
»Sie hätten wenigstens deinen Namen ausschreiben können.« Marie-Luise verschränkte die Arme vor der Brust und musterte mich aufmerksam.
Ich las den Artikel noch einmal. Eine Rachel tauchte darin nicht auf.
»Was wolltest du denn von Scholl? Oder hat dich reiner Zufall dort vorbeigeführt? Ihm gehört das jüdische Antiquariat. Ich war schon ein paar Mal dort. Man findet immer was. Derzeit werden die ganzen Bibliotheken der Gründergeneration aufgelöst. Erst neulich habe ich die Erstausgabe von Anna Seghers Das siebte Kreuz bei ihm gekauft. Für meine Mutter. Hat ja alles nur noch symbolischen Wert, obwohl ich finde, dass gerade Anna Seghers in den Schulen …« Sie verstummte, weil ich ungeduldig die Hand gehoben hatte, um ihren Redeschwall zu unterbrechen. »Was ist?«
»Sie war dabei. Bei Scholl.«
»Wer?«
»Rachel.« Ich suchte nach einem Wort, das zu ihr passte, und war erleichtert, als es mir einfiel. »Eine Mandantin. Ich war mit ihr zusammen dort.«
Marie-Luise wich meinem Blick aus, und das war kein gutes Zeichen. Wir kannten uns schon so lange. Ich konnte in ihr lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch, meinetwegen auch eines von Anna Seghers oder Dieter Noll oder Erik Neutsch oder womit ich mich damals sonst noch so herumgequält hatte, um ihr zu imponieren. Übriggeblieben aus dieser Zeit war das, was ich am ehesten mit »vertraut« und »vertrauend« umschreiben würde. Ihren Büchergeschmack einmal ausgenommen.
»Um was ging’s denn?«, fragte sie mit dem Interesse einer gelangweilten Schulkrankenschwester, die die zehnte aufgeplatzte Lippe an einem Tag behandeln muss.
Ich legte die Zeitung auf die Decke und lehnte mich zurück. Langsam kamen die Schmerzen wieder und mit ihnen offenbar auch meine Erinnerung. »Eine …« Ich brach ab. Warum war Rachel noch mal bei mir gewesen? Es war um etwas Wichtiges gegangen. Etwas Existenzielles. Etwas, das auch mich betraf. Wie ein bewegungsloser, dunkler Schatten stand es in einer Ecke meines Gedächtnisses und wollte einfach nicht hervorkommen. »Eine Familiensache, glaube ich. Sie wollte … zu Scholl. Ich habe sie begleitet, weil ich ihn von früher kenne.«
»Was weißt du sonst noch?«
Ich dachte nach und antwortete dann wahrheitsgemäß: »Nichts.«
Die Verblüffung ließ Marie-Luise einige Sekunden schweigen. Ihr Blick suchte in meinem Gesicht nach einem Anzeichen, ob ich sie auf den Arm nehmen wollte. Dann begriff sie, dass ich in meinem Zustand noch nicht einmal mehr dazu in der Lage war.
»Aber du musst dich doch an irgendetwas erinnern. An den Überfall. Wer angefangen hat. Wie das alles passiert ist.«
Ich schloss die Augen und wünschte mir, allein zu sein.
»Irgendwas?«
Nichts.
Marie-Luise stand auf. »Vaasenburg hat mich angerufen.«
Sie wartete, ob die Erwähnung des Kriminalhauptkommissars, mit dem wir schon öfter zu tun gehabt hatten, bei mir eine Reaktion hervorrief.
»Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt, wie es so schön heißt. Wie immer, wenn es um antisemitische Übergriffe geht. Die beiden Schläger sitzen noch in U-Haft. Aber … da scheint es Unstimmigkeiten zu geben.«
Sie wartete ab, ob mich ihr leichtes Zögern zu einer Nachfrage provozieren würde. Es war mir egal. Ich wollte nur meine Ruhe. Ihre leisen Turnschuhschritte entfernten sich in Richtung Tür.
»Welcher Tag ist heute?«, fragte ich hastig.
»Freitag.«
Dann lag ich also seit gestern im Krankenhaus. Es fühlte sich an, als wären Jahre vergangen, seit an einem kühlen Frühlingsmorgen diese junge Frau in mein Büro gekommen war, die ihrer Mutter so ähnlich sah, dass ich an eine Halluzination glaubte.
»Rebecca?«
Sie steht lächelnd auf und reicht mir die Hand. »Rachel, Rachel Cohen. Aber es kommt vor, dass Leute mich mit meiner Mutter verwechseln.«
»Ruh dich erst mal aus.« Marie-Luise betrachtete mich mit ungewohnter Besorgnis. »Ich komme heute Nachmittag noch mal vorbei. Dann wissen wir mehr, und du siehst hoffentlich alles etwas klarer.«
»Was für Unstimmigkeiten?«
»Die Aussagen von den beiden Hooligans widersprechen sich. Aber was will man schon von Leuten erwarten, die nicht geradeaus denken können.«
Bevor sie die Tür öffnete, sagte ich noch schnell: »Danke.«
Ich war froh, dass sie ihren Besuch nicht ausdehnte. Ich wollte allein sein und in meiner Erinnerung finden, was ich verloren hatte. Doch sosehr ich auch nachforschte, mehr als Rachels Namen und ein paar zusammenhanglose Bilder tauchten nicht auf: Sie sitzt in meinem Büro und schlägt die Beine übereinander, und ich Idiot sehe natürlich nur die Beine … Oder: Ich hole sie ab, und sie läuft auf meinen Wagen zu, ihre offenen Haare tanzen um die Schultern. Sie lächelt wieder, und das kann sie, breit und herzlich, fast wie ihre Mutter vor so langer Zeit … Oder: Sie beugt sich über mich, während ich k. o. auf der Straße liege, doch irgendein Idiot zerrt sie weg von mir. Ich will sie beschützen, bloß vor wem? Es geht mir nicht gut, und das liegt nicht nur an den Schlägen, die ich einstecken musste. Ich bin wie erstarrt, gefangen in einer tiefen Trauer, nur um was?
Als die Schwester hereinkam, um die Flasche mit der Elektrolytlösung zu wechseln, schlug ich die Decke zurück und setzte mich auf. Zu schnell. Für einige Sekunden schien der Boden zu schwanken.
»Könnten Sie mir bitte die Hand verbinden? Ich möchte gehen.«
Die Frau, eine resolute Dame mit roten Wangen und kräftigem Griff, sah mich an, als hätte ich von ihr verlangt, die oberen Knöpfe ihres Kittels zu öffnen. »Sie haben eine Gehirnerschütterung und Prellungen, dazu eine angebrochene Rippe. Ich an Ihrer Stelle …«
»Ich muss raus hier. Wo sind meine Sachen?«
»Wir haben gleich Visite. Der Arzt wird entscheiden …«
»Nein. Verzeihen Sie bitte. Das werde ich selbst tun.« Ich stand auf, ein grober Fehler. Alles drehte sich. Ich klammerte mich ans Bettgestell. »Und machen Sie mir das Ding an meinem Hals ab.«
Mit sichtlichem Unwillen ging die Schwester zu einem Einbauschrank und öffnete ihn. »Hier.«
Alles da. Schuhe, Hemd, T-Shirt, Anzug …
»Der Mantel?«
Es war Mitte April, der Himmel draußen war von regenschweren Wolken verhangen. Ab und zu lugte die Sonne hindurch. Eine Birke, noch winterkahl, schwankte im Wind.
»Den hat Ihre Mutter gestern Abend mitgenommen. Sie wollte ihn reinigen lassen.«
»Meine Mutter war hier?«
Die Schwester schloss den Schrank wieder. »Ja, mit Ihrer Tante. Eine reizende Dame, die ebenfalls sehr besorgt um Sie war.«
Frau Huth war weder meine Tante noch reizend und schon gar nicht besorgt um mich.
Ich nahm die Sachen und taumelte ins Bad. Dunkle Flecken, Schmutz und Blut, als ob man mich einmal quer über den Asphalt geschleift hätte. Das T-Shirt ging. Ich zog vor Schmerzen scharf die Luft ein, als ich es über den Kopf zerrte.
Die Formalitäten waren schnell erledigt. Ich bekam die Entlassungspapiere und warf sie vor der Klinik in den nächstbesten Mülleimer. Auf dem Parkplatz wollte ich kehrtmachen, weil ich nicht wusste, wo ich meinen Wagen gelassen hatte – die Schlüssel hatte ich bei mir. Jemand war so freundlich gewesen, sie mit meinen anderen persönlichen Dingen in die Nachttischschublade im Krankenzimmer zu legen. Wahrscheinlich stand das Auto noch in der Nähe von Scholls Wohnung, wo es mich so böse erwischt hatte. Ich ging ein paar Meter zurück, hatte vergessen, was ich eigentlich wollte, und stand einige Augenblicke ratlos vor dem Papierkorb. Die Sonne traute sich wieder für einen Moment hinter den Wolken hervor. Es war seltsam, die Klinik vor mir zu sehen und nicht zu wissen, wie ich hineingeraten war. Im Papierkorb lag ein Umschlag, auf dem mein Name stand. Meine Entlassungspapiere. Ich holte sie wieder heraus und nahm den Bus.
2
Alttay rief an. Der Gerichtsreporter der Berliner Tageszeitung wollte ein Interview. Ich lehnte ab und legte auf. Später ärgerte ich mich darüber. Er hatte Informationen, ich nicht. Alttay wusste immer mehr als das, was er schließlich veröffentlichte. Ich würde ihn zurückrufen, sobald ich wieder einigermaßen beisammen wäre, mich entschuldigen und versuchen, mehr in Erfahrung zu bringen, ohne mich dabei von ihm aufs Kreuz legen zu lassen. Aber dafür brauchte ich einen klaren Kopf.
Am Nachmittag stand Marie-Luise mit einer Tüte selbstgebackener Kekse vor der Tür, die wie Tierfutter rochen.
»Warum hast du mich nicht angerufen?«, waren ihre ersten Worte. »Ich komme ins Krankenhaus, und dein Bett ist leer. Hammer! Im ersten Moment denkt man ja an alles Mögliche.«
»Ich musste raus da.«
»Ich an deiner Stelle …« Sie musterte mich genauer. »Das sieht immer noch nicht gut aus in deinem Gesicht. Nicht dass es jemals wirklich gut ausgesehen hätte, du weißt schon, was ich meine. Wie hast du die beiden eigentlich in die Flucht geschlagen?«
»Mit meiner legendären Rechten.«
Sie grinste vielsagend, als ich die Tür hinter ihr schloss und sie vor mir ins Wohnzimmer ging.
»Du bist übrigens mit Lukas M. und Marvin P. aneinandergeraten. Einundzwanzig und zweiundzwanzig Jahre alt. Zwei echte Schätzchen.«
Eine Weile hatten Marie-Luise und ich eine Bürogemeinschaft gehabt. Was davor zwischen uns gewesen war, war vermintes Gelände, das wir weiträumig mieden. Die Stadt war groß genug für uns beide. Während sie die Kekse in meine Bauhaus-Schale von Marianne Brandt schüttete, die bis dato noch nicht einmal ein Staubkorn hatte berühren dürfen, half sie mir auf der Suche nach den fehlenden Mosaiksteinen.
»Lukas ist seit Ende seiner Lehre als Fachkraft für Automatenservice arbeitslos.«
»Als was?«
»Automatenaufsteller. Ist wohl ein anerkannter Ausbildungsberuf. War mir auch neu. Marvin hat es gar nicht erst versucht. Mehrere Jugendstrafen, Einbrüche, Diebstähle. In den letzten Jahren haben sie sich aber gefangen, wenn man das so nennen kann. Sie wurden … Nun ja, im Jargon nennt man das Pitbulls.«
»Pitbulls.«
Ich setzte mich vorsichtig. Marie-Luise biss in einen Keks, der zu Staub zerfiel und sich in die Schlingen der Auslegware verkrümelte.
»Die beiden waren Ordner, so eine Art Saalsicherheit bei rechts-, sagen wir mal, rechtspopulistischen Versammlungen. Pegida-Demonstrationen, BfD-Parteitage et cetera. Bei ihnen zu Hause hat der Staatsschutz Schlagstöcke, Wurfsterne und Das-Boot-ist-voll-Aufkleber gefunden, das ganze Arsenal. Fehlt nur noch die abgesägte Schrotflinte. Ich habe mir erlaubt, bei Vaasenburg und dem Staatsanwalt als deine Anwältin vorstellig zu werden.«
Ich konnte mir denken, wie ihr Aufzug bei den zuständigen Stellen gewirkt haben musste. Sie sah immer noch aus wie eine Studentin, auch wenn sich langsam erste Fältchen um ihre Augen zeigten. Sie war meine älteste, beste, einzige Freundin. Ich war kein sehr sozialer Mensch. Einer ihrer lobenswerten Charakterzüge war, das völlig zu ignorieren.
»Lukas und Marvin behaupteten, rein zufällig vorbeigekommen zu sein, als du Scholl angegriffen hast.«
Im ersten Moment glaubte ich, sie hätte einen ihrer unverständlichen Witze gemacht. Dann merkte ich, dass sie es ernst meinte. »Als ich was?«
Sie bückte sich und versuchte, einige Krümel aus den Teppichschlingen zu entfernen. Ohne mich anzusehen, sprach sie weiter. »Ist natürlich bullshit. Aber das haben sie zu Protokoll gegeben. Wortwörtlich. Du hättest ihn beleidigt und angepöbelt.«
»Was? Was soll ich getan haben?«
Sie hob die Hand – lass mich doch erst mal ausreden, hieß das. »Ich habe Scholl noch auf dem Revier getroffen. Ich dachte, er freut sich, von dir zu hören. Schließlich wurde ihm kein Haar gekrümmt, während du diese Frettchen am Hals hattest. Du Held.« Sie kam wieder hoch und streute die wenigen Krümel auf die Tischplatte. »Aber er hat sich nicht gefreut. Im Gegenteil. Er wollte am liebsten noch nicht mal Anzeige erstatten.«
»Wie jetzt? Er muss doch wissen, was passiert ist. Er war dabei!«
»Ja. Er sagt, er steht noch unter Schock und will erst mal zur Ruhe kommen.«
»Sonst nichts?«
»Niente. Jetzt will Rütters natürlich wissen, was wirklich vorgefallen ist.«
Rütters, der Staatsanwalt. Ich nickte. Es reichte ihr nicht.
»Was du gesehen hast«, bohrte sie weiter. »Deine Zeugenaussage. Wer wen wann wo wie angegriffen hat. Also, was ist passiert?«
»Ich weiß es nicht.«
Sie wartete.
»Ich weiß es wirklich nicht. Das Einzige, wofür ich die Hand ins Feuer lege – ich habe Scholl weder angegriffen noch beleidigt.«
»Und?«
Verstand sie denn nicht? Sie hätte mich auch fragen können, was ich an einem bestimmten Tag im vergangenen Jahr gegessen hatte. Ich war in dieser Straße gewesen, aber es fiel mir einfach nicht mehr ein, was sich dort abgespielt hatte.
»Vernau, verstehst du mich nicht? Soll ich es noch mal für dich zusammenfassen? Zwei Hooligans der übelsten Sorte wollen einen Juden vor dir beschützt haben. Vor dir!«
Ich schwieg.
»War es so?«
Ihr Tonfall verschärfte sich, aber dadurch half sie mir auch nicht auf die Sprünge. Sie machte mich nur noch wütender.
»Nein, natürlich nicht. Rachel und ich wollten mit Scholl reden. Nur reden. Ab da setzt es aus.«
»Rachel. Soso.« Sie wischte sich Flusen und Krümel von ihrem Pullover. »Gut. Wie weiter?«
Ich starrte sie an.
»Rachel wie? Hat die Frau auch einen Nachnamen? Eine Rechnungsadresse? Eine Telefonnummer? Irgendwas?«
»Keine Ahnung.«
»Wo finde ich sie?«
»Ich weiß es nicht.«
»Mach dich nicht lächerlich. Sie ist deine Zeugin, und keiner außer dir hat sie gesehen?«
»Sie ist eine Mandantin«, beharrte ich. War sie das? Warum meldete sie sich dann nicht?
Wieder das Bild vom Morgen, eine Momentaufnahme, schnell wie ein Fisch, der aus dem Wasser schnalzt: Ich am Boden, sie über mich gebeugt, Sorge und Angst im Blick, und dann …
Ich stand auf. Jetzt bloß nicht den Faden verlieren. Nur nicht ablenken lassen. Da ist es. Alles kommt wieder. Schneller als gedacht.
»Wir wollten zu Scholl, weil ich ihn kenne.« Ich stockte. Sollte ich ihr sagen, woher? Das würde bloß Fragen provozieren, die ich nicht beantworten wollte. »Jeder in Berlin kennt ihn. Nicht wegen der Bücher. Scholl ist im letzten Jahr als Vertreter des liberalen Flügels bei der Wahl der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde knapp gescheitert. Erinnerst du dich?«
Sie runzelte die Stirn. »Jetzt, wo du es sagst. Warum wollte deine Mandantin zu ihm?«
Ich begann auf und ab zu gehen, um das Schwungrad meiner Gedanken am Laufen halten. »Sie kommt aus Israel, glaube ich. Sie hat einen zweiten Pass und hat hier auch schon mal gelebt. Sie wollte …«
Der Faden war wieder weg. Seltsam. Rachels Mutter war mir sofort wieder eingefallen, auch wenn ich mir das blutjunge Mädchen von damals in dieser Rolle nicht vorstellen konnte. Dafür hatte ich jedes Detail ihres Gesichts vor mir. Die Sonne in ihren dunklen, langen Haaren, den heißen Wind, der ihr Hemd und die weite Arbeitshose flattern ließ. Die Anmut, mit der sie die Hand über die Augen legte, weil das Licht stark blendete, und ihr Lächeln, das sie so verschwenderisch verteilte. Ein Lächeln, das mir in die Seele schnitt, wenn ich nur daran dachte. Aber der Schnitt ging tiefer. Etwas war geschehen, das diesen Sommerbildern die Farbe aussaugte. Sie verblichen vor meinem inneren Auge.
»Was wollte sie?« Marie-Luise war meinem ziellosen Gang mit Blicken gefolgt.
Eine partielle Amnesie, gar nicht so selten. Alles, was mit dem Überfall zusammenhing, sogar der Grund von Rachels Besuch in meiner Kanzlei, war gelöscht.
Ich lief in mein Arbeitszimmer. Während der Computer hochfuhr, klaubte ich aus allen Ecken meines Gedächtnisses die wenigen Splitter zusammen, die mir geblieben waren: Rachel hatte ein hervorragendes Deutsch gesprochen. Als ich sie deshalb lobte, erklärte sie mir, dass sie nach dem Militärdienst einige Zeit in Berlin gelebt hatte. In Friedrichshain, dort also, wo es alle hinzog, die jung waren und noch etwas vom verblassenden Glanz der auferstandenen Hauptstadt erleben wollten. Small Talk, bevor wir auf den Grund ihres Besuches zu sprechen kamen. Ab da setzte es aus bei mir.
Marie-Luise folgte mir und blieb abwartend im Türrahmen stehen. Von dort scannte sie neugierig Zustand und Ausstattung des Raumes. Für dieses Rattenloch hast du mich also verlassen, stand auf ihrer Stirn. Dafür hast du mir und meiner Kanzlei den Rücken gekehrt, um nun auf sechs Quadratmetern mit Blick auf einen Hinterhof voller Müllcontainer dein eigenes Ding durchzuziehen.
»Rachel wollte mit Scholl sprechen. Aber aus irgendeinem Grund hat er das abgelehnt. Ich habe ihr angeboten, sie zu begleiten. Ich weiß ja, wo er seinen Laden hat. – Moment, er ist gleich so weit.«
Unter ihrem abschätzigen Blick dauerte es eine gefühlte halbe Ewigkeit, bis die alte Mühle endlich ihre Arbeit machte. Ich öffnete das Posteingangsfach, das via Cloud mit meinem Büro in Marquardts Kanzlei am Kurfürstendamm verbunden war. Ich scrollte die Seiten hinunter, tippte den Namen Rachel ins Suchfenster, starrte auf den Bildschirm, als ob ich ihn hypnotisieren könnte – nichts.
Marie-Luise kam zu mir. »Keine Rachel«, stellte sie fest.
»Das gibt’s doch nicht.« Ich ließ die gesamte Festplatte durchlaufen. »Vielleicht ist es im Büro.«
»Im Büro? Du hast noch eins?«
»Bei Marquardt.«
»Marquardt? Du bist immer noch bei ihm?«
Ich nickte. Gedankenverloren nahm Marie-Luise eine Haarsträhne in den Mund und schlenderte wieder hinüber ins Wohnzimmer. Ich unterdrückte einen Fluch und folgte ihr.
»Ich dachte, du wüsstest das.«
»Klar.« Sie sammelte ihren Parka und die leere Kekstüte ein.
»Ich kann nicht mehr zurück«, sagte ich. Es klang, als ob wir gerade unsere zerbrochene Ehe aufarbeiten würden. Dabei ging es nur um eine Bürogemeinschaft. Aber auch die hatte ihre Tücken.
Sebastian Marquardt, Chef einer gutgehenden Kanzlei am Kurfürstendamm, der seine einzige Tochter Mercedes Tiffany adelig und äußerst wohlhabend in die Levante verheiratet hatte, gab in Marie-Luises Augen ein ordentliches Feindbild ab. Allerdings war er der Einzige, der mir seine Räume zur Untermiete angeboten hatte und diese Miete nur dann einforderte, wenn ich sie auch aufbringen konnte. Wahrscheinlich war es das, was Marie-Luise so sehr beschäftigte. Dass die einen nicht mehr wussten, wohin mit ihrem Geld, während die anderen nie auf einen grünen Zweig kamen.
Sie drängte sich an mir vorbei. »Völlig egal, wo du deine Mails verschlampst. Es wäre nur gut, wenn diese Rachel irgendwann wieder auftauchen würde. Rütters ermittelt. Tut mir leid, ich hätte es dir gerne schonender beigebracht, und zwar auch gegen dich.«
»Was?«
Sie schlüpfte in den Parka und lehnte meine Hilfe mit einer unwilligen Handbewegung ab. »Du hast Lukas und Marvin eins auf die Mütze gegeben. Sie haben Anzeige erstattet.«
»Gegen wen?«
»Gegen dich, mein Lieber.« Sie schloss den Reißverschluss. »Körperverletzung. Finde diese Rachel und bringe sie dazu, eine Zeugenaussage für dich zu machen. Sofern es sie gibt.«
»Natürlich gibt es sie!«
Marie-Luise versuchte ein bedauerndes Schulterzucken und ging zur Tür. »Im Moment weißt du offenbar gar nichts. Informiere mich bitte, sobald sich etwas daran ändert. – Ach so, hätte ich fast vergessen.«
Sie förderte ein Klemmbrett aus ihrer Umhängetasche zutage und hielt es mir entgegen. Ich brauchte gar nicht auf das Papier zu sehen, das daran geheftet war.
»Unterschreib das, falls du glaubst, einen Anwalt zu brauchen.«
Das Papier war eine Mandantenvollmacht.
»Fahr mich zu Marquardt.«
»Bin ich ein Taxi?«, giftete sie mich an.
3
In der Kanzlei am Kurfürstendamm herrschte die heitere Beflissenheit, mit der man freitags am frühen Nachmittag die letzten Dinge vorm Wochenende ordnet. Seit dem Weggang von Mercedes Tiffany, die den Empfang so zart und einfühlsam geleitet hatte wie eine Prinzessin auf der Erbse, nahm mir niemand mehr den Mantel ab und flötete etwas von Earl Grey. Manchmal vermisste ich sie.
Marie-Luise hatte mich schweigend abgesetzt und darauf verzichtet, mich zu begleiten. Marquardt und sie waren seit unseren gemeinsamen Studientagen wie Hund und Katz.
»Mail mir die Sachen zu«, hatte sie zum Abschied gesagt und sich dann, eine schwarze Dieselwolke hinterlassend, mit ihrem Volvo wieder in den Verkehr eingefädelt.
Mit gesenktem Kopf ging ich hastig in mein Büro, damit mich niemand von Marquardts Kollegen auf mein lädiertes Äußeres und die Tagespresse ansprechen konnte. Natürlich hätte ich damit rechnen müssen, dass man auch in Charlottenburger Anwaltskanzleien die Blätter mit den großen Überschriften las. Kaum saß ich hinter meinem Schreibtisch, kam Marquardt federnden Schrittes herein.
»Junge, Junge!«
Sein braungebranntes Gesicht strahlte, jede einzelne pomadierte Haarsträhne saß. An diesem Tag trug er ein rosafarbenes Hemd, das ihm seine perfide Gattin ausgesucht haben musste, und dazu eine mitternachtsblaue Seidenkrawatte.
»Held von Berlin!«
Ich hob beschwichtigend die Hände, aber da krachte auch schon seine Pranke auf meine Schulter. Ich stöhnte auf.
»Tut mir leid«, sagte er und zog sich einen Drehstuhl heran. »Was ist passiert?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden.«
Der Computer fuhr hoch.
Marquardt musterte mich von oben bis unten. Zu Hause hatte ich mich zwar umgezogen, doch das frische Hemd schien die Spuren der Schlägerei in meinem Gesicht eher noch hervorzuheben.
»In der Zeitung steht, du hast einen jüdischen Mitbürger gegen zwei Neonazis verteidigt.«
»Das wird sich spätestens morgen geändert haben. Die Neonazis behaupten nämlich, ich hätte den jüdischen Mitbürger angegriffen und sie wollten ihn lediglich beschützen.«
»Der ist gut.« Er lachte dröhnend. Bis er bemerkte, dass ich keinen Witz gemacht hatte. »Was?«
Der Bildschirm leuchtete auf. Ich tippte mein Passwort ein, das Marquardt ungeniert mitlas.
»Sie haben Anzeige erstattet. Gegen mich.«
Mein Hauptmieter stieß einen leisen Pfiff aus. »Du hast deine Aussage hoffentlich nicht ohne anwaltlichen Beistand gemacht.«
»Ich kann mich an nichts erinnern. Bis vor ein paar Stunden habe ich noch im Krankenhaus gelegen. Marie-Luise erledigt das gerade für mich und versucht, eine Schonfrist rauszuhandeln.«
»Und?«
»Was und?«, fragte ich gereizt zurück. »Ich habe eine partielle Amnesie.«
»Wie? Echt jetzt?«
»Davon ist doch die Hälfte deiner Steuer-Mandanten betroffen. Das dürfte für dich nichts Neues sein.«
Marquardt lächelte leicht gequält.
»Im Ernst. Das passiert häufig. Vor allem wenn man von zwei Schlägern angegriffen wird. Ein Aussetzer. Blackout. Nur an eine Frau, die dabei gewesen sein muss, an die erinnere ich mich noch. Eine Mandantin. Ihr Name ist Rachel.«
Rachel ohne Nachnamen. Rebecca ohne Nachnamen. Ich war Joe gewesen, nichts weiter. Joe, Mike, Daniel, Rudi, Sabine, Ian, Ken … So viele waren damals dort gewesen. Von den meisten wusste ich noch nicht einmal mehr den Vornamen.
Ich öffnete mein E-Mail-Postfach und tippte »Rachel« ein. Nichts. Ich versuchte es noch einmal. Nichts. Ich begann den kompletten Posteingang abzusuchen. Nichts. Langsam drehte ich mich zu Marquardt um. »War jemand an meinem Computer?«
»Wie kommst du denn da drauf?« Die Empörung in seiner Stimme klang echt.
Ich wies mit der Hand auf den Monitor. »Weil alles fehlt, der komplette Schriftverkehr!«
»Hast du denn nichts ausgedruckt?«
»Nein.« Wütend schob ich den Stuhl zurück und stand auf. »Es war noch gar kein Vorgang. Nur ein erster Termin. Gestern früh. Hat einer von euch sie zufällig gesehen?«
»Ich war im Gericht. Und die anderen waren in ihren Büros. Wir brauchen dringend jemanden für den Empfang.«
»Ja«, knurrte ich. Sooft ich Tiffy auch heimlich verflucht hatte, Rachel wäre an ihr nicht unbemerkt vorbeigekommen. »Sie hatte angerufen. Irgendjemand hätte mich empfohlen. Es ging um eine Familiensache, und wegen der wollte sie auch mit Scholl sprechen. Ich kenne Scholl. Jeder kennt ihn.«
»Der neue Galinski, ja. Immer zur Stelle, wenn es was zu kritisieren gibt. Oh, Verzeihung.« Er hob entschuldigend die Hände. »Das war jetzt rein persönlich und nicht politisch gemeint.«
»Er wäre um ein Haar Opfer eines rechtsradikalen Übergriffs geworden, was wer auch immer verhindert hat.«