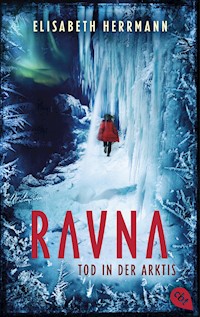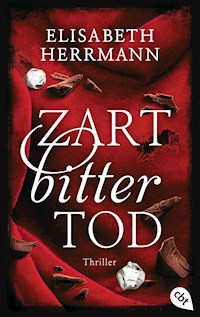11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
Ein Toter in Rumänien und ein ermordeter Bauer in Brandenburg – noch ahnt Anwalt Vernau nicht, worauf er sich bei der Verteidigung des jungen Lucian Sandu einlässt, der in die Ereignisse verwickelt zu sein scheint. Der Saisonarbeiter hat gestanden, seinen Chef brutal ermordet zu haben, doch es gibt Widersprüche, und bald ist Vernau sicher, dass Lucian mit seinem Geständnis jemanden schützen will. Auf den ersten Blick sind Verrat, Gier und Hass das Motiv. Aber als Vernau auf dem Hof die geheimnisvolle Rumänin Tina kennenlernt, ist er sich sicher, dass es auch um die Liebe geht. Und um ein furchtbares Geheimnis, das alle vernichten wird, sollte es jemals gelüftet werden. Auch ihn selbst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Ein Toter in Rumänien und ein ermordeter Bauer in Brandenburg – noch ahnt Anwalt Vernau nicht, worauf er sich bei der Verteidigung des jungen Lucian Sandu einlässt, der in die Ereignisse verwickelt zu sein scheint. Der Saisonarbeiter hat gestanden, seinen Chef brutal ermordet zu haben, doch es gibt Widersprüche, und bald ist Vernau sicher, dass Lucian mit seinem Geständnis jemanden schützen will. Auf den ersten Blick sind Verrat, Gier und Hass das Motiv. Aber als Vernau auf dem Hof die geheimnisvolle Rumänin Tina kennenlernt, ist er sich sicher, dass es auch um die Liebe geht. Und um ein furchtbares Geheimnis, das alle vernichten wird, sollte es jemals gelüftet werden. Auch ihn selbst …
Weitere Informationen zu Elisabeth Herrmann
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Blutanger
Kriminalroman
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Taschenbuchausgabe Juli 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Regina Carstensen
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: Trevillion Images / Drunaa; © FInePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30555-0V002
www.goldmann-verlag.de
Für Shirin
Er stand an diesem Grab, nachts. Frisch aufgeworfene Erde, beschienen vom Licht eines bleichen Mondes. Ein Holzkreuz, so nachlässig in den Hügel gerammt, dass es bald umfallen würde.
Und er war nicht allein.
Die kahlen Zweige zitterten im Wind. Er wusste, dass er umdrehen und verschwinden sollte. Dass gleich etwas Grauenhaftes, Unvorstellbares geschehen würde. Aber er war wie aus Stein, gelähmt und unfähig, sich zu rühren.
Und dann rieselte ein kleines Bröckchen von der Spitze des Hügels. Noch eines. Mehr. Die Erde bewegte sich. Eine Hand fuhr heraus, graufleckig, mit violetten Fingernägeln und verrottendem Fleisch über gekrümmten Knochen. Auf ihn zu. Packte ihn. Zog ihn zu der Erde, die in Aufruhr geriet, als der Leichnam sich aufrichtete und ihn aus leeren Augenhöhlen anstarrte.
Er wollte schreien.
Sich wehren.
Wegrennen von diesem namenlosen Grauen, das ihn heimsuchte, jede Nacht seit dieser verfluchten Nacht, aber er war gefangen in einem Albtraum, aus dem ihn nichts mehr retten konnte.
Der Tote zog ihn hinab in die Hölle, und sie schmeckte nach Erde und dreckigem Geld.
Ein Jahr zuvor
Autogara Timișoara (Busbahnhof Temeswar), Rumänien
Es war zwei Uhr morgens in einer von Hitze nachglühenden Stadt, als der Reisebus die Vororte erreichte. Die Stadt hatte ihr Nachtkleid angelegt: geisterhaftes Licht, leere Straßen, nur ein paar Hunde waren unterwegs, schnürten über Industriebrachen vorbei an hastig hochgezogenen Zweckbauten, die all den anderen Städten auf der Strecke ähnelten: Prag, Brünn, Bratislava, Budapest. Nach siebzehn Stunden Fahrt hatte Dragos auch keine Energie mehr, sich darüber Gedanken zu machen. Er war froh, die Strecke hinter sich zu haben und jetzt erst einmal auszuschlafen. Hinter ihm schnarchte ein voll besetzter Bus: Saisonarbeiter, Heimkehrer, Billigtouristen.
Sie hatten mehrere Stunden Verspätung, die ihm von seiner knappen Freizeit abgezogen wurden, und deshalb preschte er schneller als erlaubt das Ufer der Bega entlang und bog mit quietschenden Reifen, asthmatisch keuchenden Bremsen und einer fast bedenklichen Schieflage auf die Brücke der Arbeit[1] ab, die zum Bezirk Josefin führte.
Schuld an der Verzögerung waren die vielen Staus rund um Prag und Bratislava, aber auch ein ungeplanter Zwischenfall auf einem Parkplatz bei Brünn, der fast in eine Schlägerei ausgeartet war.
Dort nämlich warteten Hütchenspieler auf leichtgläubige Opfer, und Dragos besserte seinen kargen Lohn als Busfahrer auf, indem er sich als Lockvogel unter die Zuschauer mischte. Seine Gewinne musste er später in einer dunklen Ecke hinter der Raststätte wieder abgeben. Aber fünfzig Euro waren ihm jedes Mal sicher.
Dieses Mal hatte es Ärger gegeben. Das passierte ab und zu, und Dragos ahnte das heraufziehende Unheil, weil er die Menschen kannte, die er seit Jahren von einem Land ins andere brachte. Ein bulliger Typ hatte den einen der drei Spieler am Kragen gepackt und unmissverständlich gefordert, ihm sein Geld zurückzugeben. Vierhundertfünfzig Euro. Hatte der Mann nicht alle Tassen im Schrank? Man wusste doch, worauf man sich bei diesem Glücksspiel einließ!
Bevor der Betrogene dem Betrüger die Finger brechen konnte, waren auch schon die beiden Komplizen bei ihrem bedrängten Kompagnon. Wüste Beschimpfungen flogen hin und her, erste Handgreiflichkeiten folgten. Die Busreisenden, die ebenfalls Geld verloren hatten, scharten sich um ihren Wortführer, und die drei Kleinganoven bekamen zu spät mit, dass sie eingekreist waren.
Dragos war dazwischengegangen, aber die Stimmung heizte sich immer mehr auf. Zu allem Unglück hielt nun auch noch ein Wagen der tschechischen Autobahnpolizei an der Tankstelle. Die beiden Beamten bekamen mit, dass es an einem der Reisebusse Stress gab, und beschlossen, mal nach dem Rechten zu sehen. Dank Dragos gelang es den Hütchenspielern zu türmen, aber die erbosten Geprellten wollten natürlich Anzeige erstatten, da auch ihr sauer verdientes Geld verschwunden war.
Dragos hatte sich herausgehalten und war zurück in den Bus gestiegen. George, sein Kollege, schlief nach seiner Ablösung den Schlaf der Gerechten. Ein paar Frauen saßen noch in den Reihen hinter ihm, maskenhaft beleuchtete Gesichter vor den Displays ihrer Handys. Auf der Rückbank hatte sich ein Mann ausgestreckt. Ein Ehepaar, das sich mit Zähnen und Klauen beim Einsteigen vorgedrängt und die Plätze in der ersten Reihe erobert hatte, tuschelte missbilligend über die Verspätung, die Dummheit der Menschen im Allgemeinen und die ihrer Mitreisenden im Besonderen.
Schließlich drückte er auf die Hupe und ließ den Motor an. Einer nach dem anderen enterte den Bus, wütend, schnaubend oder resigniert, und die tschechischen Bullen machten den Abgang.
Satz mit X mit den fünfzig Euro. Samstagswasser, wie man bei ihm zu Hause sagte. Dragos hatte Gas gegeben, aber er machte sich schon einmal darauf gefasst, bei seiner Ankunft am Busbahnhof von wartenden Angehörigen und Freunden der Passagiere nicht gerade freundlich empfangen zu werden. Als ob er schuld wäre an den Schlaglöchern und dem immer chaotischer werdenden Verkehr auf der Rumänienroute.
Und der Dummheit dieser Vollidioten, die kaum lesen und schreiben konnten, aber glaubten, solchen Könnern wie den Hütchenspielern überlegen zu sein.
Der Busbahnhof Normandia kam in Sicht, ein schmuckloses Betongebäude mit mehreren Haltestellen, auch die leer und verlassen. Erst ab vier Uhr morgens herrschte hier wieder Betrieb. Er nahm die erste und parkte ein.
Die Fahrgäste quetschten sich in den Gang und drängelten nach der langen Fahrt hinaus, noch bevor George das Gepäckfach unter dem Wagen geöffnet hatte und dann das Weite suchte. Das übliche Rufen, Schubsen und Fluchen begann, bis Dragos jedem seine Kisten und Koffer übergeben hatte und die Leute sich entweder zu Fuß auf den Weg nach Hause begaben oder es sich an der Wand des Busbahnhofs bequem machten, um auf den Weitertransport in alle Teile des Banat zu warten.
Er wartete, bis sie von dannen gezogen waren, und wollte das Gepäckfach schließen. Er stutzte. Ein Koffer lag noch darin. Ein billiges Teil mit zwei abgenutzten Rollen, der Kunststoff gerissen und notdürftig mit Klebeband geflickt.
Er machte diesen Job lange genug, um zu wissen, was in diesen Koffern war. Abgetragene Kleidung, alte Schuhe, ein paar benutzte Toilettenartikel. Alles, was auch nur den geringsten Wert besaß, trugen die Heimkehrer bei sich. Das da gehörte einem armen Teufel, der wochenlang in Deutschland gearbeitet hatte und nun mit ein paar Hundert Euro und den Arbeitsklamotten nach Hause zurückkam. Mitten in der Saison. Vielleicht war er gefeuert worden. Oder der Vater krank, die Mutter gestorben, das Kind am Wochenende bei der heiligen Kommunion. Es interessierte Dragos nicht. Für ihn war der Koffer zehn Kilo Müll, die er, Optimist, der er war, natürlich nach Verwertbarem durchsuchen und dann hinten an der Bega zu dem anderen Müll werfen würde, der sich dort angesammelt hatte.
Andererseits … etwas ließ ihn noch einmal den Bus entern. Einmal hatte er eine Geldbörse gefunden. Im Lauf der Jahre zwei Handys. Ein Kondom, benutzt. Weiß der Teufel, wie die das in einem vollen Bus angestellt hatten. Klamotten. Schuhe. Mützen. All das, was die Leute eben so bei sich trugen und dann in der Eile liegen ließen.
Einen Koffer hatte noch nie jemand vergessen. Der Koffer machte sie doch erst zu dem, was sie waren. Transitreisende zwischen den Welten. Flüchtlinge in die Wohlstandswelt, von der sie sich einen Krümel stibitzten, um dann in ihr Elend zurückzukehren. Die Koffer erzählten von ihrer Reise, ihrer Plackerei und davon, dass sie zurückkamen, weil diese glitzernde Verheißung im Norden Europas ihnen nicht das geben konnte, was sie an ihrem Ende der Welt hatten.
Heimat.
Dragos stand vorne im Gang des Busses und ließ den Blick über die Sitzreihen gleiten. Sie waren leer.
Er hätte später nicht sagen können, warum er nicht ausstieg, die Tür verschloss und sich auf den Weg nach Hause machte. Vielleicht war es eine unbewusste Erinnerung an jemanden. Vielleicht ein Bild ganz hinten am Rand des fotografischen Gedächtnisses. Er ging noch einmal die Reihen entlang, eine nach der anderen, und in der Mitte des Busses stockte er.
In der letzten Reihe lag jemand auf dem Boden und rührte sich nicht. Heillos besoffen wahrscheinlich. Hoffentlich kotzte er ihm nicht noch den Bus voll.
»Hei!«, rief er. »Totul okay?«[2]
Der Mann rührte sich nicht. Dragos ahnte, dass er aus dieser Nummer so schnell nicht wieder herauskam und er den Feierabend vergessen konnte. Etwas an dieser Gestalt verriet ihm, dass er keinen Bewusstlosen nach Timișoara gefahren hatte. Während er seinen Weg durch den Gang in Richtung der leblosen Gestalt am Boden fortsetzte, holte er das Handy heraus und wählte den Notruf.
Der Mann hatte sich im Todeskampf noch einmal zusammengekrümmt. Seine blicklosen Augen starrten auf den Boden unter den Sitzreihen, auf Dreck, Staub und liegen gelassenen Müll. Der linke Arm ausgestreckt, der rechte vor der Brust angewinkelt. In der Hand ein kleines, billiges Medaillon. Dragos wusste, wer darauf abgebildet war und dass der heilige Christophorus dieses Mal versagt hatte.
Aber das war Gotteslästerung. Oder Heiligenlästerung. Oder was auch immer. Dracu,[3] dachte er. Warum hier und warum jetzt?
»Buna ziua«,[4] drang eine weibliche Stimme aus seinem Handy. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Dragos schluckte und setzte sich in Reihe 43.
»Mir geht’s gut«, sagte er. »Aber ich habe einen Toten im Bus.«
1
Es war Freitag, der 23. Juni, und Marie-Luise hatte mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie wollte etwas starten, was sich mit viel Glück – sehr viel Glück und noch mehr Optimismus, wenn man ihre Kochkünste zum Maßstab setzte – zu einer jährlichen Tradition entwickeln sollte.
Ein Spargelessen in der Kanzlei.
Beim letzten Versuch waren glücklicherweise keine Opfer zu beklagen gewesen, auch wenn die hölzernen Fasern bei Marquardt zu einem Erstickungsanfall geführt hatten und Mutter bei jeder weiteren sich bietenden Gelegenheit mit Spargelschälern auftauchte, die sie in sämtlichen Schubladen der Kanzlei versteckte und ein subtiler Hinweis darauf sein sollten, wie man dieses zarte Gemüse zu behandeln hatte.
Für mich waren die Wochen zwischen dem 15. April und 24. Juni eine Art nachgeholte Fastenzeit. Egal wo man eingeladen war, es gab Spargel. Egal, welches Restaurant man betrat, es gab eine Spargelkarte. Ein echtes Luxusproblem. Aber irgendwann kommt einem der Spargel zu den Ohren heraus.
»Übermorgen ist Schluss«, hatte Marie-Luise in einem Ton erklärt, als hätte sie mich schon wieder beim Schwarzfahren erwischt. »Dann ist die Spargelsaison zu Ende. Wir sind acht Leute, das sind vier Kilo, mindestens. Und ich will sie aus Jessendorf.«
Es war einer der ersten schönen Abende in diesem Jahr. Ein kalter Frühling hatte sich viel zu lange eingenistet und die Hoffnung auf mediterrane Temperaturen schon zu Ostern unter letztem Schnee bedeckt. Aber jetzt wehte endlich durch die weit geöffneten Altbaufenster der warme Atem der Stadt. Fast schon zu warm für diese Jahreszeit.
»Jessendorf«, murmelte ich und versenkte mich wieder in den Fall des Lkw-Fahrers Josef Kürschner, der die Einfahrt zum Betriebsgelände eines Containervermieters zugeparkt hatte, der daraufhin einen Tobsuchtsanfall bekam und Kürschner als »egoistisches Arschloch« beschimpfte, worauf es zu einem nonverbalen Meinungsaustausch und einer Mittelgesichtsfraktur Kürschners gekommen war.
Die beiden Männer hatten sich längst bei Molle und Korn vertragen, aber Kürschner wollte die Fraktur als Arbeitsunfall geltend machen, da er sie sich bei der Rückkehr von einer Betriebsfahrt zugezogen hatte. Der Fall landete vorm Sozialgericht und auf meinem Schreibtisch. Die Verhandlung war für morgen angesetzt, und ich fand, dass sie ein ausgezeichneter Grund war, nicht auf Spargelfahrt ins Brandenburgische zu gehen.
»Ich hole dich um elf Uhr dreißig ab«, sagte sie nur.
»Moment. Mein Termin ist um elf!«
»Büchner ist der Richter. Der macht immer pünktlich Mittag. Erst recht zum heiligen Wochenende. Also dann?«
Ich hatte mich auf eine langwierige Verhandlung mit einem elendem Paragrafenaustausch aus dem Sozialgesetzbuch vorbereitet und war zugegebenermaßen überrascht, als es genau so kam, wie meine Kanzleipartnerin es vorhergesagt hatte.
Unsere Klage wurde abgewiesen. Denn: Kürschner hatte den Fehler begangen, unmittelbar vor der Schlägerei die Wagentür wütend hinter sich zuzuwerfen, was eine Unterbrechung der Betriebsfahrt war und es deshalb auch keinen Versicherungsschutz gab.
Man kann daraus zweierlei lernen. Es gibt nichts, was nicht vor Gericht landet. Und, mein Tipp am Rande: Bei Schlägereien in der Nähe des Autos immer die Wagentür offen lassen.
Ganz nebenbei – als Drittes schrieb ich mir auf die Fahnen, Sozialgerichtsprozesse zu vermeiden. Sie waren nicht mein Beritt. Zudem blieb Kürschner auf den Gerichtskosten sitzen und würde, um sie sich aus den Rippen schneiden zu können, seine Anwaltsrechnung nicht bezahlen. Da er durch eine Empfehlung meiner Mutter bei mir aufgetaucht war, für die Kürschner auch kleinere Arbeiten im Haushalt erledigte, gesellte noch das Persönliche. Den Handyman meiner Mutter mit Zahlungsaufforderungen zu verprellen, kam einem Aussetzen in der Diaspora gleich, in der sich tropfende Wasserhähne, Deckenrisse und durchrostende Heizungsrohre zu einem Wohnalbtraum verdichten würden, aus dem heraus es nur noch die Flucht nach vorne gab.
Eine neue Wohnung.Seniorengerecht.Betreut irgendwie.Von mir aus zusammen mit Hüthchen.Bezahlbar.In Berlin.Wir haben damit ungefähr umrissen, was der Albtraum von Söhnen ist. Und Töchtern, die auch natürlich. Mitanzusehen, dass es so nicht mehr lange weitergeht, und keine Lösung zu finden, die nicht alle Beteiligten in den Ruin treibt.
Während ich neben Marie-Luise schweigsam aus Berlin hinaus Richtung südliches Brandenburg gekarrt wurde, schmolzen die Optionen vor meinem inneren Auge zu einem schmalen Korridor finanziellen Darbens, an dessen Ende nicht etwa ein Licht leuchtete, sondern Mutters Tod.
Es war brutal. Mutter kam kaum noch die Treppen hoch. Hüthchen erledigte die Einkäufe, was die Arme derart auszehrte, dass sie zu weiteren häuslichen Verrichtungen nicht mehr in der Lage war. Meine wöchentlichen Besuche wurden überschattet von Wäschewaschen, Bettzeug wechseln, Klo putzen und den Alkohol- und Medikamentenmissbrauch kontrollieren. Ihr ehemaliger Mitbewohner in einem alten Gewerbehof in Mitte, dem zu verdanken war, dass meine Mutter eine der letzten bezahlbaren Mietwohnungen in Berlin aufgegeben hatte, war sein Grundstück zum Preis von zwei Learjets mit Kusshand losgeworden und hatte sich mit einer dreißig, vierzig, fünfzig? Jahre Jüngeren nach Gran Canaria abgesetzt. Mutter und Hüthchen, plötzlich obdachlos, hatten Unterschlupf in einer abgerockten Zweizimmerwohnung im Wedding gefunden, Untermiete, möbliert, zu einem Preis, der mich jetzt schon ausblutete.
Und der Hauptmieter kam demnächst zurück von seinem Auslandsaufenthalt und wollte wieder einziehen. Die einzige Lösung, die sich nach endlosem, zermürbendem Suchen nach bezahlbarem Wohnraum abzeichnete, war, dass die beiden zu hochbetagten Hausbesetzerinnen wurden.
Aber es gab keine Häuser in Berlin mehr, die man besetzen konnte. Allenfalls Rohbauten, an denen sich die Investoren verhoben hatten, weil die Baukosten ins Astronomische gestiegen waren und den potenziellen Käufern die Puste ausging. Zwanzigtausend Euro pro Quadratmeter waren keine Seltenheit mehr. Irgendwann würde ich meinen ersten Fall haben, in dem es nicht mehr um Mord aus Eifersucht oder Habgier ging, sondern um einen Mietvertrag.
»Muss ich hier abfahren?«
Ich schreckte aus meinen apokalyptischen Endzeitvisionen hoch. Freitagmittag bei Badewetter nach Brandenburg, die Idee hatte schon auf der Stadtautobahn zum ersten Stau geführt.
»Keine Ahnung. Navi?«
»Der Akku ist alle.«
Marie-Luise hat sich neben vielerlei anderen Eigenheiten ihren Hang zu alten Volvos bewahrt. Ich mochte diese röhrenden Dreckschleudern, in denen der Sendersuchlauf noch ein mechanischer Knopf war und im Aschenbecher halb aufgerauchte Joints lagen. Es hatte mal einen Zigarettenanzünder gegeben, aber der war außer Betrieb und deshalb nicht geeignet, neuzeitliche Dinge wie ein USB-Kabel mit Strom zu versorgen.
Ich holte mein Handy heraus.
»Jessendorf?«
»Der Grundmann-Hof. Der hat den besten Spargel.«
»Hast du eine Adresse?«
»Der Grundmann-Hof.«
»Okay.«
Ich gab Jessendorf ein. Wir wurden an der nächsten Abfahrt auf eine Landstraße geleitet, die uns vorbei an schnurgerade aufgereihten Alleen durch entzückende, etwas verschlafen wirkende Orte führte. Ich erinnerte mich an einen Landausflug mit Marie-Luise vor vielen Jahren. Es war im Sommer gewesen, und ich hatte aus zweierlei Gründen Herzklopfen gehabt. Angst vor dem, was wir erfahren würden. Und sie neben mir.
Ihre roten Locken wurden von ersten silbernen Haaren durchzogen. Die Fältchen um ihre Augen gruben sich beim Lachen tiefer ein als damals. Ich fragte mich, welche Veränderungen ihr an mir auffallen würden, wenn sie jemals auf diesen Gedanken kommen würde. Ich glaube, er liegt ihr fern.
Jessendorf verteilte sich um eine niedrige Kirche in kleinen, abzweigenden Dorfstraßen. Liguster- und Wacholderhecken, mehr oder weniger getrimmt, umrahmten Vorgärten, in denen Pfingstrosen und Rhododendren eine malerische Blütenpracht entfalteten. Es gab eine Milchtankstelle und ein Bushäuschen. Aber keinen Bauernhof. Eine rüstige ältere Dame wies uns Richtung Ortsausgang.
»Nicht da, wo die Container stehen. Noch zwei Kilometer weiter.«
Wir folgten der Anweisung und rollten wenig später über den Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs mit mehreren großen Hallen, Ställen, einem Silo, Nebengebäuden und, rechter Hand, ein Wohnhaus mit einem kleinen Anbau.
Vor dem stand ein junger Mann in Arbeitsoverall und brüllte:
»Krebitz! Komm raus!«
Eine Frau mittleren Alters in Jeans und Karohemd wollte den Rufer offenbar beschwichtigen. Aber der hörte nicht auf sie und brüllte weiter.
»Wenn wir ungelegen kommen …?«, sagte ich zu Marie-Luise.
Die zog die Stirn kraus und zog den Schlüssel ab.
»Aber hier muss es sein. Caro hat gesagt, die verkaufen jetzt zu Spottpreisen und direkt vom Hof.«
Ich hatte längst aufgegeben, die gefahrenen Kilometer und den Benzinverbrauch gegen einen Spargelkauf im nächsten Berliner Supermarkt aufzurechnen. Für Marie-Luise gehörte die Heimsuchung des Erzeugers zum Essen dazu wie Sauce Hollandaise.
Der junge Mann sah sich irritiert nach uns um und fing dann wieder an zu brüllen.
»Krebitz, du Sau!«
Ich hob die Augenbrauen. »In Luckau habe ich einen Supermarkt gesehen. Wenn wir das Zeug da holen, kommt es ja auch aus Brandenburg.«
Marie-Luise schnaubte verächtlich. Während die Frau im Karohemd versuchte, den jungen Mann von der Haustür des Anbaus wegzuziehen, näherte sich der satte Sound einer dieselbetriebenen Zugmaschine samt Anhänger. Ein bulliger Mann saß im Sattel und hielt mit seinem Gefährt direkt auf die beiden zu.
»Moment …«, sagte ich.
Marie-Luise sprang aus dem Volvo und winkte mit beiden Armen. Ich war gerade noch rechtzeitig bei ihr, um sie wegzuzerren, sonst hätte der Verrückte sie gleich mit umgenietet.
»Halt! Stopp!«, schrie sie gegen den Motorenlärm und riss sich los.
Der junge Mann rannte direkt auf den Trecker zu, die Frau im Karohemd folgte ihm.
»Grundmann, komm runter!«, brüllte er.
Der Fahrer stoppte die Maschine keine zwei Meter vor ihnen und blinzelte mit kleinen, boshaften Augen auf die vier Leute herunter, die sich um ihn aufgereiht hatten.
Schließlich schaltete er den Motor aus und sprang erstaunlich behände herab.
Er war einen halben Kopf kleiner als ich, hatte aber Schultern wie ein Preisboxer und einen Bauch wie ein Bierfass. Er trug eine ausgewaschene, staubige Latzhose, die fast aus den Nähten platzte.
»Das geht von deinem Lohn ab«, schrie er den jungen Mann an. »Du sollst arbeiten und nicht dem lieben Gott den Tag stehlen!«
Der, den er meinte, war vielleicht Mitte zwanzig. Ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit einem hageren, scharf geschnittenen Gesicht und vor Wut blitzenden Augen. Seine Arbeitskleidung war dreckig, viel getragen und zerschlissen, aber sorgfältig von Hand immer wieder ausgebessert worden.
»Lohn«, zischte er. »Ich will das Geld. Alles Geld.«
»Halt dich an den Vertrag.«
»Contracta ist Bullshit!«
»Nichts da. Contracta kein Bullshit«, ahmte der Mann, dem der Hof offenbar gehörte, den Jungen nach. »Contracta sagt, ohne Arbeit kein Geld. Und jetzt aus dem Weg!«
Er wollte den Jungen beiseiteschieben, aber der hatte nur darauf gewartet, dass ihm jemand an die Wäsche wollte. Er gab dem älteren Mann einen wütenden Stoß, der ihn fast ins Taumeln brachte.
»Und was ist mit den anderen?«, schrie der Junge, der gar nicht zu bemerken schien, dass er Zeugen hatte. »Du beklaust doch jeden! Jeden! Ob tot oder lebendig!«
»Willst du arbeiten oder diskutieren? Wenn du diskutieren willst, dann verschwinde! Sofort!«
»Nein!«, schrie die Frau im Karohemd. »Herr Grundmann, Sie müssen sich ans Gesetz halten. Sie können nicht einfach …«
»Ich kann nicht was? Zulassen, dass Krethi und Plethi hier hereinmarschieren? Wer sind Sie eigentlich?« Seine kleinen Augen wanderten von der Frau zu uns.
Ich hatte bei diesem Blick den Impuls, mich hinter Marie-Luise zu verstecken. Tat es aber nicht.
»Und ihr zwei?«
Damit wandte er sich wutentbrannt an uns. Ich hob beschwichtigend die Hände.
»Wir wollen nur ein paar Pfund Spargel kaufen.«
»Drüben im Hofladen«, bellte er. »Macht meine Frau.«
Er wies auf das Haupthaus. Die Tür stand offen, und man sah einen roh gezimmerten Tresen mit mehreren Kisten und ein Schild mit der Aufschrift »Spargel, Erdbeeren, Eier, Kartoffeln«.
»Ah, danke.«
Ich wollte mich in Bewegung setzen, hatte aber die Rechnung ohne Marie-Luise gemacht.
»Was ist hier los?«, fragte sie.
Erst jetzt bemerkte ich, dass die Frau im Karohemd eine Umhängetasche bei sich trug. Sie griff in sie hinein und holte ein paar Flugblätter heraus.
»Ich bin Frigga Lade, IG Bau, Gewerkschaft Freie Arbeiter. Ich verteile Informationen zu den Rechten der Saisonarbeiter.«
Marie-Luise hatte noch nicht einmal die Hand ausgestreckt, als Grundmann die Blätter schon ergriffen hatte und sie mit seinen Pranken zerfetzte.
»Hier werden keine Flugblätter verteilt!«
»Ich mache Feldrandaufklärung. Ich gehe zu den Äckern, auf denen diese Leute für einen Hungerlohn schuften, und informiere sie über ihre Rechte. Das Recht auf Krankenversicherung, auf Mindestlohn, auf menschenwürdige Unterbringung …«
Alles Triggerworte, die Grundmann offenbar zum Äußersten trieben. Er trat so nahe an Frigga heran, dass seine Nasenspitze beinahe ihre berührte.
»Soll ich erst mein Gewehr holen, oder verpisst du dich jetzt freiwillig?«
»Herr Grundmann?«, schaltete ich mich ein und wagte mich endgültig aus Marie-Luises Windschatten. »Ich bin Rechtsanwalt. Ich würde Ihnen dringend raten, sich zu mäßigen.«
Grundmann sah aus, als ob er das genaue Gegenteil vorhätte. »Ein Rechtsanwalt? So? Braucht hier jemand einen?« Er wandte sich an den jungen Mann. »Du? Hast du ihn geholt?«
Und zu Frigga: »Oder du, du Gewerkschaftsfotze? Macht, dass ihr verschwindet! Allesamt!«
Ich holte meine Karte heraus und reichte sie Frigga. »Wenn Sie Anzeige erstatten wollen wegen Beleidigung und Nötigung?«
Sie nahm die Karte und grinste. Eine sympathische, bodenständig wirkende Frau mit ein paar Zornesfalten. Sie hatte einen Sonnenbrand auf der Stirn und dem Nasenrücken. Nicht viel Schatten am Feldrand.
»Das mit der Gewerkschaftsfotze würde ich mir überlegen. Was steht denn auf so was?«
»Keine Haft, aber eine saftige Geldstrafe.«
Grundmann spürte, dass er zu weit gegangen war. Er wischte sich mit seiner Pranke über die schweißverschmierte Stirn. Kein sympathischer Typ. »Das ist mir so rausgerutscht. Ich entschuldige mich. Nichts für ungut.«
Damit stapfte er zu seinem Anhänger und kam mit einem Arm voll Gurken zurück. »Hier. Regional und bio.«
Keiner nahm eine.
»Okay.«
Grundmann warf sie zurück auf den Anhänger. »Dann Abmarsch bitte.«
Der junge Mann öffnete den Mund, aber Frigga hatte auch ein gutes Gespür, ab wann man den Bogen nicht mehr überspannen sollte.
»Okay. Ich gehe. Vorerst. Lucian? Wir sehen uns.«
Lucian, der junge Mann mit einer offenbar gar nicht so unbegründeten Wut über seinen Contracta, rang mit sich. Dann nickte er und verließ den Hof.
»Ich denke, wir fahren wieder«, sagte ich.
Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, dass der Ältere kopfschüttelnd zurück zu seinem Trecker stapfte.
»Supermarkt?«
Sie blieb an ihrem Wagen stehen und beobachtete Grundmann, der mit seiner Ernte in eine der Hallen zur Linken fuhr, deren weite Tore sperrangelweit offen standen. Ein paar Männer in Arbeitsklamotten traten heraus und spähten zu uns hinüber. Kollegen von Lucian, die mitbekamen, dass die Revolte nicht gut gelaufen war.
»Du wirst nirgendwo etwas Essbares finden, das nicht durch Ausbeutung aus dem Boden gerissen wurde«, sagte ich. »Es sei denn, wir pflücken jetzt etwas Giersch und Rauke.«
»Das ist mir sowieso viel zu groß hier«, sagte sie und stieg ein.
Aber auf dem ganzen Weg zurück zur Autobahn kamen wir in keinem Dorf an einem efeuüberrankten kleinen Bauernhaus vorbei, wo in Glück und Wohlstand gealterte freundliche Bäuerinnen mit Apfelbäckchen ihre Waren anboten.
In Berlin gingen wir in den nächsten Supermarkt.
2
Ich erinnere mich noch, dass es am folgenden Abend trotzdem ein lustiges Essen wurde. Es gab drei gegrillte französische Maishähnchen, von denen wir annahmen, dass sie ein besseres Leben als ihre Artgenossen hierzulande gehabt hatten, dazu einen Salat aus Löwenzahn, Radieschenblättern und Stiefmütterchenblüten, selbst gebackenes Brot und Butter aus einer anerkannt ausschließlich mit glücklichen Kühen arbeitenden kleinen Manufaktur.
Irgendwann im Laufe des Abends kamen wir darauf, dass es nahezu ausgeschlossen war, sich rücksichtsvoll und regional zu ernähren, es sei denn, man beackerte die eigene Scholle. Was in Berlin mit Grünflächen in der Größe unserer Balkonkästen kaum möglich war.
»Was meinte er denn mit Contracta?«, fragte KHK[5] Vaasenburg, den Marie-Luise sehr zu meinem Unwillen ebenfalls eingeladen und dem sie den Vorfall geschildert hatte.
»Seinen Arbeitsvertrag«, antwortete sie und knabberte, ganz gegen ihre sonstigen veganen Gewohnheiten, an einem Hühnerbein herum. »Ich habe mich mal etwas eingelesen, was die Gewerkschaft Freie Arbeiter will. Demnach kommen mehr und mehr die Ärmsten und leider auch bildungsfernsten Leute aus Süd- und Osteuropa zu uns.«
»Bildungsfern« ist so ein Ausdruck, den ich aus dem allgemeinen Wortschatz gerne gestrichen hätte. Er umschrieb eine Tatsache auf eine Weise, die mir nicht gefiel. Beamtendeutsches Abgrenzen. Marie-Luise war nicht so, ich kannte sie lange genug. Aber ihre politische Korrektheit forderte spätestens nach dem dritten Glas Wein meinen Widerspruchsgeist heraus.
Glücklicherweise war ich erst beim zweiten.
»Das heißt, dass viele gar nicht wissen, was sie hier unterschreiben, wenn sie ankommen. Versteht mich nicht falsch. Die meisten Bauern sind korrekt. Aber manche eben nicht. Der Mindestlohn wird unterlaufen, indem man ihn durch Akkord ersetzt. Die Pässe werden eingesammelt und nicht mehr rausgerückt, bis sie das Land wieder verlassen. Löhne werden dann in bar ausgezahlt, manchmal wie bei der Mafia mit privaten Security-Leuten, die jeden, der sich beschwert, persönlich zum Bus führen.«
»Tatsächlich?«
Mutter stocherte in ihrem Salat herum.
»Die armen Leute. Aber warum ist dann alles so teuer im Supermarkt?«
»Frag den Handel.« Marie-Luise erhob sich und schenkte uns Wein nach. »Der diktiert die Preise.«
»Nicht die Bauern?«, erklang Hüthchens Bass. »In meiner Jugend war der Bauernstand noch was Besonderes. Heute kriegen sie noch nicht mal mehr eine Frau.«
Sebastian Marquardt saß links neben mir und schöpfte sich zwei Kellen Sauce auf sein halbes Hähnchen, bevor er den Topf seiner Mutter anbot.
Xenia Marquardt war die Reinkarnation der Wilmersdorfer Witwe. Stets in noblem Schwarz, die schmalen Handgelenke fast zu schwach für die schweren Goldarmbänder, die Chanel-Handtasche auf dem Schoß oder heute einmal ausnahmsweise über die Stuhllehne gehängt.
Sie wohnte in der Etage über der Kanzlei. Eine Siebenzimmerwohnung mit ausgewählten Antiquitäten und persischen Teppichen. Repräsentativ auf Immobiliendeutsch, erste Lage, unbezahlbar zu heutigen Preisen. Ihr verstorbener Mann hatte in Berliner Innenstadtlagen investiert, als noch niemand an die Wiedervereinigung geglaubt hatte. Ich hatte den Verdacht, dass sie einsam war und sich mit ihrer Schwiegertochter nicht richtig verstand.
Im Übrigen war sie die Freude eines jeden Gastgebers. Stets brachte sie eine Flasche erlesenen Champagners mit, aß aber im Gegenzug nicht mehr als drei Teelöffel. Auch dieses Mal schrie sie leise auf, als ihr Sohn es wagte, mehr als drei Milliliter Sauce béarnaise auf ihrer halben Pellkartoffel zu platzieren.
Sebastian Marquardt hingegen hatte ein paar Pfund zugelegt seit man ihm nahegelegt hatte, diverse Mitgliedschaften in Golf-, Tennis- und Ruderclubs ruhen zu lassen. Dafür war Biggi, seine Frau, dünner geworden. Auf dem Papier leitete sie jetzt seine Kanzlei am Kurfürstendamm, in der wir mit unseren Büros untergekommen waren. Sein Antrag auf Wiederzulassung lag bei der Anwaltskammer, und ich hatte den Verdacht, dass man ihn dort gerne noch etwas länger schmoren lassen wollte. Zumindest, bis seine Bewährung abgelaufen war und seine Vorstrafe wegen Steuerhinterziehung langsam ins Vergessen geriet.
»Gutes Essen kostet eben«, sagte er und wehrte die Salatschüssel ab, die ihm von Marie-Luise angeboten wurde. »Maman?«
Bei ihm, der nie Französisch gelernt hatte, klang es, als ob er Schnupfen hätte. Maman ließ sich ein Salatblatt auf den Teller legen.
»Und was machen die, die es sich nicht leisten können?«, giftete Hüthchen.
»Die essen Kuchen.«
Marquardts meckerndes Lachen über den lahmsten aller Essensscherze wurde von niemandem erwidert.
»Natürlich nicht.« Seine Frau Biggi, wie ihre Schwiegermutter in Schuhe, Gürtel und Goldketten im Gegenwert eines Kleinwagens gezwängt, schenkte ihrem Gatten einen missbilligenden Blick. »Wir spenden für die Berliner Tafel.«
»Da, wo verteilt wird, was übrig bleibt?«
Hüthchen war bei Biggi ganz offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Feindbild.
Diese hob irritiert die Augenbrauen. »Nein. Also ja, aber wir spenden, damit dazugekauft werden kann. Natürlich bringen wir nicht unsere Reste dahin.«
»Was machen Sie dann damit?«
»Wir … ähm …« Biggis Blick mäanderte über den Tisch auf der Suche nach Hilfe, aber keiner wollte sich bei diesem heiklen Thema als Verschwender outen. »Wir wärmen es auf. Am nächsten Tag.«
»Das tut ihr nie.«
Xenia dekorierte ihr Salatblatt neben die Kartoffel.
»Ich habe noch Eichelsuppe und falschen Honig gegessen, damals, nach dem Krieg.«
Alle sahen sie an. Keiner sagte ein Wort. Es war auch zu erstaunlich, dies aus dem schmalen Mund einer Frau zu hören, die immer so aussah, als wäre sie mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen.
»Nichts wurde weggeworfen. Alles von einem Tier haben wir verwertet. Heute darf es nur noch Filet und Schnitzel sein.«
»Ich kenn noch Steckrübenkaffee«, trompetete Hüthchen unbekümmert. »Und gebackene Brennnesselblätter!«
»Ich habe noch Kartoffeln übern Fisch gestrichen!«, meldete sich jetzt meine Mutter zu Wort.
Xenia, die noch nie einen Satz mit ihr gewechselt hatte, strahlte sie an. »Damit sie nach Fisch schmecken, wenn der einzige Hering für den Mann war!«
»Genau!« Mutter ereiferte sich geradezu. »Arme Ritter aus altem Brot!«
»Weiße Bohnen süßsauer!«
»Brennsuppe!«
»Ah!« Xenia lehnte das Vogelköpfchen zurück und stieß ein sehnsuchtsvolles Stöhnen aus. »Kartoffeln mit …«
Sie sah auffordernd zu Mutter und Hüthchen, die wie aus einem Mund »Stippe!« riefen. Alle drei hoben das Glas und stießen über den Tisch miteinander an.
Wir anderen enthielten uns der Stimme.
»Nun«, sagte ich schließlich. »Der Spargel schmeckt auch ganz gut.«
Hüthchen grunzte etwas und ergänzte dann: »Bei uns gab’s sonntags immer Milzwurst.«
»Noch etwas Trüffelöl über die Kartoffeln?«, schaltete sich Biggi mit der ihr eigenen Sensibilität ein.
»Jedenfalls sollten wir alle mehr darauf achten, was wir essen, wo es herkommt und unter welchen Bedingungen es produziert wird.« Das war Marie-Luise mit dem Versuch, die Unterhaltung wieder in andere Bahnen zu lenken.
Marquardt stopfte sich noch eine Kartoffel der Sorte Bamberger Hörnchen in den Mund, und Vaasenburg nutzte die Gelegenheit, seine Oberarmmuskeln spielen zu lassen und eine weitere Flasche Wein zu entkorken.
»In rund fünfzig Prozent aller Betriebe wird der Arbeitsschutz nicht eingehalten«, sagte er. »Das Gewerbeaufsichtsamt müsste sich darum kümmern. Oder die Unfallkassen.«
»Viele sind ja noch nicht mal krankenversichert«, sagte Marie-Luise.
Marquardt wischte sich den Mund mit seiner Serviette ab. »Ich verstehe das nicht. Theoretisch darf ich noch nicht mal jemanden einen Kaffee in der Kanzlei anbieten, schon steht das Amt vor der Tür. Warum kümmern die sich nicht darum?«
Es war der Auftakt für eine lange Tirade über das Versagen der öffentlichen Kräfte auf der einen Seite, die andererseits ihre gesamten Ressourcen darauf verwendeten, unschuldigen – okay, vorbestraften und reuigen – Anwälten wie ihm das Leben schwer zu machen. Mein Handy klingelte, und das war die Gelegenheit, zumindest einen Teil davon zu verpassen.
Eine unbekannte Nummer. Ich nahm den Anruf auf dem Balkon an.
»Hier ist Frigga«, meldete sich eine Frauenstimme. Etwas abgehackt und schwer atmend wie nach einem Hundertmetersprint. »Frigga Lade. Gewerkschaft Freie Arbeiter.«
Ich erinnerte mich sofort an sie. Nicht viele Frauen waren je in meiner Gegenwart so beleidigt worden. Trotzdem.
»Ja?«
Es war Samstagabend, und das freilaufende französische Hühnchen wurde kalt. Im Hintergrund mussten Musik und Stimmen zu hören sein. Nicht der Moment, um nach einer Rechtsberatung zu fragen.
»Es geht um Lucian. Lucian Sandu. Sie erinnern sich? Der junge Mann gestern auf dem Hof von Herrn Grundmann.«
»Ja?«
»Herr Grundmann ist tot. Und Lucian wurde verhaftet.«
Ich sah durch die geöffnete Balkontür in den Besprechungsraum unserer gemeinsamen Kanzlei, das wir an diesem Abend zum Esszimmer gemacht hatten. Ich wollte hineingehen und Marie-Luise diesem Kriminalhauptkommissar ausspannen. Und da mir das nicht gelingen würde, mir wenigstens gepflegt die Kante mit den Weinen geben, die Marquardt von seinen früheren Mandanten geschenkt bekommen hatte.
»Ja?«
»Herr Vernau? Sind Sie das, oder habe ich mich verwählt?«
Ich räusperte mich. »Ja. Braucht er einen Anwalt?«
»Deshalb rufe ich ja an! Er kennt hier niemanden. Ich kann auch jemanden über die Gewerkschaft besorgen, aber Mord ist nicht unser Spezialgebiet.«
»Mord?«, fragte ich.
»Er soll ihn umgebracht haben.«
»Wann?«
»Heute Nacht. Gestern Nacht. Gestern auf heute. Heute früh. Entschuldigung, ich bin so durcheinander! Mehr weiß ich auch nicht. Er hat mich heute Mittag angerufen, aber ich hatte mein Handy aus, weil Samstag ist, und ich mache mir solche Vorwürfe!«
»Ganz ruhig.«
Frigga Lade hörte sich nicht gerade konzentriert an.
»Eins nach dem anderen. Wann haben Sie miteinander gesprochen?«
»Eben gerade! Dürfen die das denn, ihn einfach verhaften und noch nicht mal einen Anwalt stellen?«
Es war nicht der Moment, um Frigga zu erklären, dass hierzulande niemand einfach verhaftet wurde. Zudem ist es ein weitverbreiteter Irrtum, dass dem Beschuldigten sofort ein Anwalt zur Seite steht. Darum muss sich der Festgenommene kümmern, und deshalb darf er auch telefonieren. In diesem Fall hatte Lucian Sandu das Richtige getan. Frigga war seine Vertrauensperson. Die allerdings stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch, was ich etwas seltsam fand. Aber vielleicht war sie jemand, der wirklich eine persönliche Verantwortung für die Menschen fühlte, für die sie sich einsetzte.
»Er hat Sie also erst vor ein paar Minuten erreicht?«
Dann war er seit mindestens zwölf Stunden in Gewahrsam.
»Er hat gefragt, ob ich einen Anwalt kenne, und da sind Sie mir eingefallen. Machen Sie Mord? Ich meine, ist das etwas, mit dem Sie sich auskennen?«
»Unter anderem.«
»Könnten Sie vielleicht nach ihm sehen? Er war schon beim Haftrichter und ist jetzt in U-Haft. Das schafft er nicht allein. Er braucht einen Anwalt! Wenn ich doch bloß das Handy eingeschaltet hätte!«
»Frau Lade, es ist gut, dass Sie mich sofort kontaktiert haben.« Sie musste wieder zu Atem kommen. Und ich wollte mein Hühnchen nicht morgen aufgewärmt essen. »Heute Abend werden wir nicht mehr viel ausrichten können.«
»Wir müssen ihn da rausholen! Er ist unschuldig!«
Eine Festnahme kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erfolgen. Flucht- und Verdunkelungsgefahr, Vorwurf von schweren Kapitaldelikten wie Mord. Diese müssen auch dem Haftrichter einleuchten, nur dann kann er den Haftbefehl aussprechen. Ich hegte den Verdacht, dass es nicht gut aussah für Lucian und wir ihn nicht so schnell auf freien Fuß bekamen, wie Frau Lade sich das vorstellte.
»War er bei der Staatsanwaltschaft Cottbus oder Frankfurt/Oder?«
»Das weiß ich nicht. Wenn er in Cottbus ist, dann Cottbus vielleicht?«
Das klang logisch. Samstagabend halb neun. Weder bei der Justiz noch der Polizei wäre jemand anzutreffen, der mir Einblick in die Ermittlungsakte geben würde. Ich konnte Frigga aber auch nicht auf Montag vertrösten. Und Lucian erst recht nicht. Wer einmal in Untersuchungshaft gesessen hat, wird sich daran erinnern, dass Minuten zu Stunden und Stunden zu Ewigkeiten werden.
»Beides liegt eine gute Stunde von Berlin entfernt«, gab ich noch zu bedenken.
Wie aus der Pistole geschossen, kam zurück: »Ich kann Sie abholen. Egal wo. Wir müssen ihm helfen. Lucian hat das nicht getan, das weiß ich.«
»Warum?«
Kurzes Schweigen.
»Warum was?«
»Warum sind Sie davon so überzeugt?«
»Ein Mord. Wirklich. Den will ihm jemand in die Schuhe schieben.«
»Wer?«
»Herr Vernau, übernehmen Sie den Fall? Sonst kümmere ich mich um einen anderen Anwalt.«
Lucian Sandu war bereits aus dem Polizeigewahrsam entlassen und dann höchstwahrscheinlich in die JVA Cottbus-Dissenchen gebracht worden, wo meines Wissens nach die männlichen Untersuchungshäftlinge untergebracht waren. Eine moderne Anstalt mit Platz für knapp sechshundert Insassen.
»Ich fahre zu ihm.«
»Jetzt?«
»Sobald ich zu ihm kann.«
Die Erleichterung am anderen Ende der Verbindung war deutlich spürbar. Ich versprach ihr, mich umgehend bei ihr zu melden, wenn ich Lucian Sandu gesehen hatte, und kehrte zu den anderen zurück.
»Entschuldigt bitte, die Arbeit.« Und direkt an Marie-Luise gewandt: »Der junge Mann, den wir gestern auf dem Grundmann-Hof getroffen haben, wurde unter Mordverdacht festgenommen.«
»Was?«, fragte sie ungläubig.
Natürlich wollten alle wissen, um was es ging. Während ich die dürren Fakten zusammenfasste, griff Vaasenburg zu seinem Handy, stand auf und ging in Marie-Luises Kanzleiraum. Wenig später kam er zurück.
»Das sieht nicht gut aus.«
Ich sah mit vollen Backen zu ihm auf.
»Chris Grundmann, zweiundsechzig, aus Jessendorf im Landkreis Dahme-Spreewald. Heute Nacht gegen eins hat ihn seine Frau tot im Büro gefunden. Mehrere Stichverletzungen, wurde schon vor Ort von der Kriminaltechnik festgestellt, aber keine Tatwaffe. Die Leiche wird gerade in Cottbus obduziert, der Bericht dürfte spätestens morgen Mittag vorliegen.«
»Von wem?«, fragte Marie-Luise.
Vaasenburg setzte sich und steckte das Handy zurück in seine Jacke, die über der Stuhllehne hing. »Das weiß ich nicht.«
»Staatsanwaltschaft Cottbus also?«, vergewisserte ich mich. Brandenburg ist groß.
»Jep.«
»Kennen Sie den Haftrichter? Oder jemanden bei der Mordkommission?«
Der Kriminalhauptkommissar wiegte sein Haupt. »Da bin ich überfragt.«
»Und Lucian Sandu? Was genau liegt gegen ihn vor?«
»Es gab wohl mehrere Zeugenaussagen, dass Herr Sandu sich mit Chris Grundmann gestritten hat und kurz vor der Tat betrunken und aggressiv zweimal zum Hof gelaufen ist. Bei seiner letzten Rückkehr hatte er Blut an der Kleidung. Auch das wird in der Rechtsmedizin untersucht. Aber wahrscheinlich nicht mehr heute Abend. Sie können nichts für ihn tun. Zumindest jetzt nicht.«
»Darf ich mal sehen?«
Ich streckte meine Hand nach seinem Handy heraus, aber er klopfte auf seine Brusttasche.
»Sorry. Polizeiinternes Informationssystem.«
Sein Herrschaftswissen zauberte ihm ein Lächeln der Genugtuung auf den Mund, mit dem er wahrscheinlich Marie-Luise küssen würde, sobald die Gäste gegangen waren. Arroganter Vollidiot.
»Ich fahre trotzdem.«
Biggi legte ihr Besteck ab und schob den halb leer gegessenen Teller weg von ihrer schmalen Taille.
»Aber doch nicht jetzt? Bis du ankommst, ist es stockfinster, und du musst mitten in der Nacht aus Brandenburg zurück nach Berlin. Das ist gefährlich!«
»Warum ist das gefährlich?«, schaltete sich Mutter ein.
»Nun … die Wölfe. Der Wildwechsel. Die … ähm … Löwen«, schob sie nach und spielte auf eine Berliner Sommerlochgeschichte an, erntete aber allseits nur müdes Lächeln. »Und die Verrückten, die mit zweihundert Stundenkilometern durch die Alleen rasen. Das hat doch noch Zeit bis morgen früh.«
»Jeder, der schon mal in U-Haft oder Gewahrsam gesessen hat, sollte jemanden an seiner Seite haben. Egal ob schuldig oder unschuldig.«
Hüthchen presste die Lippen aufeinander und senkte den Blick. Vor gar nicht allzu langer Zeit war sie selbst dieser außergewöhnlichen Erfahrung ausgesetzt gewesen. Marquardt, ebenfalls ein Veteran in diesen Dingen, nickte zustimmend. Bei beiden hätte die Sache auch anders aussehen können. Dann hätten wir einmal lebenslänglich und einmal vier bis acht Jahre am Tisch. Beziehungsweise nicht am Tisch. Es war schon eine illustre Gesellschaft, die sich in dieser Beletage am Kurfürstendamm zusammengefunden hatte.
»Aber ich werde erst morgen in die JVA hineinkommen. Er spricht nicht gut Deutsch«, fuhr ich fort. »Und wenn es Ärger mit Grundmann gegeben hat, dann wird es eine Tat im Affekt gewesen sein, also allerhöchstens Totschlag. Wenn nicht sogar Notwehr.«
Wir waren unter uns. Da durfte man sich solchen Spekulationen hingeben.
»Der Junge braucht jemanden, der ihm zuhört, seine Familie benachrichtigt und sofort alles in die Wege leitet, um ihn freizubekommen.«
Vaasenburg zog die Stirn kraus.
»Was?«, fragte ich leicht aggressiv in seine Richtung.
Marie-Luise sah ihn auffordernd an. »Weißt du etwas? Dann sag es.«
Alle wandten die Köpfe in seine Richtung.
»Nun«, sagte er und strich sich über das markante Kriminalhauptkommissarkinn. »Lucian Sandu hat die Tat gestanden.«
3
Am Sonntagvormittag saß ich ihm im Besprechungsraum der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen gegenüber und hörte es aus seinem eigenen Mund.
»Ich habe Grundmann totgemacht.«
Immer wieder.
»Ich hab das Schwein totgemacht.«
Lucian war bleich, übernächtigt, mit roten entzündeten Augen. Bartschatten verdunkelten sein schmales Gesicht. Die Haare hingen ihm zerzaust in die Stirn. Ein sehniger junger Mann, ein an Arbeit gewöhnter Körper mit schrundigen Händen und Dreck unter den Fingernägeln. Sein Blick flackerte, und die Füße in den offenen, ausgetretenen Sandalen scharrten nervös über dem Boden.
Er trug eine weite Arbeitshose und ein fleckiges T-Shirt, hastig übergezogen, Spenden aus der Kleiderkammer der Polizei, weil er nach der Festnahme seine Sachen an die KTU übergeben musste.
Ich hatte bei der Staatsanwaltschaft Cottbus Akteneinsicht angefordert, aber der Bereitschaftsdienst hatte mir wenig Hoffnung gemacht, vor Montagfrüh die zuständige Ermittlungsrichterin zu erreichen. Sie wurde mir von Stunde zu Stunde unsympathischer. Dabei gönnte ich ihr ein freies Wochenende von Herzen. Aber nicht, wenn ein Mandant von mir unter Mordverdacht in U-Haft saß.
Immerhin war es mir gelungen, unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Verteidigung nach Paragraf 140 Absatz eins Zugang zu meinem Mandanten zu bekommen. Die JVA Dissenchen war eine moderne Anstalt am Rande der Stadt. Die Wände gestrichen in zarten deeskalierenden Pastelltönen und einem, wie ich wusste, freundlich gestalteten Langzeitbesuchsraum, in dem die verurteilten Inhaftierten drei Stunden im Monat mit ihren Nächsten verbringen konnten. Mein Handy hatte ich, zusammen mit meiner Tasche, in einem der Schließfächer beim Pförtner gelassen. Nachdem ich die erste Schleuse und den Kontrollraum passiert hatte, kam ich in einen hellen und breiten Gang mit einem Automaten, an dem Angehörige Softdrinks und Süßigkeiten für sich und den Inhaftierten ziehen konnten. Der Blick fiel durch bodentiefe Fenster hinaus in einen dezent begrünten Innenhof, aber nur so lange, bis ich den Sprechraum erreicht hatte, wo mir von der anderen Seite aus Lucian Sandu zugeführt worden war.
»Wie?«, fragte ich ihn.
»Tot«, war die lapidare Antwort.
Bei unserer ersten Begegnung auf dem Bauernhof hatte er den Eindruck eines wachen Menschen gemacht, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Auf der anderen Seite des Tisches in dem kargen Besprechungsraum, der uns zugeteilt worden war, saß ein einfältiger Dummkopf.
»Warum haben Sie das getan?«
»Tot.«
Ich unterdrückte einen Seufzer. Zumindest hatte ich die Anordnung zur Untersuchungshaft vorliegen, ausgestellt von einer Jacqueline Motzke. Ein Name wie aus einer Reality Soap, aber Oberstaatsanwältin in Cottbus. Der Tatvorwurf lautete Verdacht des Totschlags.
Der Beschuldigte ist folgenden Sachverhalts dringend verdächtig: Am 24.6.2023 gegen ein Uhr morgens suchte er den geschädigten Christoph Grundmann auf dessen Bauernhof auf. Es kam zu einem Handgemenge und oberflächlichen Schnittverletzungen. Der Beschuldigte kehrte in seine Unterkunft in der Gemarkung Jessendorf zurück, brach aber gegen zwei Uhr morgens erneut zum Bauernhof auf und stach ohne rechtfertigenden Grund einmal mit einem spitzen Gegenstand in die Brust des Geschädigten Christoph Grundmann ein und nahm billigend in Kauf, den Geschädigten tödlich zu verletzen. Nach Aussage der Ehefrau fehlten nach der Tat mehrere Hundert Euro. Der geschädigte Grundmann starb unmittelbar nach der Tat an seiner schweren Stichverletzung im Brustbereich mit Eröffnung des Herzbeutels und der Lunge.
Bevor ich nicht mehr erfahren hatte, konnte ich nichts tun. Gar nichts. Ich nahm mein durchleuchtetes Notizbuch, dazu einen Bleistift der Härte B2 und legte beides vor mich auf den Tisch.
»Wo ist das Geld?«
Lucian, die Hände ineinander verschränkt und den Blick auf die Tischplatte gerichtet, zuckte mit den Schultern.
»Weiß ich nicht. Auf der Bank? In einem Safe?«
»Ich meine nicht den Lohn für Ihre Arbeit. Das gestohlene Geld.«
Sein Kopf ruckte hoch. »Gestohlen?«
»Hier steht, dass Sie Geld gestohlen haben.«
»Hab ich nicht. Wie viel?«
»Ein paar Hundert Euro.«
Lucian lehnte sich zurück und rieb sich seine hübsche gerade gewachsene Nase. »Hab ich nicht.«
Den Mord gab er zu, den Diebstahl nicht. Vielleicht hatte die Ehefrau des Opfers auch einfach nur Tabula rasa machen wollen und die Scheine selbst zur Seite geschafft. Was für eine bemerkenswerte Kaltblütigkeit sprechen würde. Dann wäre das die erste Ungereimtheit. Aber solange mein Mandant darauf bestand, Grundmann persönlich umgebracht zu haben, konnte man das wohl vernachlässigen.
»Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
»Hab ich schon.«
»Aber nicht mir. Herr Sandu, wenn Sie hier jemals wieder rauswollen, müssen Sie mit mir reden.«
Er kam wieder vor. »Ich bin zu Grundmann. Er ist der Boss. Krebitz ist nur sein catelus.«
»Sein was?«
»Sein Schoßhund. Läuft hinter ihm her, tut, was er sagt. Aber der Welpe will Boss sein. Will den Hof. Hat Emilia geheiratet, Tochter vom Boss. Aber läuft nicht gut.«
Ich notierte, was das Zeug hielt. Ich würde später daraus schlau werden. Welpe. Boss. Emilia. Streit um Hof.
»Sie sind also zu ihm, mitten in der Nacht.«
»War spät, ja. Hab was getrunken, dann bin ich zu ihm. Hab ihm gesagt, wir wollen ordentlichen Lohn für Schufterei und nicht das, was er ausrechnet. Wollen Mindestlohn. Ist Gesetz. Er sagt, er hat Contracta. Kein Mindestlohn, Akkordlohn. Ich sage, Contracta ist Bullshit. Er sagt, Männer von anderen Hof kommen und sorgen, dass wir verschwinden, wenn wir nicht spuren.«
»Verschwinden?«, fragte ich.
»Wegfahren. Zurück nach Hause. Mit nichts in der Tasche. Ticalos.[6] Da bin ich auf ihn los. Geprügelt. Bin gegangen. Zurück in Container. War wütend. Konnte nicht schlafen. Bin noch mal zu ihm. Er gleich gedroht, auf mich los. Es war Not… Not?«
»Notwehr?«
»Ja.«
»Mit was?«
Lucians dunkle Augen wurden rund. »Was?«
»Mit was haben Sie ihn getötet?«
»Mit … Messer.«
Ein minimales Zögern, das er selbst wohl kaum bemerkte, so durch den Wind, wie er war. Aber mir fiel es auf. Mörder erinnern sich im Allgemeinen an ihre Tatwaffe.
»Hatten Sie das bei sich?«
»Ja.«
»Gehen Sie immer mit einem Messer nachts zu Besprechungen?«
»Nicht immer.«
»Wo ist es?«
»Weggeworfen.«
Grundmann war mit einem spitzen Gegenstand ermordet worden. Wäre es ein Messer gewesen, hätte Jacqueline Motzke auch Messer geschrieben. Ich musste so schnell wie möglich an den Autopsiebericht kommen.
»Und dann?«
»Bin ich zurück zu Containern. Dann kam Polizei, Blaulicht, konnten wir sehen. Und dann …« Er hielt die Handgelenke gekreuzt übereinander.
Der Minutenzeiger der Uhr über der Tür sprang mit einem leisen Klacken auf halb eins.
»Warum sind Sie nicht abgehauen?«
»Ohne Lohn?«
Er schüttelte den Kopf.
»Sie können doch nicht Ihren Lohn von einem Mann erwarten, den Sie umgebracht haben.«
Er sah mich etwas begriffsstutzig an. Dann verstand er die wirre Logik seines Gedankens und stieß einen resignierten Seufzer aus.
Auch gut. Man soll seinen Anwalt nicht anlügen. Nie. Aber er war noch nicht so weit, diesen wichtigsten aller Grundsätze in einem Verfahren zu beherzigen.
Ich klappte meinen Notizblock zu. Viel Verwertbares kam nicht aus meinem Mandanten heraus. Das Interessanteste war die Frage, was er wirklich wusste und wen er schützen wollte.
»Herr Sandu?«
Sein Blick wanderte über die kahlen Wände zu dem vergitterten Fenster, hinter dem das Flutlicht über den Gefängnismauern die Dunkelheit vertrieb.
»Hab ich nicht drüber nachgedacht«, sagte er schließlich.
»Was genau haben Sie bei Ihrer Festnahme gesagt?«
»Gar nichts. Kamen rein, riefen meinen Namen. Ich wollte abhauen, aber sie haben mich gekriegt.«
Abhauen klang plausibel. Wer weiß, was im Kopf eines rumänischen Saisonarbeiters vorgeht, dem man in diesem Land immer wieder unter die Nase reibt, wie rechtlos er ist. Andererseits passt das natürlich auch ins Verhaltensmuster eines Verdächtigen.
»Ich bitte Sie, ab jetzt ohne mich nichts mehr zu äußern. Weder der Polizei noch Ihren Mitgefangenen gegenüber oder einem Justizvollzugsbeamten.«
»Okay.«
Lucian nickte nicht sehr überzeugt.
»War bei Ihrer Vernehmung ein Dolmetscher zugegen?«
Das war nach internationalem Recht für jedes Strafverfahren mit einem ausländischen Beschuldigten aus dem nicht deutschsprachigen Raum vorgeschrieben. Zu meinem Leidwesen antwortete er mit einem »Ja«.
Damit schied das schon einmal für einen Verfahrensfehler aus. Viele Prozesse enden für einen definitiv Schuldigen nur aus dem einen Grund mit Freispruch, weil irgendjemand im Vorfeld minimal geschludert hatte.
»Gerichtlich vereidigt?«, hakte ich nach.
Er sah mich ratlos an. Darum würde ich mich kümmern, aber ich hatte den Verdacht, dass die Polizei in Cottbus genau wusste, was sich für eine Festnahme und die Vernehmung gehörte.
»Haben Sie«, holte ich meinen vorerst letzten Joker aus der Tasche, »Ihre Aussage auf Deutsch oder Rumänisch gemacht?«
Wenn auf Deutsch, dann konnte ich das anfechten.
»Rumänisch. Sie wollten es so, damit ich auch weiß, was ich sage. Dabei ist mein Deutsch genauso gut. Was glauben die denn?«
»Nichts«, sagte ich. »Sie halten sich nur an die Vorschriften. Hat man Sie über Ihre Rechte belehrt?«
»Ja. Aber ich wollte aussagen.«
»Das hätten Sie lieber nicht getan. Sie sind nur verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu machen, mehr nicht.«
»Ich wollte aber.«
»Warum?«
»Es war doch klar, dass ich es war.« Er verschränkte die Arme, lehnte sich zurück und streifte mich mit einem abschätzenden Blick.
»Das ist überhaupt nicht klar. Die Mordkommission muss Ihnen nachweisen, dass Sie der Täter sind. Wenn nicht, dann sind Sie …«
»Ich war es! Ich habe Grundmann totgemacht! Was wollen Sie eigentlich?«
Ich legte den Bleistift auf dem Block ab und parierte seinen Blick. »Ich will Sie hier rausholen, wenn Sie die Tat nicht begangen haben.«
»Wie oft soll ich eigentlich noch gestehen?«
»Und wenn Sie für schuldig befunden werden, möchte ich das Strafmaß so gering wie möglich halten und alle mildernden Umstände heranziehen, die es gibt.«
»Ach so.«
Er entspannte sich etwas. »Also zwei Jahre und dann wieder raus?«
»Nein. Das wohl nicht.«
Er zog die Augenbrauen zusammen und grummelte etwas in sich hinein. Ich nahm den Bleistift wieder auf.
»Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt? Fotos, Fingerabdrücke, DNA?«
»Ja.«
»Sind auch an Ihnen Spuren gesichert worden? Fingernägel, Blut?«
Er dachte nach und nickte.
»Wann fand die Vernehmung durch die Polizei statt?«
Lucian hatte getrunken. Bevor sein Alkoholpegel nicht wieder auf null war, war an ein Verhör nicht zu denken. Mit etwas Glück hatten es die Cottbusser nicht so genau genommen, aber auch diesen Wind nahm mir Lucian aus den Segeln.
»Mittags. Erst Frühstück, war gut. Dann Mittagessen, auch gut. Bratwurst und so was, das sie Kartoffelbrei nennen. Wirklich gut.«
»Haben Sie einen Alkoholtest mit Ihnen gemacht?«
»Ja. Viele. Bis alles okay.«
Gut. Besser gesagt: nicht gut. Alles an dieser Festnahme und Vernehmung war korrekt verlaufen.
»Ich nehme an, dass nach Ihrer Vernehmung der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls geschrieben wurde und eine Haftvorführung stattfand.«
Lucians einzige Reaktion: ein Schulterzucken. Der musste innerhalb kürzester Zeit erwirkt worden sein, denn sonst säße mein Mandant jetzt nicht in der JVA.
»Was haben Sie dem Richter gesagt?«
»Ich habe gesagt: Ich habe Grundmann totgemacht.«
»Etwas genauer?«
»Totgemacht.«
Er wollte es. Mit aller Macht. Ich klappte mein Notizbuch zu.
»Die Polizei wird Ihnen die Tat nachweisen müssen. Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, kann Sie das in ernste Schwierigkeiten bringen.«
Zum ersten Mal erkannte ich so etwas wie Humor bei diesem jungen Mann. Er sah sich um und hob mit einem fast frechen Grinsen die Schultern.
»Ernster als jetzt?«
Mir war nicht zum Scherzen zumute. Die Indizien, die ich bis jetzt kannte, wiesen durchaus auf ihn als Täter hin. Aber sein Geständnis gefiel mir nicht, wenn man diesen Ausdruck in so einem Zusammenhang bemühen konnte. Etwas daran stimmte nicht, und hätte er den Tatvorwurf bestritten, stünden die Chancen, ihn auf freien Fuß zu bekommen, wesentlich besser.
Er war nicht vorbestraft. Dreiundzwanzig Jahre jung. Maschinenbaustudent an der Polytechnischen Universität Timișoara. Und zerschoss sich seinen Lebenslauf im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Vielleicht sah er mir meine Resignation an, denn sein Lächeln milderte sich etwas ab.
»Ich kann das auch alleine«, sagte er.
»Nein, das können Sie nicht. Sie machen sich keine Vorstellungen über einen Mordprozess. Wenn die Angehörigen Ihres Opfers im Zuschauerraum sitzen. Wenn die Presse über Sie herfällt. Wenn der Staatsanwalt Sie verhört und Ihnen lebenslänglich droht. Sie glauben, Sie kommen nach ein paar Jahren wieder raus, und alles ist gut? Nein. Dieser Mord wird Sie ein Leben lang verfolgen.«
Er verlor sein Lächeln und schwieg.
»Kann ich jemanden über Ihren Aufenthalt benachrichtigen? Was ist mit Ihrer Familie?«
Er zuckte mit den Schultern. »Hat Zeit.«
»Aber …«
»Hat Zeit!«
»Gut.« Ich schob ihm die Vollmacht und einen Kugelschreiber über den Tisch und wies auf die Stelle, an der er unterschreiben sollte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas brauchen. War schon jemand von Ihrer Botschaft bei Ihnen?«
Kopfschütteln.
»Ich kümmere mich darum. Ihre Papiere?«
»Hat Grundmann.«
»Okay.« Die Polizei würde sie sich besorgt haben. »Kann ich noch etwas für Sie tun?«
»Sie sind Anwalt?«
»Ja.«
»Wir wollen unser Geld. Und nicht behandelt werden wie Hunde.«
»Ich bin hier, weil Sie unter Mordverdacht stehen. Arbeitsrechtliche Dinge sind da zweitrangig.«
»Nein!«
Zum ersten Mal schoss Leben in ihn.
»Wir arbeiten Monate. Wir sehen nicht unsere Familie. Nicht unsere Kinder. Nicht die Eltern, die Freunde. Wir schufen von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Wir bluten. Wir haben Schmerzen. Wir stinken, weil keine Dusche, und wir pissen in Ecke, weil keine Toilette! Alle haben Angst. Keiner sagt was. Denn wer den Mund aufmacht, wird gefeuert. Ohne Geld. Gar kein Geld.«
Lucian spuckte auf den Boden.
»Herr Sandu?«
»Entschuldigung, Domnule.[7]Scuzati-ma.«
Dann verrieb er die Spucke mit der Sandale.
»Wer hat Chris Grundmann getötet?«
Lucian sah mich mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ich, DomnuleAvocat.«
»Auch die Irreführung der Justiz bringt Sie hinter Gitter.«
»Ich! Ich habe Grundmann totgemacht! Ich!«
Sein Blick wanderte die kahlen Wände hinauf bis zu der schrägen Decke des kleinen, schmalen Raums. Nirgendwo eine Kamera, die sein theatralisches Geständnis aufzeichnen würde.
»Können wir langsam zum Schluss kommen?«, fragte er in meine Richtung.
Ich nickte und sammelte die unterschriebene Vollmacht und den Kugelschreiber ein.
»Herr Sandu, ich werde mich morgen früh um mehrere Dinge kümmern. Sie machen bis auf Weiteres nichts anderes, als den Anweisungen des Personals hier zu folgen und bei allen, wirklich allen Fragen auf mich zu verweisen. Haben Sie das verstanden?«
Lucian nickte und setzte, als ich ihm mit hochgehobenen Augenbrauen zu verstehen gab, dass mir eine ausdrückliche Antwort lieber wäre, noch ein gequetschtes »Ja« hinzu.
Bis ich durch die Schleusen und in Besitz meiner einbehaltenen Gegenstände war und draußen vor dem Gelände stand, war es halb zwei.
Ich fuhr zurück nach Berlin und verbrachte den Restsonntag damit, meinen zwei reizenden älteren Damen Kuchen von der Konditorei Klinkmüller mitzubringen, ihr Bad zu putzen, ihre Vorräte nach Verfallsdatum durchzusehen, den Müll erst zu trennen und dann zu entsorgen und dabei die ganze Zeit zu versuchen, die Frist bis zu ihrer Obdachlosigkeit zu verdrängen.
»Schlimmstenfalls ziehen wir bei dir ein«, sagte Mutter.
Ich überlebte nur knapp einen Erstickungsanfall.
»Vorübergehend«, ergänzte Hüthchen. »Nur vorübergehend.«
4
Wie erwartet kam ich weder bei der Staatsanwaltschaft noch bei der Rechtsmedizin weiter. Es schien ja auch keinen Grund zur Eile zu geben. Tat, Motiv und Täter standen fest: Lucian Sandu hatte Chris Grundmann erstochen, weil dieser ihn nach monatelanger Schufterei übers Ohr gehauen hatte.
Ich war kein Anfänger mehr. Im Laufe meiner Berufsjahre hatten sich Sedimentschichten von Erfahrungen angesammelt, die langsam zu steinernen Gewissheiten wurden. Eine von ihnen war: Wenn ich von einem Mandanten angelogen wurde, hatte er triftige Gründe dafür. Entweder weil er hoffte, damit weiteres Unheil von sich abzuwenden.
Oder … es für jemand anders zu tun.
Ich hatte massive Zweifel an Lucians Schuld. Aber er bezichtigte sich selbst und schien sich auch darüber bewusst zu sein, was das für ihn bedeuten könnte. Für mich gab es zwei Optionen: Die Arme zu verschränken und für ihn eine möglichst milde Strafe für eine Tat im Affekt rauszuholen, was schon allein aus wirtschaftlichen Erwägungen das Vernünftigste wäre.
Oder ich fragte nach.
Es musste sein, um mehr Klarheit zu erlangen und mir eine Verteidigungsstrategie zuzulegen. Ich konnte schlecht auf »nicht schuldig« plädieren, wenn der Angeklagte im Prozess das Gegenteil behauptete. Wir mussten uns zusammenraufen. Und da Lucian nach Paragraf 140 Absatz zwei Strafprozessordnung eine »Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge« befürchten musste, stand ihm ein Pflichtverteidiger zu. Sofern die Staatsanwaltschaft in Cottbus nicht noch schnell einen anderen aus dem Hut zauberte.
Der oder die würde sich wahrscheinlich mit der offensichtlichen Sachlage zufriedengeben und sich auf »Tat im Affekt« verlegen. Nicht unter fünf Jahren, und anders, als man allgemein glaubt, durchaus auch bis lebenslänglich. Vor allem Lucians Rückkehr zu Grundmann war ein Problem. Hätte er ihn bei der ersten Auseinandersetzung getötet – Streit, böse Worte, Messer in der Hosentasche, gerne auch noch der versteckte Hinweis auf das südländische Temperament und ein bisschen Blutrache, Lucian wäre nach Anrechnung der Untersuchungshaft und bei guter Führung nach zwei Jahren wieder auf freiem Fuß.
Aber die Rückkehr. Dieses verfluchte zweite Mal. Das kam Heimtücke und niedrigen Beweggründen schon verdammt nahe.
Und das alles für eine Tat, die er vielleicht gar nicht begangen hatte. Da meine Kosten von der Staatskasse gedeckt wurden, zumindest zu einem Teil, konnte ich wenigstens versuchen, mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
Zum Beispiel bei Emilia. Was hatte sie zwischen Boss und Welpe zu suchen? Es war der einzige Name, den Lucian im Zusammenhang mit den Ereignissen in Jessendorf erwähnt hatte, und er hatte sie nicht Frau Krebitz genannt. Doamnă Krebitz, wie es auf Rumänisch heißen würde. Vermutlich stocherte ich im Finsteren herum, aber einen Versuch war es wert.
Die Einzige, die nicht mit den Grundmanns oder Krebitz verwandt oder verschwägert war, saß mir nun nach einer kurzen Nacht in einem kleinen Café in Heinersdorf gegenüber. Ein Berliner Stadtteil im Osten, der zum Bezirk Pankow gehört und direkt an Weißensee grenzt, was in absehbarer Zeit sein Ende bedeuten würde. Zumindest, wenn man auf bezahlbare Mieten und erschwinglichen Kaffee angewiesen war. Wer in Prenzlauer Berg nicht mehr genug Platz für sein Lastenfahrrad oder die Kinder fand, war schon nach Weißensee ausgewichen. Da es dort auch langsam eng wurde, drängten Makler, Mieter, Käufer und Investoren in die nächsten Kieze.
Die dicht befahrene Prenzlauer Promenade lag nur zwei Ecken entfernt, und außer Kaffee hätten wir bei dem Inhaber auch SIM-Karten, Verdampfer mit Wassermelonengeschmack oder geröstete Sonnenblumenkerne kaufen können.
Der Kaffee war gut. Ein Euro fünfzig. Friedenspreise. Vor-Gentrifizierungspreise.
»Er hat Grundmann nicht umgebracht.«
Frigga schob energisch ihr Kinn vor, was ihr den Ausdruck einer Preisboxerin gab, die man gerade um den Titel betrogen hatte. »Lucian ist kein Mörder. Vielleicht rastet er aus, aber einen so kräftigen und aggressiven Mann angreifen und ihn auch noch zu erstechen?«
»Was außer Ihrer Vermutung macht Sie da so sicher?«
Man muss bei solchen Äußerungen immer auseinanderhalten, warum sie getätigt werden. Entweder wusste Frigga mehr als die Weekenderin Jacqueline Motzke, oder ihre Anteilnahme für das Wohlergehen eines ganz bestimmten Saisonarbeiters ging über das Berufliche hinaus.
Frigga zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es eben. Ich habe ihn kennengelernt. Lucian ist einer von denen, die sich für andere aufopfern. Er hat zwei kleine Neffen, die bald zur Schule gehen, und er unterstützt seine Eltern in dem Dorf, aus dem er kommt. Er weiß genau, welche Grenze er nicht überschreiten darf.«
Krebitz, du Sau.
Frigga erinnerte sich wohl auch gerade an diesen Auftritt und strich sich hastig ein paar fliegende Haare aus der Stirn. »Ja, ich weiß. Manchmal wird er ausfallend. Aber es herrscht generell ein anderer Ton auf dem Feld als in einer feinen Kanzlei.«
Vielleicht keimte gerade der Verdacht in ihr, dass sie lieber einen verhärmten Pflichtverteidiger hätte beauftragen sollen, statt eines unausgeschlafenen, unrasierten Ku’damm-Advokaten in italienischem Maßanzug.
Dass der Anzug drei Jahre alt war und Marie-Luise und ich bei Biggi als Untermieter rangierten, konnte sie ja nicht wissen.
»Mit welchen spitzen Gegenständen arbeitet man denn so in der Landwirtschaft?«
Sie sah mich irritiert an.
»Es geht um die Mordwaffe«, erklärte ich.
»Oh, klar. Eggen, Spargelstecher, Messer, Rechen, Grubber, es gibt spitze Gegenstände ohne Ende. Jeder hat einen, jeder benutzt einen.«
Sie trank einen Schluck Kaffee. Ihre karierte Bluse war bis oben geschlossen, spannte allerdings etwas über ihrer Brust. Ein mütterlicher Typ, der sich für seine Schützlinge aufopferte. Aber auch Mütter hatten Gefühle.