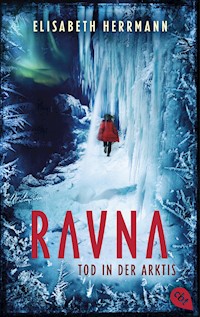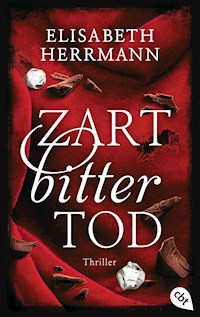9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Teepalast
- Sprache: Deutsch
1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Lene Vosskamp wächst in einer Fischerfamilie in bitterer Armut auf und muss schon als Kind schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Doch dann gerät sie durch einen Fremden in den Besitz einer geheimnisvollen Münze, die sie berechtigt, in China mit Tee zu handeln. Fortan ist sie beseelt von dem Gedanken, sich aus ihren elenden Verhältnissen zu befreien und als erste Frau ein Tee-Imperium zu gründen. Für Lene beginnt eine gefahrvolle Odyssee, die sie über die Meere der Welt und in ferne Länder führt – und auf die Spur der Liebe ihres Lebens, die ihr einst in einer Weissagung prophezeit wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Lene Vosskamp wächst in einer Fischerfamilie in bitterer Armut auf und muss schon als Kind schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Doch dann gerät sie durch einen Fremden in den Besitz einer geheimnisvollen Münze, die sie berechtigt, in China mit Tee zu handeln. Fortan ist sie beseelt von dem Gedanken, sich aus ihren elenden Verhältnissen zu befreien und als erste Frau ein Tee-Imperium zu gründen. Für Lene beginnt eine gefahrvolle Odyssee, die sie über die Meere der Welt und in ferne Länder führt – und sie auf die Spur der Liebe ihres Lebens führt, die ihr einst in einer Weissagung prophezeit wurde …
Weitere Informationen zu Elisabeth Herrmann sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Der Teepalast
Roman
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe September 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: GettyImages/E+/BIHAIBO
und mauritius images/Bjanka Kadic/Alamy und FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24048-6V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Allen Frauen vor uns gewidmet, die ein Nein nicht akzeptiert haben.
Prolog
Bremen, November 1876
Wie Blumen öffneten sich die weißen Sahnewolken, verwoben sich in zarten Schleiern, stiegen auf und ab und sanken schließlich zurück in den dunklen Grund der Tasse.
»Und jetzt«, sagte die Großmutter und lächelte Bettina zärtlich an, »darfst du deinen Tee trinken.«
Vorsichtig hob das Mädchen die Tasse. Sie war aus Meißner Porzellan, so dünn und zart, dass man Angst bekam, sie würde schon vom Ansehen zerspringen. Bettina pustete und nahm einen kleinen Schluck.
»Uh. Ich brauche mehr Kluntjes.« Sie warf zwei Stück Kandiszucker nach, die das luftige Gemälde in der Tasse augenblicklich zerstörten.
Die Großmutter lehnte sich zurück. Dabei knarrte der alte Stuhl leise. Bettina liebte ihn, fast genauso heiß und innig wie ihre Großmutter. Auf alles andere im ersten Stock des großen, prächtigen Hauses wurde sorgsam geachtet, nur auf das Ächzen und Knarren dieses abgeschabten Stuhls nicht, der bestimmt schon eine Ewigkeit in der Bibliothek stand und den niemand anrühren durfte. Noch nicht einmal, um die schlimmsten abgesplitterten Stellen auszubessern. Ein seltsamer Stuhl, knorrig, eigensinnig, ganz anders als die hübschen Möbel aus Nussbaum und Kirsche, mit denen das Stadthaus der Vosskamps eingerichtet war. Und ganz zu schweigen vom Teepalast, dem Salon der Bremer Gesellschaft, die sich dort beim Tee traf. Um die Ecke war noch der Laden, mit dem Helene vor langer Zeit begonnen hatte, ihr Imperium aufzubauen. »Die Teekönigin« wurde sie von ihren Bewunderern genannt.
Aber es gab auch andere Namen, die hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurden. Anfangs war es für sie wohl nicht leicht gewesen. Wann immer Bettina über etwas stöhnte – die strengen Diktate des Hauslehrers, die Zimtschnecken vom Vortag, das mühsame Zuknöpfen der Stiefel, stets bekam sie zu hören: »Iss du mal das harte Brot, das deine Großmutter zerbeißen musste!«
Lange Zeit hatte sie geglaubt, Helene hätte sich zeit ihres Lebens von ungenießbaren Kanten ernährt. Jetzt, mit neun Jahren und fast schon erwachsen, verstand sie viel mehr. Ihr war bewusst, dass ihre Familie ein anderes Leben führte als das vieler Leute. Schon deshalb, weil ihnen ein prächtiges Haus an der Ecke zum Grasmarkt gehörte und damit auch der Teepalast, ein nach englischem Vorbild eingerichtetes Stadtcafé im Erdgeschoss. Am Eingang bestaunten die, die zum ersten Mal eintraten, die gewundenen Säulen und die goldverzierten Akanthusranken, und drinnen dann die Vitrinen mit den Kuchen und Torten, das funkelnde Silber, die internationalen Zeitungen und Magazine, das blank polierte Parkett und schließlich die Teekarte mit der größten Auswahl Norddeutschlands. Als geborene Vosskamp erkannte Bettina die einzelnen Sorten am Duft: den zarten chinesischen Oolong, den kräftigen Assam und eine ganz spezielle Mischung, Brennys, die Helene vor langer Zeit einmal von einer ihrer Reisen mitgebracht und ins Sortiment übernommen hatte.
Bettina setzte die Tasse ab. Zu heiß.
Ihre Großmutter machte es richtig: Sie schloss die Augen und schnupperte erst mal an ihrem Tee. Heute trug sie ein moosgrünes Kleid aus Seidentaft und ein dazu passendes Schultertuch. In ihren mattblonden Haaren glänzten silberne Strähnen. Sie waren im Nacken zu einem Knoten gesteckt. Weil sie darauf bestand, die Toilette selbst zu erledigen, sprangen immer ein paar widerspenstige Locken heraus. Und da das sanfte Licht der Lampe ihren Zügen schmeichelte, sah sie überhaupt nicht aus wie das ehrbar ergraute Haupt der Familie Vosskamp. Bettina fragte sich manchmal, wie ihre Großmutter wohl in jungen Jahren gewesen war. Alles, was sie aus dieser Zeit wusste, hatte mit bitterster Armut und unfassbaren Wagnissen zu tun. Und mit Dingen, die für eine Dame von Stand absolut unmöglich waren. Wenn tatsächlich einmal die Sprache darauf kam, intervenierte ihre Mutter sofort. »Nicht vor dem Kind!«
Was dazu führte, dass in Bettinas Fantasie ihre Großmutter alles gewesen sein konnte: Marketenderin, Räuberin, Piratin … Natürlich war sie nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken machte. Das war einer der Gründe, warum die Vosskamps in der Bremer Gesellschaft eine Außenseiterrolle einnahmen, trotz ihres Reichtums. Denn er war nicht ererbt und nicht erheiratet, nicht durch königliche Gnaden oder glückliche Fügungen gewachsen, sondern einzig und allein durch meiner Hände harter Arbeit, wie Helene vielsagend hinterherschob, wenn es am Abendbrottisch um ein Haar spannend geworden wäre. Es musste also noch mehr geben, was dem Kind nicht zu Ohren kommen durfte.
»Ein kräftiger Tee aus Nordindien. Ich würde sagen, die Gegend um Darjeeling.«
Das Mädchen nickte. »Von dem haben wir ziemlich viel. Und dann haben wir noch grünen Tee und den mit Bergamotte, wie heißt er noch mal?«
»Earl Grey.« Ihre Großmutter stellte vorsichtig die Tasse ab. Der Stuhl knarrte schon bei dieser kleinen Bewegung. »Und wer hat ihm seinen Namen gegeben?«
»Ein britischer Premierminister.« Die Worte kamen wie aus der Pistole geschossen. Das wusste man, wenn man in diesem Haus aufgewachsen war.
»Sehr gut. Ein interessanter Mann, ein kluger Kopf. Habe ich dir schon erzählt, dass er die Sklaverei in den britischen Kolonien verboten hat? Nein? Und er hat der vermaledeiten Ostindien-Kompanie einen gehörigen Dämpfer versetzt. Charles Grey, 2nd Earl Grey …«
Ein versonnenes Lächeln erhellte die vielen kleinen Falten im Gesicht der Großmutter.
»Haben Sie ihn gekannt?«
Es gab niemanden, den ihre Großmutter nicht kannte. Im Haus der Vosskamps ging ein ziemlich buntes Volk aus und ein. Heute konnte es ein Admiral der britischen Flotte sein, morgen ein Trupp Theaterschauspieler, übermorgen … auch das gab es regelmäßig: Dienstbotentag. Dann ging die Großmutter hinunter in die Küche zu Magda, und beide saßen bis tief in die Nacht zusammen. Das war so in diesem Haus, seit hier Dienstboten arbeiteten.
Drei wendige Klipper gehörten zur Vosskamp-Flotte, dazu die Speicherhäuser am Hafen und ein Netz von Läden und Verkaufsstellen von Bremerhaven bis New York. Vosskamp-Tee trank man in den Häusern der Bauern genauso wie am Hof Königin Victorias, von wo aus Lady Bedfords Tea Time die Welt erobert hatte. Vosskamp nannte man in einem Atemzug mit Twinings und Fortnum & Mason und bis heute ging die Großmutter noch täglich ins Contor und ließ sich die Bücher vorlegen. Bettina, die von Anfang an vertraut war mit der rauen Seite des Lebens, mit dem Verlust von Schiffsladungen im Sturm oder einer Lagerfäule in den nassen Herbstwochen, hatte genauso fraglos den Luxus akzeptiert, in dem sie groß geworden war. Auch wenn Helene ihr immer wieder eintrichterte, dass sie diesen Wohlstand nicht als selbstverständlich ansehen sollte. Das allerdings stürzte sie in ernste Konflikte. Seine Herkunft nicht anzunehmen, war ja schon fast revolutionieren ! Jeder befand sich an dem Platz, an den der Herr ihn gestellt hatte. Sagte der Pfarrer. Sagten alle. Nur ihre Großmutter nicht. Die sagte, seinen Platz im Leben würde man sich selbst aussuchen.
Die ledergebundenen und goldgepunzten Buchrücken schimmerten geheimnisvoll, die Landkarten an den holzgetäfelten Wänden erzählten von fernen Welten. Die Bibliothek war ein Raum, in dem die Sehnsucht zu Hause war, in dem es nach Holz und Bienenwachs roch und in dem sich noch etwas befand, was Bettina nicht hätte beschreiben können. Geister vielleicht? Nein. Erinnerungen? Ja. Dabei war es kein altes Haus. Über dem Eingang stand die Jahreszahl 1867 gemeißelt – das Jahr von Bettinas Geburt.
»Oh ja, ich habe den Earl Grey gekannt … trink deinen Tee. So, wie die Friesen ihn trinken. Und nicht wie die Püppchen unten im Teepalast mit abgespreiztem Finger.«
Bettina gehorchte und nahm einen weiteren Schluck. Der schmeckte schon besser.
»Wie sah er aus?« Männerbeschreibungen waren eine der vielen Begabungen ihrer Großmutter, mit denen sie ganze Tischgesellschaften unterhalten oder vor Scham im Boden versinken lassen konnte. Aber an diesem Tag hatte sie sich wohl entschieden, zurückhaltend zu sein.
»Er war schon alt, als wir uns begegnet sind. Hager, asketisch, gesegnet mit einem Charakterkopf. Trotz der fortschreitenden Glatze. Ein paar Jahre vor seinem Tod war das, aber er blieb bis zuletzt ein Mann mit Grundsätzen. Und Moral. Was man nicht von allen hohen Herren behaupten kann. Ich habe ihm viel zu verdanken.«
»Was denn?«
»Trink.«
Noch ein Schluck. Der erdige, fast bittere Geschmack wurde nun durch die Sahne gemildert. Und dann … Bettina strahlte. »Jetzt wird es süß!«
»So ist das im Leben. So ist es oft. Erst ist es lange Zeit bitter, und man muss den Mund verziehen, aber mit etwas Glück ist der letzte Schluck das Beste, was es gibt.«
Bettina schloss die Augen und leerte die Tasse. Sahne, Zucker und warmer Tee verschmolzen zu einer einzigen Herrlichkeit. Als sie die Augen wieder öffnete, ruhte der Blick ihrer Großmutter mit einem Ausdruck auf ihr, den sie so noch nie gesehen hatte.
»Was ist? Hab ich was falsch gemacht?«
Diese Nachhilfestunden in der friesischen Teekultur hatten es in sich. Ihre Eltern sahen das nicht gerne, denn dadurch war ihre Tochter den unkontrollierten Einflüssen einer unkontrollierbaren Großmutter ausgesetzt. Aber Helene hatte darauf bestanden. Bettinas älterer Bruder Paul, ein stämmiger Bursche von zupackendem Wesen, hatte sich immer davor gedrückt. Bettina liebte diese Nachmittage. Sie hatte dann das Gefühl, irgendwie freier atmen zu können.
»Nein, Betty. Das hast du nicht. Ich musste nur gerade darüber nachdenken, was ich gesagt habe.«
»Das mit dem bitter und dem Besten?«
»Ja.«
Bettina stellte vorsichtig die Tasse ab, stand auf und machte einen Knicks. Dann beugte sie sich vor und hauchte der Großmutter einen Kuss auf die Wange. »Ich lasse Sie jetzt allein.«
Es war die Zeit des Nachmittags, zu der sich Helene gerne für eine Stunde zurückzog. Bettina wusste auch weshalb: weil sie dann in uralten, bröseligen Büchern blätterte und zerlöcherte Briefe las, und sie sie einmal, aus Versehen!, weil sie geglaubt hatte, die Bibliothek wäre leer, ganz versunken angetroffen hatte, mit einem sehnsüchtigen Lächeln, um dann ganz schnell die Schatulle zu schließen, in der sie das alte Zeug aufbewahrte.
»Danke, mein Kind. Dann sehen wir uns zum Dinner.«
»Jawohl, Großmutter.« Sie knickste und lief hinaus.
Helene strich über die schartigen Armlehnen des Stuhls. Der Gedanke, den sie beim Anblick ihrer Enkelin gefasst hatte, ließ sie nicht mehr los.
Sie stand auf. Ein Blick aus dem Fenster – Regen peitschte an die Scheiben. Auf See herrschte sicherlich Sturm, die Schiffe würden ihre liebe Not haben, einen sicheren Hafen zu erreichen.
Es war, als ob sie wieder das Salz auf den Lippen spüren konnte und die eisige Gischt auf ihrer Haut. Sie schloss die Augen und lehnte die Stirn an die kühle Scheibe. Ihre Gedanken wanderten zurück zu einem Mädchen, das vor langer Zeit in so einem Sturm jäh aus seinen Träumen gerissen worden war.
Auf dem kleinen Tisch neben dem Fenster lag eine einfache Schatulle aus Walnussholz. Jeder, der sie öffnete, wäre enttäuscht von dem, was er vorfinden würde: krümeliger Tee, der fast zu Staub zerfiel. Zimtstangen, die schon lange ihren Duft verloren hatten. Zu Papier verdorrte Blüten … Helene nahm die Schachtel und setzte sich damit vor den Kamin.
Der Wind heulte um die Ecken des Hauses. Das Feuer brannte hinunter, aber sie vergaß die Zeit, diese tückische Verräterin, die alles mit sich davontrug und nur Asche zurückließ. Wo war die Glut geblieben? Die verzehrende Leidenschaft, der Kampf ums Überleben, der wilde Triumph und diese entsetzlichen Verluste … davongetragen, in ein Sandglas gesperrt. Rieselnde Körnchen, die langsam, aber sicher alles unter sich begruben. Nur eines nicht. Die Erinnerung.
Das Murmelspiel
Hogsterwaard, Ostfriesland17. März 1834
Die Tür zur Stube wurde aufgerissen, noch bevor Lene begriff, was geschah.
»Opstahn! To! To! To!«
Ihr Vater Henry leuchtete ihr mit der Lampe direkt ins Gesicht.
»Opstahn! Aufstehen! Los!«
Verwirrt rieb sie sich die Augen. Es war mitten in der Nacht. Sie hatte vom Tanzen geträumt, vor der Marienkirche von Aurich. Zum Michaelismarkt waren sie dort gewesen mit ihren selbst geflochtenen Körben, und in Lenes Kopf wirbelten die Bilder immer noch durcheinander wie die Bänder des Maibaums: das Seidentuch der Mutter, das sie zum ersten Mal tragen durfte. Die bunten Kleider und Mützen der Leute. Die Fahnen im Wind. Die Musiker, Feuerschlucker und Wahrsagerinnen. Das Klappern ihrer Holzpantinen hatte sie zum Hafen getragen, wo die Schiffe dicht beieinanderlagen. Jeder Blick ein anderes Entzücken, jeder Schritt eine neue Überraschung. Lene war beglückt von einem Stand zum anderen gelaufen, hatte die bunten Stoffe und Bänder bestaunt und den Duft von Tee und Kaffee gerochen, war über Säcke mit Föhrer Hafer und Pellwormer Weizen gestolpert, vorbei an Eiderstädter Fettvieh und Jütländer Krickenten, an Fisch und Käse, Tellern und Krügen, Fässern mit Branntwein und Gewürzen aus fernen Ländern, wie magisch angezogen von den wilden, fröhlichen Klängen der Spielleute. Im Traum war es gestern gewesen; sie sah und roch und fühlte dasselbe wie damals. Dieses verrückte Herzklopfen, als sie Matz in dem Gewimmel entdeckte und er sie anlächelte und sich zu ihr durchschlug. Wie sie sich im Kreis drehten zur Musik, wilder und wilder, und Matz sie auffing und an seine Brust zog, ihr in die Augen sah, bis …
»Lene!«
Henry stand jetzt am Fußende der Butze, die sich die ganze Familie teilte. Der blakende Kienspan in seiner Hand warf Schatten auf die ausgemergelten Züge seines Gesichts. Ihre Schwestern Seetje und Hanna schliefen. Die Mutter wandte sich mit einem Stöhnen ab, als der Schein sie traf.
»Was ist los?«, fragte Lene schlaftrunken. Die Decke rutschte von ihren Schultern, und die Kälte ohne die Körperwärme der anderen ließ sie frösteln.
»’n Schipp auf Grund. Vielleicht Wattschiffer oder ’n Küstenfahrer. Wir müssen raus. Die annern sinn schon op de Beene.«
Henry, noch im Nachthemd, aber das Holzbein schon angeschnallt, stellte die Lampe auf die Gewandtruhe neben der Tür und ging zum Herd. Seetje blinzelte und robbte sich, schlafwarm wie ein junges Kätzchen, an Lene heran.
»Ist doch viel zu früh«, murmelte die Kleine und schlang ihre Arme um die große Schwester. »Die Krabben schlafen noch.«
Normalerweise ging Lene mit den anderen Frauen von Hogsterwaard in die Priele, um Krabben zu ernten. Immer zur hohlen Ebbe, der toten Zeit, die die Fischer zum Schlafen nutzten, mit Schiebenetz und Korb, und immer eine der Letzten, die vor der zurückkehrenden Flut mit hochgeschürztem Rock durch das eiskalte Wasser watete. Währenddessen entfachten die Männer große Feuer, und dann wurden die Krabben gekocht und anschließend in Greetsyhl1 zu Markte getragen.
Sie brachten nicht viel mehr als ein paar Witte – Weißpfennige –, und wenn es richtig gut lief, vielleicht auch mal einen Stuber oder Groten.
Die Torfstecher, die Leinweber, die Bauern, die Fischer – jeder achtete eifersüchtig darauf, dass der andere ihm nicht ins Handwerk pfuschte und das Geschäft verdarb. Als Henry vor ein paar Wochen das alte Boot gekauft und dafür den gesamten Notgroschen geopfert hatte, war das ein großes Risiko gewesen. Der Einbeinige uffmFiskersboat? Das würde nicht lange gut gehen … aber bisher ließen ihn die anderen in Ruhe. Vor dem Unfall war er Matrose gewesen, aber das mit dem Fischen musste er wohl erst noch lernen. Die Ausbeute war entsetzlich dünn, sodass Lenes Krabbenfischerei fast die einzige Einnahmequelle blieb.
Den Verkauf hatte bisher ihre Mutter Rensche übernommen, während Lene nach den harten Stunden im Watt zu Hause blieb und die Garten- und Hausarbeit übernahm. Doch die letzten zwei Wochen hatten gezeigt, dass das nicht mehr reichte. Rensches Kräfte ließen nach, je dicker ihr Bauch wurde. Sie war müde, den ganzen Tag, und fand nachts keine Ruhe. Noch ein Maul zu stopfen, hatte die Gerberin gesagt und einen verächtlichen Blick auf ihre Nachbarn geworfen.
»’n Schipp«, flüsterte Lene, um Hanna nicht auch noch zu wecken. »Wir müssen raus.«
Seetjes blaue Augen blitzten auf, und eine Mischung aus echtem Mitgefühl mit den armen Seelen draußen auf See und unbändiger Abenteuerlust huschte über ihr Gesicht. Alle sagten, sie sähen sich ähnlich wie ein Ei dem anderen. Die blonden Haare, die blauen Augen, die Stupsnasen und die gleiche hohe Stirn, die sehnigen Arme und die dünnen Beine. Sie hatten keinen Spiegel, aber Lene kam es vor, als würde sie sich selbst Jahre jünger in Seetjes schlafgerötetem Gesicht erkennen. Drei Kinder hatte die Mutter nach ihr verloren. Deshalb war der Altersunterschied zu den kleinen Schwestern so groß. Lene war mit ihren achtzehn Jahren die Älteste, dann kamen Hanna, zwölf, und Seetje, acht. Dass sich jetzt noch ein Nachzügler angemeldet hatte, war natürlich ein Grund zur Freude. Aber es war auch ein weiterer Esser.
»Piraten?«, flüsterte Seetje aufgeregt.
»Wohl eher ein Wattschipp, das in den Nordmarschen stecken geblieben ist. Und jetzt schlaf.«
»Kann ich nicht!«
»Dann dummel ein bisschen. Träum was Schönes.«
Jede Stunde Schlaf war eine Stunde weniger Hunger. Lene stieg vorsichtig über ihre Mutter. Gerade hatte sie das Lager verlassen, als eine heiße Hand nach ihr griff.
»’n Schipp?«
Rensches Stimme klang heiser. Lene beugte sich zu ihr hinab und strich ihr über die schweißnasse Stirn. Sie hatte Fieber, auch das noch.
»Vatter will raus und nimmt mich mit.«
Rensche setzte sich mit einem Stöhnen halb auf. »Das kann er nicht. Nicht mit seinem Bein.«
»Sag es ihm selbst.«
»Macht ihr ’nen Ströndgang?«
Der Strandgang war allgemein geduldetes Recht. Von Schiffen, die den Kampf gegen die See verloren hatten, wurde oft ein Teil der Ladung angespült. Da hieß es, schnell zu sein und vor den anderen zu finden, was die Wellen ans Ufer warfen. Bisher ging die wilde Jagd immer ohne die Vosskamps ab. Aber seit sie das Boot hatten, schien Henry nur auf so eine Gelegenheit gewartet zu haben.
»Das Wetter schlägt um.«
»Deshalb müssen wir uns ja beeilen.«
Henry stand in der Tür, fast angezogen. »To nu«, brummte er.
Erschöpft sank Rensche zurück auf das Lager. Sie winkte ihren Mann zu sich heran, der einen unsicheren Blick über die Schulter warf. Draußen auf der Straten waren Stimmen zu hören, das Klappern von Holzschuhen und genagelten Ledersohlen über Steine, und Rufe, die von Hast und Aufbruch kündeten, aber langsam leiser wurden. Sie mussten sich beeilen.
»Pass auf die Lüttje auf«, flüsterte sie mit Blick auf Lene. »Ich hab wieder von ihm geträumt …«
Im flackernden Licht der Kerze sah Lene eine Düsternis, die über das Gesicht ihres Vaters huschte.
»Sei nicht toll!« Der nervöse Unterton in seiner Stimme konnte niemandem entgehen. »Du träumst zu viel.«
Damit verließ er das Haus. Lene küsste ihre Mutter auf die Stirn und zog hastig den Bettkasten auf, in dem sie ihre wenigen Habseligkeiten verwahrte. In diesen kalten Nächten schlief sie immer angezogen, deshalb entfiel jetzt das lästige und zeitraubende Ankleiden. Hemd und Rock und Jacke, viel mehr besaß sie sowieso nicht.
Neben dem kalten Herd hingen die Wolltücher auf Haken an der löchrigen Bretterwand. Der Wind fuhr durch die Ritzen und ließ sie noch mehr frösteln. Wir brauchen Torf, dachte sie beim Anblick des leeren Korbs. Dringend. Wir müssen endlich mal wieder heizen. Mutter kann nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. An ein paar Krümel Tee wagte sie gar nicht zu denken. Die letzten Blätter hatten sie wohl schon drei Dutzend Mal ausgekocht.
»Lene!« Henrys Ruf klang drängend und ärgerlich.
Das ganze Dorf schien auf den Beinen, die Fackeln tanzten und hüpften durch die Nacht und strichen über die Fassaden der Katen. Vor fast jeder Tür standen Frauen und Kinder, um den Männern ein letztes Lebewohl zuzuschreien. Als sie Lene sahen, wandten sie den Blick ab. Nur die Gerberin nickte ihr kurz zu – Pack hächt2 sich, Pack verträgt sich. Sie waren die Außenseiter in Hogsterwaard, und das schweißte dann doch irgendwie zusammen. Lene zurrte ihr Tuch fest um die Schultern und stapfte los.
Es kam nicht oft vor, dass die Vosskamps bei etwas dabei waren. Lene konnte sich mit ihren achtzehn Jahren kaum noch daran erinnern, aber das war einmal anders gewesen. Henrys Unfall musste dabei eine Rolle gespielt haben, aber er sprach nicht darüber. Sie hatten einmal in einem richtigen kleinen Haus gewohnt, und es hatte im Winter ein prasselndes Feuer gegeben und im Sommer helles Leinen auf dem Gras, aber dann war etwas über sie hereingebrochen, ein Unheil, eine Verdammnis, eine so große Armut, dass sie sich bis zum heutigen Tag nicht davon erholt hatten.
Und Verachtung. Die war auch gekommen. Lene spürte sie in den Blicken der Leute. An der Art, wie sie ihr den Rücken zuwandten. Dass keiner sich bei den Festen zu ihnen setzte und in der Dorfschule man ihr schließlich den Platz neben der stotternden Sulla zugewiesen hatte, die sich nicht schnell genug dagegen wehren konnte. Einmal hatte Jolesch, der fahrende Händler, gesagt: »Lever dood as to Huus im sefte Beed« – lieber tot, als zu Hause im weichen Bett. Als sie ihren Vater danach fragte, hatte er sie zum ersten Mal geschlagen. Die anderen in Hogsterwaard zu fragen, traute sie sich nicht.
Aber sie kam ohne Zwischenfälle zum Hafen. Niemand stellte ihr ein Bein, keiner stieß sie vom Weg. Das musste daran liegen, dass alle nur ein Ziel hatten: das Sieler Tief, wo die Schiffe festmachten und das Boot ihres Vaters den ungünstigsten Platz hatte; ganz am Ende des natürlichen Beckens. Wenn sie Pech hatten, wären sie die Letzten, die hinauskamen. Die Flut hatte ihren Scheitelpunkt schon lange hinter sich. Es waren die letzten Minuten, in denen die Ausfahrt noch gelingen würde. Der Wind wehte kräftig aus Nordost und würde draußen auf See fast schon ein Sturm sein. Ihr Herz klopfte, und es lag eine seltsame Aggressivität in der Luft.
Die Nachricht von dem Schiffsuntergang musste sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Lene drängte sich durch die Gaffer und Zurückbleibenden. Ihr Vater war schon im Boot und rollte gerade die Persenning zusammen.
»Wat fürn Schipp?«, schrie es von links.
»Mecklenburger!«, rief jemand zurück.
»Engländer!«
»Preuße!«
»Lene! Mach die Leine los!«, schrie Henry.
Mit fliegenden Händen löste sie den Knoten und warf das Seil ins Boot. Schon hatte ihr Vater das Segel gehisst und das Reff eingebunden. Eine steife Brise fuhr hinein und ließ es knattern.
»Alle Mann auf! Alle Mann auf!«, schrie es von den anderen Schiffen. »Fest holen! Reftalje holen! Fiert! Rahen aufbrassen!«
Die Ersten verließen den Hafen.
»Verdammt!«, brüllte Henry, als die breite Grete von Jörg an ihnen vorbeizog, ein wendiger Hoeker, das größte Schiff von Hogsterwaard. Der Bugspriet bohrte sich fast in die Seitenwand von Henrys kleinem Boot. Lene hörte, wie das Holz sich wand und die Segel knatterten. Einen Moment sah es so aus, als würden sie krachend ineinander fahren.
»Hoo!«, schrie ihr Vater und ballte wütend die Faust. »Willst du uns umbringen, du Hundsfott?«
Jörg stand neben dem Klüverbaum und machte eine obszöne Handbewegung in ihre Richtung. Er war ein breiter, kräftiger Mann mit einem zerfurchten Gesicht und Händen hart wie Stein. Seine Söhne turnten auf Deck herum und bildeten sich etwas darauf ein, mit diesem Kahn angeblich bis vor die schottischen Küsten zu kommen. Ob ihre wilden Geschichten stimmten? So genau wollte das keiner wissen. Hauptsache, gut erzählt an den langen Abenden zwischen den Fangreisen oder beim Fleischer, wo Lene vor hohen Tagen um Abfälle bettelte und oft eine ganze Weile unbemerkt in der Ecke stehen bleiben konnte, bevor man sie bemerkte und die Grabesstille folgte, an die sie sich mittlerweile gewöhnt hatte.
»Lene!«, schrie ihr Vater. »Wind schießt auf! Anluven!«
Sie griff nach der Leine, um das Segel dichter zu holen.
»Hol! Hol dicht!«
Lene zog aus Leibeskräften, ihr Vater stand achtern und riss das Steuer herum.
»Lene! Verdammt!«
Sie legte ihr ganzes Gewicht in die Schoten und stemmte sich mit ihren Holzpantinen gegen das schartige Deck, und langsam, ganz langsam machte das Boot Fahrt und pflügte hart am Wind hinaus auf See. Sofort wurde es von den Wellen angegriffen, die sich auf es stürzten wie wilde, hungrige Tiere. Lene war klatschnass. Das Salzwasser lief ihr in die Augen, sie musste blinzeln und wischte sich das Gesicht am Oberarm ab.
Keuchend vor Anstrengung befestigte sie die Leine und hatte jetzt erst Gelegenheit, nach den anderen Fischerbooten Ausschau zu halten. Der Wind heulte, und jedes Mal, wenn sie aus einem Wellental nach oben stiegen, bot sich ihnen in der schwarzen sturmgepeitschten Nacht ein neuer Anblick.
Die Grete lag ein ganzes Stück backbord vor ihnen. Aber Henrys kleines, altes Boot hatte sich wacker im Mittelfeld der Verfolger gehalten.
»Wohin?«, schrie sie.
»Hart Nordost! Den annern efter!« Also den anderen nach. »Zur Leybucht! Ums Leyhorn herum!«
Das war nicht weit. An schönen Tagen keine halbe Stunde Fahrt. Aber bei diesem Wetter … sie war nicht vertraut mit dem Schippern. Erst ein paarmal hatte Henry sie mitgenommen, und da war es nicht so ein Schietwetter gewesen wie jetzt.
»Wissen die von der anderen Seite schon, was passiert ist?«
Damit meinte sie die Leute, die im Osten des Hörns lebten. Die Küste machte an dieser Stelle einen Schlenker ins Meer hinaus, als ob sie einen Finger ins Wasser krümmen würde, und links davon saß Hogsterwaard, rechts davon die Utlandshorner. Jetzt wurde ein richtiges Wettrennen daraus: Wer war als Erster an der Stelle, an die das Strandgut gespült wurde? Von beiden Seiten würden sie kommen und sich um die Kisten balgen. Lene war nicht wohl bei dem Gedanken. Wenn es ums Überleben ging, gab es keine Rücksicht mehr. Schon gar nicht auf die beiden Armhäusler in ihrem halb lecken Kahn.
Aber Henrys Boot hielt gut mit. Er stand breitbeinig an Deck, so wie er das wohl auch als junger Spund gemacht hatte, vor dem Unfall. Ihr Herzschlag raste. Welch eine Jagd! Und Henry war der Held. Alle Bitterkeit, die ihn in den letzten Jahren verzehrt hatte, schien wie weggeblasen. Hier war er in seinem Element. Seine Augen leuchteten, seine Stimme klang so kräftig, wie sie sie noch nie gehört hatte.
»Heejo! Heejo!«, schrie er und zog in weiter Entfernung an der Grete vorüber. Jörg ballte die Faust und brüllte etwas, das vom Wind verschluckt wurde. Es war erstaunlich hell, das musste am Mond liegen, der immer wieder hinter den jagenden Wolken hervorblitzte. Sie verbot sich, an die Männer auf dem Unglücksschiff zu denken. Was sich dort gerade abspielte oder noch vor Kurzem abgespielt haben musste …
»Was für ’n Schipp?«, rief sie gegen den Wind.
Henry zuckte nur mit den Schultern. Er sah angespannt in Richtung des Ufers, ein lang gestreckter dunkler Schatten, der eine halbe Seemeile entfernt lag.
»Fregatte oder Logger. Vielleicht mit Eis an Bord, wenn’s von England käm?«
»Oh nein!« Es war bei den Engländern zu einer Mode geworden, wendige schnelle Schiffe in die Karibik zu schicken, um den Plantagenbesitzern den Luxus eines gut gefüllten Eiskellers zu gönnen. Aber wenn die Fracht ins Meer fiel, würde sogar in der eiskalten Nordsee nichts mehr davon übrig bleiben.
»Oder Salz«, grinste Henry. »Oder Tee.«
»Bitte nicht!« Tee – das kostbarste Gut, das ein Schiff laden konnte, und das verderblichste, wenn es mit Salzwasser in Berührung kam. Lene dachte eher an etwas Handfestes wie eine Schatzkiste voller Seidenstoffe und Goldmünzen. Aber was bei solchen Unglücken meist an Land gespült wurde, war geborstenes Holz und, so selten, dass es fast zur Legende geworden war, ein Fass mit Branntwein. Aber es gab ja auch noch das, was man nach der Flut fand. Zerrissenes Segeltuch. Kochgeschirr. Leere Kaffeesäcke. Ölfässer. Manchmal auch … Lene schloss die Augen. Manchmal auch einen toten Seemann.
»Gottverdammich!«
Erschrocken sah Lene zu ihrem Vater.
»Das Leuchtfeuer!«
Durch die Dunkelheit stach ein helles Licht.
»Da ist es doch.«
»Ja! Aber erst jetzt! Diese Verbrecher. Diese gottlosen Hunde.«
Wütend stemmte er sich gegen das Steuer, um den Kurs zu halten.
»Vielleicht hast du dich getäuscht?«
Aber nein, das hatte er nicht. Jetzt, wo das Feuer wieder in der Turmspitze loderte und weithin sichtbar war, musste selbst einem Blinden klar sein, dass es eine ganze Weile nicht gebrannt hatte.
»Du meinst … sie haben es gelöscht?«
Henry nickte grimmig. »Wir müssen zurück. Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn das rauskommt, wandern wir alle zusammen an den Galgen.«
Noch nicht einmal Mord und Totschlag waren so schlimm wie das mutwillige Löschen eines Seefeuers. Es war ein abscheuliches Verbrechen, Schiffe in den Untergang zu locken.
»Umdrehen?«, rief sie.
Ihr Vater nickte. Lene robbte sich zum Bug nach vorne und befolgte die raschen Befehle von achtern. Langsam, ganz langsam legte sich das Boot leicht zur Seite. Die Segel knatterten empört im Wind, und von irgendwoher hörte sie heisere Rufe. Wahrscheinlich von den anderen Booten, die nicht verstanden, warum jemand so kurz vor dem Ziel wieder abdrehte.
Und die See machte es ihnen schwer. Als ob sie sich mit aller Macht gegen das hölzerne Ding auf ihrem Rücken stemmen und es abschütteln wollte. Das Gebrüll ihres Vaters ging fast unter im heulenden Sturm und dem Tosen der Wellen. Ihre Hände waren wundgescheuert, obwohl sie schon mit Schwielen übersät waren. Ihre Beine zitterten, weil ihre Kraft kaum noch ausreichte.
»Lene!«, schrie er. »Lene!«
Sie drehte sich zu ihm um, und das war ein Fehler. Die Leine riss und rutschte aus ihren Händen. Sie konnte das Ende nicht mehr fassen, der Großbaum drehte sich und traf Henry mit voller Wucht, nahm ihn mit über Bord und warf ihn ins brodelnde Wasser.
»Vater!«, schrie sie entsetzt. Der Baum kam zurück, sie konnte sich im letzten Moment ducken, um nicht auch noch über Bord geschleudert zu werden. Das lose Ende der Leine schwang wie eine Peitsche durch die Luft. Sie stürzte sich darauf und ignorierte den brennenden Schmerz, den das Salzwasser in die abgeschürften Handflächen schoss. Sie verknotete es und hastete so schnell es ging zum Steuer.
»Vater!« Es war, als wäre sie selbst untergegangen und umschlossen von einer dumpfen, undurchdringlichen Kälte. »Henry!«, schrie sie.
Er war weg. Das Boot kletterte über die nächste Welle. Oben auf dem Kamm gelang es ihr, einen kurzen Blick in die Richtung zu werfen, in der Henry verschwunden war. Die anderen Boote hatten das Leyhorn erreicht, das Leuchtfeuer zog eine geisterhafte Spur aus Licht übers Meer.
»Vater!« Die Verzweiflung sprengte fast ihre Brust. Tränen schossen ihr in die Augen, und langsam, begleitet vom triumphierenden Heulen des Windes, sank das Boot ins nächste Tal.
Ihre Hände zitterten, sie schrie, betete, heulte, wusste nicht mehr, wie lange das ging und wie weit sie schon weg war von der Stelle, an der Henry ins Meer geworfen worden war. Spuckte auf ihre Hände, diese nutzlosen Mörderhände, die ihrem eigenen Vater nicht hatten helfen können, biss sich auf die Knöchel und stemmte sich gegen das Steuer.
»Help!«, kam es von irgendwoher. »Help!«
»Hjir to!«, brüllte sie. »Hier zu!«
Sie spähte backbord und steuerbord. Ihr Herz raste wie verrückt. Der Wind klatschte ihr das nasse Haar ins Gesicht, ihr Rock klebte an den Beinen. Sie angelte nach der Notleine, bereit, sie jederzeit über Bord zu werfen.
»Help!« Und dann sah sie im Schaum der nächsten Wellenkrone einen Kopf und zwei rudernde Arme. Mit aller Kraft warf sie die Leine in diese Richtung. Arme und Kopf verschwanden, tauchten wieder auf, und das Boot warf sich ins nächste Tal, sodass von Henry nichts mehr zu sehen war.
»Fass zu!«, betete sie. »Fass zu, um Himmels willen!«
Die Leine straffte sich. Jemand hatte sie ergriffen! Bisher weigerte sich ihr Verstand zu begreifen. Aber der kurze Ruck hatte gereicht, um all ihre Kräfte noch einmal zu mobilisieren. Sie hielt das Steuer so fest sie konnte. Die Gischt sprühte ihr ins Gesicht. Hastig wischte sie sich die Augen frei und sah auf die Leine. Nicht loslassen, betete sie, nicht loslassen!
Die Küstenlinie kam näher, und endlich, endlich wurde der Wind schwächer. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Henry würde es wissen. Sie mussten es nur ins flache Wasser schaffen, damit er ins Boot klettern konnte. Jetzt wagte sie, für einen Augenblick nach hinten zu sehen. Die Leine war noch gut zehn Meter gestrafft, und sie konnte die Gestalt eines Mannes erkennen, der sich erschöpft daran festhielt.
Es war nicht Henry. Und schon rollte wieder eine Welle heran und nahm ihr die Sicht.
Sie schnappte nach Luft. Vielleicht hatte sie sich getäuscht? Angespannt wartete sie auf die nächste Dünung, die paar Sekunden dehnten sich zu einer Ewigkeit. Er ist es, sagte sie zu sich selbst. Das kann nicht sein. Wo sollte denn so plötzlich jemand anderes auftauchen …? Und dann fiel ihr das Schiff ein, das mit Absicht ins Verderben geschickt worden war. Es musste jemand von der Besatzung sein.
Nein. Mehr brachte ihr Hirn nicht zustande. Nein, nein, nein! Das Heck hob sich, und als es sich das nächste Mal senkte, starrten sie aus der Dunkelheit die verzweifelten Augen eines Mannes an, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Angst verzerrte seine Züge, Todesangst. Und da war noch etwas, das sie nicht begriff: Er sah anders aus als all die Menschen, denen sie bisher begegnet war.
Mit ungeheurer Wut wandte sie sich wieder nach vorne. Irgendwann knirschte es unter dem Kiel. Noch ein, zwei Meter, dann stoppte die Fahrt, und das Boot neigte sich zur Seite. Sie ließ das Steuer los, warf den Anker, schlug die Hände vors Gesicht und ging in die Knie. Beugte sich nach vorne. Biss sich auf die Lippen vor Schmerz, konnte die Hände nicht mehr öffnen, weil sie sich zu lange verkrampft hatten, und wurde von einem hemmungslosen Schluchzen geschüttelt, wie sie es noch nie erlebt hatte.
»Help«, rief er. »Pull! Pull!«
Eine hohe, junge Stimme. Genauso schockiert und verängstigt wie sie.
Lena wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht und kam taumelnd auf die Beine. Sie konnte kaum erkennen, wer da im hüfthohen, eisigen Wasser stand. Vielleicht ein Schiffsjunge oder ein junger Leichtmatrose. Seine Zähne klapperten, er zitterte am ganzen Körper. In den Händen hielt er immer noch die Leine. Sie beugte sich über die Bordwand und hielt ihm ihre Hand entgegen. Fast hätte sie aufgejault vor Schmerz, als er sie packte. Mit letzter Kraft gelang es ihr, ihn an Deck zu ziehen.
Er brach vor ihren Augen zusammen. Spuckte, keuchte, krümmte sich, erbrach schließlich einen Liter Seewasser und wimmerte schlussendlich leise vor sich hin. Lene betrachtete ihn, wie man etwas ansah, dem man noch nie im Leben begegnet war und mit dem man auch keine nähere Bekanntschaft schließen wollte. Schließlich stieß sie ihn mit ihrem Fuß an. Die maßlose Enttäuschung, dass er nicht Henry war, ließ bei seinem erbärmlichen Anblick etwas nach.
»Wer bist du? He! Rede!«
Das Wimmern hörte auf. Erst kam er auf alle viere, dann versuchte er, sich auf die Beine zu stellen. Beim zweiten Mal packte sie ihn an seinem Hemd und zog ihn hoch.
Er war etwas kleiner als sie, sehr schmal und sehr jung. Aber das Hemd, zerrissen und klatschnass, das sie zunächst für das eines Schiffsjungen gehalten hatte, war aus Seide. Er trug einen Gürtel aus Leder und Kniebundhosen, die ziemlich neu aussahen. Das Seltsamste an ihm war sein Gesicht. Hohe Wangenknochen und schmale Augen, dazu eine trotz seiner Blässe dunkel getönte Haut. Ein Chinese?
»Wer bist du?«, fragte sie noch einmal.
Der Junge stammelte etwas, das sie nicht verstand. Dann deutete er auf das Meer und rief ein ums andere Mal: »Lady Grey! Lady Grey!«
»Suchst du deine Lady? Ist sie da draußen?«
»Schipp. Schipp Lady Grey!«
Jetzt verstand sie. Er musste das Schiff meinen, das da draußen auf Grund gelaufen war. Sie dachte an die anderen aus dem Dorf, die jetzt am Strand darauf warteten, dass herrenloses Gut angeschwemmt wurde, an dem das Blut der unschuldigen Seelen klebte.
Er verbeugte sich, mehrmals. Dabei legte er die Handflächen zusammen vor die Brust.
»Puyi«, sagte er. Und dann: »Thank you, thank you.«
Lene wusste nicht, was das hieß, aber sie ahnte es. Hier oben schnappten sie immer mal wieder ein paar Brocken Englisch, Französisch und Niederländisch auf. Die Küstendialekte ähnelten sich sehr. Aber dieser Junge schien von sehr fernen Ufern zu kommen. Dennoch sprudelte es aus ihm heraus, und ab und zu glaubte sie, Worte zu erkennen, die dem Friesischen nicht unähnlich waren. Er wollte wohl wissen, wo sie gestrandet waren.
»Friesland«, sagte sie. »Das ist jetzt das Königreich Hannover. Vorm Leyhorn. Ihr müsst auf dem Weg nach Emden gewesen sein. Emden?«
Er verstand sie nicht.
»Friesia? Norden? Leer? Aurich?« Was gab es noch, wo fing die Welt an? »Bremerhaven?«
»Bremen?« Sein Gesicht hellte sich auf. »Yes, yes, Mylady!«
Ihre Zähne fingen an zu klappern, sie zitterte am ganzen Leib. Ohne einen Laut von sich zu geben, brach sie zusammen.
Das Nächste, woran sie sich erinnern konnte, war eine brennende Flüssigkeit in ihrer Kehle. Sie schluckte, hustete, keuchte und schob die Hand weg, die ihr noch mehr einflößen wollte.
Puyi, wenn der Junge so hieß, steckte das kleine Fläschchen zurück in seinen Gürtel.
»Go?«, fragte er und deutete zum Ufer. Eine erste Ahnung des Morgens breitete sich im Osten aus und ließ die Küstenlinie hervortreten.
Lene hangelte sich an der Bordwand hoch und biss die Zähne aufeinander, um vor Schmerzen nicht laut aufzuschreien. Puyi sprang zurück ins Wasser und half ihr, das Boot zu verlassen. Sie streifte die Pantinen ab und behielt sie in der Hand.
Gegen den eisigen Wind war das hüfthohe Wasser fast schon warm. Hand in Hand kämpften sie sich zum Ufer durch, über lose Steine und schmatzenden Schlick. Endlich erreichten sie nasses Land. Lene schleppte sich noch ein paar Schritte eine Düne hoch und ließ sich dann fallen. Die fahle Morgendämmerung ertastete das Meer.
Vater, dachte sie, und Tränen schossen ihr in die Augen. Ich bete, dass du es an Land geschafft hast.
Der Junge hockte neben ihr und starrte aufs Wasser. Lene musste bis zur nächsten Flut warten, bis sie das Boot wieder flottkriegen würde. Verzweifelt sah sie auf ihre Hände. Allein war das nicht zu schaffen. Sie musste ins Dorf zurück und Hilfe holen.
Der Junge sagte etwas, das sie nicht verstand. Sie biss die Zähne zusammen und atmete tief durch. Sie spürte Hass auf ihn, dass er lebte und atmete und Henry den Kampf vielleicht schon verloren hatte.
Er stieß sie sacht an. Die Berührung ließ sie hochfahren – ein Reflex auf all die Knüffe und Schläge, die sie in ihrem Leben schon bekommen hatte. Sofort gestikulierte er mit den Händen – ich wollte dir nichts tun!, sollte das heißen. Sein Gesicht war ein heller Fleck in der Dämmerung. Fremdländisch, aber nicht furchteinflößend. Wahrscheinlich hatte er genauso viel Angst wie sie.
Was machte man eigentlich als Schiffbrüchiger, wenn man an einer fremden Küste angespült wurde? Sie hatte keine Ahnung. Ihr Widerwille wuchs, als sie aufstand und er das Gleiche tat. Er wollte sich doch nicht an ihre Fersen heften?
Aber genau das tat er. Nachdem Lene noch die Hand zu einem schwachen Gruß erhoben hatte und losging, blieb er hinter ihr. Wenigstens hielt er ein paar Schritte Abstand. Dabei redete er ohne Unterlass in seiner Heimatsprache, die seltsam klang, irgendwie zwischen zwitschernd und rau. Kehlige Laute wechselten sich ab mit weit ausholenden Vokalen, Stakkatosilben und Sätzen ohne Pause.
Hinter den Dünen wurde das Land flach. Sie kamen nur schwer voran, weil der sumpfige Morast kaum Möglichkeiten zum Ausschreiten bot. Obwohl sie durch das Krabbenfischen einiges gewohnt war, setzte ihr der Marsch ziemlich zu. Erst als das Tageslicht durch bleigraue Wolken kroch, ging es etwas einfacher voran. Das sumpfige Marschland wurde trockener, es musste nicht mehr jeder Meter erkämpft werden. Lene, die schon früh gelernt hatte, sich nach den Himmelsrichtungen zu orientieren, hielt sich einfach an Südwest. Als in der Ferne endlich eine Kirchturmspitze auftauchte, atmete sie auf. Middelstewehr. Von dort aus war es nicht mehr weit bis Hogsterwaard.
Sie kamen auf einen Pfad, der in einen Weg mündete und schließlich eine Kreuzung erreichte, an der einige Bäume und etwas Gebüsch standen. Lene setzte sich auf einen Findling, der wahrscheinlich zu genau diesem Zweck an die Kreuzung gerollt worden war. Die Erschöpfung war so groß, dass sie alles Fühlen und Denken verschluckte.
Puyi, wenn er so hieß, hockte sich in respektvoller Entfernung auf den Boden. Sie schlang die Arme um ihren Körper, aber es half nichts. Sie fror zum Gotterbarmen. Ihre Füße waren rot und blau, überzogen von blutigen Kratzern und Striemen. Ihr langes Haar hing in einem verfilzten Knoten im Nacken, und ihr Gesicht musste auch etwas abbekommen haben, die linke Wange brannte wie Feuer.
»Was hast du vor?«, fragte sie. Ihr war klar, dass sich ihre Wege hier trennten.
Er sah sie fragend an.
»Wo willst du hin? Hier ist Friesia. Du warst auf einem englischen Schiff. Du musst zurück, egal, wo du herkommst.«
Hatte er sie verstanden? Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Mager war er, genauso dreckig wie sie. Und bestimmt auch nicht viel älter. Der erste Chinese meines Lebens, dachte sie und hoffte, dass er ihre Musterung nicht als aufdringlich empfand. Woher sollte sie wissen, wie man sich diesen Leuten gegenüber benahm?
»Pin Dschinn«, sagte er. Und als sie nicht verstand: »Guaang Tschou.«
Sie hob ratlos die Schultern.
»Kwong Tschau?«, fragte er. Als sie immer noch nicht verstand, fuhr er sehr deutlich fort: »Can Ton.«
»Kanton?«
Irgendwo hatte sie das schon einmal gehört … eine Stadt, sehr weit weg, am anderen Ende der Welt. Sie erwiderte sein Lächeln.
»Tee! Du kommst aus der Stadt, aus der der Tee kommt!«
Die Händler hatten ihn direkt aus den Kisten auf dem Michaelismarkt verkauft und ihn dabei mit Namen angepriesen, die sie noch nie gehört hatte. Souchong. Oolong. Congou. Direkt aus Kanton! Nur sechs Monate auf See! In kleinen Tüten wurde er verkauft, kostbar wie Gold und Diamanten.
Puyi nickte heftig. Sein Grinsen wurde breiter. Er deutete auf sie.
»Hogsterwaard«, antwortete sie in der Hoffnung, dass sie seine Geste richtig verstanden hatte. »Ein kleines Dorf nah an der Küste.« Sie sprach überdeutlich und pikte mit dem Zeigefinger auf ihre Brust. »Ich bin Lene.«
»Lee-Nie«, wiederholte er.
»Lene Vosskamp. Mein Vater heißt Henry.«
Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie sah über die Schulter zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »Er ist draußen geblieben. Vielleicht ist er ertrunken.«
»Father Henry?«
Sie nickte und wischte sich schnell die Tränen ab. Puyi stand auf und trat zu ihr. Ohne zu fragen, nahm er an ihrer Seite Platz. Sofort rückte sie weg von ihm. Was bildete er sich ein?
»He ist dead?«
Sie ahnte, was er sagen wollte. Dead und dood klangen ähnlich.
»Warum sprichst du Englisch? Du bist doch ein Chinese?«
Die dunklen Haare fielen ihm in die Stirn. Sie glänzten wie Ebenholz. So ein Schwarz hatte Lene noch nie gesehen. Sie fragte sich, wie es sich wohl anfühlte, mit den Fingern hindurchzufahren.
Er verstand sie nicht. Aber er sah sie an, offen und interessiert. Ohne Feindseligkeit, ohne Verachtung. Sie war schon so daran gewöhnt, immer den Blick niederzuschlagen, dass sie ganz erstaunt war, es bei ihm nicht zu tun.
Doch dann geschah etwas. Seine Schultern strafften sich, und er fuhr mit der Hand unter sein Hemd. Dort ließ er sie ruhen und sah aufmerksam zum Weg Richtung Norden.
Hufschlag näherte sich von Ferne. Jemand musste früh von der Küste aufgebrochen sein und war nun auf dem Weg ins nächste Kirchspiel.
»Heda!«, schrie sie und humpelte auf die Kreuzung. »Halt an!«
Das Pferd war ein behäbiger Brauner, und auf seinem Rücken saß ein hochgewachsener Mann in dunklem Rock. Kein Bauer, kein Skipper, kein Fischer. Vielleicht ein Händler? Die trugen solche Kleidung, wenn sie gute Geschäfte machten und sich das Tuch leisten konnten. Er fiel in Trab, dann in Schritt. Der Schweif des Pferdes schlug nervös. Der Mann mochte um die vierzig sein, mit scharfen Falten im Gesicht und einem stechenden Blick. Instinktiv zog sie die Schultern hoch und sah zu Boden. Vielleicht gehörte er auch zur Obrigkeit und bezichtigte sie nun der Wegelagerei?
»Was willst du?« Die Stimme passte zu ihm. Streng und von oben herab. Sie spähte kurz über ihre Schulter, aber Puyi war weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Gut. Einem Mädchen zu helfen fiel hohen Herren bestimmt leichter, als wenn zwei abgerissene Gestalten aufgetaucht wären.
»Ich muss nach Hogsterwaard. Mein Vater und ich hatten heute Nacht ein Unglück auf See, er ist …« Sie stockte.
Der Mann hielt seinen Braunen an und stieg ab. Das war immerhin ein gutes Zeichen. Als er allerdings näher kam, wirkte er geradezu Angst einflößend. Immer noch fixierte er sie, sah auf ihre blutenden Füße, die zerschundenen Hände und den Dreck in Kleidung und Haar.
»Was ist mit deinem Vater?«
»Er ist draußen geblieben«, flüsterte sie und fühlte, wie sie noch kleiner und unterwürfiger wurde. »Ich hab es nur mit Müh und Not an Land geschafft.«
Er warf den Zügel über den Sattel.
»Du kommst aus Hogsterwaard? Warum seid ihr raus?«
»’n Schipp«, flüsterte sie. Er trat noch näher zu ihr. Sie wich nach hinten aus, aber das stoppte ihn nicht.
»Was für ’n Schipp?«
Lene hielt den Kopf weiter gesenkt, um ihn durch ihren Blick nicht weiter zu provozieren.
»Weiß ich nicht. Die Nachricht kam mitten in der Nacht. Alle sind raus. Aber wir … wir haben nur so einen lecken Kahn, den hat Vatter erst letztes Jahr zusammengespart. Wir sind Korbflechter und Krabbenfischer, aber mit dem Boot …« Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. »Mit dem Boot haben wir ab und zu noch ein paar Fische fangen können. Jetzt liegt es fest. Und Vatter …«
»Wo ist dein Vater?«
Nichts in seiner Stimme verriet auch nur einen Funken Mitgefühl.
»Ich weiß es nicht«, schluchzte Lene. »Er ist über Bord gegangen.«
»Dann seid ihr nicht bis zur Leybucht?«
Woher wusste er das? War die Nachricht so schnell über die Dörfer gerast? Sie sah hoch, aber als sie den Ausdruck auf seinem Gesicht bemerkte, erschrak sie zutiefst.
»Nein, großachtbarer Mijnheer.« War das richtig? Wo hatte sie nur so eine Anrede aufgeschnappt? »Wir sind vorher umgedreht.«
»Warum?«
Lene zuckte mit den Schultern. »Mein Vatter wollte das so.«
»Dein Vater dreht ab, während alle anderen wie die gierigen Hunde in die Bucht fahren, um Strandgut zu sammeln? Auf See? Das ist eine seltsame Geschichte, Mädchen. Sehr seltsam.«
Spätestens jetzt wusste Lene, dass aus der Hilfe nichts werden würde. Sie lugte nach links, dann nach rechts. Vielleicht, wenn sie sich in die Büsche schlug …
»Es war aber so.«
»Und euer Boot?«
»Das musste ich zurücklassen. Ich kann es ja schlecht bis Hogsterwaard treideln.«
Peng! Die Ohrfeige traf Lene so unvermittelt, dass sie beinahe rückwärts über den Findling gestolpert wäre.
»Lüg mich nicht an! Du tauchst hier auf, ganz in der Nähe vom Leuchtfeuer, abgerissen und voller Blut, und willst mir erzählen, dass du nicht zu den Strandräubern gehörst?«
»Nein!« Himmel, wer war dieser Mann? »Nein, wir waren nicht dabei!«
»Und warum nicht?«
»Mein Vatter hat geglaubt, dass das Leuchtfeuer … dass es nicht gebrannt hat. Ich weiß es nicht, ich hab nicht darauf geachtet. Aber er sagte, er will zurück, damit wir nicht am Galgen landen.«
Die Hand des Mannes fuhr vor und packte sie im Nacken. Lene schrie auf vor Schmerz, aber mit ihren verletzten Händen war es unmöglich, sich zu wehren. Durch einen Tränenschleier sah sie, wie das Gesicht des Mannes zu einer Furcht einflößenden Fratze wurde. In seinen Augen glimmte etwas, das zwischen maßloser Wut und schierer Lust lag.
»An den Galgen?«, spie er sie wütend an. »Das ist noch viel zu gut für euch Verbrecher! Du kommst mit. Ich hole den Hofrichter von Middelstewehr und den Drosten von Greetsyhl. Und dich schleife ich am Seil hinterher!«
»Nein«, wimmerte sie. »Mijnheer! Bitte! Bitte!«
Er zerrte sie zum Gebüsch. Lene wehrte sich, sie schrie und strampelte, aber er war stärker als sie. Plötzlich spürte sie den Griff zwischen ihren Beinen. Er presste sie an den Baumstamm, die eine Hand an ihrer Kehle, die andere unter ihrem Rock.
»Nein, Mijnheer, nein, bitte, bitte!«
»Aber vorher werde ich dich noch lehren, wie wir mit Strandräubern umgehen!«
Lene schrie. Schrill und hoch, in aller Verzweiflung, aber das schien ihn erst recht anzufachen. Er riss ihr das Hemd auf, dann zerrte er an ihrem Rock. Und dann hörte sie einen dumpfen Schlag, und ein Ruck ging durch den Mann. Er ließ ab von ihr, öffnete den Mund, als ob er noch etwas sagen wollte, und brach zusammen. Hinter ihm tauchte Puyi auf, bleich, mit von Todesangst verschatteten Augen, und starrte sie an.
Der Mann zu ihren Füßen röchelte. Puyi hielt einen Stein in der Hand und ließ ihn fallen. Seine Hand war blutverschmiert. Er ging in die Knie und drehte den Ohnmächtigen auf den Rücken, klopfte ihm auf die Wange – keine Reaktion! – und stand wieder auf.
Sie raffte ihr Hemd und den zerrissenen Rock zusammen und stieg über den schlaffen Körper. Dann stürzte sie auf die Knie, robbte ins Gebüsch und erbrach das bisschen Galle, das noch übrig war. Irgendwann kam Puyi zu ihr. Er berührte sanft ihre Schulter, doch sie rückte mit einem angsterfüllten Schrei sofort von ihm weg.
Was haben wir getan?, dachte sie. Und wieder: Was haben wir getan?
Wen auch immer Puyi außer Gefecht gesetzt hatte – dieser Mann dort, der ohnmächtig mit einer blutenden Wunde im Gras lag, hatte die Macht, sie alle an den Galgen zu bringen.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte sie mit brüchiger Stimme.
Sie mussten verschwinden, so schnell wie möglich. Der Gedanke, ohne ihren Vater und mit blutbefleckten Händen zu ihrer Mutter zurückzukehren, war unfassbar. Selbst wenn alle ihr glaubten – dieser Mann hatte die Gewalt. Und sie, Lene, hatte nichts. Sollte sie zurück, um die anderen zu warnen? Wahrscheinlich waren sie jetzt fertig mit dem Plündern, schon wieder auf See, setzten die Segel und warteten auf die Flut, um am Nachmittag zurück nach Hogsterwaard zu fahren. Zur Bucht zu laufen war sinnlos. Sie musste verschwinden, und zwar so schnell wie möglich.
Puyi, der wohl mehr den Ton ihrer Frage als den Inhalt verstanden hatte, deutete auf das Pferd, aber Lene schüttelte wild den Kopf. Nicht auch noch Raub! Wusste er denn nicht, was ihnen bevorstand?
»Du gehst da lang, ich dorthin.«
Sie deutete in entgegengesetzte Richtungen. Sollte er doch sehen, wie er allein zurechtkam.
»Prima?«, fragte der seltsame Junge und wandte sich nach Nordost, dorthin, wo Lene ihn am liebsten augenblicklich geschickt hätte. Sie schreckte aus ihren Gedanken hoch.
»Prima?«
»Was meinst du?«, herrschte sie ihn an.
»Breehhmaa.« Er betonte jeden einzelnen Buchstaben.
»Bremen?«, wiederholte sie erleichtert und nickte. »Genau da lang.«
Sie wies nach Südost und lief los, ohne sich umzusehen. Das Zittern ihrer Hände hatte aufgehört, dafür kehrten die Schmerzen zurück. Bei ihrer Gegenwehr hatte sie sich außerdem den linken Fuß verletzt, er schmerzte beim Auftreten. Sie musste sich durch die Felder schlagen und hoffen, dass vorerst keiner sie in diesem Aufzug sah.
Der Hufschlag des Braunen klapperte dumpf über den Weg. Wenig später tauchte das Pferd neben ihr auf.
»Mylady?«
Puyi thronte auf dem Sattel, als hätte er niemals woanders gesessen. Reiten konnte er also.
»Hättest du lieber mal schwimmen gelernt«, giftete sie.
Er beugte sich zu ihr herab. Wieder fuhr seine Hand unter sein Hemd, das mittlerweile getrocknet war und trotz der Risse und Flecken immer noch besser aussah als alles, was sie in Hogsterwaard je zu Gesicht bekommen hatte.
Sie wurde wieder sichtbar mit einem kleinen Beutel.
»For you.«
Er drückte ihn ihr in die Hand, trieb den Braunen mit den Schenkeln und bog ab vom Weg, dorthin, wo weit entfernt die Stadt Bremen lag mit ihren vielen Menschen und Häusern, wo einen keiner nach dem Woher und Wohin fragte.
Der Beutel war faustgroß, feucht und schwer. Sie starb fast vor Ungeduld, bis sie ihn endlich aufgeknotet hatte. Dann stieß sie einen enttäuschten Schrei aus.
Es war Tee. Schwarzer, salzwassernasser Tee. Immerhin, man konnte ihn vielleicht erst mal aufbrühen und abschütten. Mit etwas Rübensirup wäre er vielleicht noch genießbar, wenn sie irgendwo an so eine Kostbarkeit herankäme.
Tee. Es war das erste Mal an diesem düsteren Tag, dass ein grimmiges Lächeln um ihre Mundwinkel zuckte. Die Hogsterwaarder Strandpiraten hatten zusammen mit dem Leuchtturmwärter ihr Leben riskiert, um ein Handelsschiff vom Kurs und ins Verderben zu bringen. Und alles, was an den Strand gespült werden würde, war verdorbener Tee. Dies war wohl für alle ein Pechtag.
Es war eine ärmliche Kate, in der die Vosskamps hausten. Am Dorfausgang gelegen, nur ein paar Schritte von der stinkenden Abzucht entfernt, an der der Gerber seinem Geschäft nachging, und nah am Weg zu den Feldern, auf denen die Marschbauern Kartoffeln und Gerste anbauten.
Das Wetter in den letzten Wochen war zu schlecht gewesen, um das Reisig zu trocknen, das sie für ihre Körbe brauchten, deshalb stand es immer noch in Bündeln an der Bretterwand. Ein paar löchrige Hemden flatterten auf der Leine im Wind, aber kein Rauch stieg aus dem Loch im Dach. Lene war über die Äcker gelaufen, um nicht gesehen zu werden. Im Geist überschlug sie, wen sie bitten könnte, mit ihr das Boot zu retten. Henning, den Gerber? Ein versoffener, stinkender Übeltäter und zu alt. Vielleicht Jann und Casper Groth, die Reichsten im Dorf? Jörgs Söhne waren jung und kräftig. Jann hatte ihr eine Weile nachgestellt, aber sie hatte schnell begriffen, dass er nur jemanden suchte, an dem er vor der Ehe üben konnte. Casper hingegen war ein Duckmäuser, der sich noch nie mit Hilfe für andere hervorgetan hatte. Nein, die beiden fielen wohl aus.
Zögernd ging sie durch den kleinen Garten auf die schiefe Haustür zu. Sie setzte sich auf einen umgekippten Eimer und versuchte, den gröbsten Dreck von ihren Pantinen zu entfernen.
Die Tür wurde aufgestoßen, und Hanna stürzte heraus.
»Lene! Ich hab dich kommen sehen. Was hast du mitgebracht?«
Dann spürte das Mädchen, dass etwas nicht stimmte. Sie konnte es sehen an den Empfindungen, die sich in Lenes Gesicht spiegelten.
»Wo ist Vatter? Was ist passiert?« Hanna, verunsichert durch Lenes Anblick, drehte sich um und rief ins Dunkel der Kate hinein: »Lene ist wieder da!«
Rensche erschien, die Hände im Rücken, den riesigen Bauch nach vorne geschoben, ihre Wangen glänzten fiebrig. »Wo ist Henry?«
Hinter ihr tauchte Seetje auf, den Daumen im Mund, um den Hunger zu betäuben. Sie klammerte sich an den Rock der Mutter. Der Rotz unter ihrer Nase war getrocknet. Alle husteten und schnieften. Das würde wohl erst im Sommer besser werden.
»Ich weiß es nicht«, sagte Lene.
Rensche machte sich von ihrer Jüngsten los und kam zwei Schritte hinaus. In der Hand hielt sie einen Kochlöffel.
»Was soll das heißen, du weißt es nicht?«
»Der Großbaum hat ihn erwischt. Die Leine ist gerissen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte!«
Rensche hob den Kochlöffel. Seetje und Hanna gingen in Deckung. Auch Lene zuckte zusammen.
»Wo ist Henry?«
»Ich weiß es nicht!« Lene sprang auf und stolperte ein paar Schritte zurück. »Ich hab das Boot gerade noch ans Ufer gebracht. Dann bin ich gelaufen. Er ist ins Wasser gefallen. Ich konnte nichts tun, gar nichts!«
»Du weißt es nicht?«, schrie Rensche. »Du bist doch raus mit ihm! Wie kannst du da allein zurückkommen?«
Zack, fuhr der erste Schlag auf Lene herab. Panik und Verzweiflung warfen sich auf ihre Mutter. »Wie kannst du es wagen? Du bist mit ihm raus und kehrst ohne ihn zurück? Wo ist Henry? Wo ist er?«
Lene hob die Arme, denn jetzt prasselten die Schläge auf sie herab, Flüche und Verwünschungen kamen dazu, wie sie sie im Leben noch nie aus dem Mund ihrer Mutter gehört hatte. Lene schrie und weinte, sie krümmte sich zusammen, aber erst, als Rensche innehielt und einen erstickten Schrei ausstieß, wagte sie, wieder aufzusehen.
Mit erhobenem Kochlöffel starrte ihre Mutter auf den Boden. Die abgeschabten Holzschuhe waren nass von wässrigem Blut. Sie ließ den Löffel fallen, hielt sich den Bauch und taumelte zurück ans Haus, wo sie sich an der Bretterwand abstützte. Ihr Gesicht war leichenblass.
»Holt die Greet«, keuchte sie. »Lene!«
Ihre älteste Tochter rappelte sich auf. Die Schläge – für Lene immer noch viel zu milde nach allem – waren augenblicklich vergessen.
»Im Topp, hinterm Haus …« Ihre Mutter krallte sich in ihren Unterarm und senkte den Kopf. Schwer atmend rang sie nach Luft. Sie musste Schmerzen haben, entsetzliche Schmerzen. »An der Abseite hab ich ihn vergraben. Da sind ein paar Groschen und …« Sie biss die Zähne zusammen.
Lene drehte sich nach ihren Schwestern um – verständnislose Zuschauerinnen des Schauspiels. »Die Greet!«, schrie sie. Die Hebamme wohnte am anderen Ende des Dorfes, am Hafen. »Schnell! Lauft!«
Die beiden stoben davon. Lene stützte ihre Mutter, so gut es ging, und führte sie zurück ins Haus.
»Henry«, schluchzte Rensche. »Wo ist Henry?«
Jedes Wort war wie ein Stich ins Herz.
»Er wird schon wiederauftauchen.« Lene half ihrer Mutter, durch den winzigen Innenraum in die Butze zu gelangen. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte.
»Hol Stroh. Schnell!«
Lene rannte raus, umrundete die Kate und suchte hilflos im Hof die wenigen Halme zusammen, die nach dem Winter übrig geblieben waren. Sie hatten fast alles Stroh, zusammen mit Torf, zum Heizen und Kochen verwendet. Jetzt lagen nur noch einige Armvoll im Schuppen, der kurz vorm Einstürzen war.
Wann ist das alles kaputtgegangen?, fragte sie sich. Sie erinnerte sich an Überschwemmungen – viel Leid und viele Tote jedes Jahr. An so viele vergangene Kriege und Revolutionen, die Armut gebracht und die Söhne genommen hatten, die als Hollandgänger und Heuerleute für fremde Herren schufteten und nicht mehr zurückkehrten. Höfe ohne Herren, Äcker ohne Bauern. Und an ein schreckliches Unglück, nach dem nichts mehr so war, wie sie es kannte. Henry … in der Ecke standen Spaten und Harke. Der Gedanke, dass er beides vielleicht nie mehr anrühren würde, brachte sie fast um den Verstand. Wie sollte es weitergehen ohne ihn?
Ein fürchterlicher Schrei drang aus der Kate. Sie raffte in Windeseile die letzten Halme zusammen und rannte zurück. Wie angewurzelt blieb sie vor der Butze stehen.
»Mutter?«
Rensche lag auf dem Boden. Sie rührte sich nicht, aber ihr Rock war dunkel und nass von Blut. Ein seltsamer Geruch lag in der Luft. Lene fühlte sich, als ob alles in ihr erstarb und nur noch eine dumpfe Leere in ihrem Kopf vorhanden war. Sie ließ das Stroh fallen und ging neben ihrer Mutter in die Knie.
»Hörst du mich?«
Das alles hatte sie schon einmal erlebt. Sie war noch klein gewesen und hatte sich auf das Geschwisterkind gefreut. Und dann …
Sie nahm den leblosen Körper in die Arme und legte Rensches Kopf in ihren Schoß. Dabei wiegte sie sich vor und zurück, und die sanfte Bewegung brachte sie etwas zur Ruhe. Sie weinte leise, und die Tränen tropften auf das Gesicht ihrer Mutter. Irgendwann verdunkelte sich das Zimmer, weil Menschen in die Kate traten. Als Erste war Greet bei ihr, eine kräftige Frau mit einem Tuch um den Kopf, das blaue Holdoek, dessen Zipfel Lene übers Gesicht strichen, als die Hebamme ihr vorsichtig die Mutter aus den Armen nahm. Hinter Greet tauchte Jule auf, die Frau des Gerbers, eine verwegene, alternde Vettel, die streng roch und die Hände vor ihren zahnlosen Mund geschlagen hatte. Dann kamen die Krummen, Schiefen und Gebeugten aus der Nachbarschaft, gestützt auf Krücken oder sich gegenseitig haltend. Es waren Frauen darunter, die Lene manches Mal ein Stück Brot zugesteckt hatten, heimlich, damit es ihre Männer nicht sahen. Und andere, die sich abgewandt hatten, als die Not immer größer geworden war. Manche waren nun aus Mitgefühl gekommen, die meisten aber als stumme Zeugen einer Tragödie, die Lene noch nicht begriff.