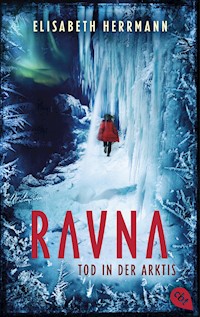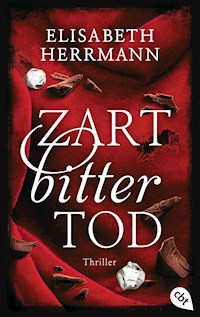
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zart wie die Liebe, bitter wie die Schuld
Mia ist in dem kleinen Chocolaterie-Geschäft ihrer Eltern aufgewachsen – mit den wunderbaren Rezepten, aber auch mit dem rätselhaften Familienfoto, auf dem ein lebensgroßes Nashorn aus Schokolade zu sehen ist, zusammen mit ihren Urgroßvater Jakob und seinem Lehrherrn. Der Lehrherr ist weiß, Jakob schwarz. Mia ist zwar bekannt, dass ihr Vorfahr als kleiner Junge aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika nach Deutschland gekommen ist. Aber warum? Und wie?
Als Mia den Nachkommen von Jakobs Lehrer unbequeme Fragen stellt, sticht sie in ein Wespennest. Liebe und Verrat, sie ziehen sich durch die Generationen, und als Mia endlich versteht, wer sie zum Schweigen bringen will, ist es fast zu spät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Elisabeth Herrmann wurde 1959 in Marburg/Lahn geboren. Sie machte Abitur auf dem Frankfurter Abendgymnasium und arbeitete nach ihrem Studium als Fernsehjournalistin beim RBB, bevor sie mit ihrem Roman »Das Kindermädchen« ihren Durchbruch erlebte. Fast alle ihre Bücher wurden oder werden derzeit verfilmt: die Reihe um den Berliner Anwalt Vernau sehr erfolgreich mit Jan Josef Liefers vom ZDF. Elisabeth Herrmann erhielt den Radio-Bremen-Krimipreis und den Deutschen Krimipreis 2012. Sie lebt mit ihrer Tochter in Berlin.
Außerdem von Elisabeth Herrmann bei cbt:
Die Mühle
Lilienblut
Schattengrund
Seefeuer
Seifenblasen küsst man nicht
ELISABETH HERRMANN
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2018 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotive: © Shutterstock (Neirfy; Husjak; kelvn; Sattra; Tim UR; Bjoern Wylezich)
SK • Herstellung: AnG
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17298-5 V004
www.cbj-verlag.de
Personen und Handlung dieses Buches sind frei erfunden. Allerdings orientieren sich die geschichtlichen Bezüge an wahren Begebenheiten. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, bei historischen Briefen und Textauszügen die vor über hundert Jahren übliche Sprache zu wählen. Nur dort, wo es unumgänglich notwendig war, habe ich Bezeichnungen verwendet, die heute glücklicherweise aus unserem Sprachgebrauch verschwunden sind. Dies erschien mir aus Gründen der Glaubwürdigkeit die beste Lösung. Die betreffenden Passagen sind im Buch in anderer Schrift gesetzt und besonders hervorgehoben. Sie geben in keiner Weise meine Meinung oder Auffassung wieder.
Elisabeth Herrmann, 2018
Die Vergangenheit ist nicht tot,
sie ist nicht einmal vergangen.
Thornton Wilder
Bremerhaven, 21. Januar 1904
Endlich hieß es Leinen los! Mit vollen Kapellen ging es durch die Stadt. Hunderte, Tausende standen am Kai und jubelten und warfen ihre Mützen hoch. Für den Kaiser! Für die Freiheit! Für Südwest! So geht es gen Afrika, in fremdes, unbekanntes Land. Stolz pflügt sich das Schiff durch die Wellen, stolz schwillt unsere Brust. Einjähriger beim Seebataillon! Da sah ich die Augen von manchem deutschen Mädel beim Abschied blitzen, und kaum verschwand die Küste in der Ferne, so stimmte schon der Erste mit trauriger Stimme an: Nach der Heimat möcht ich wieder … Drei Wochen geht die Reise mit dem Kanonenboot Habicht. In Swakopmund werden wir sie alle treffen: Soldaten, Matrosen, Schutztruppler und Reservisten. Gemeinsam stellen wir uns dem Feind entgegen und werden ihn hart in die Schranken weisen. In Treue fest – Südwest!
1.
Ein altes, verblichenes Foto. So groß wie eine Postkarte. Die Gesichter der beiden Männer waren kaum noch zu erkennen, die Zeit hatte fast alle markanten Züge gelöscht. Doch die Haltung war eindeutig: Der eine groß, stolz und selbstbewusst, der andere fast noch ein Junge, schmal, schüchtern, beide in knöchellangen weißen Kitteln. Zwischen ihnen stand, riesig und dunkel glänzend, ein Nashorn. Mia trat näher, streckte die Hand nach dem Rahmen aus und ließ sie wieder sinken. Sollte sie? Sollte sie nicht?
»Du kannst es ruhig nehmen.« Mias Mutter Helene sah kurz von der Kasse hoch. Gerade hatte sie die Ladentür zu der kleinen Chocolaterie abgeschlossen und die Jalousien an den Schaufenstern heruntergelassen, um die Auslage vor der Abendsonne zu schützen. »Der links ist Gottlob Herder und rechts dein Urgroßvater Jakob Arnholt.«
»Ich weiß.« Mia kannte die Namen. Sie wusste sogar, wo das Foto aufgenommen worden war: in Lüneburg, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Dort hatte Jakob eine Lehre als Zuckerbäcker gemacht, und zwar bei Herder, dem Gründer einer der größten deutschen Schokoladenfabriken. Herder war der Selbstbewusste. Jakob der Schmale, Schüchterne.
»Ein Nashorn aus Schokolade. In Lebensgröße. Wow.« Mia betrachtete das längst vergangene Meisterwerk und seine beiden Erschaffer, festgehalten von einem »Photographen« vor über hundert Jahren. Es hing an der Wand, seit Mia denken konnte. Als Kind hatte sie sich ausgemalt, wie es wäre, auf dem Rücken dieses Tieres zu sitzen und ein winziges Stück von seinem Ohr abzuknabbern. Jetzt war sie erwachsen – auch wenn ihre Eltern nicht mit ziemlich unwitzigen Kommentaren sparten, sobald Mia das erwähnte. Aber mit neunzehn war man doch erwachsen? Und wenn sie Glück hatte und eine richtig gute Familiengeschichte recherchieren konnte, wäre sie demnächst sogar Studentin an der renommierten Hamburger Journalistenschule …
Die Aufnahmeprüfung war ein harter Brocken. Erzählen Sie uns die Geschichte eines Familienfotos und erläutern Sie die einzelnen Rechercheschritte. Mia war davon überzeugt, dass nicht viele Bewerber mit einem lebensgroßen Schokoladennashorn aufwarten konnten. Es musste mindestens zwei Zentner gewogen haben und wirkte ziemlich … na ja, nicht unbedingt gefährlich. Aber trotzdem eindrucksvoll. Schon allein die Maße! Der höchste Punkt am Rücken überragte sogar noch Gottlob Herder. Und Jakob sah geradezu winzig dagegen aus. Wenn so ein Hammer-Teil keine Extrapunkte gab, was dann?
»Für welches Jubiläum haben sie das noch mal gemacht?«
Helene Arnholt zuckte mit den Schultern. Bei der Abrechnung durfte man sie nicht stören. Oft genug prüfte sie noch ein zweites und drittes Mal, immer mit der kleinen Falte zwischen den Augenbrauen, die Mia so gut kannte. Harte Zeiten, sagte sie manchmal, wenn die Kasse beim besten Willen nicht das hergab, was man für Strom, Heizung, Kühlung und die Produktion ausgeben musste.
An diesem Abend waren die Zeiten wohl besonders bitter. Mia bemerkte aus den Augenwinkeln, dass nur ein paar Scheine in die kleine Reißverschlussmappe wanderten. Wie lange würden die Arnholts noch durchhalten? Wie lange würden sie mit ihren kleinen Kunstwerken aus Schokolade, Nougat, Pistanzienganache und Marzipan bestehen können gegen die Discounter und deren Massenware, die für ein paar Cent den Markt überschwemmten?
»Warum nimmst du nicht das andere? Ich könnte dir jede Menge darüber erzählen.«
Mias Mutter wies auf eine weitere Fotografie. Sie war größer und farbig, wenn auch leicht verblichen. Darauf zu sehen: das Haus in der kleinen Straße zwischen Marktplatz und dem steilen Aufstieg zum Meißner Dom, auf der Fassade die fast schon abgeblätterten Buchstaben: Mohrenbäckerei. Davor, gerade wie Zinnsoldaten, ihre Eltern: Alex mit Vokuhila – zum Brüllen! Und Helene mit Pferdeschwanz und Schulterpolstern, die sie wie eine Rugbyspielerin aussehen ließen. Neunzigerjahre!
Helene kam hinter dem Tresen hervor und stellte sich vor das Bild, um es genauer zu betrachten. »Mein Gott, wie jung wir waren. Kaum älter als du heute! Und wie das hier ausgesehen hat nach der Wende und was wir alles reinstecken mussten. Das war nicht einfach, mit unseren Schokocroissants gegen die Schrippen anzukommen. Und jetzt … na ja. Vielleicht sollten wir doch so eine Stehbackstube mit Automatenkaffee und aufgetauten Tiefkühltorten aus dem Laden machen.« Sie wandte sich ab.
»Bloß nicht!« Mia liebte die Chocolaterie. Den herben Duft nach Kakao, der einen empfing, wenn man das kleine Geschäft betrat, die Kuchen und Torten und die dicke, heiße Schokolade, die in dem kleinen Nebenraum serviert wurde. Glitzernde Bonbons in bunten Gläsern, Petits Fours, riesige handgegossene Tafeln mit geheimnisvollen Ingredienzien. Aber am meisten liebte sie es, wenn sie am Samstag oder auch mal unter der Woche im Laden aushalf und neugierigen Kunden eine Praline zum Probieren gab. Erst dieses stirnrunzelnde Nachdenken – könnte mir ein Crème-brûlée-Cappuccinotrüffel oder dieses, wie noch mal?, Macha-Marzipan schmecken? Der erste vorsichtige kleine Biss und dann … Dieses glückliche Leuchten, das ihr entgegenstrahlte und am besten noch von »Packen Sie mir bitte 200 Gramm davon ein!« getoppt wurde.
»Das wäre so was von unter eurer Würde. Außerdem könnt ihr das weder den Touristen noch den Meißenern antun.«
Helene Arnholt seufzte. Und Mia wusste, warum: Sie war hier geboren, sie fühlte sich in der hübschen Stadt an der Elbe zu Hause. Aber ihre Eltern hatte der lange Rechtsstreit zermürbt, den es um die Rückübertragung des alten Hauses gegeben hatte. Sie waren aus dem Ruhrgebiet zurückgekommen, wohin es die Familie in den Kriegswirren verschlagen hatte. Auf der Flucht war das Meiste verloren gegangen, weshalb Mia nicht allzu viel über die Arnholts in Sachsen wusste. Nur, dass es ziemliche Diskussionen gegeben hatte, als Helene bei der Hochzeit ihren Namen behalten hatte. Das war für die Achtzigerjahre fast schon revolutionär gewesen (aber wieder verständlich, wenn man wusste, dass Mias Vater sonst der Familie den seltenen, aber nur bedingt poetischen Namen Rübchen vermacht hätte …).
Und es war nach der Rückkehr nicht einfach für ihre Eltern gewesen, Fuß zu fassen. Mia respektierte und bewunderte die Leistung, mit der erst das Haus und dann das Geschäft wiederbelebt worden war. Aber ob sie mit dieser Geschichte einen der begehrten Studienplätze ergattern konnte? Dann doch lieber ein Nashorn aus Schokolade und der unbekannte, fremde Jakob, der vor langer Zeit bei den berühmten Herders in Lüneburg in die Lehre gegangen war. Sie könnte die Arbeitsbedingungen der damaligen Zeit recherchieren. Und gleichzeitig etwas darüber herausfinden, wie der kleine Jakob nach Deutschland gekommen war und warum die beiden ausgerechnet ein Nashorn nachgebildet hatten. Die Idee gefiel ihr immer besser.
Mia nahm das Foto ab. Es steckte hinter Glas in einem Holzrahmen, auf der Rückseite festgehalten von einem verklebten Pappdeckel. Vorsichtig pustete sie den Staub ab.
»Gottlob Herder und Jakob Arnholt«, sagte sie leise, als ob sie mit den beiden Männern reden würde. »Der Meister und sein Lehrling. – Mutsch, darf ich es rausholen? Vielleicht steht ja das Datum auf der Rückseite oder irgendein Hinweis darauf, für wen dieses Nashorn gedacht war.«
Helene verstaute die kleine Mappe in der Schublade unter der Kasse und schloss die ab. »Klar. Unser Wappentier.« Sie versuchte ein Lächeln. »Ich hab tatsächlich mal dran gedacht, es als so eine Art Wahrzeichen zu nehmen. Aber dann hielt ich es im Zusammenhang mit Schokolade für ebenso kontraproduktiv wie den alten Namen. Mohrenbäckerei. Geht gar nicht. Nimm ein Messer.«
Mia legte den Bilderrahmen mit der Rückseite nach oben auf der Ladentheke ab und huschte hinüber in die Küche. Auf der Marmorplatte kühlte gerade ihre neueste Schokoladenkreation aus: Rainbow Princess. Sie gab allen ihren Erfindungen Namen. Manche schafften es tatsächlich in den Verkaufstresen, aber nicht alle wurden ein Renner. Die Sache mit dem Roquefort an Zartbitter nagte immer noch an ihr. Sie hätte einen anderen Käse nehmen müssen und dazu Schokolade mit 99 % Kakaoanteil. So viele entsetzte Gesichter hatte sie selten gesehen und ihr Werk war noch am selben Abend auf nicht ganz geklärte Weise aus der Kühltheke verschwunden … Aber ohne Experimentierfreude ging nichts in diesem Beruf.
Mit dem Messer in der Hand blieb sie einen Moment stehen und sah sich in der Küche um. Ein paar Jahre hatte sie tatsächlich geglaubt, hier läge ihre Zukunft. Doch dann hatte ihr älterer Bruder das Heft an sich gerissen und immer wieder gesagt, wie er »den Laden ordentlich in Schwung« bringen würde. Und dass Mias Kreationen ja ein »nettes Hobby« wären, sie aber bitte nicht auch noch die letzten Kunden vertreiben sollte. Und Einhorn ginge immer. Die Fabelwesen waren überall, und obwohl Mia wusste, dass der Hype den Sommer wahrscheinlich kaum überleben würde, war sie »konventioneller« geworden.
Allerdings nicht weniger fantasievoll. Die Regenbogenprinzessin (und warum eigentlich kein Prinz?) hatte gute Chancen. Weiße Schokolade, die in sanften Wirbeln von Blassrosa bis Tiefrot verlief … Rote Beete und Johannisbeersirup gaben die Farbe und einen sanften, süß-säuerlichen Geschmack. Dazwischen gepuffter Reis, um alles etwas leichter zu machen. Mia brach ein kleines Stück von der Probetafel ab und kostete. Es schmeckte … himmlisch. Vielleicht sollte sie sich doch dazu entscheiden, eine Konditorlehre zu machen. Aber das Geschäft würde ihr älterer Bruder übernehmen und noch eine Chocolaterie würde Meißen nicht verkraften. Also zurück zu dem Foto und dieser einzigartigen Geschichte, die man aus ihrem Schlaf in den hintersten, schummrigsten Ecken der Familienhistorie aufwecken musste.
Sie kehrte zurück. Helene ließ mittlerweile die Jalousien an der Tür herunter.
»Er war schwarz, nicht wahr?«
»Jakob? Eher mokka, würde ich sagen, wenn das nicht politisch inkorrekt ist. Er war der Sohn von meinem Urgroßvater Karl, der Ende des neunzehnten Jahrhunderts in die Kolonien gegangen ist und eine Einheimische geheiratet hat«, antwortete ihre Mutter. »Ihr Sohn Jakob hat dann Marie, eine waschechte strohblonde Dresdnerin, zur Frau genommen. Es muss irgendwo noch ein Foto von den beiden geben. Ich glaube, auf dem Dachboden. Wir haben es immer noch nicht geschafft, uns mal darum zu kümmern.«
Nichts an ihnen, weder bei der Mutter noch der Tochter, erinnerte an ihr afrikanisches Erbe. Vielleicht Mias krause braune Haare. Aber die konnte sie genauso gut von ihrem Vater haben. Und der kam aus einem kleinen Dorf nahe der Nordsee. Nur drei Generationen hatten Jakobs afrikanische Herkunft fast vergessen lassen. Trotzdem war es immer ein running gag in der Familie gewesen, dass eines Tages bestimmt einmal ein schwarzes Baby in der Wiege liegen würde …
Mia sah das fast verschwundene Gesicht auf dem Foto an, die steife, beinahe ängstliche Haltung des Jungen im weißen Kittel neben seinem strengen Lehrherrn und Meister, und für einen Moment zog sich ihr Herz zusammen. Wie alt Jakob gewesen sein mochte? Fast noch ein Kind. Keine zehn Jahre alt, geboren in den Kolonien, wie ihre Großeltern das noch genannt hatten … Kein running gag. Ein kleiner Mensch in einem fremden, kalten Land, der viel zu früh gestorben war.
Mia ritzte das Papier ein und begann vorsichtig, es von der Unterlage zu lösen. Sie wollte das Foto auf keinen Fall beschädigen.
»Das erste sächsische mixed couple?«, fragte sie. »Ich muss wirklich mal in die Archive. Nicht nur wegen der Bewerbung. Ich meine, ein afrikanischer Junge in Sachsen zur Kaiserzeit und in der Weimarer Republik, das ist schon was Besonderes.«
»Da wird es nicht viel geben.« Helene war fertig und kam näher, um über Mias Schulter zu spähen. »Das wenige liegt alles in der Hausmappe. Ein paar Zeitungsartikel zu den Firmenjubiläen und dann seine Todesanzeige. Meine Mutter hat sie noch gehütet wie einen Schatz, deshalb ist das auch so ziemlich das Einzige, was ich genau über Jakob weiß. Eine Blutvergiftung, die zu spät behandelt wurde. Ich glaube, Ende der Zwanzigerjahre. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das als Glück ansehen soll …«
Mia zog das Deckblatt ab. Es war mürbe und hatte eine undefinierbare altrosa Farbe. Darunter kam die Rückseite des Fotos zum Vorschein. Ihr Herz klopfte schneller: Sie war beschrieben.
»Ist das Sütterlin?«
»Keine Ahnung.«
Das Foto war aus stabilem Karton und die Schrift auf der Rückseite erschien ebenso ordentlich wie unleserlich. Immerhin: Mia konnte das Datum entziffern.
»Neunzehnter Mai neunzehnhundertdreizehn. Für … Jakob Arnholt. Nicht? Das ist doch sein Name?«
Helene nickte. »Definitiv. Für Jakob Arnholt in me-mo-moribundi?«
»In memoriam. In memoriam – was? Ich kann’s nicht lesen.« Mia versuchte, den nächsten Wörtern irgendeinen Sinn abzuringen. »Hochzeit. Das könnte tatsächlich Hochzeit heißen! Victoria? Sieg?«
Helene schüttelte erst den Kopf und nahm ihr dann mit einem triumphierenden Lächeln die Aufnahme ab. »Victoria Luise! Aber natürlich! Es ist ein Name!«
»Gottlob, Jakob und Victoria Luise? Hieß das Nashorn so?«
»Das Nashorn? Nein! Victoria Luise ist, genauer gesagt war, die Tochter des letzten deutschen Kaisers. Das war kein Jubiläum. Dieses Nashorn aus Schokolade wurde für ihre Hochzeit hergestellt! Natürlich! Hätte mich auch gewundert, wenn die Herders nicht auch noch Hoflieferanten gewesen wären.«
Mias Augen begannen zu funkeln. »Eine kaiserliche Hochzeit? Und mein Urgroßvater hat dazu dieses Monstrum beigesteuert? Da muss es doch noch Unterlagen geben! Listen, Einladungskarten, vielleicht ein paar verruckelte alte Filmaufnahmen. Mai neunzehnhundertdreizehn, ein zentnerschweres Nashorn aus Schokolade, aus Lüneburg nach Berlin verschickt und das vielleicht bei dreißig Grad im Schatten … Ich hab’s! Meine Story. Sie werden niederknien in Hamburg!«
Helene reichte Mia mit einem leichten Zögern das Foto zurück. Sie wusste, dass die Journalistenkarriere ihrer Tochter nur zweite Wahl war. Immerhin: Es gab einen Plan nach dem Abitur. Wenn auch nicht den, den Mia sich, seit sie ein kleines Mädchen war, vorgestellt hatte. Manchmal hatte sie das Gefühl, ihrer Mutter wäre es lieber, wenn nicht der Karrierist in der Familie, sondern die Träumerin den Laden übernehmen würde … »Wo willst du denn anfangen?«
»In Berlin. Im Deutschen Historischen Museum. Und im Filmmuseum. Und überall, wo es noch Archive zur Kaiserzeit gibt. Vielleicht existiert ja ein Dankschreiben von Ihrer Kaiserlichen Hoheit.« Sie kicherte und fühlte sich ganz berauscht von den Abenteuern und Entdeckungen, die auf sie warten würden auf der Suche nach den letzten Zeugen von Jakobs Reise mit dem Nashorn. Vielleicht hatte er den Triumphzug begleiten dürfen? Irgendwo musste es doch noch Zeitzeugnisse von diesem Meisterwerk geben. »Und dann natürlich bei den Herders. Hattest du mal zu denen Kontakt?«
»Zu den Multimillionären mit ihren Tausenden von Filialen?«
»Ich kann ja mal anrufen. Bestimmt haben die ein Archiv. So große Firmen heben eine Menge auf. Vielleicht gibt es noch alte Rechnungen und …«, Mia betrachtete wieder die verblichene Aufnahme, »… noch mehr Fotos. Dieses Nashorn ist der Hammer. Wahrscheinlich hat die Zeitung damals darüber berichtet. Ganz Lüneburg muss ja aus dem Häuschen gewesen sein. Vielleicht gab es eine Ausstellung! Und die Leute durften einmal daran vorbeigehen und sich vorstellen, dass dieses Ungeheuer die kaiserliche Tafel schmücken würde. Vielleicht haben sie ja auch noch Giraffen gemacht? Oder Papageien? Einen Elefanten?«
Sie spürte, wie das Jagdfieber in ihr erwachte. Vielleicht war das ja ihr Beruf! Pralinen machen ging nicht, aber Geschichten erzählen? Versunkene Schätze heben. Menschen aus dem Vergessen holen. Jakob Arnholt, ihr Urgroßvater, im Jahre 1913 Zuckerbäckerlehrling bei den Herders in Lüneburg, dann in Meißen gelandet, wo er geheiratet und eine, ihre Familie gegründet hatte. Und dann war er mit gerade mal Mitte, Ende zwanzig verstorben! Aber bevor er von allen vergessen wurde, konnte sie daran erinnern, dass er etwas Großartiges erschaffen hatte.
»Ich will dich ja nicht enttäuschen«, kam es von Helene.
»Wieso?« Mia sah überrascht hoch. Sie sah sich schon staubbedeckt durch Archive kriechen und kleine Jubiläumsnashörner aus Schokolade gießen. Irgendein Jahrestag ließ sich doch bestimmt aus dem Hut zaubern.
Helene legte den Arm um die Schultern ihrer Tochter und zog sie liebevoll mit sich in Richtung Hintertür, die zu einer engen Treppe in den ersten Stock führte. Dort befand sich die Wohnung über dem Laden. »Ich fürchte«, sagte sie, »es ist bisher noch niemandem gelungen, wirklich Einblick in die Familien- und Firmengeschichte der Herders zu bekommen. Eine verschlossene Auster ist nichts gegen diese Leute. Überlege es dir – ich glaube kaum, dass du bei denen weiterkommst.«
Jandrik kam zum Abendessen. Mias zweiter Bruder, ein schlaksiger strohblonder Surfertyp, bei dem offenbar Uroma Maries Erbe voll zur Geltung kam. Er war zwei Jahre älter und hatte nach seiner Lehre als Zerspanungsmechaniker seine Liebe zu Oldtimern entdeckt und in einer Spezialwerkstatt in Dresden angeheuert. Deshalb war er mit einem 280er SL Pagode aufgetaucht, einem schwarzen, etwas zerbeulten Mercedes, den er seinem Vater mit einem Stolz präsentierte, als hätte er das Teil persönlich gebaut.
Mia und Helene ließen die beiden draußen im Hof fachsimpeln und bereiteten das Abendessen vor. Mias älterer Bruder, Matthias, blieb übers Wochenende immer häufiger in Berlin. Er arbeitete als Pâtissier in einem Fünf-Sterne-Hotel am Pariser Platz direkt gegenüber vom Brandenburger Tor. Wenn er es doch mal nach Meißen schaffte, brachte er manchmal seine eigenen Kreationen mit. Gefällige, hübsche Patisserie. Im Moment war eine Art feste, glänzende Wasserglasur der allerletzte Schrei. Die Schokoladentörtchen und Himbeerwölkchen sahen aus wie frisch lackiert. Ob das den Meißenern und den Touristen gefallen würde? Bestimmt.
»Wann hat Jakob noch mal die Mohrenbäckerei in Meißen aufgemacht?« Mia wusch den Salat und stopfte ihn dann in die Schleuder.
»Neunzehnhundertzweiundzwanzig.« Helene stand am Fenster zum Hof und zupfte Kräuter, die sie in Balkonkästen zog. »Und er war wohl sehr erfolgreich. Sonst hätte er auch nicht ein paar Jahre später, kurz vor seinem Tod, das Haus gekauft.«
»Und …« Mia wusste nicht, wie sie es ausdrücken sollte. »Ich meine, er war schwarz. Wenn auch nur zur Hälfte. Wie war das mit den Nazis?«
»Ich glaube, Jakob war das, was sie damals einen Kolonialmigranten nannten. Meine Oma Marie, seine Frau, wird nach seinem Tod sehr gelitten haben und vorher wahrscheinlich auch schon. Sie hat nie viel darüber erzählt. Mein Vater ebenfalls nicht. Er ist ja als Kind mit ihr nach Holland gegangen und hat dort den Krieg überlebt. Irgendwie muss es Marie gelungen sein, seine Hautfarbe im Stammbuch zu verheimlichen. Wir haben ja noch Fotos von ihm. Man hätte deinen Opa durchaus auch für einen Südeuropäer halten können.«
»Ich kann mich kaum noch an ihn erinnern. Wie schade. Meine Großeltern hätten mir bestimmt eine Menge erzählen können.«
»Dieser blöde Autounfall …« Helene strich sich hastig über die Augen. »Jedenfalls, dein Opa fand ein nettes Mädchen, deine Oma Dietlinde. Und dann kamen meine Geschwister und ich, und irgendwann Alex«, das war Mias Vater, »und dann ihr.« Die Hände voller Basilikum, Petersilie und Koriander, kam Helene zu ihrer Tochter zurück. »Wir hätten das alles aufschreiben sollen, ich weiß. Aber ich glaube, meine Eltern wollten, dass Jakob auch in der Erinnerung als jemand behandelt wird, der nicht die Außenseiterrolle wie einen Stempel mit sich herumträgt. Er ist eines viel zu frühen, aber natürlichen Todes gestorben, und als ich jung war, hat man unerfreuliche Dinge noch gerne unter den Teppich gekehrt. Für mich und meine Geschwister war Jakob, unser Großvater, den wir nie kennengelernt haben, einfach der Opa.«
Mia nahm ihrer Mutter die Kräuter ab und spülte sie unter fließendem Wasser ab. »Ich bin froh, dass es so ist«, sagte sie. »Dass er einfach Jakob geblieben ist und kein Freak oder irgendein totgeschwiegener Fehltritt oder, was das Schlimmste wäre, jemand, der die Nazizeit nicht überlebt hat. Trotzdem ist es schade, dass so wenig von ihm geblieben ist.«
Ihre Mutter nickte und fuhr ihr liebevoll über die Locken. »Immerhin du. Und ich. Und mein Vater. Das zwanzigste Jahrhundert ist das der Verluste. Und das einundzwanzigste … Ich frage mich manchmal, was eure Generation eines Tages über uns denken wird. Wenn ich mich umschaue in der Welt …«
Mia drückte ihrer Mutter einen schnellen Kuss auf die Wange. »Lass gut sein. Ich würde sagen, ihr habt euch bemüht. Immerhin, das Haus ist ja noch da.«
»Ja. Aber nach welchen Kämpfen und wer weiß für wie lange noch.«
Helene wandte sich ab, um den Tisch zu decken. Es war einer dieser Momente, in denen Mia sich gar nicht mehr so erwachsen fühlte. In denen sie die Zeit zurückwünschte, als die Erwachsenen alles gerichtet hatten und sich jede Geschichte zum Guten wandte. Aber in denen sie auch ahnte, dass sich die Uhr nicht zurückdrehen ließ und irgendwann, eines fernen Tages, der Stab in ihrer Hand und der ihrer Brüder läge.
»Ich mach das mit Jakob«, sagte sie. »Mein Entschluss steht fest.«
»Gut. Ich suche dir Herders Nummer raus.«
Jandrik pickte die letzte Bratwurst vom Teller, bevor Mia auch nur die Gabel ausgestreckt hatte.
»He!«
»Es ist noch Salat da. Ist sowieso besser für deine Linie. Hast du zugenommen?«
Mia tauchte die Finger in ihr Wasserglas und schickte Jandrik ein paar Tropfen über den Tisch. »Muss ich mir diese Frechheiten noch lange gefallen lassen oder wann gehen wir runter in den Hof und tragen das wie Männer aus?« Und an ihren Vater gewandt, fragte sie: »Ab wann ist er groß genug für eine Tracht Prügel?«
Wer zwei ältere Brüder hatte, wusste, wie man sich durchsetzte.
»Schon gut.« Jandrik teilte die Wurst und lud eine Hälfte auf ihrem Teller ab. »Gewalt zieht bei mir nicht. Schenk mir dein zahnloses Lächeln.«
Mia zog eine Grimasse. Ihre Zähne waren makellos – sein Witz war ein Überbleibsel aus der Zeit, in der sie auf Bäume geklettert und Skateboard wie eine Wilde gefahren war. Das war nicht ohne Blessuren abgegangen. Sie drehte sich zu ihrer Mutter. »Hast du die Nummer?«
»Ich hol sie.« Helene stand auf.
Mias Vater Alex griff zum Wasserkrug und schenkte sich nach. »Und?«, fragte er. »Ist die Entscheidung gefallen?«
Mia nickte mit vollem Mund. »Jakob«, nuschelte sie. »Und das Nashorn. Mutsch hat gesagt, es gibt noch was auf dem Dachboden.«
»Einen Koffer, ja. Wir haben ihn bei den Renovierungsarbeiten gefunden. Er liegt immer noch oben. Schande über mein Haupt. Aber es ist nichts drin außer Mäusedreck und ziemlich verrottetem Zeug. Kleider wahrscheinlich und stockfleckige Papiere.«
»Aber die könnten doch interessant sein! Wenn sie noch von Jakob selbst stammen? Kann ich nachsehen?«
Der Dachboden sollte einmal ausgebaut werden, aber im Moment waren andere Dinge wichtiger. Deshalb hatte Alex die Arbeiten gestoppt und verboten, ohne Aufsicht dort oben herumzuturnen.
»Ich komme mit.« Jandrik war fertig. Er stand auf und trug sein Geschirr zur Spülmaschine, Mia machte es ihm nach.
»Ich auch«, sagte Alex. »Ich wollte sowieso mal nach den Mausefallen sehen.«
Zusammen gingen sie in den Flur, und Alex holte die Ausziehleiter herunter, mit deren Hilfe man auf den Dachboden klettern konnte. Helene folgte ihnen.
»Passt auf!«, rief sie, aber da war Mia, die als Letzte die steilen Stufen erklommen hatte, auch schon oben.
Schummriges Halbdunkel erwartete sie. Obwohl es draußen noch nicht dunkel war, drang nur wenig Licht durch die kleinen, staubverkrusteten Luken. Der Boden war mit Brettern bedeckt und in der Mitte des Raumes führte ein schmaler Kamin nach oben.
Alex musterte ihn mit einem resignierten Blick. »Es hat sich schon wieder ein Ziegelstein gelöst.« Das Corpus Delicti lag zerbrochen vor seinen Füßen. »Da müssen wir ran, bevor der Winter kommt.«
Mia ging zur Schrägseite, die zur Straße lag. Dort, wo das Dach auf der Hausmauer ruhte, war die Schräge so niedrig, dass man nur gebückt stehen konnte. Mehrere Zementsäcke lehnten aneinander, daneben erspähte Mia einen Stapel Dachziegel und jede Menge Holzlatten. »Wo?«, fragte sie. »Wo ist der Koffer?«
»Moment.« Alex kam zu ihr, gefolgt von Jandrik. Ihr Vater deutete in einen schmalen Spalt hinter dem Holz. »Das muss hier schon ewig liegen. Ein Glück, dass sie ihn nicht eingemauert hat, sonst hätten wir ihn nie gefunden.«
Sie. Marie, Jakobs Witwe und Mias Urgroßmutter. Tatsächlich wäre niemand auf die Idee gekommen, hinter diesen Brettern etwas zu suchen.
Alex zwängte seinen Arm in den Spalt zwischen Holz und Wand, er zog und ächzte und beförderte schließlich einen kleinen, abgeschabten Koffer hervor. Das Leder war brüchig, und als er versuchte, den Koffer abzuwischen, stieg eine Wolke Staub empor. »Ich habe ihn erst mal hiergelassen, weil es wirklich nur verrottetes Zeug ist und er dahinten wenigstens vom Taubendreck verschont geblieben ist. Wegschmeißen wollte ich ihn aber auch nicht. Ich hoffe, er ist keine Enttäuschung für dich!«
Mia wollte ihn sofort öffnen, aber Alex trug ihn zur Leiter.
»Lass uns das unten machen. Hier oben sieht man gleich die Hand nicht mehr vor Augen.«
Helene hatte den Tisch in der Küche abgedeckt und vorsorglich auch die Decke entfernt. Alex legte den Koffer ab. Alle vier standen einen Augenblick um dieses Relikt aus längst vergangener Zeit herum. Fast schon eine Schweigeminute, dachte Mia.
»Wollen wir?«
Helene nickte ihr zu. Die Schnappschlösser waren zwar verrostet, sprangen aber sofort auf. Langsam hob sie den Deckel. Zum Vorschein kam …
»Was ist das denn?«, schrie Mia entsetzt.
Aus dem Koffer stieg ein durchdringender Geruch. Er musste aus einem Haufen Lumpen kommen, zumindest sah es auf den ersten Blick danach aus, auf dem verstreut Dutzende kleine schwarze Kügelchen lagen.
»Mäuse.« Helene beugte sich mit gerümpfter Nase über den Inhalt. »Holt mir mal die gelben Spülhandschuhe.«
Mia eilte zur Spüle und brachte die Teile, damit Helene sie sich überstreifte.
»Und einen Müllsack!«
Den besorgte Jandrik. Nachdem das Plastik neben dem Koffer ausgebreitet lag, griff Helene mit spitzen Fingern nach dem Stoff und hob ihn so vorsichtig wie möglich heraus. Die kleinen Kügelchen rieselten ab, zum Vorschein kam ein angefressenes, durchlöchertes …
»Hemd. Das ist eindeutig ein Leinenhemd.« Helene hielt es hoch. Fleckig, zerknittert und offenbar Heimstatt für Generationen von Mäusen, die dort ungestört gehaust hatten.
»Kann man«, Mia hustete, »kann man das waschen?«
»Du meinst, ob du das waschen kannst, unten im Hof?« Jandrik rümpfte die Nase. »Und dich anschließend dazu.«
»Es ist alt. Und es hat Jakob gehört, oder?«
Mit einem leisen Seufzer legte Helene das Ding auf dem Müllsack ab. Alle beugten sich wieder über den Koffer.
»Was ist das denn?« Jandriks Stimme schraubte sich noch eine halbe Oktave höher.
Mia überwand sich und griff auch ohne Handschuhe nach etwas, das entfernt aussah wie verknotete Lederschnüre. »Eine Art … Schmuck?« In die Schnüre waren Perlen und Glimmersteinchen eingewebt. Metall, Glas, Keramik. Alles blind vor Schmutz und Erosion. Das Leder war brüchig, und Mia hob das seltsame Gewirk so vorsichtig aus dem Koffer, als könne es jederzeit reißen. »Eine doppel-, nein, eine dreireihige Kette. Meine Güte … Das ist aus Afrika, nicht wahr?«
»Vermutlich«, sagte Helene leise. »Das wird das Einzige sein, was er aus seiner Heimat mitgebracht hat.«
»Ob das wertvoll ist?«, fragte Jandrik. »Für ein Museum oder so.«
Helene schüttelte den Kopf. »Wohl kaum. Schon gar nicht in diesem Zustand.«
Vorsichtig legte Mia den Fund auf das Hemd. »Da ist noch was drin. Papier. Nein, ein Brief. Und … ein paar Postkarten.«
Die Mäuse hatten durchaus versucht, sich den Brief einzuverleiben, aber nach ein paar Ecken musste er ihnen doch nicht geschmeckt haben. Vorsichtig holte Mia zwei Seiten aus dem Umschlag.
»Alles Sütterlin«, seufzte sie, als sie die Schrift sah, die so fremd wirkte wie Hieroglyphen.
»Zeig her.« Alex nahm ihr eine Postkarte ab. Auf der Vorderseite war ein Dampfer auf hoher See zu sehen, links davon Pfahlbauten und hölzerne Kräne. Die Karte sah aus wie nachträglich koloriert. Zumindest die Beschriftung war in Druckbuchstaben. »Deutsch-Südwestafrika. Ostafrika-Dampfer auf der Reede, Swakopmund.«
»Namibia.« Mia nahm ihm vorsichtig die Postkarte ab und drehte sie um. »Das Datum kann ich noch lesen, vierter August neunzehnhundertvier. Aber dann … Mutter? Kann das Mutter heißen?«
Helene beugte sich über ihre Schulter und versuchte, die alte Schrift zu entziffern. »Mutter … Tut mir leid. Das müssen wir jemandem zeigen, der das noch lesen kann. Aber die Karten sind von Karl, deinem Ururgroßvater. Und sie sind hierher nach Meißen gegangen. Ich würde sagen, das ist alte Feldpost. Was ist mit dem Brief?«
»Es steht nur Jakob darauf. Keine Marke, kein Stempel, keine Adresse.«
Das Papier war eng beschrieben in einer klaren, aber winzigen Handschrift, als ob ein halber Roman auf dieses eine DIN-A-5-Blatt passen musste. »Aussichtslos«, seufzte Mia enttäuscht. »Ich glaube, das hier könnte Mein lieber kleiner Jakob heißen, aber mehr ist nicht drin. Was machen wir damit? Gibt es Schriftsachverständige oder Übersetzer für so was?«
Alex presste die Lippen aufeinander. »Wenn es eine alte Druckschrift wäre, die könnte ich lesen. Fraktur heißt sie, glaube ich. Das kriegt jeder hin. Aber Sütterlin und dann noch so klein und kaum leserlich … Das müsste jemand sehen, der sich damit auskennt. Wir könnten mal in der Kirche fragen oder im Seniorenheim.«
»Nein«, sagte Helene scharf. »Ich will das nicht.«
Mia war erstaunt über den Ton in der Stimme ihrer Mutter. »Weil es Jakobs Privatsachen sind?«
»Weil es immer noch Leute hier gibt, die es unserer Familie nicht leicht gemacht haben.«
Mia sah zu Jandrik. Der hob kaum merklich die Schultern.
»Ich möchte das nicht.«
»Was?«
»Dass diese Dinge an die Öffentlichkeit kommen. In einer Zeitung erscheinen oder irgendwie publiziert werden.«
»Es ist eine Aufnahmeprüfung, Mutsch. Nichts davon wird irgendwo veröffentlicht.«
»Trotzdem. Das ist Privatsache. Das sind vielleicht die letzten Worte, die Karl im Krieg vor seinem Tod geschrieben hat. Was, wenn sie irgendwann in einer Ausstellung landen und jeder sie liest?«
Mia steckte das Papier vorsichtig zurück in den Umschlag. Es war klar, dass die Postkarten und der Brief von zwei verschiedenen Personen stammten. Die Schriften, so unleserlich sie auch für moderne Augen waren, unterschieden sich voneinander. »Das wird nicht geschehen, ich verspreche es dir. Ich will nur herausfinden, wie Jakob aus Afrika nach Deutschland kam und es ihm gelungen ist, so ein Wunderwerk wie das Nashorn zu erschaffen. Vielleicht steht es da drin.«
»Herder hat ihn nach Deutschland gebracht«, sagte ihre Mutter. »Jakob war Waise und Herder hat sich nach Karls Tod um ihn gekümmert. Er hat ihn ausgebildet und Jakob ist dann weitergezogen und hier gelandet. Der Rest ist bekannt.«
»Ja«, sagte Mia langsam, obwohl das nicht stimmte. Kaum etwas war bekannt. Warum war ihre Mutter auf einmal so seltsam? »Aber wieso war Jakob Waise? Was ist mit seiner Mutter passiert? Woher kam er? Und wie ist es ihm hier ergangen?«
Jandrik schnaubte. »Du glaubst, dass ausgerechnet die Herders dir das erzählen? Erstens lebt keiner mehr, der das wüsste. Und zweitens … Deutsch-Südwestafrika war eine Kolonie. Über dieses Kapitel der Geschichte schweigt des Sängers Höflichkeit. Und da denkst du, ein Fabrikant, der den Grundstein seines Vermögens mit der Versklavung fremder Völker gelegt hat, steht dir Rede und Antwort?«
»Nur wer nicht fragt, kriegt keine Antwort.«
»Träumerin.«
Im Koffer befand sich nur noch Staub. Wieder spürte Mia, wie etwas in ihrem Herzen zu ziehen begann. Ein zerlöchertes Hemd, ein paar mürbe Lederschnüre, ein bisschen angeknabbertes Papier. Das Hemd musste dem Jungen bis an die Knöchel gereicht haben.
»Und das Nashorn wird mir dabei helfen«, sagte sie. »Ich habe vollstes Vertrauen in fünfhundert Kilo Schokolade aus der Kaiserzeit. Niemand wird dem widerstehen. Auf diesem Pferd werde ich einreiten in die Bastion der Herders!«
»Was?«, fragten ihre Eltern gleichzeitig und mussten lachen. Das passierte ihnen immer wieder, auch noch nach fast fünfundzwanzig Jahren Ehe.
Mia grinste. »Mein trojanisches Nashorn. Ich werde die Herders bei ihrer Eitelkeit packen. Sie werden gar nicht merken, was sie mir alles verraten, während ich sie nach ihrem Meisterwerk befrage und in ihre Archive steige.«
Kopfschüttelnd nahm Helene das Hemd und trug es hinüber zur Spüle. »Ich werde sehen, was ich damit machen kann. Aber wahrscheinlich löst es sich selbst im Schonwaschgang auf.«
»Und die Kette?«
Helene streifte die Handschuhe ab und holte einen wiederverschließbaren Plastikbeutel aus dem Schrank unter der Spüle. »Tu sie hier rein. Vielleicht kann dir jemand aus einem Völkerkundemuseum mehr dazu sagen.«
»Und die Briefe?«
Helene reichte ihr eine zweite Tüte. Vorsichtig verstaute Mia die Fundstücke in den Beuteln. Die Postkarte mit dem Dampfer lag obenauf. Mutter … Ein Gruß aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Es musste eine Fahrt in den Tod gewesen sein. Neunzehnhundertvier. Irgendwo ganz hinten in einer weit abgelegenen Ecke ihres Gedächtnisses rührte sich etwas.
»Die Telefonnummer?«, fragte sie.
Helene ging in den Flur. Obwohl sie mittlerweile alle fast nur noch mit dem Handy telefonierten, befand sich dort ein Festnetzanschluss. Daneben, wie ein Relikt aus vorsintflutlicher Zeit: ein altes, in abgegriffenes Leder gebundenes Notizbuch. Zu Mias größtem Erstaunen blätterte ihre Mutter darin herum und kam dann mit einer aufgeschlagenen Seite zu ihr zurück.
Mia las: »Willi.« So lautete der Name neben einer mehrfach durchgestrichenen und durch eine neue ersetzten Nummer. »Wer zum Teufel ist Willi?«
»Wilhelm Herder. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Er müsste schon über neunzig Jahre alt sein.«
Plötzlich war es still in der Küche. Alle sahen Helene an und warteten auf eine Erklärung.
Schließlich fragte Alex: »Du … kennst Wilhelm Herder?«
»Kennen ist zu viel gesagt. Er hat sich alle Jahre wieder mal gemeldet und wollte sich mit mir treffen, aber ich habe es abgeblockt.«
»Warum?«, fragte Mia entgeistert. Da kannte ihre Mutter einen hochbetagten Millionär, der vielleicht auch noch auf irgendeine Weise etwas mit Jakob zu tun gehabt hatte, und … verschwieg es?
»Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben.«
»Warum?«, fragte jetzt auch Jandrik.
Helene klappte das Buch zu und reichte es Mia. Die ließ es fast fallen, so verdutzt war sie immer noch. »Weil ich es meinem Vater versprechen musste. Er wollte keinen Kontakt zu den Herders. Ich weiß auch nicht, was ihn dazu getrieben hat, aber es klang in meinen Ohren ernst. Wir können ihn leider nicht mehr fragen.« Mias Großeltern waren ja gestorben, als sie noch ein kleines Kind gewesen war. »Glaubt mir, ich habe es ein paar Mal versucht und nichts aus ihm herausbekommen. Und schließlich: Warum hätte ich mich denn an Herder wenden sollen?«
»Na ja«, brummte Alex und rieb sich das Kinn. Das machte er immer, wenn er einen unangenehmen Gedanken in sich wälzte. »Vielleicht ein Darlehen?«
»Niemals.« Das Wort schoss aus Helenes Mund. »Wir haben nichts, aber auch gar nichts mit den Herders zu tun.«
»Dafür hast du aber im Lauf der Jahre ziemlich viele Telefonnummern gesammelt.«
»Weil er immer wieder angerufen und mich darum gebeten hat, sie zu notieren! Er war alt, schon seit jeher war er in meinen Augen alt gewesen. Also hab ich die Nummern aufgeschrieben. Na und?«
»Warum?«
Mias und Jandriks Augen flitzten zwischen ihren Eltern hin und her. Es war selten … Ach was! Es kam so gut wie nie vor, dass die beiden Geheimnisse voreinander hatten.
»Weil … Weil ich ein junges Mädchen war und er mir leidgetan hat. Weder mein Vater noch meine Mutter wollten mit ihm reden. Wahrscheinlich haben sie jedes Mal aufgelegt, wenn er angerufen hat. Also hat er es so lange probiert, bis er mich an der Strippe hatte. Er war immer sehr nett zu mir. Aber meine Eltern hatten verboten, mit ihm zu reden. Ich stand zwischen Baum und Borke. Also habe ich ihm wenigstens den Gefallen getan und die Nummern notiert. Das letzte Mal ist zwanzig Jahre her. Und jetzt könnte es ja tatsächlich sein, dass wir sie mal brauchen. Für Mias Recherche. Wo also ist das Problem?«
»Vielleicht, dass du all die Jahre nie etwas davon erzählt hast?«
»Ich fasse es nicht!« Wieder erschien die kleine Falte zwischen Helenes Augenbrauen. Mia wollte den Mund öffnen und etwas Beruhigendes von sich geben, da spürte sie Jandriks Hand auf ihrem Arm.
»Willst du mir etwa vorwerfen, ich hätte dich mit einem Neunzigjährigen hintergangen?«
»Einem neunzigjährigen Multimillionär«, knurrte Alex ärgerlich. Aber tief auf dem Grund seiner Augen glitzerte es. Er nahm Helene auf den Arm – und die merkte es nicht.
»Du glaubst doch nicht etwa … Du kannst doch nicht im Ernst …« Und da fiel endlich auch bei Helene der Groschen. Sie boxte Alex in die Seite, der klappte theatralisch zusammen.
»Eine Furie!«, rief er. »Rettet mich vor dieser materialistischen Furie!«
»Rettet mich eigentlich einer vor diesem Mann?«
Sie nahmen sich in die Arme.
Mia verdrehte die Augen und wandte sich ab. »Ich geh mal telefonieren«, sagte sie.
Sofort waren ihre Eltern wieder ernst.
»Warte«, sagte Helene. »Es ist nur eine Telefonnummer. Die Herders … Vergiss nicht! Wir haben sie über Jahre hinweg vor den Kopf gestoßen.«
»Aus gutem Grund offenbar«, warf Jandrik ein.
»Keine Sorge. Mehr als auflegen kann er ja nicht. Dann bleibt mir immer noch eine offizielle Rechercheanfrage über die Pressestelle.«
Sie ging in den Flur und schloss die Tür hinter sich. Das Telefonbuch wog mit einem Mal zehn Kilo. Es war kurz nach sieben. Offenbar hatte Willi ihrer Mutter eine Privatnummer gegeben. Sie könnte es jetzt versuchen. Oder morgen. Oder am Montag.
Jetzt.
Mia setzte sich auf die Telefonbank, die kein Mensch mehr für diesen Zweck benutzte, sondern nur noch als Ablage für ausgelesene Zeitungen, Alex’ Baskenmütze, den Schuhlöffel und andere nutzlose, nicht vermisste Dinge, die einfach nur im Weg herumlagen und von Mia erst mal abgeräumt wurden. Dann griff sie nach dem Telefon. Ihr Blick ging zur Küchentür, hinter der es verdächtig still war. Sie wählte die Nummer und sogar das Tuten im Hörer klang altmodisch. Die ersten beiden Male klopfte ihr Herz wie rasend. Beim dritten Klingeln beruhigte es sich. Beim vierten sackte es vor Enttäuschung eine Etage tiefer Richtung Magengrube. Beim fünften klickte es und eine heisere Stimme meldete sich.
»Ja, hallo?«
Mia hätte um ein Haar den Hörer fallen lassen. Sie wusste nicht, warum sie auf einmal so nervös war. »Spreche … Spreche ich mit Wilhelm Herder?«
Stille. Dann: »Wer ist da?« Es klang misstrauisch und ablehnend.
»Mia Arnholt. Aus Meißen. Ich bin die Tochter von Helene. Also, ähm, Helene Arnholt.«
Keine Antwort.
»Hallo? Sind Sie noch dran?«
Nichts. Es rauschte zwar noch, aber der Mann am anderen Ende schien nicht mehr zu existieren.
»Hallo?«
»Mia?« Es klang wie ein Flüstern. »Helenes Tochter?«
»Sind Sie Wilhelm Herder?«
Ein tiefes Seufzen. »Ja. Oh ja, das bin ich. Und ich habe so lange auf diesen Anruf gewartet.«
2.
Nie wurde es still in dem großen Haus. Mal knackte irgendwo das verzogene Holz einer Stiege, dann wieder schrie draußen ein Nachtvogel. Früher hatten ihn diese Geräusche gestört. Doch seit Wilhelm Herders Ohren langsam aber sicher ihren Dienst einstellten, vermisste er sie. Er lauschte. Aber entweder schliefen die Vögel und das Haus auch, oder er war auf dem besten Weg, völlig taub zu werden.
Mit einem leisen Seufzen setzte er den Füllfederhalter wieder an und schrieb die letzten Worte. Im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte, Lüneburg, den …
Na, das mit den körperlichen Kräften war heillos übertrieben. Er hoffte, dass sein Notar sie in Relation zu seinem Alter setzte: 93 Jahre. Fast ein Jahrhundertleben …
Er legte den Füller ab und lehnte sich zurück. Das Holz des alten Stuhls knarrte leise. Das konnte er hören, also war es tatsächlich sehr still um ihn herum geworden. Er liebte die späte Stunde. Alles schlief, die Welt da draußen schloss die Augen. Niemanden interessierte es, ob er um Mitternacht oder um vier Uhr morgens das Licht löschte. Keiner störte ihn. Er war mit sich allein, umgeben von Büchern und Erinnerungen.
Immer öfter glitten dann seine Gedanken zurück in frühere Zeiten. Zeiten, in denen das Haus und die Fabrik noch eine Einheit gewesen waren und die Eingangstür offen gestanden hatte für Mitarbeiter und Freunde. Die Abendgesellschaften waren groß und glanzvoll gewesen, und oft war er als kleiner Junge durch den Kellergang hinübergelaufen in die Manufaktur und hatte staunend vor den großen Maschinen gestanden, die ohrenbetäubend laut arbeiteten. Oder er hatte in die Kupferkessel mit dem brodelnden Zucker gelinst, bis der Meister ihn vertrieb. Da war das wuchtige Dreiwalzwerk, mit dem Zucker, Milchpulver und Kakao vermahlen wurden. Oder der Conchensaal, wo tagelang die dicke, glänzende Schokoladenmasse unter einer Granitwalze veredelt wurde. Rudolph Lindt hatte den Längsreiber erfunden, mit dem sie stundenlang bewegt wurde – dunkel, träge fließend und so betörend duftend, dass er bis heute den Geruch von Kakao weniger mit fremden, exotischen Ländern verband, sondern vielmehr mit der alten Halle. Der Nougat wurde mit dem Melangeur verarbeitet. Die Fondantmaschine machte aus Zucker eine halbelastische Masse, die anschließend in Förmchen gedrückt wurde. Kleine Osterhasen, Weihnachtsengel oder … Ja, sogar ein Nashorn war darunter gewesen.
Irgendwo standen die Aluminiumformen noch herum. Warum verwendete man sie nicht wieder? Die Leute liebten das. In Berlin arbeitete ein Konditor bis heute mit den Originalen aus den Zwanzigerjahren. Kleine Mäuse aus Schaumzucker mit schwarzen Knopfaugen, die noch mit Handarbeit aufgetupft wurden … Aseli hieß die Firma, er erinnerte sich an eine Messe in Breslau, wo er an der Hand des Vaters durch die Hallen gegangen war und sich sofort in diese Mäuse verliebt hatte (am liebsten hätte er ihnen allen die Schwänze abgebissen und die Äuglein weggeknuspert). Aber die Herders arbeiteten nicht mit Schaumzucker, sondern mit Schokolade. Der Pralinensaal – ein Paradies! Die Frauen hatten ihn rundgefüttert mit Walnussmarzipan und Nougat-Ganache und Buttersahnetrüffeln und Katzenzungen. Als seine Mutter dahintergekommen war, dass auch die eine oder andere Weinbrandbohne darunter gewesen war, hatte es ein Donnerwetter gegeben!
Noch heute konnte er das Lachen und Schwatzen der Frauen hören, die in Schürzen und mit Hauben auf dem Kopf garnierten, verzierten, die köstlichsten Pralinen mit Schokolade überzogen. Einen Raum weiter wurden sie in die Schachteln mit dem berühmten Herder-Schriftzug gepackt. »Rosengruß« hieß eine dieser Bonbonnieren. »Orchidee«, »Liebeslied«, »Wiener Walzer«.
Schokolade war in seiner Jugend eine frivole Verführung gewesen. In einer Zeit, in der die Sinnlichkeit am Knöchel endete, hatte der Gedanke an zart schmelzende, auf der Zunge zergehende Pralinen durchaus etwas Zweideutiges gehabt. Vor allem wenn die Pralinenschachtel von einem schneidigen jungen Mann überreicht wurde, wie er einer gewesen war …
Und dann waren die Braunhemden gekommen. Die Fackelzüge. Die Aufmärsche. Alles wurde zertreten von ihren Stiefeln, und ein Mädchen, das er sehr geliebt hatte, verschwand und kam nie wieder. Dieser entsetzliche Krieg! Das Leid. Die Schuld. Die Bomben. Die Bomben! Seltsamerweise hatten sie das Werk verschont. Ob die Tommies gewusst hatten, dass die Herders in ihrer altmodischen kleinen Fabrik nur Kanonenkugeln aus Schokolade herstellten? Dann der Untergang. Die Not. Es gab schon lange keine Rohstoffe mehr. Erbsenmehl, Braumalz und Haferflocken, dazu gehärtetes Pflanzenfett, mach mal einer Schokolade aus diesen Zutaten! Erst 1949 kam wieder Rohkakao in Bremen an und wurde unter allen Schokoladenherstellern aufgeteilt. Von da an ging’s bergauf. Noch bis in die Achtzigerjahre hatten sie dort produziert. Dann, auf einmal, war Schluss damit.
Da hatte sein Sohn das Zepter übernommen. Aus der alten Halle aus Glas, Eisen und Ziegelstein hatte er ein Gästehaus gemacht und die Herder-Werke produzierten am Rande der Stadt in einer modernen Fabrik. In der Garage standen vier Autos, dazu noch irgendwo zwei Oldtimer. Es gab ein Ferienhaus in der Schweiz und moderne Kunst im Esszimmer, die seine Schwiegertochter Gabi in Basel oder Miami auf irgendwelchen Kunstmessen aufgeschwatzt bekam. Wann hatte das angefangen, dass der Reichtum eine so große Rolle in der Familie spielte? Mit Wolfgang, das musste er widerwillig zugeben. In den Achtzigerjahren war das gewesen, als Wilhelm gemerkt hatte, dass er langsam den Anschluss verlor an das, was sich Globalisierung, Arbeitsmarktprozesse und Kosten-Nutzen-Optimierung nannte. Der Firma war es gut gegangen, den Mitarbeitern auch. Herder-Schokolade galt etwas. Man verschenkte die großen Pralinenschachteln zu besonderen Anlässen, und an den Läden in Lüneburg, Hannover und Hamburg drückten sich die Steppkes die Nasen platt, wenn sie zu Weihnachten und Ostern die Schaufenster mit den Meisterwerken aus der Fabrikation dekorierten. Mit Wolfgang aber hatte eine Veränderung begonnen. Die Herders hatte sie reich gemacht. Immer noch ein paar Cent mehr für den Sack Kakao herauspressen. Immer höhere Produktionsleistungen. Dann die billigeren Zutaten, die nicht ganz so teuren Nüsse und Öle.
»Wir müssen weg von diesem Manufaktur-Image«, hatte Wolfgang erklärt. »So kommen wir nicht in die Discounter rein!«
Discounter … Noch so ein Wort, das Wilhelm fremd geblieben war. Er hatte begriffen, dass die Leute kein Geld für Qualität mehr ausgeben wollten. Dass es ihnen auf Masse ankam und Wolfgang lieferte sie ihnen. Eine Tafel Schokolade für 29 Pfennige. Als Wilhelm sie zum ersten Mal probierte, hätte er sie um ein Haar wieder ausgespuckt. Um auf den gleichen Gewinn zu kommen, mussten sie nun das Fünffache verkaufen. Und siehe da – es gelang!
»Es ist der Preis, Papa. Die Leute schauen nur auf den Preis. Es ist ihnen egal, wo die Rohstoffe herkommen.«
Und ihm, ja, ihm war es irgendwann auch egal gewesen. Seine liebe Reinhild wurde krank. Immer kränker, immer schmaler wurde sie. Ihre letzten gemeinsamen Jahre wollte er nicht mit den Umstrukturierungen der Firma belasten. Wolfgang machte es doch gut, oder? Die kleinen Läden verschwanden, die Fabrikhalle hinter dem Haus wurde geräumt. Das neue Werk entstand. Die Produktion lief wie geschmiert. Und dann kamen die Skandale. Kinderarbeit auf den Plantagen. Verseuchtes Milchpulver aus China. Krebserregendes Mineralöl in den Verpackungen. Wolfgang gelang es immer irgendwie, sich herauszuwinden. Aber als man ihm mit dem Vanille-Betrug auf die Schliche kam – künstliche statt natürliche –, verlor er den Prozess. Weitere folgten. Geschmack und Duft kamen nicht mehr von den verarbeiteten Produkten, sondern von Firmen, die Aromastoffe herstellten. Da hatte Wilhelm seine Reinhild schon lange begraben und sich völlig zurückgezogen.
Immerhin – seit ein paar Jahren war die Sehnsucht nach dem Echten, Unverfälschten wieder erwacht. Wolfgang eröffnete die »Herder Manufactur«-Läden: Geschäfte, in denen das Personal altmodische Schürzen trug und die Kunststoffregale auf Holz getrimmt worden waren. Verkauft wurde im Großen und Ganzen dasselbe Sortiment: Schokolade, Gebäck, Pralinen aus der Massenproduktion. Dafür aber einzeln angeboten und in knisternde Papiertüten oder Kartons verpackt. Augenwischerei, hatte Wilhelm gedacht, als er vor Jahren zum letzten Mal in Bremen eines der Geschäfte von außen betrachtet hatte. Warum geben die Leute dafür nun mehr Geld aus? Weil ihnen die Illusion von etwas Handgemachtem verkauft wird? Er war die Fußgängerzone hinuntergelaufen, die er kaum noch wiedererkannt hatte, und hatte sich in eines dieser neuen Cafés gesetzt, die so gemütlich waren wie das Nagelbrett eines Fakirs. In seinem Kakao ertrank ein Berg Sprühsahne, verunziert mit zäher, künstlicher Karamellsoße. Wilhelm hatte den Becher stehen gelassen. Das war keine heiße Schokolade. Das war … Chemie, Stickstoff, Zucker. Eine blassrosa, kränklich aussehende Brühe. Warum kauften die Leute so etwas? Kannten sie denn nicht mehr den Geschmack des Echten?
Er schreckte auf. Was war das? Er lauschte. Nichts. Sein Besucher war schon lange gegangen, die Haustür war abgeschlossen. Langsam sank er wieder zurück. Wenn man den Gedanken einmal freien Lauf ließ … Die beiden Kartons standen auf dem Tisch. Ihr Inhalt war seit einem halben Jahrhundert nicht mehr durchgesehen worden. Ein Glück, dass er sie aufgehoben hatte. Oben, auf dem Dachboden, in der Kiste, die außer ihm niemand mehr öffnete. Irgendwo musste es sein, das alte Tagebuch, das plötzlich so wichtig geworden war. Aber wo? In der ersten Kiste lag es nicht. Nur ein paar herausgerissene Seiten, in denen es um die Kriegsgräuel in Südwestafrika ging und die diese Pfeife von Historiker wohlweislich nicht verwendet hatte. Er hob den Deckel des zweiten Kartons an. Obenauf lagen uralte Schwarz-Weißaufnahmen. Gleich die erste zeigte Gottlob auf einem Zebra. Das Tier war gesattelt wie ein Pferd und setzte gerade zum Sprung an. Den Barren hielten … Wilhelm kniff die Augen zusammen. Wer war dieser kleine schwarze Junge auf dem Foto? Doch nicht etwa Jakob? Er legte das Foto zurück. Das Verlangen, noch einmal in die Vergangenheit hineinzutauchen, war übermächtig. Doch erst musste er das Wichtigste erledigen.
Er rieb sich über die Augen und nahm das Blatt hoch. Testament stand über dem kurzen Text. Er las ihn noch einmal durch, unterschrieb, faltete das Papier dann zusammen und steckte es in einen Umschlag. Gerade wollte er den Namen des Notars daraufschreiben, als er innehielt.
Wolfgang bekäme einen Tobsuchtsanfall, wenn er das lesen würde. Bataillone von Anwälten würden aufmarschieren und ihre Geschütze in Stellung bringen, um diesen letzten Willen zu pulverisieren. Und hatte Jürgensen, der alte Gefährte, seine Geschäfte und die Kanzlei nicht auch schon längst an die Nachfolger weitergegeben? Das Alter, es brachte alles durcheinander, löste alles auf – Beziehungen, Freundschaften, Loyalitäten. Jürgensen, zehn Jahre jünger, also auch schon über achtzig, Jürgensen würde dem alten Freund nicht mehr helfen können, wenn es hart auf hart kam. Was tun? Um es hieb- und stichfest zu machen, könnte er zwei Zeugen rufen. Wer kam dafür in Betracht? Sein Sohn und seine Schwiegertochter. Die würden sich bedanken, wenn sie mitbekämen, was er mit diesem Testament vorhatte. Den Jungen, seinen Enkel, wollte er raushalten. Der hatte doch nur Flausen im Kopf. Mit zwanzig durfte man das. Nein, Zeugen waren nicht nötig, solange er, Wilhelm, jetzt alles genau richtig machte.
Er setzte erneut an – und hielt wieder inne. Das Geräusch kam von oben. Es war so leise, dass er erst glaubte, er hätte sich verhört. Doch dann kam es wieder. Ein leises, wiederholtes Knarren.
Manchmal, wenn alles so still um ihn herum war wie in dieser Nacht, funktionierten seine Ohren noch. Halbwegs. Es war in Wirklichkeit ein ziemlich lautes Knarren, und er erinnerte sich sogar noch daran, wie es geklungen hatte: als ob zwei Baumstämme im Wald aneinanderrieben. Wahrscheinlich dachte derjenige, der sich dort oben herumtrieb, dass Wilhelm sowieso taub war oder schon längst schlief. Seltsam. Seit Jahren war niemand mehr auf dem Dachboden gewesen. Nur Carolina, die er gebeten hatte, die Kartons zu holen. Und jetzt war es mitten in der Nacht …
Er schrieb einen anderen Namen und eine andere Adresse auf den Umschlag. Dann zog er eines dieser famosen gelben Papierchen ab, die von alleine hafteten und sich auch problemlos wieder abziehen ließen. Darauf schrieb er: »Per Einschreiben. Dringend!«
Carolina, die Haushälterin, die morgens in sein Zimmer kam, das Bett machte und den Staub wischte, würde den Brief zur Post bringen. Er vertraute ihr, weil ihre Familie seit Generationen im Dienst der Herders stand und diese Zeit mehr verband als Tarifverträge. Er erhob sich und ging mit vorsichtigen, tastenden Schritten zu seinem Schrank. Im oberen Fach lag das Portemonnaie. Ein Zwanzig-Euro-Schein. Er fühlte sich glatt und künstlich an, gar nicht so wie das Papiergeld, das er kannte. Schöne neue Zeit … Bald würde es wohl gar nichts Bares mehr geben, wenn man den Propheten der Abendnachrichten glauben durfte. Aber hatte er eigentlich so viel ausgegeben diesen Monat? Dabei war sein Enkel erst vor ein paar Tagen für ihn auf der Bank gewesen. Er würde Gabi bitten müssen, für ihn Geld abzuheben, und sie würde wieder mit ihrer hohen Stimme fragen, wofür er denn so viel bräuchte, er hätte doch alles, sie täten doch alles, wofür das alles … Carolina hingegen schwieg wie ein Grab. Im Laufe der Jahre war zu dem Vertrauen noch etwas zwischen ihnen beiden entstanden, dem gebrechlichen Alten und der Haushälterin, was man vielleicht mit freundschaftlicher Komplizenschaft beschreiben könnte. Mal eine gute Flasche Wein, mal eine Zigarre (am offenen Fenster natürlich, denn seine Schwiegertochter hatte die Angewohnheit, ohne zu klopfen einzutreten, die Arme in die Hüfte zu stemmen wie Witwe Bolte und mit gerümpfter Nase zu fragen: Wurrrrde hierrr gerrrauchttt?). Wilhelm holte den Schein heraus, den er als Portoauslage für ein Einschreiben ebenfalls an den Brief heften wollte, faltete ihn auf seine Art – einmal längs, einmal quer – und fuhr zusammen: Oben war etwas heruntergefallen und rollte über den Boden.
Langsam legte er das Portemonnaie zurück. Den Schein steckte er in die Tasche seines Morgenmantels. Er wusste, was dort rollte. Schließlich kannte er den Dachboden. Er war da oben aufgewachsen, an diesem verstaubten, geheimnisvollen Ort, an dem die Geister der Vergangenheit in Truhen gesperrt waren und ihre Seufzer durch die Ritzen wehten. Wie oft hatte er sich dort versteckt! Es war verboten gewesen hinaufzugehen, aber seit wann kam man einem Jungen mit Verboten bei? Da waren Schätze und Dämonen, Fabelwesen und Kobolde, Schlangenhäute und Totems, Masken und Giftpfeile, und so vieles, was einem in einer Mischung aus Faszination und Grauen eine Gänsehaut den Rücken hinunterschickte.
Was für eine seltsame Nacht! Die Vergangenheit stieg aus dem Vergessen, aus Buchdeckeln und Gräbern, aus Schubladen und, ja, auch aus dem Telefon, und sie schien auf einmal zum Greifen nah. Das musste mit dem Anruf zusammenhängen. Mia Arnholt, das Mädchen aus Meißen. Jakobs Urenkelin. Jakob … In seinen Augen war er riesig gewesen, riesig und schwarz. Und er, Wilhelm, ein kleiner Junge, der gar nicht mitbekommen hatte, was da geschah und warum dieser Mann auf einmal im Haus war und so wütend mit seinem Vater redete. Erst viel später hatte Wilhelm herausgefunden, worum es gegangen war. Da war sein Vater schon lange tot und Wilhelm hatte die Geschäfte übernommen und durch die schweren Zeiten bringen müssen. Das hatte es nicht gegeben, damals. »Aufarbeitung.« Sie hatten noch nicht einmal einen Begriff dafür gehabt. Entschuldigung vielleicht? Er hatte es versucht, viel zu spät. Und natürlich war ihm eisige Ablehnung entgegengeschlagen.
Es war sein wunder Punkt. Und vielleicht hatte ihn deshalb Mias Anruf so aufgewühlt. Er wollte sich abwenden und zum Schreibtisch zurückgehen, da knarrte es wieder. Direkt über ihm.
Das war in Afrika. So hatte er den Teil des Dachbodens immer genannt, weil die Museen seiner Kindheit eigene Säle für die Kontinente gehabt hatten mit riesigen Schildern: Afrika, Asien, Amerika … Jemand stöberte in Afrika herum. Weder Wolfgang noch Gabi oder sein Enkel Will hatten jemals Interesse dafür gezeigt. Der Dachboden war »ein Fall für die Müllabfuhr«. Ein paar Stücke waren im Bremer Überseemuseum gelandet – Wilhelm erinnerte sich mit Grausen, welche das gewesen waren. Der Rest war wertloser, mottenzerfressener Plunder.
Und trotzdem schlich jemand dort oben herum. Etwas in Wilhelm riet ihm, Hilfe zu holen. Doch das ging gegen seine Ehre. Afrika gehörte ihm. Und er musste es verteidigen. Seine Kinder würden nicht verstehen, was da oben verborgen lag und beschützt werden musste. Und Will … Eine Sekunde dachte er an seinen Enkel. Will würde sofort mit ihm kommen, aber der Junge war wahrscheinlich noch gar nicht zurück von seinen nächtlichen Touren. Außerdem hatte er ein Zimmer im Erdgeschoss und Wilhelm war sich über das Schwinden seiner Kräfte durchaus im Klaren. Hinauf zum Dachboden würde es noch gehen. Aber hinunter zu Will und dann wieder hinauf … Nein, er musste selbst nachsehen und den Eindringling stellen oder vertreiben. Wahrscheinlich war es ein verzweifelter Einbrecher, der dort oben Schätze vermutete und sich nun in steigender Enttäuschung durch die staubigen Relikte wühlte. Ein Griff zum Spazierstock, der an der Wand lehnte, und schon fühlte Wilhelm sich bewaffnet. Langsam drückte er die Klinke hinunter und öffnete die Tür.
Der lange Flur lag da wie ausgestorben. In der Ecke verbreitete eine heruntergedimmte Stehlampe trübes Licht. Wilhelm tastete sich vorwärts, eine Hand an der Wand, die andere am Stock, und verfluchte den rutschigen Läufer, den Gabi hier oben hatte auslegen lassen. Wollte sie, dass er sich das Genick brach? Er war nie richtig warm mit seiner Schwiegertochter geworden. X-mal hatte er sie gebeten, den Teppich zu entfernen. Aber ab einem gewissen Alter schien es, dass die anderen einen weder sahen noch hörten. Er wünschte sich, dass das auch für den Einbrecher gelten möge. Denn als er die schmale Treppe zum Dachboden erreicht hatte, war er sich seiner Sache nicht mehr so sicher. Weit entfernt von einer Furcht einflößenden und Respekt gebietenden Gestalt, schleppte er sich die steilen Stufen hoch. Bis auf den Überraschungsmoment hatte er nichts, womit er den Eindringling vertreiben konnte. Da. Wieder ein Geräusch! Es klang, als ob ein Pappkarton mit bloßen Händen zerrissen würde. Da war aber jemand ziemlich in Eile und ganz schön auf der Suche.
Wilhelm erreichte den kleinen Absatz vor der Dachbodentür und blieb einen Moment stehen, um zu verschnaufen und das Stechen in seinem Knie unter Kontrolle zu bringen. Die Tür stand einen Spalt offen. Eigentlich war hier oben immer abgeschlossen. Doch seine Augen waren zu schlecht, als dass er erkennen konnte, ob das Schloss aufgebrochen oder konventionell geöffnet worden war.
Jemand stolperte, riss etwas Schepperndes um und stieß einen wütend geflüsterten Fluch aus. Wilhelm öffnete die Tür. Ihn empfing eine plötzliche, unheilvolle Stille.
Er begriff, dass er mitten im Fluchtweg stand. Wenn er den Einbrecher vertreiben wollte, durfte er sich ihm nicht in den Weg stellen. Tock tock tock. Der Stock klopfte auf den Boden, als er den Raum betrat. Seine Hand zitterte auf dem Weg zum Lichtschalter. Das Drehen des Knebels brauchte mehr Kraft, als er gedacht hatte. Klack. Blingblingbling. Zwei Neonröhren sprangen an, hoch oben und weit weg, irgendwann in den Sechzigern installiert. Licht blendete, Schatten warfen sich auf ihn. Er lehnte sich an die Wand und spürte, wie sein Herz jagte. Jetzt bloß keinen Infarkt, dachte er. Einbrecher leisten selten Erste Hilfe. Und bis ihn hier einer finden würde …
Es blieb still. Der Unbekannte musste schockgefroren sein. Damit hast du nicht gerechnet, Kerlchen, dachte Wilhelm grimmig. Hinten links hast du dich versteckt. Zwischen Indien und Amazonas, in Afrika. Da werde ich dich jetzt raustreiben. Tock tock tock. Wilhelm machte sich auf den Weg. Den Stock ließ er vor sich wie ein Blinder über den Boden gleiten. Er sah das Zebra, es schien ihn anzugrinsen. Die vielen Regale mit den Krügen und den Schachteln. Die Landkarten, die Körbe voller vertrockneter Pflanzen, die zu Staub zerbröselten. Brokat- und Samtstoffe, deren Farben ihn einst mit ihrer Leuchtkraft begeistert hatten, verblichen waren sie und dienten den Mäusen als Lager. Und stand da nicht, kurz vorm Amazonas, Kurt in der Ecke? Kurt, der Maskenmann? Lauter alte Bekannte. Da. Ein Schatten flitzte hinter einem Regal entlang.
»Stehen bleiben!«, schrie Wilhelm und wusste, dass dies ein absurder Wunsch war. »Ich habe die Polizei informiert!«
Wo war der Kerl hin? Wilhelm drehte sich um. Ein metallisches Geräusch drang an seine Ohren. Wie verrostete Räder. Irgendetwas bewegte sich und es war kein Mensch. Ihm wurde bewusst, wie tollkühn er gewesen war, den Einbrecher zu bedrohen. Er sollte schleunigst zurück zur Treppe. Er lief los, und das eiserne Kreischen verfolgte ihn, schraubte sich in seinen Kopf, kam näher und näher. Er wagte nicht, sich umzusehen. Die Schatten wirbelten durcheinander, und einer davon erhob sich, wurde größer und größer und ähnelte keinem Menschen mehr …
Mit einem Schrei stürzte Wilhelm ins Treppenhaus und schlug die Tür hinter sich zu. Schwer atmend blieb er stehen. Jetzt nur noch ein paar Stufen und rein in sein Zimmer. Da stand das Telefon, mit dem er die Polizei rufen würde.
Etwas neben ihm bewegte sich. Es war die Türklinke. Und sie wurde langsam, Millimeter für Millimeter, nach unten gedrückt.