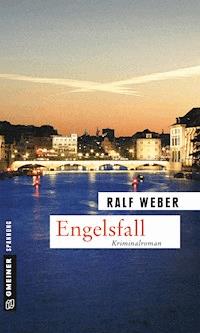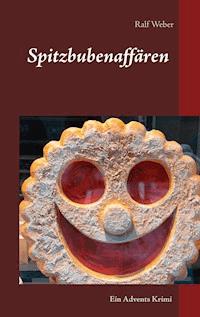Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Studer und Helbling
- Sprache: Deutsch
Bei der misslungenen Notlandung eines Privatjets im Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz verlieren Crew und Passagiere ihr Leben. Was zunächst für einen tragischen Unglücksfall gehalten wird, entpuppt sich als grausames Verbrechen, denn die Pilotin wird am Tag darauf ans Ufer gespült - mit einem Kopfschuss. Frank Studer, von der Luzerner Mordkommission, tritt mit seinen Ermittlungen eine gewaltige Lawine los und steht bald übermächtigen Gegnern gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Weber
Tränen im Vierwaldstättersee
Kriminalroman
Zum Buch
Tiefenrausch In einer sturmgepeitschten Nacht stürzt der Privatjet der Genfer Luxusgüterfirma Provaxis unter mysteriösen Umständen in den Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz. An Bord befand sich eine außergewöhnlich kostbare Fracht. Eigentlich kein Fall für Frank Studer von der Luzerner Mordkommission, wäre nicht am Tag nach dem Absturz die Leiche der Pilotin ans Ufer gespült worden – mit einem Kopfschuss. Studers Ermittlungen führen ihn zu Nadja Glockner, der atemberaubend attraktiven Geschäftsführerin von Provaxis, die sich aber eisern über die geheimnisvolle Fracht der Maschine ausschweigt. Während die Schweiz im Dauerregen versinkt und immer neue Leichen auftauchen, mischt sich neben einem kauzigen Umweltschützer auch noch die Schweizer Armee in die Ermittlungen ein. Es wird bald klar, dass auf dem Grund des Sees noch weitaus düstere Geheimnisse verborgen sind.
Ralf Weber wurde 1969 im Kanton Baselland geboren. Nach seiner Schulzeit und einer technischen Ausbildung verbrachte er mehrere Monate in den USA und absolvierte anschliessend diverse Weiterbildungen im technischen Bereich sowie in mehreren Fremdsprachen. Heute ist Ralf Weber Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglied einer technischen Firma. Seine Freizeit verbringt Ralf Weber gerne mit seiner Familie, mit Sport, Lesen und Schreiben, mit Fremdsprachen und der Aviatik. Das Schreiben von Romanen und Gedichten fasziniert ihn seit seiner Jugend. In der Natur, speziell in den Bergen beim Wintersport, lässt er sich gerne von neuen Ideen inspirieren. Ralf Weber lebt in der Nordwestschweiz.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Gipfelblut (2017)
Engelsfall (2016)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © daniel.schoenen / photocase.de
ISBN 978-3-8392-6320-4
Zitat
Nichts genügt dem, welchem genug zu wenig ist.
Epikur von Samos, griech. Philosoph
1
Bea und Marc konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, wie dieses Abteilungsessen enden würde. Ein Abendessen in einem bekannten Fischrestaurant in Gersau, direkt am Vierwaldstättersee, stand auf dem Programm.
Dabei begann der Freitag wie gewohnt. Gut gelaunt und mit Vorfreude auf das kommende Wochenende war ihre Abteilung in den Tag gestartet. Ihre Abteilung oder, besser gesagt, was noch davon übrig war, folgte der Einladung ihres Chefs. Er hatte sie zum Dank dafür eingeladen, der Firma die Stange gehalten zu haben. Sie bildeten den Ableger eines Zuger Technologiekonzerns, der in den letzten Jahren umstrukturiert und zerstückelt worden war. Eigentlich hätte ihre Abteilung aufgelöst oder ins Ausland verlagert werden sollen. Wichtige Kunden hatten aber gedroht abzuspringen und so war es in letzter Sekunde gelungen, die Abteilung zu retten. Aufgrund der großen Unsicherheit und der Missstimmung, die im Betrieb herrschte, hatte aber fast die Hälfte ihrer Kollegen die Firma verlassen. So blieben zwölf Programmierer und Entwickler der Abteilung erhalten. Acht Männer und vier Frauen, welche damit beschäftigt waren, Steuerungseinheiten für Brandschutz- und Haustechnikeinrichtungen zu konfigurieren, die in der ganzen Welt angewendet wurden.
Es war die ganze Woche schön und mild gewesen. Zu warm für den Monat April und so war ein Abendessen auf der Seeterrasse geplant. Das Wetter hatte aber am frühen Nachmittag umgeschlagen. Ein Föhnsturm und ein anschließender Wetterumschwung mit viel Regen war vorausgesagt worden. So wurde das Abendessen im Inneren des Lokals eingenommen. Durch die großen Panoramafenster bot die Natur ein eindrucksvolles Schauspiel. Paddelten eben erst noch Enten und Schwäne am Ufer entlang, bildeten die Wellen des Sees nun wütende und wippende Schaumkronen. Der Himmel war wolkenlos, der starke Föhnwind, der von Süden her peitschte, bog die Baumkronen der umliegenden Bäume immer bedrohlicher. Die Lichter für die Sturmwarnung entlang des Ufers blinkten in regelmäßigen Abständen und wirkten beinahe hypnotisierend.
Zu leckeren Felchenfilets hatten sie Weißwein getrunken. Viel Weißwein. Beendet hatten sie ihr Essen mit Espresso und Grappa. Es war beinahe Mitternacht, als die Mehrheit der Runde beschloss, den Abend in einer Bar fortzusetzen. Man fand diese in Flüelen, etwas weiter dem Ufer des Sees entlang in Richtung Süden. Für die Fahrt nach Flüelen wurden zwei Taxis bestellt. Marc fuhr mit seinem Wagen. Er war wie immer trocken geblieben. Er bot seinen einzigen freien Platz in seinem Pick-up-Truck Bea an. Wem sonst? Den ganzen Tag schon hatte sie ihm hungrige Blicke zugeworfen. Sie berührte ihn auch immer wieder, zufällig, wie es schien. Beim Vorbeigehen hinter seinem Stuhl, bei den Raucherpausen auf der windigen Seeterrasse, als er ihr Feuer gab und beim Gang zur Toilette. Während der Fahrt nach Flüelen, entlang der Axenstraße, strich sie sich immer wieder durch die Haare und lächelte ihn an. Marc genoss den Moment und wünschte sich, dass die Fahrt niemals enden würde.
In der Bar in Flüelen wurde die Stimmung immer ausgelassener. Ihre Kollegen mischten sich unter eine polnische Touristengruppe und begannen ein Wodka-Wetttrinken. Bea und Marc blieben diesem Treiben fern und tranken in einer kleinen Sitzecke alkoholfreies Bier. Beas Augen wirkten hinter ihrer Brille größer, als sie in Wirklichkeit waren und sogen Marc beinahe auf. Sie begaben sich auf eine kleine Tanzfläche und tanzten. Zuerst offen, danach geschlossen.
Angewidert wollte Marc die Bar verlassen, nachdem er auf der Herrentoilette einem großgewachsenen, total betrunkenen Polen zusah, wie er den »Dyson-Händetrockner« mit einem Pissoir verwechselte und nicht einmal dann den Irrtum bemerkte, als sich das Gebläse in Betrieb gesetzt und seinen Urin im ganzen Raum verteilt hatte.
Er zog Bea zu sich hoch.
»Komm, lass uns gehen, mir reicht’s.« Bea nickte in ihrer Verwunderung.
»Und wohin gehen wir?« Die Frage war nicht ganz unberechtigt. Bea lebte mit ihrem Mann in einer Luzerner Eigentumswohnung und Marc teilte sich eine Mietwohnung mit seiner Freundin und deren Schwester in Küsnacht.
»Ich bring dich nach Hause, wenn du möchtest.« Wieder nickte Bea. Leichte Enttäuschung in ihrem Gesicht. Sie hätte gerne noch eine Weile an der Seite von Marc verbracht. Marc erzählte ihr auf der Fahrt, was auf der Herrentoilette passiert war, und Bea musste lauthals lachen. Marc erwiderte ihr Lachen. Als es wieder still wurde, sah er, wie sie ihn anlächelte. Er verlangsamte seine Fahrt kurz vor einem Tunnel, lenkte seinen Truck auf einen kleinen Parkplatz am Ufer und schaltete den Motor aus. Heftige Böen ließen den Wagen schaukeln.
»Komm mit, ich will dir etwas zeigen.« Er stieg aus und sie folgte ihm einen schmalen Fußweg entlang. Rechts von ihnen das Ufer des Sees, links eine Felswand. Immer wieder peitschte sie der warme Südwind, als wollte er versuchen, sie aufzuhalten. Der Fußweg führte auf eine kleine Halbinsel. Die Halbinsel war eine kleine bewaldete Fläche, die in einer Lichtung am Ufer endete. Dicht am Ufer stand eine Art Bootshaus, das als Tauchbasis diente. Um das kleine Haus herum waren Picknicktische und eine Feuerstelle. Immer wieder türmten sich Wellen vor ihnen auf und der Sturm trug Wassertropfen auf ihre Gesichter.
Unermüdlich erleuchteten die Drehlichter für die Sturmwarnung ihre unmittelbare Umgebung. Auf dem aufgewühlten See reflektierten die mächtigen, nervös wippenden Schaumkronen das Mondlicht.
Bea lehnte sich an einen der Tische und versuchte vergeblich, sich eine Zigarette anzuzünden. Der Wind blies ihr die Haare vor das Gesicht. Marc stellte sich vor sie.
»Soll ich dir Windschatten geben?«
Bea blickte ihn verführerisch an und schüttelte ihren Kopf. Dann ließ sie die Zigarette los, als hätte der Wind sie ihr entrissen. Marc wischte ihr die Haare aus dem Gesicht. Sie griff nach seiner Hand und legte sie auf ihren Busen. Zärtlich begann er, ihre Brüste zu massieren. Bea lehnte sich zurück und ließ sich von Marcs Zunge liebkosen. Der Holztisch war unbequem und die Kleider konnten sie nicht ganz ausziehen. Der Wind hätte sie sofort weggeblasen. Aber sie ignorierten die widrigen Umstände und gaben sich mitten im Sturm ihrem hemmungslosen Liebesspiel hin.
Der Sturm trug Beas Lustschreie fort und als sie sich rittlings ihrem Höhepunkt entgegenschaukelte, nahm sie ein Licht am Himmel wahr. Zuerst wollte sie sich nicht ablenken lassen und es einfach ignorieren. Schließlich fixierten ihre Augen das Scheinwerferlicht doch. Es näherte sich ihnen. Links und rechts vom Scheinwerferlicht blinkten zwei rote Lichter. Zweifellos ein Flugzeug im Tiefflug. Um diese Uhrzeit? Bei diesem Sturm? Marc lag unter ihr und hatte die Augen geschlossen. Seine Hände umklammerten ihre Pobacken abwechselnd mit ihren Brüsten. Das kleine Flugzeug kam schnell näher und befand sich nur noch etwa 100 Meter über dem Wasser. Als es beinahe auf ihrer Höhe war, erhellte ein Feuerstrahl aus einem der Triebwerke die Nacht. Der Jet änderte abrupt die Richtung und setzte zu einem steilen Sinkflug an.
»Oh Gott, gleich knallt’s!«, schrie Bea.
»Allerdings!«, antwortete Marc, in Anspielung auf seine Erregung. Mit einem dumpfen Knall bohrte sich die Maschine in das Wasser, überschlug sich und brach auseinander. Der Knall widerhallte dumpf und laut an der Felswand hinter ihnen, viel lauter als der eigentliche Aufprall. Funken sprühten und eine Wasserfontäne schoss dem Himmel entgegen wie ein Geysir. Für einen kurzen Moment tauchte der zerbrochene Rumpf wieder auf, dann wurde das Flugzeug vom Wasser verschlungen und die Umgebung sah wieder exakt aus wie zuvor. Nicht einmal Trümmerteile waren auf der Oberfläche auszumachen. Alles sah aus, als wäre rein gar nichts passiert.
Mount Tsabiams – 60 km südöstlich von Lüderitz, Deutsch-Südwestafrika (Namibia) – 3. Januar 1915
Die Mittagssonne ließ den Horizont der Dünenburgen flimmern. Francis Liwanna wischte sich mit einem stinkenden und klebrigen Tuch den Schweiß von der Stirn. Mit seiner flachen Hand bildete er ein kleines Vordach, das seinen Augen Schatten spendete. Er presste seine Hand auf die feuchte Stirn und kniff die Augen zusammen. Seine Füße steckten knöcheltief im heißen Sand. Bei jedem Schritt hatte er zuvor das Gefühl gehabt, ein paar Zentimeter tiefer einzusinken. Hinter seiner Stirn stach ihn ein dumpfer Schmerz, als würde jemand sein Gehirn in einer Faust kneten. Er hatte sich in der Nacht zuvor nach einem Trinkgelage verlaufen. Die vermutete Abkürzung zur Straße nach Lüderitz entpuppte sich als sengende Falle. Nichts als braune Dünen, umgeben von sich wild aneinanderreihenden Felsbrocken. Hier und dort Spuren in der Ferne von einer längst weitergezogenen Karawane.
Deutsch-Südwestafrika befand sich im Diamantenfieber. Städte schossen wie Pilze aus dem Boden, ehe sie nach kurzer Zeit wieder verlassen wurden und unter dem Sand für immer verschwanden. Längst hatten sich die Karawanen weiter nach Süden aufgemacht. Jenseits des Dreizackberges vermutete man weitere Reichtümer, die darauf warteten, von gierigen weißen Männern aus dem Berg geschafft zu werden.
Seitwärts taumelte Francis die Flanke einer Düne talwärts, wo sich vor ihm eine kleine felsige Senke öffnete. Die Gegend hier war unwirtlich, wild und schroff. Der Sage nach, deponierte Gott den übriggebliebenen Bauschutt hier, nachdem er die Erde geschaffen hatte. Die Sonne weinte beim Anblick dieser öden Gegend. Ihre Tränen fielen weit verstreut überall auf das karge Land und wurden zu Diamanten.
Etwas weiter hinten erkannte er den verlassenen Eingang eines Stollens. Mit etwas Glück befand sich im Inneren des Stollens noch etwas Trinkbares oder zurückgelassener Proviant. Bald auf allen vieren quälte er sich vor den Eingang des Stollens, der mit Holzplanken versperrt war. Mit letzter Kraft schob er die Bretter zur Seite und ließ sie auf den staubigen Boden fallen. Hinter den Holzdielen versperrte eine Plane den Weg in den rettenden Schatten. Francis versuchte, die Plane herunterzureißen. Dies gelang erst, als er sich mit seinem ganzen Körpergewicht an die Plane hängte. Er stürzte zu Boden und wurde unter der Plane und einem Balken, der zur Beschwerung der Plane diente, begraben. Staub wirbelte auf. Der schwere Holzbalken traf ihn am Oberarm und hinterließ eine klaffende Wunde. Francis strampelte sich frei und rettete sich in den kühlenden Schatten einige Meter in den Berg hinein. Angenehme Kühle drang aus dem Inneren des Berges. Für den Moment begnügte er sich damit, an einem Stein zu sitzen und seine ausgepumpte Lunge mit kühler Luft zu füllen. Die Bilder um ihn herum waren verschwommen. Seine Augen hatten sich an die gleißende Sonne draußen gewöhnt. In der Dunkelheit des Stollens funkelten lauter rote und gelbe Sternchen vor seinem Gesicht. Die Sternchen verharrten auch, wenn er seine Augen schloss. Selbst als er einschlief und zur Seite kippte, waren sie noch da.
2
»Sind Sie sich absolut sicher, dass es unser Jet ist?« Nadja Glockner legte das Handy zurück auf ihren Nachttisch. Vergeblich hatte sie versucht, das rote Symbol auf ihrem Display zu treffen, um die Leitung zu trennen. Zu stark zitterte sie. Sie schlug sich die Hände vor ihr Gesicht und begann zu heulen. Schließlich erhob sie sich verärgert und sah auf die leere Betthälfte neben ihr. Sie wusste, er würde nie mehr hier liegen, falls das, was sie eben gehört hatte, wirklich eingetroffen war. Nie mehr würde er sie berühren und sie zum Lachen bringen.
Nadja begab sich ins Bad und sah in den großen Spiegel. Die Schockstarre hatte sich tief in ihr Gesicht gegraben. Sie trug einen seidenen Schlafanzug, der ihre makellose Figur betonte. 6.20 Uhr zeigte ihre edle Omega Armbanduhr. Eilig begab sie sich zurück ins Schlafzimmer, nachdem sie ihren Kopf eine Weile unter den kalten Wasserstrahl gehalten hatte. Etwas Schlimmeres hätte gar nicht passieren können. Nadja startete ihren Laptop. Ungeduldig wartete sie, um sich einloggen zu können. Kaum gestartet, verlangte ihr Betriebssystem ein Update.
»Nicht jetzt!«, fluchte sie und ignorierte die Meldung. Bereits erhielt sie den nächsten Anruf. Während sie auf Französisch sprach, klickte sie sich durch Kartenmaterial. Vierwaldstättersee, scrollte weiter nach unten, wo der See den Namen Urnersee trug. Sie öffnete eine neue Seite im Internet und las auf einem Newsportal die Schlagzeile:
Privatjet in den Vierwaldstättersee gestürzt. Vermutlich alle Insassen tot, in Kürze mehr …
Sie wechselte auf die vorherige Seite und klickte sich geschickt durch weiteres Kartenmaterial, bis schließlich ein Tiefenprofil des Sees auf ihrem Bildschirm erschien.
»200 Meter tief!« Nadja ballte ihre Faust und schlug damit auf die Tischplatte. Sie beendete das Gespräch und umklammerte ihr Handy, als wolle sie eine Zitrone auspressen. 200 Meter Tiefe. Der Gedanke daran schoss durch ihren Kopf wie die Kugel in einem Flipperkasten. Eine beklemmende Hilflosigkeit breitete sich in ihr aus. Sie war es zwar gewohnt, anspruchsvolle Situationen zu meistern, sich durchschlagen zu müssen. Aber die Tatsache, dass drei Jahre ihres Schaffens in unerreichbarer Tiefe lagen, lähmte sie.
Mit Beharrlichkeit, Fleiß und Ausdauer hatte sie sich zur stellvertretenden Geschäftsführerin hochgearbeitet. Nur noch Albert Deville war in der Hierarchie höher als sie. Deville, mit dem sie eben gesprochen hatte, war ein Phantom. Selten bis nie ließ er sich in der Öffentlichkeit blicken. Er vermied es tunlichst, sich auf Messen oder Veranstaltungen zu zeigen. Für diesen Job hatte er Nadja. Sie genoss großes Vertrauen. Er verstand es, sie gewähren zu lassen und gleichzeitig über alle ihre Unternehmungen Bescheid zu wissen. So wusste er auch bis ins Detail über ihr jüngstes Projekt Bescheid, in welches sie die letzten drei Jahre alle ihre Kräfte investiert hatte.
Nadja hatte sich in all den Jahren ein enormes Netzwerk an Kontakten in der Genfer High Society aufgebaut. Ein Netzwerk, bestehend aus den schillerndsten Figuren der Luxusgüter-Branche. Sie verstand es ausgezeichnet, ihren Charme für ihre Geschäfte zu nutzen. Denn schließlich war diese Branche das Bindeglied zu den reichsten Menschen dieses Planeten. Größen in Sport und Politik, Konzernbosse und Staatsmänner gehörten ebenso dazu wie Größen aus dem Showbusiness.
In ihrer gegenwärtigen Lage nützten ihr diese Kontakte aber wenig. Was sie brauchte, war jemand aus ihrer Vergangenheit. Mit Genugtuung brachte ihr Browser seine Adresse hervor. 20 Sekunden später hatte sie Fabrice Meury schlaftrunken in der Leitung.
»Fabrice, ich bin’s, Nadja. Ich brauche deine Hilfe.« Sie hatte Fabrice in einem noblen Genfer Jachtklub kennengelernt. Sie war damals mit Franz Glockner, einem deutschen Industriellen, verheiratet, der in Genf eine große Jacht besaß. Fabrice und sie verliebten sich und es kam zur Scheidung, als Glockner die beiden auf seiner eigenen Jacht beim Liebesspiel erwischte. Fabrice war damals als Hafenlotse tätig und war ein Tüftler, was Boote und Jachten anbelangte. Er war auch treibende Kraft beim Bau diverser kleiner U-Boote, mit denen er, zusammen mit ein paar Extremtauchern, den Genfersee erforschte.
Sie beschlossen, sich am Quai Wilson zu treffen. Sie wollte in zehn Minuten, er in einer Stunde. So einigten sie sich auf 20 Minuten.
*
Kurz vor 7 Uhr stand Nadja unter einem fest installierten Sonnenschirm am Quai Wilson. Es regnete in Strömen, nachdem die Nacht sehr stürmisch war. Auf ihrem Handy verfolgte sie gierig die neuesten Nachrichten über den Flugzeugabsturz. Wilde Spekulationen machten bereits die Runde. Vom Privatjet eines berühmten Schauspielers war ebenso die Rede wie von einem Terroranschlag. Gesichert schien die Erkenntnis, dass das Wrack noch immer nicht geortet werden konnte und dass heftiger Regen derzeit die Suche unmöglich machte. Das konnte Nadja nur recht sein.
Fabrice näherte sich mit zwei Bechern Kaffee in seinen Händen. Er umarmte Nadja und küsste sie auf die Wangen, während er darauf bedacht war, den Kaffee nicht zu verschütten.
»Hier, schwarz mit zwei Zucker. Ich nehme an, du trinkst ihn immer noch so.« Er streckte ihr den einen Becher entgegen und lächelte.
»Es ist lange her. Ich wusste ja, wie sehr du mich vermisst, aber …«
Nadja unterbrach ihn. Die Falten in seinem Gesicht waren tiefer geworden. Seine langen blonden Haare waren im Ansatz grau geworden und wirkten ungepflegt. Seine Augen waren gläsern. Und doch strahlte er noch immer diese unbändige Lebenslust aus, der Nadja damals verfallen war.
»Ich brauche dein Unterseeboot, noch heute.« Fabrice verschluckte sich am Kaffee und musste heftig husten. »Ist dir etwa dein Handy in den See gefallen?«
»Ach, lass das, Fabrice. Hilfst du mir oder nicht?« Und ungeduldig drängte sie:
»Ja oder nein, Fabrice?«
Er schaute ungläubig auf sie herab.
»Ja oder nein, Fabrice? Sag mal, worum geht es hier überhaupt?«
Nadja begann in ihrer Verzweiflung zu weinen. Fabrice schloss sie in seine Arme und wartete, bis sie sich etwas beruhigt hatte. Schließlich begann sie zu erzählen.
»Unser Firmenjet ist vor ein paar Stunden in den Urnersee gestürzt. Mein Freund war an Bord und ist vermutlich tot. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Basel. Es sollte dort noch Fracht aufnehmen und danach hierher nach Genf kommen. Es war etwas sehr Wichtiges an Bord der Maschine. Ich muss es ganz dringend haben. Es hängt sehr viel davon ab. Ich habe drei Jahre in dieses Vorhaben investiert. Und es muss sehr schnell gehen. Noch ehe die Polizei Taucher losschickt.«
»In welcher Tiefe liegt die Maschine?«
»Ich weiß es noch nicht. Der See ist steil abfallend und über 200 Meter tief an der tiefsten Stelle.«
Fabrice stieß einen Pfiff aus.
»Wenn die Maschine in 200 Metern Tiefe liegt, dauert es, bis die Polizei eingreifen kann. Sie werden versuchen, mit einer Spezialausrüstung das Flugzeug zu heben. Wenn es in einem Stück ist, kann man es mit Luftkissen anheben und bergen. Aber auch das dauert. So eine Ausrüstung hat man nicht einfach in der Garage stehen. Ich weiß nicht mal, ob es das überhaupt gibt in der Schweiz.«
»Heißt das, du hilfst mir?«
»Nein, das heißt nur, du hast etwas Zeit.«
»Du willst mir also nicht helfen, mich bloß vertrösten?«
»Nadja, jetzt hör mir zu. Weißt du überhaupt, was du da verlangst? Arbeiten in dieser Tiefe ist lebensgefährlich. Da geht man nicht einfach runter, holt sich etwas und taucht wieder auf. Das braucht exakte Planung. Ein eingespieltes Team, geeignetes Equipment, Tauchroboter. Nach dem Tauchgang müssen die Taucher in eine Dekompressionskammer, für Tage. Alles andere ist glatter Selbstmord. Und außerdem …«, Fabrice zögerte, »Urnersee, hast du gesagt?«
Nadja nickte.
»Ein weiteres Problem. Die Armee.«
Nadja machte Stirnrunzeln.
»Die Armee?«
»Wenn das Flugzeug tatsächlich auf dem Grund dieses Sees liegt, dann liegt es auf über 3.000 Tonnen Munition, die die Schweizer Armee nach dem Zweiten Weltkrieg dort versenkt hat. Unmöglich, dort zu tauchen. Was immer es ist, das da unten liegt, rechne damit, dass es für immer dort bleibt. Dann wird der Flieger nicht mal geborgen. Es tut mir leid, Nadja.« Fabrice warf seinen halbvollen Becher in eine Mülltonne und entfernte sich. »Viel zu gefährlich.«
Nadja ließ ihn ein paar Schritte gehen und rief ihm dann trocken hinterher:
»Eine Million Franken, in bar.«
Fabrice blieb stehen.
In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages wurde Francis von einem trommelnden Geräusch geweckt. Ein Sandsturm tobte draußen und ließ die heruntergerissene Plane laut flattern. Sein Arm schmerzte und seine Zunge war an seinem Gaumen angetrocknet. Immerhin vermochte er, im Gegensatz zu gestern, Umrisse des Stolleninneren zu erkennen. Eine dreirädrige umgekippte Draisine lag etwa drei Meter hinter ihm. Holzkisten, die meisten beschädigt oder leer, lagen überall verstreut auf den aufgegebenen Geleisen, die im Zickzack in der Dunkelheit des Stollens verschwanden.
Francis rappelte sich auf. Sein Körper fühlte sich an wie ein rostiges Drahtgestell. Keuchend begann er im Halbdunkel, in den Holzkisten zu wühlen. Tatsächlich fand er eine Flasche und zog sie unter verrosteten Nägeln hervor. Die Flasche war gefüllt mit Sand. Enttäuscht leerte er den Inhalt der Flasche über seine halboffenen Schuhe.
Er wühlte verzweifelt in weiteren Holzkisten und verletzte sich dabei an einer scharfen Metallkante. Sein Schrei hallte durch den verlassenen Stollen und echote tief im Inneren des Berges. Das Echo belustigte ihn und er begann, laut zu lachen. Mehr als eine Minute lang lachte er wie in Trance in den Berg hinein und als er sich erschöpft zu Boden fallen ließ, hörte er gefühlte Minuten lang sein eigenes Lachen, dessen Echo sich wie ein Virus im Berg ausbreitete und schließlich von der Tiefe des Stollens verschluckt wurde.
Abermals fiel er in einen merkwürdigen Halbschlaf. Das Flattern der vom Wind traktierten Plane wirkte halluzinierend auf ihn. Und während er diesem trommelnden Geräusch eine Weile zuhörte, schien es sich langsam, aber stetig zu entfernen. Francis glitt erschöpft dahin und ergab sich seinem nahenden Schlaf. Er war bereit für seine letzte Reise. Die Plane und der Wind wurden leiser und verstummten allmählich.
3
Als im November 2011 das Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen BFU in die Unfalluntersuchungsstelle UUS eingegliedert und zur schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wurde, erhielt Stefan Lorentz die Leitung des Untersuchungsdienstes Bereich Aviatik. Sämtliche Zwischenfälle und Unfälle im Schweizer Luftraum lagen in seiner Zuständigkeit. Lorentz erhielt den Anruf kurz nach 6 Uhr und befand sich bereits auf dem Weg ins Unfallgebiet.
Vom Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL hatte er soeben erste Informationen über die verunglückte Maschine erhalten. Das Flugzeug, eine in der Schweiz registrierte Challenger 604, war auf dem Weg von Dakar, Senegal nach Basel. Besitzerin der Maschine war die Genfer Luxusgüterfirma Provaxis. An Bord waren zwei Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Die Namen waren noch nicht mitgeteilt worden.
Seepolizei und örtliche Feuerwehren waren bei strömendem Regen bereits auf dem See, um nach Überlebenden und Trümmern zu suchen. Außerdem musste ein aufgekommener Ölteppich mit einer Ölsperre davon abgehalten werden, sich weiter über den See auszubreiten.
Lorentz wurde von den örtlichen Behörden empfangen und an die Stelle geführt, von wo aus eine Zeugin aus nächster Nähe beobachtet hatte, wie das Flugzeug in den See stürzte. Ein Notzelt in der Größe einer Doppelgarage bot Ausrüstung und Personal Schutz vor dem heftigen Regen. Unter einem großen Regenschirm ließ sich Lorentz die ungefähre Absturzstelle zeigen. Die Ölsperre war etwa 200 Meter weiter nördlich kreisförmig angelegt worden und trieb langsam weiter von ihnen weg.
»Wie tief ist der See dort?«, wollte Lorentz wissen.
»Wir haben 195 Meter gemessen, ganz schön tief.« Gustav Stettler, der Einsatzleiter der örtlichen Polizei, machte eine entsprechende Handbewegung.
»Es gibt einige Trümmer, aber bis jetzt keine Leichen. Laut der Zeugin ist das Flugzeug beim Aufprall auseinandergebrochen und ganz schnell gesunken.«
Lorentz starrte mit leerem Blick auf den See.
»Alles in Ordnung, Herr Lorentz?«
Lorentz schüttelte den Kopf.
»Wir brauchen den Flugdatenschreiber und den Cockpit Voice Recorder, so schnell als möglich. Haben Sie entsprechende Ausrüstung?« Lorentz wusste die Antwort im Voraus.
»Ich fürchte nicht, nein. Unsere Taucher können bis maximal 40 Meter arbeiten. Wir sind daran, einen Tauchroboter aufzutreiben, bis jetzt leider ohne Erfolg.«
»Ist die Zeugin noch hier?«
»Nein, aber das Protokoll der Einvernahme ist im Zelt, dort gibt es auch Kaffee, kommen Sie.«
Lorentz verblieb noch einen Moment mit dem gleichen leeren Blick auf das Wasser wie zuvor und folgte danach Stettler ins Zelt. Erstaunlich schnell hatten die Einsatzkräfte ein gut funktionierendes Dispositiv aufgebaut. Nur wenige Stunden nach dem Unfall beherrschten organisierte Abläufe ohne jegliche Hektik das Geschehen, als würde das Zelt schon seit Tagen stehen. Das Notfallszenario, durchgespielt in unzähligen Katastrophenübungen, schien Früchte zu tragen. In einer freien Ecke des Zeltes installierte Lorentz seinen Laptop. Er kontrollierte seine Mails und fand, worauf er gewartet hatte. Eine Nachricht vom BAZL mit den Namen der Crew und der Passagiere:
Ms. Dakota Reyes – Commander
Mr. Ron Doyle – First Officer
Mrs. Franziska Berger – Flight attendant
Mr. Christoph Zeidler – Pax
Mr. Boris Kaufmann – Pax
Total Crew + Pax: 5
Eine weitere Nachricht bestätigte das Eintreffen weiterer Spezialisten des SUST mit geeignetem Equipment für die Ortung von Voice Recorder und Blackbox, dem Flugdatenschreiber.
*
Fabrice hatte sich das Wochenende ganz anders vorgestellt. Er hätte sich ohrfeigen können, sich auf so einen verrückten Deal einzulassen. Zumal ihm Nadja noch immer nicht preisgeben wollte, wonach sie im Flugzeugwrack suchen sollten. Aber eine Million in bar war einfach zu verlockend.
Aus den Nachrichten hatte man inzwischen die exakte Tiefe des Wracks erfahren. Fabrice hatte bereits zwei Mitglieder seines Teams an den See geschickt, um einen geeigneten Platz für die Wasserung vom »Amphitrite«, ihres Klein-Unterseebootes, benannt nach einer Meernymphe der griechischen Mythologie, zu suchen. Ein Zwei-Mann-Gefährt in der Größe eines Kleinwagens mit einer Druckschleuse und kompletter Helmtaucherausrüstung für Arbeiten bis 200 Meter Tiefe.
Was Fabrice große Sorgen machte, war der unsichere Untergrund, auf welchem sich das Wrack möglicherweise befand. Unmengen entsorgter Munition der Armee lagerten auf dem Grund des Sees, lediglich mit etwa 25 Zentimetern Seegrund bedeckt, der sich in den letzten 50 Jahren auf natürliche Weise über die entsorgte Ware gelegt hatte. Munitionsabfälle, Granaten und Fehlchargen, die zwischen 1940 und 1960 in der Munitionsfabrik Altdorf produziert worden waren. Was, wenn etwas davon gefährlich freigelegt worden war durch den Aufprall des Wracks auf dem Boden des Sees? Sie müssten mit äußerster Vorsicht arbeiten. Fabrice hatte keine Lust, auf einen Blindgänger zu treten, um dort unten in die Luft zu fliegen.
Die Armee hatte vor Jahren überlegt, die Munition zu bergen. Da die Bergung aber als zu langwierig und zu gefährlich eingeschätzt wurde, hatte man darauf verzichtet. Die Angelegenheit war höchst umstritten. Hatte man doch Fische, vor allem Felchen, mit deformierten Geschlechtsorganen gefunden. Umweltschützer machten postwendend die entsorgte Munition dafür verantwortlich, was aber nie bewiesen werden konnte. Die Armee machte unzählige Wasser- und Bodenproben und fand keinen Hinweis auf Spuren, die auf die entsorgten Waffen hindeuteten. Schließlich wurde die Angelegenheit mit dem Versprechen, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, ruhen gelassen. Neben dem Urnersee waren in zahlreichen weiteren Seen in der Schweiz Unmengen von Militärabfällen entsorgt worden. Fast 5.000 Tonnen allein im Thunersee, im Walensee wurden nach dem Zweiten Weltkrieg einige Hundert Maschinengewehre der deutschen Wehrmacht versenkt.
Nadja wollte bei der Aktion dabei sein. Fabrice und der Rest seines Teams bereiteten den Transport des Unterseebootes vor. Dazu waren zwei Lastwagen erforderlich. Außerdem musste eine geeignete Stelle am See für die Wasserung von »Amphitrite« gefunden werden, von welcher aus eine Verbindung zwischen dem Unterseeboot und der Oberfläche möglich war. Das größte Problem dabei war eine Seesperre um das Wrack herum, welche von der Seepolizei und der Feuerwehr mit Sicherheit aufgebaut worden war, um Schaulustige und Presse auf Distanz zu halten. Sie mussten also damit rechnen, da unten völlig auf sich allein gestellt zu sein.
Es musste etwas unglaublich Kostbares sein, was Nadja unbedingt haben musste und was einen Wert für sie hatte, jenseits der Million, die sie ihm für die Bergung angeboten hatte. Unter höchstmöglichem Zeitdruck hatte Fabrice einen Tauchgang für die Nacht zum kommenden Dienstag in Aussicht gestellt. Es blieben ihnen also nur drei Tage.
Der Wüstenskorpion hinterließ eine zickzackförmige Spur im feinen Sand und befand sich etwa zehn Zentimeter vor Francis’ Gesicht, als dieser seine Augen aufschlug. Zwar realisierte Francis die Gefahr, war aber unfähig, auch nur seine Hand zu bewegen. Die Kraft reichte einfach nicht dazu. So betete Francis zu Gott, als der Skorpion seinen giftigen Schwanz an seinem Gesicht vorbeiwedelte. Als er das Wüstentier aus seinem Blickwinkel verlor, bemerkte er, dass der Wind und die Plane verstummt waren. Ein anderes Geräusch war zu hören, ein rettendes. Etwas, was vermutlich auch den Skorpion angezogen hatte.
Wasser.
Ganz leise und weit hinten in der Dunkelheit war das Tropfen von Wasser zu hören. Wassertropfen, die in eine Pfütze zu fallen schienen. Wasser bedeutete Leben. Francis versuchte, Kräfte zu sammeln. Er bewegte seine Arme und Beine und begann, kräftiger zu atmen.
Wären doch nur Streichhölzer in den zahllosen Holzkisten. Nur ein einziges. So aber musste er hinein in die Dunkelheit kriechen. Er folgte seinem Feind, dem Skorpion, dessen Schlängelspur sich vor ihm in der Dunkelheit verlor. Entweder würde er verdursten oder der Skorpion würde ihm einen tödlichen Giftstich versetzen.
Meter für Meter kroch Francis der Dunkelheit entgegen. Näher und näher kam er dem rettenden Geräusch des Wassers. Er beschloss, weiter nach rechts zu kriechen, da sich die Spur des Skorpions eher auf der linken Seite des Stollens in der Dunkelheit verlor. Mit seiner unverletzten Hand zog er sich die Schiene entlang, auf welcher noch vor wenigen Wochen oder Monaten die Draisinen, beladen mit diamantgeschwängerter Erde, fuhren.
Der Boden unter ihm wurde kühler. Es ging in den Berg hinein. Das Tageslicht war nur noch als dunkelgrauer Schimmer wahrnehmbar.
Francis vermutete das tropfende Geräusch noch weiter rechts und rollte sich über die rechte Schiene. Dabei wurde er von abfallendem Gelände überrascht und er verlor seinen Halt. Ungeschützt rutschte er in einen abfallenden Seitenstollen und wurde rasch schneller. Er überschlug sich zweimal, bis sein Körper in ein knöcheltiefes Wasserloch hineinrutschte. Verzweifelt suchte er, sich zu orientieren. Aber er war in völliger Dunkelheit. Das Einzige, was jetzt zu tun war, war trinken.
4
Frank Studer von der Mordkommission Luzern verbrachte den Samstag mit seiner neuen Nachbarin in den weitläufigen Hallen eines schwedischen Möbelhauses. Sie hatte ihn beinahe angefleht, ihr beim Transport und beim Aufstellen des Kleiderschrankes und des Bettes zu helfen. Da Studer nichts mehr hasste als Einkaufszentren und Möbelhäuser, zwangen ihn schließlich ihr Charme und ihre rehbraunen Augen in die Knie. Seine Nachbarin, eine Flugbegleiterin mit dem klingenden Namen Amanda Duval, hatte extra für diesen Samstag einen Lieferwagen für den Möbeltransport angemietet, inklusive Studer als Fahrer und Träger. Was Studer nicht ahnen konnte, waren die Unmengen an Accessoires, die an der Verladerampe ebenfalls zum Abtransport bereitstanden. Als Studer vor den bedrohlich hohen Türmen mit Schachteln stand, rechnete er sich aus, wie oft er zu Hause in den vierten Stock steigen musste mit all dem Zeug. Amanda hatte sich von ihrem Freund vor Kurzem getrennt und hatte nur sehr wenige Möbel in ihrem Besitz.
»Ich dachte ein Bett und ein Schrank, Amanda. Wo willst du denn all die Sachen hinstellen? Bleibt ein Teil davon im Keller?« Studer erhoffte sich mit seiner letzten Bemerkung, einen kürzeren Transportweg für zumindest einen Teil der Fracht zu erwirken.
»Aber nicht doch, nein. Es hat alles seinen Platz, du wirst schon sehen. Und hab noch einmal lieben Dank, dass du mir die Möbel zusammenbaust, während ich arbeiten gehe.« Studer hatte ihr das in seinem jugendlichen Leichtsinn versprochen. Amanda war für eine Fernost Rotation eingeteilt und daher von Sonntag bis Mittwoch abwesend. Genügend Zeit also, um ihr alles fertig zusammenzubauen.
»Hast du es schon gehört, Amanda? Da ist ein Flugzeug in den Urnersee gestürzt.«
Traurig nickte Amanda. Die Frage schien ihm auf einmal taktlos in Anbetracht ihres Berufes. Und so wechselte er rasch das Thema.
»Heute regnet es wohl nur einmal.« Schwere Tropfen prasselten auf das Dach ihres Transporters. Schachtel um Schachtel trugen sie in den Lieferwagen. Vor ihrem Haus hatten sie einen Parkplatz abgesperrt, damit sie nur ein paar Schritte durch den Regen mussten.
»Wir könnten warten, bis es etwas nachlässt zu regnen.« Ein weiterer Versuch von Studer, sich wenigstens noch eine Weile vor der Schlepperei zu drücken, schlug fehl.
»Es regnet nur einmal heute, hast du selbst gesagt, gerade eben.« Regenwetter nun auch in Studers Gesicht. Er umrundete den Lieferwagen und schwang sich in den Laderaum. Schon die paar Schritte reichten aus, um ihn zu durchnässen. Es schienen nicht nur Tropfen, sondern ganze Fäden aus Wasser vom Himmel zu fallen. Nach zwei Stunden fühlte sich Studer wie ein Sherpa auf dem Weg ins K2 Basislager. Die Beine wurden schwer und sauer. Nach drei Stunden war alles in der Wohnung, der Transporter leer und Studer durchnässt und fix und fertig. Amanda drückte ihm einen Kuss auf die Wange und bedankte sich.
»Komm zu mir runter, wenn du etwas Trockenes angezogen hast. Dann lade ich dich auf eine Pizza ein.« Der Einladung folgte ein zweiter Kuss auf die andere Wange.
*
Studer hatte einen Bärenhunger. Sie ließen sich die Pizza bringen und Studer trank einen ausgezeichneten Primitivo dazu. Sie hatten Mühe, in der mit Schachteln zugestellten Wohnung einen geeigneten Platz zum Essen zu finden, und so schlug Studer vor, die Pizza bei sich zu essen. Amanda hatte ihm zuvor erklärt, wie und wo sie die Möbel aufgestellt haben mochte. Es war Abend geworden und der Regen hielt unvermindert an, als hätte der Himmel seine Schleusen geöffnet. Kurz nach 20 Uhr stand sein Chef Ernst Wenziker mit versteinerter Miene vor seiner Türe.
»Ich nehme an, Sie haben vom Flugzeugabsturz im Urnersee gehört?«
Studer bejahte.
»Sie müssen hinfahren. Wir werden ermitteln.« Studer brachte seine Verwunderung zum Ausdruck. Es klingelte erneut an der Türe. Es war Amanda. Sie drückte ihm eine Schachtel Pralinen und die Wohnungsschlüssel in die Hände und verabschiedete sich bis Mittwoch. Ihr Wohnungsschlüssel war an einem originellen Handschellen-Schlüsselanhänger angehängt. Neidisch musste Wenziker zusehen, wie sie Studer drückte und zum Abschied auf die Wangen küsste.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie in einer Beziehung sind. Wer ist die Kleine? Sie ist hübsch.« Studer hüstelte.
»Meine neue Nachbarin, Amanda.« Eilig wollte Studer auf das eigentliche Thema zurückkommen.
»Warum wir? Die Mordkommission? Ein Flugzeugabsturz wird doch normalerweise vom BFU untersucht. Ich wüsste nicht, was wir dort ausrichten könnten.«
»Seit 2011 nennt sich die Behörde SUST, nicht mehr BFU. Die haben eine Leiche gefunden. Die Pilotin. Sie wurde ans Ufer gespült.«
»Das ist zwar tragisch, aber bei einem Flugzeugabsturz gibt es meistens Leichen. Und wir sind die Mordkommission, also …«
Wenziker fuhr ihm ins Wort.
»Aber die Pilotin hat eine Kugel im Kopf, Studer.«
Studer raufte sich das Haar.
»Wer erschießt schon seine eigene Pilotin während des Fluges?«
»Ihre Aufgabe, das herauszufinden.«
Regungslos saß Francis auf dem feuchtkalten Boden und horchte auf die Wassertropfen, die im Gleichtakt in die Pfütze fielen. Bauchschmerzen plagten ihn, die es ihm unmöglich machten, sich zu strecken.
Er starrte in die Dunkelheit, ohne die geringste Kontur zu erkennen. Lediglich seine nächste Umgebung tastete er ab. Nichts als feuchte Erde. Irgendwann, dachte er, würde jemand sein Skelett hier unten entdecken. Wenn er Glück hatte, bevor er zu Staub verfallen war.
Sein Kopf war leer und gedankenlos. Mit jedem Pulsschlag pochten seine Wunden und seine vom faulen Wasser vergifteten Gedärme stachen und krampften. Er verlor das Zeitgefühl und war orientierungslos. Oben wurde zu unten, vorne zu hinten, links zu rechts. Mit letztem Lebenswillen durchkämmte er auf allen vieren seine Umgebung. Mit seinen Händen tastete er nach Wänden und nach der Decke. Er tat dies so lange, bis er sich im Kopf eine Art Zeichnung seiner Umgebung angelegt hatte.
Die Öffnung, durch die er rutschte, befand sich links von ihm. Dort war der Raum hoch genug, um aufzustehen. Seine Bauchschmerzen zwangen ihn aber sofort wieder in die Knie. Weiter rechts war die Decke tief. Er schätzte die Raumhöhe dort auf etwa einen Meter. Allmählich hatte er sich an den mörderischen Gestank des Wassers gewöhnt. Er nahm ihn nicht mehr wahr. So beschloss er, in die Richtung zu kriechen, wo die Decke tiefer lag und die Erde unter ihm langsam abtrocknete. Die Raumhöhe hatte wieder zugenommen und das tropfende Geräusch entfernte sich.
Schließlich stieß sein Kopf auf etwas Hartes. Seine Hände tasteten das Hindernis rundum ab. Er befand sich vor einem Holzfass. Vorsichtig befühlte er den Inhalt. Kleine Holzkistchen und eine Ledertasche mit einem Riemen entnahm er dem Fass, legte die Gegenstände vor sich hin und richtete seine Blicke auf sie, obwohl er sie gar nicht sehen konnte in der Dunkelheit.
Er schüttelte die kleinen Holzkästchen und suchte nach dem Verschluss, um das erste Kästchen zu öffnen. Aufgewickelter Draht und ein kleiner dünner Strick befanden sich darin. Im zweiten Kästchen ein Stück Seife und eine kleine Bürste. Das dritte Holzkästchen enthielt Nieten und Nägel. Es blieb noch die Ledertasche. Er öffnete den Knopfverschluss und klappte die Tasche auf. Seine Hand umfasste eine kleine Schachtel, die sich aufschieben ließ. Eine Streichholzschachtel. Er schüttelte die kleine Schachtel vorsichtig. Tatsächlich befanden sich drei Streichhölzer darin. Er war vielleicht gerettet.
*
Neben der Streichholzschachtel befand sich in der Ledertasche ein kleines Buch. Sorgfältig bereitete er eine kleine Feuerstelle vor, indem er jede einzelne Seite des Buches herausriss und zusammenknüllte. Er plante, ein kleines Feuer zu entfachen, das ihm ermöglichte, seine Umgebung zu erkunden und nach einem Ausweg zu suchen.
Einen Stofffetzen, der sich ebenfalls im Fass befand, wickelte er um eine dünne Holzlatte, über die er gestolpert war. Dann wickelte er den Draht um den Stoff zu einer primitiven Fackel. Sobald er Feuer hatte, konnte er seine Umgebung nach weiteren brennbaren Gegenständen absuchen, um das Feuer möglichst lange zu erhalten. Dies würde ihm ermöglichen, seine Fackel zu verbessern, mit welcher er den Ausgang suchen wollte.
Der große Moment kam und Francis entfachte sein erstes Streichholz. Ein Lichtschweif entstand und das Streichholz zerbrach. Ein kurzes Aufflackern, das ihn blendete, wich erneuter Dunkelheit. Noch zwei Hölzer. Zitternd entnahm er das zweite Streichholz. Er griff es etwas weiter beim Schwefelkopf und übte das Entfachen, ohne an der Zündfläche zu reiben.