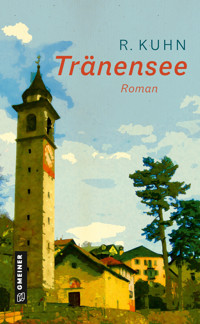
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Ich wusste, dass mein Mann tot war. Ich kann nicht sagen, woher, ich wusste es einfach. Ich wusste auch, dass Broch und ich kein Sirenengeheul, kein modernes Lebensrettungsgetue, keine Intensivstation und kein Sauerstoffzelt wollten, keine Herzmassage und am Ende trotz allem nur den Würdeverlust. Deshalb unternahm ich nichts. Kurze Zeit stand ich ratlos im Zimmer, dann ging ich wieder ins Bett und legte mich zu meinem Mann.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
R. Kuhn
Tränensee
Roman
Zum Buch
»Du hast dir das Meer in die Augen gegossen und in meine Brust einen Schmerz.«
Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes, eines bekannten Schriftstellers, zieht sich seine Witwe Anna in ihr Ferienhaus im Tessin zurück. Dort versucht sie mit dem Schmerz zurechtzukommen – und mit der Einsamkeit. Halt findet sie nur in der Arbeit am Nachlass ihres Mannes. Der einzige Mensch, den sie sieht, ist ein alter Bauer. Bis sie eines Tages im Dorfladen einen jungen Journalisten kennenlernt, sich auf eine kurze Affäre mit ihm ein- und ihn ebenso schnell wieder ziehen lässt.
Ein halbes Jahr später taucht Cellini, Inspektor von der Kriminalpolizei in Bellinzona, bei Anna auf. Er sucht den Journalisten, der vor Wochen spurlos verschwand. Cellini verdächtigt sie. Fast süchtig nach seiner Aufmerksamkeit hält Anna ihn hin und auch Cellini scheint Gefallen an diesem Spiel zu finden. So entrollt sich durch seine Befragungen immer mehr von Annas Leben. Ein intimes Zwiegespräch über das Leben, den Tod – und die Liebe.
Roswitha Kuhn studierte in Graz und in Zagreb Slawistik und Germanistik. Als Bibliothekarin arbeitete sie in Graz und Wien sowie am Tibet-Institut Rikon, wohin sie eine vorausgegangene Tibet-Reise führte. Dort lernte sie ihren Mann Jacques kennen. Nach einer späten Heirat wagte sie sich in die Gefilde der Literatur. Gemeinsam mit ihrem Mann schrieb sie, bis zu seinem Tod im Jahr 2016, Tösstal-Krimis. Sie lebt in Rikon und Zürich.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung einer Illustration von: © Lutz Eberle
ISBN 978-3-8392-7926-7
Gedicht
»Du hast dir das Meer in die Augen gegossen und in meine Brust einen Schmerz.«
1. Teil
1
Da sitze ich jetzt im Bus und fahre nach Berzona, obwohl ich mir geschworen habe, in meinem Leben keinen Fuß mehr in diesen Ort zu setzen. Der Grund, warum ich trotzdem hier unterwegs bin, liegt in der Nachricht, die ich vor einigen Tagen erhalten habe. Cellini ist gestorben. Und man hat mir eine Todesanzeige geschickt. Offenbar war es sein Wunsch, dass ich zur Beerdigung komme. Sie ist für den nächsten Tag in Cavigliano angesetzt.
Wie früher nehme ich bis Cavigliano die Centovallibahn. Zu meiner Enttäuschung rattert und scheppert sie jetzt durch einen finsteren Tunnel, dessen Widerhall ihren Lärm vervielfacht, und die Stationen sind verschmiert mit Graffiti. Erst bei San Martino kommt sie wieder ans Licht. Aber auch die alte Strecke ab Ponte Brolla scheint mir enger geworden, vermutlich weil die vielen neuen Häuser nahe an die Bahnlinie gerückt sind.
In Cavigliano finde ich mich nicht mehr zurecht. Solang ich mich erinnern kann, war die Busstation direkt auf dem Bahnhofplatz. Doch jetzt hält hier nur der Schulbus. Gleich bei der Kirche steht ein Neubau, in dem die Casa Communale, eine Bar sowie eine Schule untergebracht sind. Schräg gegenüber gibt es einen kleinen Park und eine weitere Schule. Neben all diesen Neubauten wirkt die alte Kirche, als wäre sie geschrumpft. Ich frage ratlos einen Mann, der bei offenem Seitenfenster in seinem Auto sitzt, wo der Bus ins Onsernonetal abfährt. Nach seinen Angaben haste ich dann die schmale Gasse hinauf, die zwischen alten Häusern zur Kantonsstraße führt. Bei den einen bestehen die Mauern noch aus den ursprünglichen Steinen, die anderen sind grau verputzt. Hinter einer Wand aus Granit versteckt sehe ich einen modernen weißen Neubau. Oben wechseln alte und neue Häuser ab. Ich gehe eilig an ihnen entlang bis zur Haltestelle bei der Kreuzung. Tatsächlich kommt der Bus von Intragna her schon nach wenigen Minuten. Er ist voll besetzt mit Wanderern, die hier unterwegs sind, ihren Riesenrucksäcken, Kindern, Hunden und Walkingstöcken. Ich finde noch einen Fensterplatz, setze mich und schaue hinaus in das unendlich zarte, frühlingshafte Grün, das die dicken Falten der Berghänge überzieht. Ich sehe es und sehe es nicht, denn vor meinem inneren Auge ist Cellinis Gesicht aufgetaucht, überraschend nah nach so vielen Jahren und immer noch fremd.
Bevor Cellini auf der Bildfläche erschien, war schon ein Gendarm vorbeigekommen. Die Haselstauden blühten, und jedes Mal, wenn ein Windhauch sie streifte, zogen Pollenwolken über die Wiese. Ich notierte mir gerade, welche Pflanzen ich in Locarno für meinen neuen Garten kaufen wollte, als es an der Haustür klingelte. Das war ungewöhnlich, denn die meisten Besucher gingen um das Haus herum und klopften an die Terrassentür.
Der junge Mann hatte ein schmales, langes Gesicht und den Körperbau eines Knaben. Wegen der Hitze trug er die Uniformjacke offen. Ich führte ihn auf die Terrasse und setzte ihn in einen Korbstuhl unter dem Sonnenschirm. Er stülpte seine Mütze über das Knie. Ich kochte Kaffee. Wir redeten italienisch. Der Junge bemühte sich um eine deutliche Aussprache. Ich freute mich, dass ich ihn verstand und mich auch selbst in dieser Sprache einigermaßen mitteilen konnte. Früher hatte ich das Reden stets Broch überlassen. Ich fragte den jungen Mann nach seiner Familie. Er stammte aus Losone und hatte drei Geschwister. Ihm war es nach dem Militär als Einzigem gelungen, einen anderen Job zu bekommen als auf dem Bau. Der Vater arbeitete jeden Sommer als Kellner in Ascona.
Der Gendarm trank den Kaffee mit geschlossenen Augen. Dann stellte er die Tasse ab, leckte den Schaum von der Oberlippe, seufzte, sah mich an. »Kennen Sie zufällig einen Herrn Casanova?«, fragte er.
»Ja.«
»Woher?«
»Aus dem Dorf«, sagte ich.
»Hat er bei Ihnen gewohnt?«
»Nur kurz«, sagte ich und setzte in einer plötzlichen Eingebung hinzu: »Aber er hat hier etwas vergessen.« Ich sprang auf, holte Frieders Rucksack. Er hing nach wie vor noch an demselben Garderobehaken, wohin ich ihn vor Monaten gehängt hatte. Jetzt nahm ich ihn und stellte ihn vor den Jungen hin.
Der Gendarm beugte sich in seinem Sessel vor, nestelte an der Schnur, die den Sack verschloss.
Herr Casanova, erklärte ich, sei beruflich im Dorf gewesen.
»Und dann?«, fragte der Gendarm.
»Ist er wieder abgereist. Ist schon eine Weile her.«
Endlich hatte er den Knoten geöffnet, tauchte mit der Hand hinein, schnaufte hörbar und zog die Pistole heraus. »Signora«, sagte er.
»Die gehört Herrn Casanova.«
»Und er hat nie nach seinem Rucksack gefragt?«, erkundigte sich der junge Gendarm ratlos.
»Nein.«
Ungläubig sah er mich an und hielt die Waffe hoch.
Irgendetwas, dachte ich, muss ich jetzt sagen. Fragte ich mich doch selbst, woher Frieder sie hatte.
»Vielleicht«, begann ich, »hat er sich bedroht gefühlt.«
»Was hat Herr Casanova hier gemacht?«, fragte der Gendarm.
»Er hat über die unbewilligte Mülldeponie recherchiert.«
Oh ja, das ist sehr gut, dachte ich. Das passt. Und listig setzte ich hinzu: »Bitte behandeln Sie das vertraulich. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das überhaupt sagen dürfte. Solche Dinge sind meist heikel. Da geht es um Politik.«
Der junge Mann war so naiv, wie er aussah. Er fühlte sich sofort unbehaglich, blickte mich unsicher an. Er schwitzte. Eifrig kramte er im Rucksack. Ich wusste, er würde weiter nichts finden als Frieders glänzend rote Turnhose.
»Sie können die Sachen mitnehmen«, bot ich ihm an, »wenn Sie mir eine Quittung dafür ausstellen.«
Der Gendarm hatte keine Ahnung, was er tun sollte.
»Warum interessieren Sie sich überhaupt für Herrn Casanova?«, fragte ich.
Ja, wenn man das wüsste. Aus Bellinzona sei der Auftrag eingegangen.
»Und da kommen Sie ausgerechnet zu mir?«
Er hob die Schultern, lachte, sah mich zweifelnd an, kramte sein Notizbuch aus dem Hosensack, kritzelte eine Empfangsbestätigung auf Italienisch, die ich nur zum Teil lesen konnte. Dann schraubte er sich aus dem Sessel hoch, drückte mir die Hand, dankte für den Kaffee und verschwand um die Hausecke. Den Rucksack nahm er mit.
Als Cellini dann das erste Mal nach Berzona kam, war der Pollenflug vorbei und an den Stauden zeigten sich bereits winzige grüne Haselnüsse.
Ich stand in der Halle unseres Hauses. Vor mir auf dem Tisch lagen einige von Brochs Büchern. Ich nahm das oberste zur Hand. Eine Seite war leicht verschnitten. Behutsam riss ich die vorstehende Ecke ab, rieb sie zwischen den Fingern und sah, wie das winzige Stück Papier im Sonnenlicht zu Boden flatterte. Für den Bruchteil einer Sekunde durchströmte mich ein unbeschreibliches Gefühl – Euphorie, Gleichgültigkeit, Staunen.
Ein Schatten fiel in die offene Terrassentür.
»Ercole Cellini von der Kriminalpolizei Bellinzona«, stellte er sich vor.
Der Bus hält in Auressio. Hier steigen ein paar ältere Leute aus, vermutlich Einheimische. Die Jungen haben heutzutage ein Auto. Wie in allen Dörfern hier im Tal sind die Häuser den Hang hinauf gebaut. Ganz oben thront die Kirche. Darüber sieht man den dunklen Nadelwald, und über ihm stechen kahle Felsenberge in den Himmel.
Die Touristen verlassen den Bus erst in Loco, um die alte Mühle zu besichtigen. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert, wurde inzwischen restauriert und als Touristenattraktion wieder in Betrieb genommen.
Bei der Weiterfahrt bin ich beinahe allein im Bus. Der nächste Halt ist schon Berzona.
Anders als der Gendarm, welcher Uniform getragen hatte, war Cellini in Zivil. Ich schätzte sein Alter zwischen 40 und 50. Er war klein, stämmig, trug das Haar sehr kurz und hatte einen runden Kopf. Sein Gesicht war gebräunt, der Mund wie ein Strich zwischen die Wangen geschnitten.
Er hatte eine dünne dunkelblaue Windjacke über die Schulter geworfen. Das Hemd stand am Hals offen. Die Manschetten hingen ihm aufgeknöpft fast bis an die Fingerspitzen, was sich seltsam ausnahm. Und seine Hosen waren zu lang.
Auch ihn lud ich zum Kaffee ein.
Anders als der Junge, der seine Mütze auf den Knien behalten hatte, legte Cellini seinen Hut auf den Tisch. Dann krempelte er bedächtig die Ärmel hoch.
Wir sprachen deutsch. Er nahm drei Löffel Zucker und trank, gierig, wie mir schien. Trotzdem war er kein ungehobelter Mensch.
»Kennen Sie Friedrich Casanova?«, fragte er.
»Ja.«
»Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?«
»Das habe ich bereits Ihrem jungen Mann erzählt, der mich vor einiger Zeit besucht hat. Daher weiß ich es noch, es war Ende Oktober vorigen Jahres.«
»Wie stehen Sie zu ihm?«
Ich hob die Augenbrauen. Dann sagte ich langsam: »Gar nicht.«
Cellinis Gesicht blieb unbewegt. »Er hat bei Ihnen gewohnt?«
»Kurz.«
»Wieso?«
»Es gab im Dorf keine andere Unterkunft. Er hat über die wilde Deponie im Wald recherchiert. Friedrich Casanova war Journalist.«
»Wieso war«, hakte Cellini nach, bevor ich meinen Fehler bemerkte. Doch ich besserte ihn aus, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. »Keine Ahnung, was er jetzt macht. Frieder wechselt häufig seine Jobs. Und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm.«
»Ah ja.« Der Polizist lehnte sich zurück, ließ den Blick über das Panorama schweifen, trank einen Schluck. Dann sagte er zu meiner Überraschung, er sei ein großer Bewunderer meines Mannes.
»Danke«, sagte ich, ohne zu wissen, warum. Ich wunderte mich, dass ein Tessiner Polizist Broch kennen sollte, denn seine Bücher sind nie ins Italienische übersetzt worden.
Wir schwiegen eine Weile, bis Cellini sich behutsam erkundigte, woran Broch gestorben sei.
»An einem Gehirnschlag, steht auf dem Totenschein«, antwortete ich. Die überraschende Anteilnahme tat mir gut. Gleichzeitig fragte ich mich, ob es sich dabei nur um vertrauensbildende Maßnahmen handelte.
2
Broch starb völlig unerwartet an einem Dienstag in seinem 58. Jahr. Ich erwachte durch ein Geräusch, von dem ich nicht weiß, was es war. Das heißt, ich glaube, ich erwachte, weil ich seinen Atem nicht mehr hörte. Heute, wo sich in jedem Haus ein Defibrillator befindet, hätte man ihn sicher reanimiert, doch damals, vor 40 Jahren, war das keine Option. Ich griff nach ihm. Er war noch warm. Ich überlegte, ob ich einen Krankenwagen holen sollte.
Ich wusste, dass mein Mann tot war. Ich kann nicht sagen, woher, ich wusste es einfach. Ich wusste auch, dass Broch und ich kein Sirenengeheul, kein modernes Lebensrettungsgetue, keine Intensivstation und kein Sauerstoffzelt wollten, keine Herzmassage und am Ende trotz allem nur den Würdeverlust. Deshalb unternahm ich nichts. Kurze Zeit stand ich ratlos im Zimmer, dann ging ich wieder zu Bett und legte mich auf meinen Mann, der langsam unter mir auskühlte. Gegen Morgen rief ich unseren Hausarzt an, sagte, dass Broch gestorben sei. Ich ging ins Bad und zog mich schnell an. Noch bevor ich fertig war, kam er schon die Treppe heraufgehastet. Unser Haus war alt, es besaß keinen Lift.
Der Arzt untersuchte Broch nur flüchtig. »Er hat nicht gelitten«, sagte er zu mir.
Er schrieb auf den Totenschein: Gehirnschlag. Von unserem Telefon rief er die Bestattung an, damit sie die Leiche holen kämen. Während des kurzen Gesprächs musterte er mich besorgt.
»Wollen Sie eine Beruhigungsspritze?«, fragte er mich dann.
»Nein«, sagte ich.
»Sie müssen jetzt tapfer sein«, sagte er zu mir, und ich antwortete: »Ja.«
Auf seinen Rat suchte ich schon die Kleider zusammen, die Broch im Sarg tragen sollte, Anzug, Hemd, Krawatte, Unterwäsche und Socken. Noch einmal polierte ich seine schwarzen Schuhe und machte aus allem ein Paket. Währenddessen lag Broch im Schlafzimmer in unserem Bett und rührte sich nicht. Ich ging immer wieder hinein, um nach ihm zu sehen. Der Doktor hatte sich an den Küchentisch gesetzt. Er bat um Kaffee. »Das wird Ihnen guttun«, sagte er, »wir frühstücken zusammen.«
Ich wollte lieber bei Broch bleiben. So brühte ich nur rasch den Kaffee auf, goss dem Doktor und mir eine Tasse ein, dann setzte ich mich im Schlafzimmer auf die Bettkante. Viel Zeit blieb mir nicht, da hörte ich sie schon die Treppe heraufpoltern. Ich ging an die Tür, ihnen zu öffnen. Im Flur stand die Nachbarin und fragte mich händeringend: »Um Gottes willen, Frau Broch, was ist passiert?«
»Mein Mann ist in der Nacht gestorben«, antwortete ich.
Die Leute von der Bestattung jonglierten etwas, das aussah wie eine Blechbadewanne mit Deckel, durch unsere Wohnungstür.
Ich dachte, dahinein kriegen sie ihn nie. Das Ding ist viel zu klein. Im Vorzimmer wies ihnen der Doktor den Weg, ehe ich etwas sagen konnte. Mich ging er an um ein Dokument, das er unbedingt noch brauchte. So musste ich an Brochs Schreibtisch. Natürlich fand ich es nicht gleich. Bis ich plötzlich begriff, dass sie mir in der Zwischenzeit den Mann davontrugen. Da war es schon zu spät. Ich kam gerade noch recht zu sehen, wie sie die Badewanne aus der Tür hoben. So schnell geht das, dachte etwas in mir.
Jetzt schrie ich den Doktor an.
»Wollen Sie nicht doch eine Spritze?«, fragte er.
»Nein!«, schrie ich.
Ich lief den Männern nach, bat sie, ob es nicht möglich wäre, dass ich Broch ankleidete.
Sie sagten: »Nein«, da holte mich schon der Doktor zurück.
Ich riss mich von ihm los. »Lassen Sie mich mit Ihren Spritzen in Ruhe!«, schrie ich.
Er sah mich prüfend an. »Also gut«, sagte er. »Ich muss jetzt weiter. Aber wenn Sie etwas brauchen, Anna, ich bin für Sie da.«
»Danke«, sagte ich.
Er blieb immer noch.
»Haben Sie niemanden, den Sie anrufen können, dass er Ihnen bei den Formalitäten hilft?«
»Doch, doch«, sagte ich schnell.
Ich musste als Erstes den Doktor loswerden, dann würde ich nachdenken, was eigentlich passiert war. Er störte mich dabei.
Als er endlich gegangen war, erwog ich einen Augenblick, James Bodensiehl, den Verleger, anzurufen. Dann läutete es. Die Nachbarin stand vor der Tür und erbot sich, mir bei der Erledigung der Wege behilflich zu sein. Sie war bereits länger Witwe und hatte, wie sie mit einem traurigen Lächeln versicherte, Übung in solchen Dingen, denn im Lauf der Jahre habe sie ihre ganze Familie begraben müssen. Nur ihr Sohn, das einzige Kind, lebe gottlob noch.
Sie war eine dicke Frau, etwas steif in den Hüften. Vor lauter Reden ging ihr auf der Straße dauernd die Luft aus, und sie musste stehen bleiben. Ich fragte sie, ob ich Broch noch einmal sehen könne. Da schaute sie mir mit ihren vorstehenden Augen von nahe ins Gesicht. Sie rate es mir nicht, sagte sie. Man solle die Toten in Erinnerung behalten, wie sie im Leben gewesen seien. Ich dachte, ich will ihn sehr wohl noch einmal sehen, sonst glaube ich nicht, dass er mich sitzen lässt.
So fuhr ich allein mit dem Tram zum Friedhof Nordheim, ging die Straße hinauf in den geräumigen Empfangsraum, von wo mich ein Angestellter zu einer der kleinen gekühlten Kammern führte, in denen die Leichen aufgebahrt lagen. Broch sah genauso aus wie in der Nacht, in der er gestorben war, aber als ich seine Wange berührte, fühlte er sich nicht mehr so an, und als ich die Christrosen, die ich ihm mitgebracht hatte, auf seine Brust legte, war sie steinhart und eiskalt. »Broch …«, stammelte ich fassungslos.
Ich verfügte, ohne zu zögern, über die Einzelheiten der Abdankung, als hätten wir alles vorher besprochen. Wir waren 20 Jahre verheiratet gewesen, hatten Bett und Tisch geteilt, all den Ärger und die Freuden, die einem im Lauf des Lebens begegnen.
Mir kaufte ich für das Begräbnis einen schwarzen Mantel. Als es Zeit war, auf den Friedhof zu gehen, zog ich ihn an.
Die Stadt Zürich stellte damals der Trauerfamilie gratis ein Auto mit Chauffeur zur Verfügung. Ich saß allein hinten in dem großen Wagen. Alle Angebote von Freunden, mich zu begleiten, hatte ich abgelehnt.
Broch und ich hatten keine Verwandtschaft. Dafür waren viele Bekannte gekommen. Man merkte, mein Mann war in den letzten Jahren berühmt geworden. Wir hatten keine Kinder, haben nie welche gewollt. So ging ich allein als Erste hinter dem Sarg. Broch kam in das Grab seiner Familie. Es war sein Wunsch gewesen, beerdigt, nicht kremiert zu werden. Meine Urne würden sie eines Tages dazustellen. Als ich daran dachte, wunderte ich mich flüchtig über meinen Mann. Aber ich hatte keine Zeit, diesem Gedanken nachzuhängen, denn die Zeremonie nahm ihren Fortgang. Der Pfarrer redete, wie es sich gehörte, am offenen Grab. Dann sprachen ein Vertreter der Stadt, der Präsident des Schriftstellerverbandes und Brochs Verleger und Freund, James Bodensiehl. Das hatte ich nicht verhindern können. James weinte. Seinen Bruder Mege und dessen Frau Meri sah ich nicht. Ich blickte mich auch nicht um.
Ich musste den Pfarrer verabschieden, der mit wehendem Talar hinter dem Stein des Nachbargrabes davonging. Vorher hatte ich aus seiner Hand das Schäufelchen genommen und einen kleinen Klumpen Lehm auf den Sarg geworfen, zusammen mit einer Rose, die ich mitgebracht hatte. Dann warfen auch die anderen Anwesenden Erde in das Grab.
Nachher gab es in unserer Wohnung einen Umtrunk für die engere Bekanntschaft. Ich hatte alle Hände voll zu tun, denn das war nicht vorgesehen gewesen. Ich kochte schnell Kaffee und Tee, goss Schnaps in die Gläser. Die Leute standen, sie redeten. Haufen von abgelegten Kleidern türmten sich auf unserem Bett im Schlafzimmer. Hin und wieder benützte jemand sein Taschentuch. Ich hätte nicht einmal Zeit gehabt, das meine hervorzuziehen.
Anschließend ging es zum Leidmahl. Die Stadt hatte es für ihren berühmten Sohn ausgerichtet. Und am späten Nachmittag fand dann noch die Seelenmesse statt. Broch war katholisch gewesen wie sein Vater. Er konvertierte, kaum volljährig, ich vermute, aus Protest gegen den reformierten Rest der Familie.
Ich bin ohne Bekenntnis. Ich finde, was soll eine Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, wenn man nicht glaubt. Broch und ich waren noch an der Uni in Graz, als ich mich entschloss, aus der Kirche auszutreten. Er hielt das im Staatsdienst eines katholischen Landes für keine gute Idee. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, dass ich mich gegen ihn durchgesetzt habe.
Nach dem Leidmahl ging ich endlich allein nach Hause. Ich wusch das Geschirr ab und räumte die Wohnung auf. Eine Zeit lang stand ich am Fenster, dann legte ich mich in unser Bett, das bereits frisch bezogen war. Auf Brochs Nachttisch herrschte das gleiche Chaos von Büchern, Manuskripten und Kram wie zu seinen Lebzeiten. Ich nahm das oberste Buch vom Stapel. Broch hatte darin noch am Abend vor seinem Tod gelesen. Nun schlug ich es beim eingelegten Zeichen auf und las dort weiter, wo er aufgehört hatte. Ich dachte, er würde es gern bis zu Ende kennen, denn er hatte zu mir gesagt, er fände es spannend. Doch nach ein, zwei Seiten legte ich es weg. Ich dachte an meinen Mann, der jetzt in seinem Sarg unter der Erde lag, während ich warm auf seiner Seite im Bett lag und mit einem Ohr ins Treppenhaus nach seinen Schritten horchte. Schließlich schlief ich ein. Mühelos. Ich war noch geduldig.In den 20 Jahren unserer Ehe hatten wir uns nie länger getrennt. Immerhin war es vorgekommen, dass Broch allein auf Lesereise ging. Diese Erfahrung, Zeiten ohne ihn zu überstehen, rettete mich über die ersten Tage, und ich lebte verhältnismäßig bequem auf dem schmalen Grat zwischen Wahrheit und Verweigerung. Die Dinge des täglichen Lebens bedeuteten eine Gefahr. Wie lang man allein an einem kleinen Stück Butter hat …
Lähmend wurde das Leben erst, als mir die Erfahrungen ausgingen. Auch dann litt ich noch nicht. Eher war ich verärgert, machte Broch innerlich bittere Vorwürfe. Was hatte er mir angetan? Er, dem ich felsenfest vertraute. Wozu hatten wir uns früher so oft versichert, wir würden zusammengehören. Für immer. Und jetzt dieser Vertrauensbruch.
Freunde telefonierten, boten ihre Unterstützung an, luden mich ein. Ich lehnte alles ab. Sie begriffen nicht, dass es für mich keine Hilfe gab außer von Broch.
Nur, er kam nicht. Ich wagte mich nicht mehr aus dem Haus, um nicht ihn oder wenigstens seinen Anruf zu versäumen. Immer öfter griff ich zum Telefon. Dann wurde das Leben gefährlich, bis ich den Hörer unverrichteter Dinge aufgelegt und mich wieder mit Warten abgelenkt hatte.
Während ich wartete, beantwortete ich Berge von Beileidschreiben, gewissenhaft, wie ich stets alle Briefe für Broch erledigt hatte. In den letzten Jahren war das eine gewaltige Aufgabe geworden, aber er hasste Fanpost. Ich las mit leerem Hirn die ewig wiederkehrenden Phrasen des Bedauerns, der Trauer und des Trostes, bemühte mich, Brochs Dank in immer neuen Wendungen auszudrücken. Erst allmählich fiel mir auf, dass ich die Briefe schrieb, als wäre ich gestorben.
An diesem Tag ließ ich alles liegen und rannte ins Kaffeehaus. Ich wollte Zeitung lesen. Das hatte Broch leidenschaftlich gern getan, selbst wenn er mitten in der Arbeit an einem Roman steckte. Fast täglich waren wir eine Stunde im Kaffeehaus gesessen. Dort versank er hinter den raschelnden Blättern. Auf dem Tisch stand dampfend Kaffee oder Tee. Ich blätterte in den Illustrierten. Auch Modezeitschriften mochte ich gern. Zeitungen waren so mühsam zu lesen. Außerdem erzählte mir Broch auf dem Heimweg alles, ob ich wollte oder nicht. Das war ein Ritual. Und er erzählte gut. Hatte ich eine Meldung durch Zufall vorher selbst gelesen, staunte ich, wie anders sie sich aus seiner Sicht ausnahm. Viel spannender als auf dem Papier. Broch schuf Zusammenhänge, die mich schaudern ließen. Manchmal hörte ich auch gar nicht hin. Ich hatte gelernt, blindlings an den richtigen Stellen eine Zustimmung zu murmeln. Mehr brauchte er nicht, denn er monologisierte gern.
Als ich zum ersten Mal nach Brochs Tod ins Café ging, las ich nichts. Ich saß nur da, rauchte, trank meinen Kaffee, bestellte gleich darauf noch ein Mineralwasser. Am Fenster bewegten sich Leute vorbei. Zwei Bekannte kamen und kondolierten sowie ein Mann, von dem ich nicht wusste, ob ich ihn je zuvor gesehen hatte. Ich fühlte eigentlich keinen Schmerz, ich hatte noch nicht einmal geweint, außer an der Beerdigung ein wenig, weil sich das so gehört.
Vom Café ging ich nach Haus. Broch war noch immer nicht da. Ich sagte mir, dass er tot sei. Tot, was hieß das schon. Er konnte nicht einfach verschwunden sein. Wäre er lange krank gewesen, hätte ich vielleicht sein Ende für ihn erhofft. Aber Broch war nicht krank, war in den Tagen vorher nicht anders gewesen als sonst. Wie konnte er ohne ein Wort zu mir gestorben sein? Also wartete ich, zunehmend verbittert, aber ruhig. Geradezu infernalisch ruhig wickelte ich mein zierlich und sauber abgezirkeltes Warteleben ab. Ich behielt Brochs Anzüge im Schrank, seine Wäsche, flickte ein Paar von seinen Socken.
Ich hätte gern geweint. Doch so sehr ich auch würgte, drückte und presste, es kamen keine Tränen. Ich warf mich auf den Boden, schlug mit der Stirn dagegen. Broch sollte sehen, was er mir antat. Damit er endlich zurückkam. Denn trotz Friedhofsbesuch, Inschrift und Blumen auf dem Grab konnte mein Mann nicht tot sein. Ich hatte ihm meine Gefühle, meine Kraft, mein Leben geschenkt. Was blieb mir ohne ihn?
Ich weinte nicht. Stattdessen fuhr mir Panik in die Glieder, als ich erkannte, ich trauerte nicht um den Toten, sondern um mich, mein eigenes nutzloses Leben. Nie vorher war mir so klar geworden, wie bedingungslos ich auf Broch vertraute. Jetzt spürte ich mit zunehmender Verzweiflung, er hatte mich unversorgt zurückgelassen.
James Bodensiehl, der Verleger, telefonierte. Besuche hatte ich mir verbeten. Er erkundigte sich nach dem Nachlass.
»Ich weiß nicht«, sagte ich und dachte, was geht mich Brochs Nachlass an. Das soll er selber machen. Wenn er erst wieder da ist. Ich fühlte mich viel eher als verlassene Frau denn als Witwe.
»Anna«, bohrte James, »wie weit kam Broch mit dem neuen Roman?«
»Keine Ahnung«, sagte ich, »ich rühre auf seinem Schreibtisch nichts an.«
Eine Pause entstand. Ich kann mir nicht vorstellen, was in James vorging. Wahrscheinlich hielt er mich für irr. Eilig beendete ich das Gespräch und entschloss mich wieder einmal zu einem Einkauf im Supermarkt um die Ecke. Ich zwang mich dazu. Ich brauchte nicht viel. Aber ich schob meinen Einkaufswagen wie die anderen Hausfrauen. Nichts unterschied mich von ihnen. Ich kleidete mich nicht schwarz. Broch war für mich drei Monate nach seinem Tod noch lange nicht gestorben. Ich liebte ihn. Bedeutete das gar nichts? Der Steinmetz in der Straße beim Friedhof hatte im Garten eine Platte mit der Inschrift stehen: »Die Liebe ist stärker als der Tod.« Ich glaubte daran.
Dass eben diese Liebe dem Steinmetz das Geschäft verschafft, hätte ich damals noch glatt geleugnet.
3
Ein paar Tage nach dem Anruf von James packte ich Brochs Papiere aus dem Schreibtisch in zwei Koffer, stopfte ein paar Sachen für mich in eine Reisetasche. Ich wollte nach Berzona.
Hier haben mein Mann und ich in einem anderen Leben ein Haus besessen.
Das ist immer unser Traum gewesen, wenigstens ein Ziegenstall, aber im Tessin. »Und wäre er so klein«, hat Broch stets gesagt, »dass wir, wenn wir uns zum Schlafen ausstrecken, unsere Füße ins Freie halten müssen.«
Wir hatten lange gesucht und uns dann für diesen Ort entschieden. Der Fremdenverkehr war damals noch nicht bis in den entlegenen Talwinkel gedrungen. Niemand außer uns wollte hier etwas kaufen, die Bodenpreise waren normal, die Dorfstruktur intakt.
Am liebsten hätten wir einen kleinen alten Hof hinter Intragna gekauft. Er stand mit einem einzigen Baum auf einem rechteckigen Stück Wiese. Vor dem Haus lag auf zwei schmalen Terrassen im steilen Hang ein Garten, und um die Lichtung war Wald. Der Makler hatte von solchen Käufen jedoch abgeraten, da die Erbschaftsverhältnisse kompliziert seien. Die meisten Bauern hier hatten Verwandte irgendwo in Amerika. So konnte man nie sicher sein, dass nicht jemand mit berechtigten Ansprüchen auftauchte, wenn man schon bezahlt hatte.
Bei dem Haus in Berzona, auf das unsere Wahl fiel, war die Besitzlage klar. Der Sohn eines Bauern aus dem Dorf hatte es schon in der Absicht zu verkaufen bauen lassen. Bei der Planung hatte der Mann sogar einen Architekten zugezogen. Das Ergebnis war erstaunlich, ein raffiniert schlichtes Gebäude, das sich, obwohl neu und weiß getüncht, mit seinem tief heruntergezogenen, welligen grauen Dach wunderbar in die Landschaft fügte.
Der Bauplan ist einfach. Ich habe ihn auch nach der langen Zeit noch im Kopf. An der Hinterseite befinden sich die Küche sowie eine kleine Dusche mit WC. Dann kommt auf der einen Seite das Gästezimmer, auf der anderen unser Schlafzimmer mit dem Bad und ein Arbeitszimmer für Broch. Die Vorderfront nimmt ein einziger großer Raum ein. Mittelpunkt bildet wie die Achse eines Schneckenhauses ein rundgemauerter Kamin, um den man herumgehen muss, will man in den hinteren Teil des Hauses gelangen. An die Halle schließt, von ihr nur durch eine breite Schiebetür aus Glas getrennt, die Terrasse an.
Das Haus steht abseits auf einem Hügel über dem Dorf. Nur ein schmaler Pfad verbindet es mit dem Gemeindeweg. Auch er wurde selten begangen, denn er führt nirgendshin außer zu einem zwei Stunden entfernten Gehöft und weiter auf eine unsichtbare Bergspitze.
Nachdem wir den Kauf abgeschlossen hatten, übernachteten wir in der Cantina eines Dorfes im Tal. Das Zimmer ging auf die Piazza hinaus und hatte eine Tür zum Balkon, der an der Vorderseite entlangführte. Draußen regnete es in Strömen. Kaum hatten wir unsere nassen Mäntel abgelegt, warf Broch mich voll Übermut aufs Bett und zog mir die Hosen herunter. Mit den Füßen steckte ich noch in meinen schweren Schuhen. Während er mich liebte, sah ich über seine Schulter die Wirtin, die uns, von den Falten des Vorhangs halb verdeckt, durch die offene Tür beobachtete. Ihre runden dunklen Augen stachen aus dem teigigen Gesicht. Ihr Haar war rabenschwarz. Wir wussten, dass sie schon lange Witwe war.
Inzwischen bin ich 75, auch schon lange Witwe und war seit mehr als 30 Jahren nicht mehr hier. Ich habe keine Ahnung, ob der Bus in Berzona noch an derselben Stelle hält wie damals, als ich eingestiegen bin, um zu Cellini auf den Polizeiposten in Bellinzona zu fahren. Ich drücke den Knopf zu spät, und der Bus hält meinetwegen nicht mehr. Ich muss mit bis nach Mosogno fahren, das nächste Dorf. Die früheste Verbindung in die Gegenrichtung geht erst in drei Stunden.Der Chauffeur rät mir zu Autostopp.
Ich entscheide mich für einen Fußmarsch. Die Straße ist schmal und kurvenreich, Gehsteig gibt es keinen. Ich gehe ganz am linken Straßenrand. Hier steigt der Hang steil an, auf der anderen Seite der Fahrbahn geht es ebenso steil hinunter ins Tal.
Niedriger Ginster wächst auf den Felsen, wo sich in Vertiefungen ein wenig Erde angesammelt hat. Seine gelben Blüten leuchten auf dem grauen Stein. Aus den Ritzen sprießen zarte weiße Blumen, die an Gänseblümchen erinnern, aber dünnere Stängel sowie feinere Blütenblätter besitzen. Und da und dort ein kleiner Farn.
Die Sonne sticht, es wird heiß, doch ich habe nicht daran gedacht, eine Wasserflasche mitzunehmen.
Nach einer Weile komme ich zu einer Straße, die steil den Berg hinaufführt. Gleich nach der Abzweigung steht links eine Kapelle. Der Hauptbau ist neu, der überdachte Eingang noch aus alten Granitsteinen. Ich bleibe stehen, frage mich, ob das die Kapelle sein kann, die nahe bei unserem Haus stand. Zwar stimmt hier nichts mit meiner Erinnerung überein, aber da mir alles fremd ist, bin ich verunsichert. Ich gehe die paar Meter zu dem kleinen viereckigen Bau. Wie erwartet ist die Tür verschlossen. Ich spähe durch das feinmaschige Gitter vor dem Fenster, sehe nichts als ein verstaubtes Marienbild. Hinter der Kapelle steht ein grob gezimmerter Tisch, darauf eine aus gemasertem Holz geschnitzte Hand. Sie hält eine Art Stift zwischen den Fingern und schreibt etwas auf die Tischplatte. Es gelingt mir nicht, die Botschaft zu entziffern. Auch hier fällt das Gelände auf der anderen Straßenseite steil ab in ein Tobel. Das kann nicht sein, denke ich, kehre um und marschiere weiter, jetzt schon schwitzend in der Hitze.
Schließlich lande ich wieder an der Haltestelle, die ich vorher verpasst habe. Ihr gegenüber befindet sich eine Bäckerei. Sie ist geschlossen. In der Eingangstür hängt ein Stück grauer Stoff, der den Blick ins Innere verwehrt. Dankbar für den Schatten, lasse ich mich auf den Stufen vor dem Laden nieder.
Am liebsten würde ich hier sitzen bleiben, bis der Bus ins Tal kommt, egal ob es noch Stunden dauert. Ich bin müde und habe genug von diesem überflüssigen Abenteuer. Da erscheint aus dem Nichts eine jüngere Frau vor mir. Ich verlasse meinen Sitzplatz, um sie nach dem Weg zu fragen. Sie zieht die Achseln hoch, schüttelt den Kopf und mustert mich misstrauisch. Offenbar versteht sie kein Italienisch. Schnell hängt sie eine Kette vor die Stufen zum Laden. Dann fährt sie in einem kleinen weißen Auto davon. Ich raffe mich auf und gehe zurück auf die Straße. Unterwegs halte ich vergebens Ausschau nach einem Menschen, den ich fragen könnte, bis ich endlich bei einer Garage auf einen älteren Mann treffe, der an einem Lastwagen schraubt. Auch bei ihm erkundige ich mich nach dem Haus von Anton Broch. Es kostet mich Überwindung, den Namen auszusprechen. Der Mann ist alt genug zu wissen, wonach ich frage, und erklärt mir, ich müsse 200 Meter auf der Hauptstraße zurück, dann würde ich den Wegweiser nach Berzona sehen.
Als ich damals drei Monate nach Brochs Tod zum ersten Mal allein nach Berzona gefahren war, hasteten auf dem Bahnhof die Leute in leichten Sommerkleidern durcheinander. In der Menge wurde mir schwarz vor den Augen, ich war die vielen Menschen nicht mehr gewöhnt.
Während der ganzen Fahrt ins Tessin schaute ich aus dem Fenster. Broch und ich kannten diese Strecke in- und auswendig. Trotzdem hatten wir jedes Mal aufs Neue nach der Kirche von Wassen Ausschau gehalten. Auch jetzt beobachtete ich, wie sie, dank eines Kehrtunnels, drei Mal in verschiedener Perspektive im Tal auftauchte.
Schlagartig nach dem Gotthard veränderte sich die Gegend. Ich sah mit Stein gedeckte Häuser, südliche Kirchtürme, die ersten Palmen. Nichts war anders als vorher. Nichts. Es schien mir eine ungeheure Beleidigung. Broch lebte nicht mehr, und die Welt drehte sich weiter, obwohl er für mich ihr Mittelpunkt gewesen war.
In Bellinzona musste ich umsteigen. Allein schleppte ich die schweren Koffer. Die Arme brachen mir fast ab. Dann, in Locarno, leistete ich mir ein Taxi bis hinauf nach Berzona.
An der Busstation ließ ich das Taxi halten. Ich ersuchte den Fahrer, mein Gepäck auf das Gerüst zu stellen, von dem früher jeden Morgen die Milchkannen abgeholt worden waren. Er hob die schweren Koffer mit Schwung hinauf. Dann bezahlte ich, gab dem Mann ein gutes Trinkgeld und machte mich auf die Suche nach Enrico, dem alten Bauern aus dem Dorf, der sich in unserer Abwesenheit um das Haus kümmerte.
Wieder komme ich zu der Abzweigung mit der Kapelle. Diesmal folge ich der Straße weiter bergauf und lande verschwitzt und erschöpft vor der Dorfkirche. Eindeutig der falsche Weg. Die Kirche ist geschlossen. Mit aller Kraft gelingt es mir, den Eisenriegel an der Tür zurückzuschieben. Dann drücke ich einen Flügel auf, zwänge mich durch die Öffnung. Drinnen ist es still und kühl im Gegensatz zu draußen. Die Kirche hat eine dunkelbraune Holzdecke sowie große Fenster aus farblosem Glas, in das als Verzierung nur da und dort kleine bunte Scheiben eingelassen sind. Da der Altar sich zurückversetzt in der Apsis befindet, wirkt der Raum eher wie ein überdimensionales Wohnzimmer. Einzig an der hinteren Wand stören kleine grellbunte Kreuzwegstationen das wohltuend altmodische Ambiente. Links vor dem Seitenaltar entdecke ich einen schmalen Tisch mit Kerzen. Ich gehe hin, werfe Geld in den Opferstock, zünde zwei Teelichter an, die hier nicht in billigen Plastikbehältern, sondern in sauberen kleinen Glasbechern stecken. Dann stehe ich da, frage mich, wie kann es sein, dass ich den Weg zu unserem Haus, in dem wir so lange gelebt haben, nicht mehr finde.
Nach dem Verlassen der Kirche schiebe ich den Riegel wieder vor und schlage den Weg ins Dorf ein. Die engen Gassen scheinen ausgestorben. Ständige Bewohner gibt es nicht mehr viele. Die meisten alten Häuser gehören Auswärtigen, die sie ausschließlich für die Ferien benützen. An einem von ihnen fallen mir die massiven neuen Läden auf, mit denen die Fenster im Erdgeschoss gesichert sind, während im oberen Stockwerk noch die uralten rissigen Balken hängen.
Keine Menschenseele kommt mir entgegen, kein Tier kreuzt meinen Weg. Erst weiter oben höre ich von irgendwoher Stimmen, dann das scharfe Geräusch eines Rasentrimmers.
Endlich biegt ein Mann in Arbeitskleidung um eine Hausecke. Ich schaue ihm ins Gesicht und denke, den kenne ich. Erst als er sich mit einem gemurmelten Gruß an mir vorbeigedrückt hat, kommt mir in den Sinn, dass derjenige, an den er mich erinnert, inzwischen wie ich Jahrzehnte älter geworden ist. Ich schüttle unwillig den Kopf, als würde eine Fliege mich belästigen, und versuche zu begreifen, was das ist: die Zeit. In dem Moment schmettert irgendwo eine Amsel los. Der Triller ist atemberaubend, bricht aber gleich darauf in einem Gicksen ab. Dann herrscht Stille, bis sie von Neuem anhebt.
Damals war ich auf meiner Suche nach Enrico ebenfalls ins Dorf gegangen. Ich wusste, dass er im Haus, in dem sich das einzige Geschäft befand, ein Zimmer bewohnte und auch im Laden aushalf. Er war an die 70, ein gebeugter, aber zäher kleiner Mann mit einem kurz geschorenen, runden Schädel. Meist war er unrasiert, sodass auf den Wangen ein silbriger Schimmer lag. Er hatte in Locarno Sohn und Tochter. Beide waren verheiratet, ihre Kinder gingen längst zur Schule. Früher war er Schreiner gewesen, seine Frau hatte eine bescheidene Landwirtschaft geführt. Nach ihrem Tod übergab er den Hof. Aber keines der Kinder wollte im Dorf bleiben. Der Sohn ging in eine Bank, der Mann der Tochter war Eisenbahner. Sie verkauften den Besitz. Verbittert mietete sich Enrico bei der Krämerin ein, deren Mann ebenfalls schon tot war. Das alles erfuhr ich nur von Katharina, denn Enrico selbst machte den Mund nicht auf.
Als ich den Laden betrat, saß er auf einem Melkschemel und reparierte die Kaffeemühle. Katharina putzte die Scheiben der Käsevitrine. Als ich ihn bat, mir mit dem Gepäck zu helfen, erhob er sich sofort, um seine Trage zu holen. Ich kaufte inzwischen einige Lebensmittel, stand schon wieder auf der Schwelle, da sagte Katharina hinter mir: »Wenn du etwas brauchst, Anna.«
Mir wurden sofort die Knie weich. Ich war noch nie ohne Broch im Tessin gewesen. Zum Glück klopfte in dem Moment Enrico von draußen ans Fenster. Ich dankte Katharina und lief rasch zu ihm. Er wenigstens, so hoffte ich, würde nichts dergleichen zu mir sagen.
Ich verlasse das Dorf, die Häuser bleiben zurück. Der Pfad aus weit auseinandergezogenen flachen Stufen, die mit groben Steinbrocken aufgeschüttet sind, steigt leicht bergan. Ich bin vorsichtig, um mir nicht einen Knöchel zu verstauchen. Immer wieder bleibe ich stehen, schaue hinunter auf die grauen Dächer, die sich zwischen die Sträucher ducken. Dann hebe ich meinen Blick zu den Berghängen der anderen Talseite und von dort zu den Gipfeln und immer höher bis ins zarte, weiße Nichts, das, vielleicht, irgendwo die Unendlichkeit küsst.
Als ich damals mit Enrico zu unserem Haus gegangen bin, gab es nur den schmalen Pfad, den ich nicht mehr finden kann, weil er möglicherweise gar nicht mehr existiert.





























