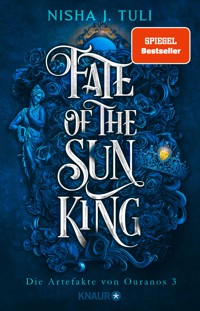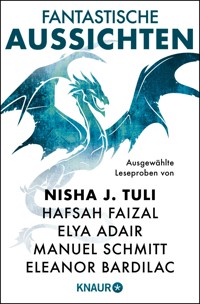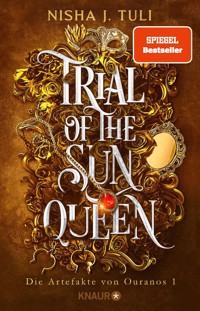
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Artefakte von Ouranos
- Sprache: Deutsch
Ein goldenes Reich, eine knallharte Außenseiterin und ein tödlicher Wettkampf um die Hand des Sonnenkönigs: Rache, Sex und fatale Intrigen am Hof der Fae! Nach zwölf langen Jahren im Kerker des Aurorakönigs hat Lor nur ein Ziel: dem grausamen High Fae jeden einzelnen Moment ihres Elends heimzuzahlen und mit ihren Geschwistern zu fliehen. Als sie gegen jede Wahrscheinlichkeit – und gegen alle Regeln – an den Hof des rivalisierenden Sonnenkönigs gelangt, scheint ihre Rache in greifbarer Nähe. Denn Lor wurde auserwählt mit neun anderen Tributen um die Hand des äußerst attraktiven Königs zu kämpfen und den Thron an seiner Seite zu erklimmen. Nur wenn ihr das gelingt, ist sie frei und kann ihre Familie retten. Doch um den Sonnenkönig für sich zu gewinnen, muss Lor erst einmal die tödlichen Wettkämpfe und intriganten Spiele am Hofe der Fae überleben. »Trial of the Sun Queen« ist der erste Band der temporeichen Fantasy-Romance-Reihe »Die Artefakte von Ouranos« um mächtige Fae undeine schlagfertige menschliche Heldin. Die kanadische Autorin Nisha J. Tulis hat mit ihrer unterhaltsamen, romantischen New-Adult-Fantasy direkt einen Hit auf TikTok gelandet: Leser*innen vergleichen die romantische Fantasy-Serie mit »Das Reich der sieben Höfe« von Sarah J. Maas oder »The Serpent and the Wings of Night« von Carissa Broadbent. Das perfekte Buch für den Book Hangover nach Rebecca Yarros' »Fourth Wing« und »Iron Flame«! »Die Artefakte von Ouranos« erscheinen in folgender Reihenfolge: - Trial of the Sun Queen - Rule of the Aurora King - Fate of the Sun King - Tale of the Heart Queen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nisha J. Tuli
Trial of the Sun Queen
Die Artefakte von Ouranos 1
Aus dem amerikanischen Englisch von Paula Telge
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein goldenes Reich,eine knallharte Außenseiterinund ein tödlicher Wettkampfum die Hand des Sonnenkönigs
Nach zwölf langen Jahren im Kerker des Aurorakönigs hat Lor nur ein Ziel: dem grausamen High Fae jeden einzelnen Moment ihres Elends heimzuzahlen und mit ihren Geschwistern zu fliehen. Als sie gegen jede Wahrscheinlichkeit – und gegen alle Regeln – an den Hof des rivalisierenden Sonnenkönigs gelangt, scheint ihre Rache in greifbarer Nähe. Denn Lor wurde auserwählt mit neun anderen Tributen um die Hand des äußerst attraktiven Königs zu kämpfen und den Thron an seiner Seite zu erklimmen. Nur wenn ihr das gelingt, ist sie frei und kann ihre Familie retten. Doch um den Sonnenkönig für sich zu gewinnen, muss Lor erst einmal die tödlichen Wettkämpfe und intriganten Spiele am Hofe der Fae überleben.
Rache, Sex und fatale Intrigen am Hof der Fae – Band 1 der romantischen New-Adult-Fae-Fantasy
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Karte von Ouranos
Widmung
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Danksagung
Für alle, die gleichermaßen von Liebe und Wut angetrieben werden.
Vorwort
Vielen Dank, dass du dich dazu entschieden hast, Trial of the Sun Queen zu lesen. Es ist das erste Buch einer Reihe, die voraussichtlich vier Bände umfassen wird. Ich verspreche nicht, dass sich das nicht möglicherweise noch ändern wird! Ich bin wirklich aufgeregt wegen dieser Geschichte und möchte euch ermutigen, nach all den Easter Eggs zu suchen, die sich darin verstecken. Einige Antworten werden sich hier enthüllen, aber andere erst in den folgenden Büchern … und es kommt noch so viel mehr! Ich hoffe, ihr liebt sie genauso sehr wie ich.
Die Liebesgeschichte entwickelt sich langsam, die wirklich heißen Szenen kommen in späteren Büchern (versprochen).
Die Triggerwarnung findet ihr weiter unten, falls ihr sie lesen möchtet, ansonsten könnt ihr direkt mit dem ersten Kapitel beginnen.
Alles Liebe
Nisha
Triggerwarnung: Dies ist ein Buch für Erwachsene, in dem Tod und Blut ebenso vorkommen wie Tötungen und Mord. Auch von sexueller Belästigung und Vergewaltigung wird gesprochen, doch davon ist nichts direkt in diesem Buch zu lesen. Die üblichen F-Bomben und ein bisschen Smut dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Kapitel 1
Das Miststück hat meine Seife genommen. Ich durchwühle den kleinen hölzernen Schrank, der all meine Besitztümer enthält. Eine verschlissene Tunika. Ein Paar Socken. Einige zerfledderte Bücher, die ich so oft gelesen habe, dass sie praktisch nur noch Staub sind. Aber keine Seife.
»Ich bringe sie um«, murmle ich, während ich den Inhalt des Schranks auf meinem niedrigen Feldbett ausbreite. »Ich zerschneide ihr Gesicht. Ich werde sie vom Kopf bis zum Arsch ausnehmen. Ich werde –«
»Es ist nur ein Stück Seife, Lor.«
Ich halte mitten in der Bewegung inne und drehe mich zu Tristan um. Er lehnt an der Wand, die Arme überkreuzt und ein Bein vor das andere gestellt. Ein paar seiner schwarzen Haarsträhnen hängen ihm ins Gesicht, und ein kleines Lächeln umspielt seine Lippen.
Die Erinnerung an das, was ich für dieses eine Stück Seife getan habe, schießt mir durch den Kopf. Wenn ich mit der Zunge über die Rückseite meiner Zähne fahre, kann ich noch immer den Geschmack saurer Verwesung wahrnehmen, den Schweiß des Aufsehers und …
Denk nicht dran.
»Es ist nicht nur Seife«, zische ich. »Weißt du, was ich dafür ma…« Ich breche ab, als sein Lächeln verschwindet. Mein Bruder senkt den Blick, lässt die Arme sinken und macht einen Schritt auf mich zu. Er ist fast einen Kopf größer als ich, drahtig und schlank, und trotz der dunklen Ringe unter seinen Augen unglaublich gutaussehend – eine Tatsache, derer er sich sehr bewusst ist.
»Was hast du gemacht? War es Kelava?«, fragt er.
Mein Blick fängt Willows auf. Sie sitzt auf ihrem Bett, das direkt neben meinem steht, und wir teilen einen Moment des gegenseitigen Verständnisses. Die großen dunklen Augen meiner Schwester sind erfüllt von der gleichen dunklen Bürde, die sich auch in meinen widerspiegelt.
»Nichts«, sage ich. Das Letzte, was ich gerade brauche, ist ein Bruder, der versucht, meine Ehre beim Aufseher zu verteidigen.
Wozu Kelava mich genötigt hat, ist nichts Neues. Es war nicht das erste Mal, dass ich mir mein Überleben hier verdienen musste. Und wenn seine Forderungen mir ermöglichen, einen weiteren Tag in Nostraza zu überstehen, werde ich es wieder und wieder tun. Tristan meint es gut, aber manchmal vergisst er, was es kostet, hinter diesen erdrückenden Steinmauern zu leben.
»Lor«, sagt Tristan warnend.
»Lass es einfach gut sein, okay? Es ist besser, wenn du nichts Genaues weißt.«
Ein Muskel in seinem Kiefer zuckt, seine dunklen Augen funkeln. Er will mich nur beschützen, aber manchmal sollte er sich wirklich um seine eigenen verdammten Angelegenheiten kümmern.
Willow steht von ihrem Feldbett auf und entstaubt ihre dünne graue Tunika, als würde sie dadurch jemals sauber werden. Dutzende weitere Betten füllen den Raum, aufgereiht an jeder Wand. Der Raum ist so niedrig, dass Tristan sich bücken muss, um nicht dagegenzustoßen. Auf den Betten liegen Decken, die irgendwann mal vermutlich weiß gewesen sein mochten, zusammen mit blassen grauen Kissen, die so dünn sind, dass sie genauso gut nicht da sein könnten. Wenn man Glück hat, wird einem der Luxus einer kratzigen Wolldecke zuteil, aber genau wie bei meinem Stück Seife kommt man nur selten in den Genuss. Wenn man dann auch noch eine ohne Löcher ergattert, ist es schon fast so, als wäre man von Zerra gesegnet.
»Lasst uns was frühstücken. Wir besorgen dir eine neue Seife«, sagt Willow mit sanfter Stimme und hakt sich bei mir ein. Ihre schwarzen Haare enden stumpf und kraftlos knapp unter ihren Ohren. So lang sind sie gewachsen seit dem letzten Läuseausbruch, als sie jedem von uns den Kopf rasiert haben. Wochenlang glichen wir einer Armee aus Kartoffeln in formlosen grauen Säcken. Ich fahre mir durch das Haar und verziehe das Gesicht. Genau wie das meiner Geschwister ist es Mitternachtsschwarz. Im Vergleich zu Willows ist es ein wenig länger und geht mir fast bis zum Kinn.
Das Längste, was ich je geschafft habe, war bis zur Mitte meines Rückens. Aber das ist schon Jahre her, und selbst da war es so trocken und brüchig, dass die vielen Strähnen, die ich auf dem Kopfkissen hinterlassen habe, wie ein Nest aus vertrockneten Würmern ausgesehen haben. Mittlerweile fühlt es sich ein bisschen gesünder an, aber Nostraza ist nur noch überfüllter und krankheitsanfälliger geworden. Ich rechne jeden Tag mit einem neuen Ausbruch. Es ist ein Wunder, dass es noch nicht so weit gekommen ist.
Ich nicke, als ich meinen Arm von Willows löse und meine Sachen wieder in den Schrank stopfe. Ich schlage ihn so fest zu, dass er auf seinen Füßen wackelt. Es gibt kein Schloss – das ist das Problem. Nichts gehört einem hier wirklich. Alles ist nur vorübergehend geliehen, unsere Körper und definitiv unsere Seelen. Das Einzige, was sie noch nicht für sich beansprucht haben, ist mein Verstand, doch das scheint mit jedem Jahr, das vergeht, weniger wahr zu sein.
Tristan und Willow gehen voran, und ich folge ihnen durch einen düsteren, schmalen Gang, der nur von flackernden Leuchten erhellt wird. Die Steinwände sind glatt und glänzen von der Feuchtigkeit. Es ist immer nass in Nostraza, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur Wasser ist. Vor langer Zeit habe ich mir selbst geschworen, nicht genauer darüber nachzudenken, was zwischen den Ziegeln hervorsickert. Nur wegen dieser zahllosen Selbsttäuschungen bin ich in der Lage, Tag für Tag zu überstehen.
Wegen mir werden wir zu spät zum Frühstück kommen und wahrscheinlich nichts mehr zu essen bekommen. Meine Geschwister werden sich nicht beschweren oder mir die Schuld dafür geben, aber ich werde es trotzdem irgendwie wiedergutmachen.
Als wir an dem Schlafsaal vorbeikommen, in dem Jude schläft, meine Nemesis, spähe ich hinein. Vielleicht klaue ich etwas von ihr, damit wieder Gleichstand herrscht. Vielleicht ist meine Seife ja auch in ihrem Schrank. Sie ist dumm genug, um sie so zu verstecken, dass jeder sie finden könnte. Ich will gerade hineinhuschen, als Tristan meine Hand festhält.
»Mach’s nicht. Das ist es nicht wert.«
Mein Blick trifft seinen, und die Wut befeuert den Ball des Zorns, der wie ein harter Stein in der Mitte meiner Brust steckt. Nur hat dieser keine glänzende Zukunft als Diamant vor sich.
Er versteht es nicht. Er ist einer der Bevorzugten in diesem Drecksloch. Für einen Gefangenen ist er stark und fit, ganz zu schweigen von seinem Charme, mit dem er die meisten Wachen um seinen Finger gewickelt hat. Sie nennen ihn spöttisch Prinz von Nostraza, doch er hat sie durchschaut und behält deswegen die Oberhand.
»Ich besorge dir eine neue.« Seine Gesichtszüge werden weicher. »Versprochen.«
Obwohl die Wachen Tristan bevorzugt behandeln, hat sich dieses Wohlwollen nie auf mich oder Willow übertragen. Unsere Verwandtschaft bleibt zu unserem Schutz geheim, und es ist nicht seine Schuld, aber es gibt Tage, an denen ich ihm verüble, wie viel leichter er es hat. Doch das ist nicht wirklich fair. Er hat von Anfang an alles in seiner Macht Stehende getan, um uns beide zu beschützen.
»In Ordnung«, sage ich und versuche, die unerwarteten Tränen zu unterdrücken. Ich habe auf die harte Tour gelernt, wie ich sie zurückhalte. Tränen sind nur nützlich, wenn sie als Waffe eingesetzt werden.
Aber manche Tage sind härter als andere.
Mein Magen ist ständig leer und mein Hals trocken wie die tiefste Höhle, ohne jegliche Wasserquelle. Die heilenden Wunden auf meinem Rücken, die mir vor zwei Wochen mit einer Peitsche zugefügt wurden, tun noch immer weh, wenn ich mich zu schnell bewege. Die Strafe habe ich bekommen, weil ich »aus Versehen« eine Schüssel heißer Suppe umgestoßen habe, die im Schoß einer besonders grausamen Wache gelandet ist. Er hat es verdient, und ich bereue nichts. Ich hoffe, seine Eier sind verschrumpelt und abgefallen.
Heute fühle ich die erstickende Schwere jedes einzelnen der zwölf Jahre, die ich in diesen Gefängnismauern verbracht habe. Zwölf Jahre für die einfache Straftat, geboren worden zu sein. Dafür, dass wir durch ein zerstörtes Vermächtnis beschmutzt sind, das ich weder wollte noch wirklich verstehe.
Jede Sekunde, jede Minute konzentriere ich mich auf den Tag, an dem ich endlich freikomme. Ich lebe ihn in meinen Träumen und sehe ihn vor mir, wenn ich wach bin. Ich fühle es in dem zitternden Mark meiner Knochen. Eines Tages werde ich hier rauskommen und dem Aurorakönig alles heimzahlen, was er mir genommen hat. Alles, was er getan hat.
Aber ich kann nicht einfach weglaufen. Selbst wenn ich es könnte, kann ich nicht ohne Tristan und Willow gehen. Ohne sie gäbe es keinen Frieden.
Eines Tages werde ich einen Weg finden, wie ich uns alle hier raushole.
Willow nimmt meine Hand und wirft mir besorgte Blicke zu, während wir weiter durch den Gang laufen. Sie ist die Sanfte in unserem abgerissenen kleinen Trio. Trotz der zermürbenden Härte von Nostraza bleibt sie ein warmherziger Schmetterling, der meinen Schutz braucht.
Während wir hier ersticken, werde ich alles tun, um dafür zu sorgen, dass sie sicher ist – soweit ich das kann in einem Leben, in dem wir weniger als nichts haben.
Aber wir passen alle auf uns auf, und manchmal bin ich auch auf ihre Hilfe angewiesen.
Einen Moment später fühle ich, wie mir jemand in den Hintern kneift, und drehe mich um, die Faust geballt, bereit, vernichtend zuzuschlagen. Als ich sehe, dass es Aero ist, knurre ich und hole trotzdem aus. Er duckt sich, ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus, als ich ihn um ein Haar verfehle.
»Behandelst du so deinen liebsten Mithäftling?«
»Liebsten …« Ich lache, bevor ich mich wegdrehe. Aber er legt mir einen Arm um die Hüfte und zieht mich zurück an seine Schulter, sein Kinn ruht auf meinem Nacken. Ich kann das Grinsen spüren, das an Tristan und Willow gerichtet ist.
»Sie ist in einer Minute wieder da.«
Willow sieht mich an und wartet auf meine Zustimmung. Ich nicke. »Ich komme nach. Sichert mir ein paar Steine.« Willow schnaubt als Reaktion auf meinen Witz über die Brötchen in der Kantine, während Tristan Aero einen warnenden Blick zuwirft.
»Geht einfach«, sage ich ihm. »Mir passiert nichts.«
»Wenn du ihr wehtust, bringe ich dich um«, sagt Tristan, und ich verdrehe die Augen, während ich mich aus Aeros Umarmung befreie.
Er hebt ergeben die Arme, und sein Grinsen wird breiter. »Verstanden, Boss.«
»Jetzt geht schon«, sage ich, und Tristan dreht sich mit Willow um, um den Gang weiter hinabzugehen und um die Ecke zu verschwinden. Aber nicht, bevor Tristan Aero noch einen bedrohlichen Blick zugeworfen hat.
Sobald sie weg sind, liegen Aeros Hände auf meiner Hüfte, er drückt mich gegen die Wand, und sein Mund findet meinen. Er ist deutlich größer als ich und schmal gebaut. In Nostraza sind immer alle kurz vorm Verhungern, und niemand hat das Privileg, etwas mehr auf den Rippen zu haben.
Seine Hände streichen über meinen Po und über die Rückseiten meiner Oberschenkel, bevor er mich hochhebt und ich meine Beine um seine Hüften schlinge. Meine Arme liegen um seinen Nacken, während wir uns küssen, unsere Zungen und Zähne treffen verzweifelt aufeinander. Unser Kuss ist nicht vorsichtig oder liebevoll, denn das passt nicht zu diesem Leben oder diesem Ort. Nach so vielen Jahren hier scheint die Erinnerung an alles Liebevolle so fern wie die Sterne am Himmel.
Unser schweres Atmen hallt in dem niedrigen Flur wider, und ich bin dankbar, dass schon alle zum Frühstück gegangen sind. Aero reibt seine Hüften gegen meine, seine Erektion pocht hart an meinem Bauch. Meine Finger verlieren sich in seinen kastanienbraunen Haaren, während er sich an mir reibt. Ich stöhne. Als er vor zwei Jahren hier angekommen ist, war er das Sinnbild eines verwegenen jungen Diebes. Aber Nostraza hat ihm diesen Lebensfunken gestohlen, wie von uns allen. Seine hellblauen Augen, einst klug und listig, sind in dem Wissen verblasst, dass er, wie wir alle, eines Tages hier sterben wird.
Dennoch ist er eine der wenigen schönen Sachen, an die ich mich in diesem Drecksloch klammern kann.
»Triff mich heute Abend hinter der Schmiede«, sagt er, sein Mund noch auf meinem. Seine Hände gleiten unter meine Tunika, und seine Finger streicheln sanft über meine Narben. »Ich brauche dich.«
Sein Mund bringt mich um eine Antwort, und ich nicke, als seine Zunge meine streift, stöhne voller Begierde. In dieser trostlosen Existenz ist dieses bisschen Vergnügen ein schwaches Licht, das durch die schmalen Risse der Dunkelheit scheint.
»Schlampe«, sagt eine bissige Stimme, und wir lösen uns voneinander. Jude steht in dem Gang, ihre schmutzig blonden Haare hängen in schlaffen Wellen bis zu ihrem Kinn. Ihre dünnen Arme überkreuzt, ihre Lippen voller Verachtung verzogen. »Wenn das nicht Nostrazas größtes Flittchen ist. Treibst du es jetzt schon wie ein Tier hier im Freien?«
Ihr durchdringender Blick wandert zu Aero, ihr finsteres Gesicht verdunkelt sich weiter.
»Verpiss dich«, sage ich und suche nach Anzeichen auf meine Seife, als würde sie sie an einer Kette um ihren Hals tragen. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, fängt sie an, zu grinsen, und fährt mit den Fingern ihren Hals hinab und unter ihre Arme, so als würde sie sich gerade unter der Dusche waschen. Ich erwidere ihr Grinsen. Sie mag meine Seife haben, aber ich weiß, dass sie ein Auge auf Aero geworfen hat, seitdem er hier angekommen ist. Er wurde wegen eines Einbruchs im Smaragd-Distrikt festgenommen, Auroras wohlhabendstes Viertel.
Ich wäre eine Lügnerin, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht in selbstgefälliger Zufriedenheit schwelge, seit er stattdessen an mir Interesse gezeigt hat. Um sie so richtig zur Weißglut zu treiben, lege ich Aero einen Arm um die Schultern und streiche mit einem Finger meiner anderen Hand über seine Brust, bevor ich seinen Kopf für einen langen, intensiven Kuss zu meinem runterziehe.
Meine Gefühle für Aero sind kompliziert.
Es ist schwierig, jemanden in Nostraza zu lieben, an einem Ort, an dem dir früher oder später jeder genommen wird. Die Einzigen, die ich je an mich herangelassen habe, sind Tristan und Willow, und ich weiß, dass das ein Fehler ist. Jedes Mal, wenn einer der beiden dem Tod nahe kommt, jedes Mal, wenn einer von ihnen geschlagen wird oder in Isolationshaft kommt, versuche ich, sie mir aus der Seele zu schneiden, in der Hoffnung, dass es weniger wehtut, wenn sie sterben.
Mir bleibt nur die Hoffnung, dass ich uns eines Tages – irgendwann – hier raushole. Es ist ein unmöglicher Traum, aber ich versuche, mich so fest wie möglich daran zu klammern, denn dieser Traum ist alles, was ich habe.
Jude knurrt und drückt sich an uns vorbei, wobei sie ihre Schulter gegen meine stößt, bevor sie Richtung Kantine stürmt.
»Wir sollten auch essen gehen«, sagt Aero, »oder es ist alles weg. Ich sehe dich nach deiner Schicht?« Er nimmt meine Hand, und wir gehen ebenfalls durch den Korridor.
Ich nicke. Ich habe heute Wäschedienst. Das bedeutet Stunden über Stunden in klebriger Hitze, mit Rücken- und Armschmerzen, während ich in riesigen Wannen mit seifigen, durchtränkten Laken rühre, die versuchen, an der Erinnerung ihrer ursprünglichen Farbe festzuhalten. Ich werde später eine Aufmunterung brauchen, und Aero ist meistens das vorübergehende Heilmittel.
Wir gehen um die Ecke und betreten die Kantine, in der sich schon Hunderte Häftlinge tummeln. Das Stimmengewirr ist wie immer ohrenbetäubend. Jeden Tag füllt es jede kostbare freie Sekunde – dreißig Minuten fürs Frühstück, dreißig Minuten fürs Abendessen. Die restliche Zeit schuften wir – manche in den Juwelenminen, manche in der Schmiede, andere in der Wäscherei oder in der Schneiderei. Der Rest geht anderen nervtötenden Pflichten nach, die keine freie Person übernehmen würde.
Wenn man seine Schicht geschafft hat, kann man sich eine Stunde der Erholung gönnen, aber nur, wenn man nicht vor Erschöpfung umgehend auf dem eigenen Bett zusammenbricht. Heute Abend werde ich die Energie aufbringen, denn an einem Ort, an dem es nur Leid gibt, versuche ich, unter jedem Steinchen einen Funken Hoffnung zu finden.
Jude sitzt mit ihrer Gang an einem Tisch nahe dem Ende der Essensschlange, jeder Einzelne von ihnen mürrischer und rattengesichtiger als der vorherige. »Liebt ihr nicht auch den Duft meiner neuen Seife? Meine Haut riecht so gut nach Rosen«, sagt sie, während sie den Ärmel ihrer Tunika hochzieht und ihren Unterarm in die Gesichter ihrer Untergebenen hält.
Ich bleibe stehen und versuche mit meinem Blick, Löcher in ihren Schädel zu bohren. In diesem Moment sieht sie auf, und ein langsames Lächeln breitet sich auf ihrem verkniffenen Gesicht aus.
Dieses Miststück.
Ich setze mich in Bewegung, bevor ich auch nur darüber nachdenken kann, was ich gerade tue. Mit einem Knurren stürze ich mich auf sie und schließe meine Hände um ihren Hals. Als ich auf ihr lande, kippt der Stuhl um, und wir schlagen beide hart auf dem Steinboden auf. Ich sitze rittlings auf ihr und versuche, ihr die Luft abzudrücken. Sie wehrt sich, schreit und zerkratzt die Haut an meinen Unterarmen. Dann holt sie mit der Faust aus und erwischt mich so fest an der Seite meines Kopfes, dass meine Sicht verschwimmt. Leicht desorientiert lockere ich meinen Griff etwas, und sie wirft mich zu Boden, hält mich unter sich fest. Nach einem weiteren Schlag auf den Kiefer schmecke ich Blut.
Ich werde sie so was von umbringen.
Dieses Mal greife ich nach ihrem Handgelenk und ziehe mit ganzer Kraft, bis ich das widerliche, aber befriedigende Geräusch von brechenden Knochen höre. Jude schreit auf, und ich trete sie von mir runter. Wieder sitze ich auf ihr und lasse wie von einem Dämon besessen Schläge auf ihren Magen, ihre Rippen und ihren Kopf niederprasseln.
»Lor!« Ich nehme den Klang meines Namens wahr und spüre Hände auf meinen Armen und meiner Hüfte, die versuchen, mich wegzuziehen.
»Lass mich los!«, schreie ich und schlage weiter auf Jude ein.
»Lor!« Ich erkenne Tristans Stimme und werde von Jude runtergezerrt, mein Atem geht keuchend, und mein Kopf pocht. Die Wachen haben einen Kreis um uns geformt, sie schließen mich ein, wie das wilde Tier, das ich bin. Jude liegt am Boden, stöhnt, Blut sammelt sich unter ihr. Etwas Warmes tropft mir vom Kinn und färbt die Vorderseite meiner Tunika purpurrot. Ich versuche, es wegzuwischen, aber Tristan hält meine Arme auf meinem Rücken fest.
»Lass mich los«, zische ich und versuche, meine Handgelenke aus seinem Griff zu befreien.
»Nicht, bevor du dich beruhigt hast.«
Die johlende, lärmende Kantine wird mit einem Schlag still, als schwere Schritte ertönen. Sie alle haben die Show genossen, froh, dass nicht sie es waren, die heute die letzte Kontrolle über ihren Verstand verloren haben. Von den Wachen eins auf die Fresse zu bekommen, gilt in Nostraza als Unterhaltung, was daran liegt, dass es sonst einfach keine gibt.
»Was ist hier los?«, fragt Kelava.
»Nichts, Sir«, antwortet Tristan mit seiner schmeichelhaftesten Stimme. Ein Teil von mir will ihn schlagen, aber das ist der Grund, warum Tristan hier überlebt, und das kann ich ihm nicht verübeln. Wir alle tun, was wir tun müssen.
Der Kreis der Wachen wird durchbrochen. Kelava tritt hindurch und bleibt vor mir stehen, während ich noch immer versuche, mich von Tristan loszumachen. Das Blut tropft weiter aus meinem Mund, auf den Boden und auf meine Schuhspitzen. Meine Schläfen und Lippen pulsieren schmerzhaft, als die Wache mich mit scharfem Blick fixiert.
»Habe ich nicht gesagt, dass es Konsequenzen haben wird, wenn du noch mehr Ärger machst?«
Ich sage nichts, funkle ihn nur an und versuche einmal mehr, mich aus Tristans Griff zu befreien.
»Oh, Lor. Warum musst du so sein?«
Kelavas wässrig blaue Augen werden von etwas erfüllt, was fast schon als väterliche Sorge um meine verlorene Seele durchgehen könnte. Er denkt wirklich, er wäre der Gute. Ich will ihn anspucken, ihn schlagen. Will ihm so fest in die Eier treten, dass er es noch immer spürt, wenn er alt und schwach ist und versucht, sich an die letzten Fetzen seiner Würde zu klammern.
Jude stöhnt erneut auf, sie liegt immer noch am Boden und hält ihr Handgelenk fest, das definitiv in einem unnatürlichen Winkel absteht. Verdammte Dramaqueen. Der Aufseher guckt sie an und dann mich, runzelt die Stirn.
»Hast du angefangen?«
Ich öffne den Mund, will mich verteidigen. Niemand wird mich verraten. Selbst unter den Kriminellen und Hoffnungslosen gibt es einen Ehrenkodex.
Na ja, Jude ausgenommen. Sie hat keine Bedenken, wenn es um mich geht.
»Ja, hat sie«, keift sie, als sie endlich wieder sprechen kann, wobei ihre Stimme wegen ihrer blutigen, geschwollenen Lippen gedämpft ist. »Sie hat mich ohne jegliche Provokation angegriffen!«
»Sie hat meine Seife geklaut!«
»Hab ich nicht! Das kannst du nicht beweisen!«
Kelava hebt eine Hand und bringt uns damit beide zum Schweigen. Judes Gesicht schwillt immer mehr an, und Blut tränkt die Vorderseite ihres Shirts. Sie sieht schrecklich aus.
Was nicht gut für mich ist.
»Aufseher«, sage ich und lächle schüchtern, versuche, mich irgendwie zu retten. »Wenn wir in Ihr Büro gehen, können wir das bestimmt aufklären.« Allein von der Andeutung wird mir schlecht.
Ich hasse es, aber das ist das Einzige, was ich zu bieten habe.
Ich habe das Falsche gesagt, Kelavas ruhige, geduldige Fassade bekommt Risse, seine Pupillen vergrößern sich zu schwarzen Löchern. Die Wachen mögen uns für ihre schmutzigen Triebe benutzen, aber anscheinend gibt es selbst unter Vergewaltigern ein Ehrgefühl, wenn sie versuchen, vorzutäuschen, dass hinter den geschlossenen Türen Nostrazas alles mit rechten Dingen zugeht. Der Aufseher deutet auf zwei grausame Wachen, mit deren Fäusten ich bestens vertraut bin.
»Bringt sie in den Schlund«, sagt Kelava, als die Wachen mich von Tristan losreißen.
Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, dass er mich nicht ohne Widerstand gehen lässt.
»Nein«, stoße ich aus, Panik schnürt mir die Kehle zu. Nicht das. Alles, nur nicht das. Das letzte Mal bin ich fast gestorben. Eine Woche im Schlund hat mich fast gebrochen, meinen Verstand zerrüttet und meinen Körper völlig zerschunden. »Nein, bitte. Es tut mir leid. Es wird nicht wieder passieren.«
Der Aufseher bringt sein Gesicht ganz nah an meines, während ich weiter gegen den Griff der Wachen ankämpfe. Er ist so nah, dass ich seinen feuchten Atem auf meinen Lippen spüre. Er stinkt nach den Überresten, von was auch immer er zum Frühstück verschlungen hat.
»Zwei Wochen dort sollten dir eine Lehre sein. Alles andere scheint ja nicht zu funktionieren.«
»Nein!«, schreie ich, strample und versuche, mich zu befreien. »Nein! Bitte!« Ich schluchze, heiße Tränen laufen mir über das Gesicht, meine Schreie hallen durch den Raum.
Ich habe meine Regel gebrochen. Diese Tränen sind keine Waffe. DieseTränen werden sie gegen mich verwenden.
Tristan fleht den Aufseher an, aber Kelavas harter Blick bleibt fest, und ein dünnes Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Er genießt meine Verzweiflung.
Meine Schreie reißen ab, als eine Wache mir so hart in die Magengrube schlägt, dass ich mich vorbeuge und fast den spärlichen Inhalt meines Magens hinaufbefördere. Ich schnappe nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Dann werde ich so kräftig an meinen Armen hochgerissen, dass eines meiner Schultergelenke laut kracht. Mein Schrei hallt aus jeder Ecke des Raumes wider.
»Bringt sie weg«, sagt Kelava erneut. »Ich sehe dich in zwei Wochen wieder, Häftling, sofern etwas von dir übrig bleibt.«
Und damit bleibt nichts als das dröhnende Rauschen in meinen Ohren, während ich weggezerrt werde.
Kapitel 2
Die Wachen bringen mich raus, über den staubigen Innenhof und durch ein massives Eisentor zu der Nordseite des Gefängnisses, wo wir den undurchdringlichen Wald betreten, der Nostraza umgibt und Nichts genannt wird. Wer einmal hineingeht, kommt nie wieder hinaus. In den seltenen Fällen, dass ein Gefängnisausbruch glückt, stellt das Nichts sicher, dass die wiedergewonnene Freiheit ein kurzlebiges Unterfangen ist.
Ich wehre mich noch immer, meine Schulter brennt wie Feuer, während die Wachen mich praktisch zwischen ihnen tragen, meine Beine zappeln in der Luft wie die einer wild gewordenen Marionette. Es ist aussichtslos. Sie sind beide doppelt so groß wie ich, und nach zwölf Jahren im Gefängnis bin ich schwach und unterernährt.
Was vermutlich genau der Sinn der Sache ist.
Als wir die Tore passieren, berühren die Wachen die schillernden Ovale, die an ihre Brust gepinnt sind. Sie murmeln ein paar Worte, und die Anstecker beginnen, zu leuchten, hüllen uns in eine schimmernde, durchsichtige Blase. Ich kann zwar durch die Oberfläche sehen, aber sie trübt meine Sicht wie eine beschlagene Fensterscheibe. Die Wachen sind sterblich, ohne jegliche magische Fähigkeit. Sie sind von diesen Gegenständen abhängig, dem einzig bekannten Schutz vor dem Nichts. Die Anstecker wurden von einem Imperial oder High Fae erschaffen, in diesem Fall vom Aurorakönig.
Der Schlund ist nichts weiter als ein Loch, das tief in die Erde gegraben wurde und sich direkt hinter den Mauern des Gefängnisses befindet. Das Nichts wurde nach seiner Fähigkeit benannt, seine Opfer zu umschließen und nicht mehr gehen zu lassen, der Schlund nach seiner Fähigkeit, jedes Lebewesen auszusaugen und leer und nach Luft schnappend zurückzulassen.
Er liegt nah genug beim Gefängnis, sodass die Wachen nicht so weit in den Wald müssen, aber weit genug davon entfernt, dass es sich anfühlt, als hätten sie einen den Monstern des Waldes ausgesetzt.
Ich habe mehr als genug Zeit im Schlund verbracht.
Mit einem Temperament wie meinem ist es fast schon normal, hin und wieder in Schwierigkeiten zu geraten … oder ständig. Die Standardstrafe ist ein oder zwei Nächte. Das ist Abschreckung genug, und die meisten sind kein zweites Mal hier. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das an der kurzen Lebenserwartung in Nostraza liegt oder ob die einmalige Erfahrung ausreicht, um ewigen Gehorsam sicherzustellen.
Wahrscheinlich ein bisschen von beidem.
Nur eine Handvoll Gefangene hat mehr als eine Nacht hier durchgestanden, ohne den Verstand zu verlieren. Ich bin eine davon. Obwohl mein Verstand vermutlich auch nicht mehr das ist, was er mal war.
Das letzte Mal bin ich in die Speisekammer eingebrochen, nachdem die Wachen unsere Rationen verkleinert hatten, als Antwort auf einen kleinen Aufstand. Wir waren noch hungriger als sonst und brauchten etwas zu essen, um nicht gegenseitig auf uns loszugehen. Es war ein Akt der Selbsterhaltung, der mir sieben quälende Nächte im Schlund eingebracht hat. Es war ein kleiner Verstoß, und die Schwere der Strafe hat nicht der Straftat entsprochen. Aber das ist genau das, was dieser Ort mit dir macht. Er treibt dich an den Abgrund, und wenn du kurz davor bist, auf die spitzen Steine zu stürzen, gibt er dir noch einen kräftigen Stoß.
Als sie wieder gekommen sind, um mich herauszuholen, war ich ein heulendes Elend mit blutiger Haut, verfilzten Haaren und zerstörten Nägeln. Es dauerte Wochen, bis Willow mir das erste Wort entlocken konnte. Es dauerte länger, bis ich aufgehört habe, mit den Zähnen zu klappern, und mich aus den endlosen Albträumen reißen konnte. Die düsteren Träume kehren nur selten zurück. Sie sind das Beste, worauf ich hoffen kann.
Während die Wachen mich tiefer in den Wald zerren, muss ich wieder daran denken, wie gebrochen ich beim letzten Mal war. Wie alles in mir wehtat, von den aufgerissenen Fingern bis hin zu meiner geschundenen Seele.
Zwei Wochen.
Meine Nerven gehen mit mir durch, Panik durchdringt meinen Körper.
Mein Verstoß heute war ebenfalls vergleichsweise klein, aber ich war schon immer der »Liebling« des Aufsehers. Ich werde das nicht überleben. Ich werde wegen einem verdammten Stück Seife sterben.
Die Wachen sind genauso nervös wie ich – hier im Nichts. Ich kann die Anspannung zwischen ihnen spüren, während sie mich über den unebenen Boden ziehen. Und ich kann von hier aus die hohen Spitzen und Türme des Bergfrieds von Aurora sehen, der über den Wald ragt wie eine lebendige Kröte. Seine schwarzen Steine glitzern, als wären sie mit Sternen besetzt, und in sanft wogendem Licht wechseln die Fenster von Grün zu Lila und schließlich zu Rot.
Eines Tages werde ich ihn stürmen und dem Aurorakönig dafür den Kopf abreißen, dass er mich hier verrotten lässt. Dafür, dass er mich hier reingeworfen hat, als ich noch ein Kind war.
Eines Tages werde ich hier ausbrechen und werde ihm alles heimzahlen.
Meine Aufmerksamkeit wandert zurück zum Schlund, Verzweiflung durchschneidet meine blutrünstigen Fantasien, in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich nie die Befriedigung meiner Rache spüren werde. Falls ich diese Bestrafung überleben sollte, wird nichts mehr von mir übrig sein. Ich werde nur noch eine Hülle sein, die einst einen Geist und einen Traum hatte.
Ich lausche der Stille, die mich umgibt, und schlucke die Anspannung hinunter. Mein Verstand spielt mir schon Streiche, und ich sehe die kriechenden Monster vor mir, die immer näher kommen wie eine Schlinge aus stacheligen Schuppen und geschärften Krallen, die sich langsam um mich schließt.
Mit einer Hand auf meinem Rücken schubst mich eine der Wachen nach vorne. »Rein mit dir, Süße.«
Meine Füße verfangen sich, und ich stolpere. Ich rutsche auf dem Rand des Lochs ab, der Boden gibt nach, und ich lande hart drei Meter tief auf dem Grund, begleitet von einem Schauer aus Erde und Kies. Die Wände sind zu hoch, um raufzuklettern, aber flach genug, um gar keinen Schutz zu bieten.
Ich weiß bereits, dass die Wände aus weicher, brüchiger Erde bestehen. Wenn ich versuche, mich an den Seiten hochzuziehen, werde ich nur einen kleinen Erdrutsch auslösen, der mich begraben und ersticken könnte. Nein, das Einzige, was ich tun kann, ist, abwechselnd in der Ecke zu sitzen oder drei Schritte in jede Richtung zu gehen und auf das Ende meiner Strafe zu warten.
»Keine Sorge«, ruft eine der Wachen runter. »Wenn du rauskommst, werden wir uns gut um dich kümmern. Es ist so einsam hier draußen. Du wirst ein bisschen Gesellschaft brauchen.« Sie brechen beide in Gelächter aus, als er sich in den Schritt greift und seine Hüften nach vorne stößt. »Es wird unser kleines Geheimnis vor dem Aufseher sein«, sagt er und zwinkert.
Ich spucke aus, wünschte, sie könnte Flügel bekommen und in seinem Auge landen. Was sie natürlich nicht tut.
Die beiden lachen noch mehr.
»Nein, danke«, rufe ich zurück. »Ich habe gehört, dass dein Penis die Größe einer Babykarotte hat. Ich brauche einen viel, viel größeren, um mich zu befriedigen.« Der Gesichtsausdruck der Wache verändert sich schlagartig, und das Lachen weicht Zornesröte. Für diesen Kommentar werde ich bezahlen, so viel steht fest.
Die zweite Wache beugt sich herunter und grinst. »Die Mig’dran sind in letzter Zeit besonders rastlos, und ich habe gehört, dass süße kleine Mädchen ihre Lieblingsspeise sind.« Er zwinkert, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es neckisch oder verführerisch gemeint ist. Es könnte von beidem nicht weiter entfernt sein.
»Nun, gut, dass an mir nichts süß ist, Schwanzgesicht«, blaffe ich ihn an, und sie lachen wieder.
»Oh, ich hoffe, du überlebst das hier, Süße. Unglaublich, dass ich es bisher noch nicht mit dir treiben konnte. Verdammtes Schoßhündchen des Aufsehers.« Er funkelt mich an, als wäre es meine Schuld. Als wäre ich diejenige, die sich das hier alles ausgesucht hätte.
Ich bin kurz davor, noch mal zu spucken, aber überlege es mir anders. Vielleicht langweilen sie sich, wenn ich still bin, und lassen mich allein. Aber schon bei dem Gedanken, wie sie weggehen, ziehen sich sämtliche meiner Eingeweide vor Angst zusammen.
Allein. Zwei Wochen hier draußen ohne alles.
Nur meiner puren Verzweiflung ist es zuzuschreiben, dass ich diese zwei Idioten dem Alleinsein vorziehen würde.
Aber offensichtlich hatten sie ihr Vergnügen. Denn sie drehen sich um, um zu gehen. Ich möchte nichts lieber, als sie zurückzurufen, beiße mir aber auf die Zunge. Selbst wenn sie bleiben würden, um mich noch für ein paar Minuten zu schikanieren, werden sie mich letztendlich hier zurücklassen. Ich sollte mich besser daran gewöhnen.
Ihre Stimmung ist ausgelassen, und ich höre ihre gegenseitigen Beschimpfungen, bis ihre Stimmen leiser werden. Um mich herum herrscht nichts als Stille. Das Einzige, was ich höre, sind mein Atem und die tobenden Gedanken in meinem Kopf.
Ich drücke mir die Hand auf die Brust und versuche, meinen Atem zu beruhigen. Im Schlund gibt es weder Essen noch Trinken – das wäre zu menschlich. Ich muss also auf baldigen Regen hoffen. Was das Essen angeht – ich suche den leeren Erdboden ab – nun, da habe ich verdammtes Pech gehabt.
Zum Glück sind der Hunger und ich alte Bekannte.
Ich lasse mich mit dem Rücken zur Wand auf den Boden sinken und massiere meine schmerzende Schulter. Mein Gesicht pulsiert noch immer dort, wo Jude mich geschlagen hat, aber es scheint nicht mehr zu bluten. Ich berühre meine Schläfe, wo sich eine Beule gebildet hat, und zucke zusammen. Nur ein paar weitere Narben, die die Chronologie von Übergriffen auf meiner Haut vervollständigen.
Der Wald bleibt still, vielleicht versucht er, herauszufinden, ob ich eine Bedrohung darstelle. Ich schaue nach oben. In Aurora gibt es keinen blauen Himmel, nur einen dunklen Himmel und einen etwas weniger dunklen Himmel. Ein monochromer Regenbogen, dessen Spektrum von der Farbe kalter Asche zu Tintenschwarz reicht. Die einzige Möglichkeit, den Unterschied zwischen Tag und Nacht zu erkennen, ist, die Anwesenheit der Namensgeberin des Reichs, die Aurora borealis, zu überprüfen.
Nachts verlaufen die Lichter in Farbbahnen am Himmel, wogend wie Wellen auf dem Meer. Kobalt und Smaragd und Violett und Purpur. Die Farben sind so kräftig, als hätte jemand Juwelen in einem Kessel geschmolzen und über den Himmel gegossen. In den meisten Nächten sehen wir sie nicht, wenn wir in den Schlafsälen eingesperrt sind, aber bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen ich sie betrachten konnte, hat ihre Schönheit einen kleinen Teil meiner Seele wieder zusammengesetzt.
Das ist der einzige Vorteil des Schlunds. Hier kann ich das Spektakel ungestört genießen, wenn auch nur durch einen winzigen rechteckigen Rahmen aus Dreck. Mit der aufziehenden Dunkelheit und dem Verstreichen der Stunden warte ich auf die ersten Anzeichen der Aurora, während ich auf die Geräusche der Kreaturen lausche, die im Nichts zu Hause sind.
Ich war ein Kind, als ich nach Nostraza gebracht wurde. Die Erinnerungen an mein vorheriges Leben sind unscharf, durch Hunger und die verlorene Zeit hier abgenutzt. Nur dank Tristan und Willow weiß ich überhaupt noch etwas über unsere Vergangenheit.
Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie sich ein normaler Wald anfühlt, obwohl ich meine ersten Lebensjahre in einem verbracht habe. Angestrengt versuche ich, das Zwitschern von Vögeln und das Brummen von Insekten wahrzunehmen. Das Rascheln des Windes in den Blättern. Vielleicht das Plätschern von Wasser in einem fließenden Bach.
Doch ich höre nichts davon.
Der Himmel über mir wird langsam dunkler, während sich die Nacht über den Wald legt. Wenn ich meine Ohren nur ganz genau spitze, habe ich fast das Gefühl, die Gefängnisgeräusche in der Ferne hören zu können: die Abendessensglocke und das beständige Dröhnen von Hunderten Stimmen nach einem langen Arbeitstag. Ich denke an Aero und das Treffen, das wir heute Abend geplant hatten.
»Sorry, Aero«, flüstere ich in die zunehmende Dunkelheit.
Aber hauptsächlich sorge ich mich um Willow und Tristan. Sie sind bestimmt außer sich. Von uns dreien bin ich die, die am häufigsten in Schwierigkeiten gerät, und ich weiß, dass es sie jedes Mal bricht, wenn der Aufseher meine nächste Strafe verhängt. Ich versuche immer, mich um ihretwillen an die Regeln zu halten. Aber mich Autorität zu beugen, gehört nicht gerade zu meinen Stärken.
Mit der Dunkelheit kommt auch die Kälte. Ich schlinge meine Arme um mich und wünschte, dass ich etwas mehr anhätte als nur die klassische Gefängnisbekleidung, bestehend aus einer dünnen Leggings und einer Tunika. Mein Magen grummelt, und mein Mund ist trocken, meine Zunge dick und meine Lippen spröde. Ich habe heute Morgen nicht mal gefrühstückt. Wolken ziehen über meinen Kopf hinweg, verdecken heute Nacht die Sicht auf die Aurora, aber vielleicht bedeutet das zumindest Regen.
Die beunruhigende Stille des Waldes hält an, doch dafür kann ich dadurch die Geräusche des Gefängnisses hören, während der Abend dort seinen gewohnten Lauf nimmt. Abendessenszeit. Duschzeit. Jude benutzt wahrscheinlich meine Seife und freut sich über meine Strafe. Ich stelle mir vor, wie sie eine triumphierende Melodie summt, während sie sich wäscht, und knirsche mit den Zähnen.
Ich hoffe, dass ich ihr verdammtes Handgelenk gebrochen habe und es noch wochenlang wehtut.
Wenn ich meine Augen schließe, kann ich noch immer den blumigen Duft der Seife riechen. Rosen, hat der Aufseher gesagt. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals wirklich eine gerochen habe, aber sie müssen wunderschön sein.
Es ist nicht so, als gäbe es sonst keine Seife zum Duschen, aber sie ist rau und säuerlich, und der Geruch brennt in meiner Nase und meinen Augen. Dieses Seifenstück hat nicht nur himmlisch geduftet, es war auch so weich und cremig wie ein Stein, der von dem sanften Lauf der Zeit samtig weich poliert wurde. Es ist schwierig, sich eine Welt vorzustellen, in der solche Seife zum Alltag gehört.
Schließlich gehen die Insassen zu Bett, und das Gefängnis wird leise. Ich stelle mir vor, wie Willow mein leeres Feldbett sieht und sich wegen mir in den Schlaf weint. Tristan liegt wahrscheinlich im Bett, starrt die Decke an und überlegt sich Tausende Wege, mich hier rauszuholen, obwohl er weiß, dass das so gut wie unmöglich ist.
Ich denke an Aero und frage mich, ob er allein ist oder ob er sich jemand anderes gesucht hat, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Allein bei dem Gedanken wird meine Brust eng. Aber das ist nicht fair. Schließlich haben wir uns nie etwas versprochen. Welchen Sinn hätte das gehabt?
Mein Magen knurrt so laut, dass das Geräusch durch den stillen Wald hallt. Ich bin der Gong zum Abendessen. Ein leuchtend rotes Signal, das jedes Raubtier im Nichts direkt zu meinem sehr sichtbaren Versteck führt. Doch das macht auch keinen Unterschied mehr. Ich bin mir sicher, dass sie mich riechen können. Selbst wenn ich so leise wie ein Geist wäre, wüssten sie schon längst, dass ich hier bin.
Gerüchten zufolge erschafft der Aurorakönig diese grotesken Hybriden aus den Monstern, die er auf dem Kontinent Ouranos und in der restlichen Welt jagt. Seine Magie hat sie zu wilden Bestien gemacht, die sich von dem Fleisch Sterblicher ernähren, sobald sie den Wald betreten. Gleichzeitig beschützen sie die Fae-Bewohner von Aurora, wie auch die königliche Familie, die in der Burg wohnt.
Die Monster sind erstklassige Jäger. Nichts gelangt durch diese Bäume.
Ein Ast bricht, und mein Herz setzt einen Schlag aus. Ein weiteres Knacken. Ich drücke mich tiefer in die Ecke, habe panische Angst vor dem, was in dieses Loch kriechen könnte. Bis jetzt hatte ich unwahrscheinliches Glück. Obwohl es oft knapp war, hat mich hier draußen nie etwas angegriffen. Andere Gefangene hatten definitiv mehr Pech.
Erst vor ein paar Tagen habe ich durch Zufall mitbekommen, wie zwei Wachen über einen Gefangenen gesprochen haben, der für eine Nacht hier draußen gelassen wurde, nur um sein Ende zwischen den Fangzähnen eines Ozzillers zu finden.
»Es war nur eine Lache aus Blut und Knochen übrig«, sagte der eine schaudernd.
Selbst sie hat diese Vorstellung verstört. Ich stelle mir den Ozziller vor, wie er über dem Rand auftaucht und sich über die Lippen leckt. Wenn er überhaupt Lippen hat. Obwohl ich nicht weiß, wie er aussieht, habe ich ein Bild vor Augen: rasiermesserscharfe Schuppen und tropfende Fangzähne. Einfach der schlimmste Albtraum, den ich mir vorstellen kann.
Mit einem weiteren Knacken wird die Luft schwerer, schwarze Schatten wabern umher. Sie kommen auf mich zu, dringen durch meine Nase und meinen Mund ein und füllen meine Lunge mit dem starken, fauligen Geschmack des Todes. Mein Atem geht schneller, ich hole stoßweise Luft in dem vergeblichen Versuch, mich zu beruhigen.
Die Dunkelheit wird noch erdrückender und nun von einem rasselnden Atem begleitet, der dem Klang von Ketten gleicht, die durch rostige Stangen gleiten. Ein Schatten, dunkler als die, die mich bereits einnehmen, taucht über der Kante des Abgrunds auf. Ich sehe die verschwommene Gestalt eines Körpers, verbogen und gebrochen. Gliedmaßen, die länger sind, als sie sein sollten, und in unmöglichen Winkeln am Körper hängen. Ein Wimmern entweicht mir, während ich mich noch kleiner mache und versuche, mich in Nichts aufzulösen.
Ich bin Nichts. Ich habe nichts. Bitte verschwinde, schreie ich wieder und wieder in meinen Gedanken.
Mein Herz pocht gegen meine Rippen, und ich kneife die Augen zusammen. Ich wage es nicht, zu schauen. Sollte ich jetzt sterben, müsste ich zumindest nicht die nächsten zwei Wochen leiden. Ich hoffe nur, dass es schnell und schmerzlos sein wird.
Ich warte auf den Angriff.
Die Anspannung frisst sich wie Säure durch meine dünne Schale aus Mut. Unfähig, die Spannung weiter auszuhalten, öffne ich vorsichtig meine Augen. Genau in diesem Moment stürzt sich ein pechschwarzer Schatten mit unnatürlicher Geschwindigkeit auf mich.
Das ist der Moment, in dem ich einen ohrenbetäubenden Schrei loslasse.
Kapitel 3
In der nächsten Sekunde zuckt ein Blitz aus strahlend hellem Licht über den Himmel, gefolgt von einem Donner, der so sehr dröhnt, dass die Erde bebt. Dreck und Steine lösen sich aus den Wänden und stürzen auf mich herab. Ein weiterer heller Blitz, gefolgt von einem noch lauteren Donnerschlag hallen durch die Luft, bevor der Himmel sich öffnet und es anfängt, zu schütten.
Die Kreatur scheint verschwunden zu sein, wahrscheinlich vor dem Sturm geflohen. Ich atme erleichtert aus. Mein Herz schlägt noch immer so schnell, dass es sich anfühlt, als würde es sich gleich überschlagen. Das war viel zu knapp. Wie soll ich das zwei Wochen lang überleben?
Aber Zerra hat in dieser Nacht mein Gebet erhört, und ich lege meinen Kopf zurück, schaue in den Himmel und lasse das kalte Regenwasser in meinen Mund und über meine ausgetrocknete Zunge laufen. Zumindest werde ich nicht verdursten. Nicht heute.
Die Temperatur sinkt schlagartig, und ich zittere, während der Regen in einem gleichmäßigen Rhythmus auf meine Haare, Haut und Kleidung fällt.
Nach gefühlt endlosen Stunden, in denen der Regen ununterbrochen auf mich herabströmt, wird mir bewusst, dass ich wirklich vorsichtiger mit dem sein sollte, was ich mir wünsche. Das Loch füllt sich mit Wasser, und die Sintflut ist so stark, dass die Feuchtigkeit keine Zeit hat, in den Boden zu sickern. Noch ist sie nur ein paar Zentimeter hoch, und ich schicke ein Stoßgebet an Zerra und bettle darum, dass der Regen aufhört, bevor er zu einem Problem wird, das ich nicht lösen kann. Geschweige denn überleben.
Aber mein Gebet bleibt unerhört, denn der Regen lässt nicht nach. Er fällt weiter mit der Entschlossenheit eines Meeres, das versucht, einen Wal zu ertränken.
Es muss ein Tag vergangen sein, der Himmel wird von Schwarz zu Grau und wieder Schwarz wie die langweiligste Geschichte, die je erzählt wurde. Die Wolkendecke ist so dick, dass nichts von der Aurora sichtbar ist. Der Regen fällt weiter, und das Loch füllt sich, bis ich nicht mehr auf dem Boden sitzen kann. Als das Wasser fast einen Meter Höhe erreicht hat, habe ich keine andere Wahl, als zu stehen. Ich lehne mich gegen die mittlerweile matschige Wand, und meine Tränen fallen im Einklang mit dem Regen. Niemand kann mich hier weinen sehen, sodass ich mir diesen seltenen Luxus erlaube.
Es regnet immer weiter. Weiter und weiter in einer endlosen Flut. Das Wasser steigt an meinen Oberschenkeln empor und dann an meiner Hüfte, als wäre ich eine Statue, die langsam von Efeu bedeckt wird. Ich bin so müde. So schwach. Ich würde alles dafür geben, mich hinlegen zu können. Oder auch nur zu sitzen. Meine Füße und Beine schmerzen, und mir ist kalt. Meine Finger sind komplett taub. Ich überprüfe ständig meine Hände, um sicherzugehen, dass sie noch da sind. Ich versuche, meine Zehen in den Stiefeln zu bewegen, aber sie sind zu unbeweglichen Klumpen gefroren.
Ich lehne meinen Körper gegen die Wand und versuche, zu schlafen, aber genauso gut könnte ich versuchen, inmitten einer aufgebrachten Gnu-Herde ein Nickerchen zu machen. Der Regen fällt und fällt, durchnässt meine Kleidung und Haare, weicht meine Haut auf und brennt in meinen Augen. Ich zittere so stark, dass meine Kiefer vom Zähneklappern wehtun. Ich schlinge die Arme um meinen Körper auf der Suche nach etwas Wärme, finde jedoch keine.
Ich lege mich auf den Rücken, will mich treiben lassen und versuche, meine untere Körperhälfte zu entlasten. Es hilft, aber führt dazu, dass ich mich entscheiden muss, ob ich lieber den Schmerz vom Stehen oder die zusätzliche Kälte ertragen möchte, wenn ich meinen Körper mehr eisigem Wasser und kühler Luft aussetze.
Zerra sei Dank ist es zumindest Sommer, und die Temperaturen sind vergleichsweise warm. Die Winter in Aurora sind bestenfalls brutal, schlimmstenfalls tödlich.
Endlich. Endlich hört der Regen auf.
Ich weiß nicht, wie lange er angehalten hat, aber mein ganzer Körper – bis hin zur kleinsten Zelle – schmerzt. Die Taubheit hat von jeder Pore Besitz genommen, hat sich dort eingenistet und sich wie erkaltende Lava ausgebreitet. Der Himmel klart auf, die Wolken verschwinden, und ich weine vor Erleichterung. Zumindest bin ich nicht vor Durst eingegangen. Eis überzieht meine Haut, eine harte Schale, die knackt, weil ich so zittere. Kann man von zu langem Stehen sterben?
Es scheint eine Ewigkeit zu vergehen, bis das Wasser im Boden versickert. Wenn ich überhaupt schlafe, dann nur in ein paar gestohlenen Sekunden, die keine Erholung mit sich bringen. Ich bin so müde. So hungrig. Ich bin eine gebrochene, hohle Hülle. Langsam, unendlich langsam lasse ich mich mit dem sinkenden Wasserspiegel an der Wand hinuntergleiten. Meine Beine zittern, mein Rücken verkrampft sich. Mein Kopf pocht, und mein Herz flattert unregelmäßig.
Irgendwann kann ich mich endlich hinsetzen. Mein Körper entspannt sich mit einem Schlag, als ich meine Beine und Füße entlasten kann. Ich fühle mich so leicht, als würde ich auf Wolken schweben, aber meine Haut ist so aufgedunsen, dass ich wahrscheinlich auf den Grund eines Sees sinken würde wie ein Stein, der an einen Felsbrocken gebunden ist.
Ich ziehe meine Knie zu mir heran, verschränke meine Arme darauf und lege meinen Kopf ab. Ein paar Stunden später, als nur noch wenige Zentimeter Wasser zurückbleiben und keine Gefahr mehr besteht, zu ertrinken, breche ich auf dem Boden zusammen. In diesem Moment kann ich mir nichts Göttlicheres vorstellen, als die Möglichkeit, sich einfach hinzulegen. Ich würde weinen, wenn ich die Energie dafür hätte.
Meine Augenlider senken sich, und ich schlafe ein.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Boden des Schlunds lag.
Die Tage gehen ineinander über, während der Himmel wieder und wieder von Grau zu Schwarz zu Grau wird. Wenn die Lichter der Aurora erscheinen, versuche ich, sie anzuschauen, aber ich kann kaum meinen Kopf heben und sehe aus meinen Augenwinkeln nur den schwachen Hauch von Rot, Blau, Grün und Violett. Doch wenn ich den Atem anhalte, kann ich die Lichter hören. Sie knistern, als wären sie energetisch aufgeladen – wie ein aufgestauter Blitz, der niemals einschlägt.
Ich versuche, die Tage zu zählen, aber verliere schnell den Überblick, und meine Gedanken fangen an, mir Streiche zu spielen. Nichts hiervon fühlt sich real an. Ich kann die eine Sekunde nicht von der nächsten unterscheiden. Ich bin eine kaputte Uhr, die für immer ins Nichts tickt.
Es regnet nicht mehr, und dafür bin ich dankbar, doch es ist ein kleiner Trost. Ich werde bald wieder Wasser brauchen. Der Hunger sitzt so tief, dass er schon an meinem Knochenmark nagt.
Ich kenne den Hunger wie einen alten Bekannten. Ich kenne seinen Rhythmus und seinen Herzschlag, die Eigenheiten seiner Struktur, aber ich weiß nicht, ob ich jemals so hungrig war.
In manchen Momenten spüre ich die Anwesenheit des Dämons, aber er kommt nicht mehr so nah wie zuvor. Ich rufe nach ihm. Flehe ihn an, mich zu verschlingen. Mich auseinanderzunehmen, Stück für Stück, und das hier zu beenden. Es ist mir sogar egal, ob es wehtut. Ich will nur, dass es vorbei ist.
Aber er hört nicht auf mein verzweifeltes Flehen. Irgendwas hält ihn zurück. In dem Labyrinth meiner trostlosen Gedanken spüre ich seinen Widerwillen, näher zu kommen.
Ich werde immer wieder bewusstlos, Träume folgen Albträumen in einem endlosen Kreis, der zu einem Schleier aus Farben und Dunkelheit wird. Schattenhafte Bilder von schwarz gefiederten Flügeln und lederartigen Häuten. Ein Himmel, übersät von purpurroten Blitzen und einem Fluss aus Sternen. Ein blutiges Lächeln, das mich mit einem scharfen Knistern durchbohrt. Schreie, die von einem Ort widerhallen, den ich fast vergessen habe. Ein Ort, den ich kenne, aber noch nie besucht habe.
Ich träume von Tristan und Willow, die versuchen, ohne mich weiterzumachen. Von ihren gesenkten Köpfen, tränenüberströmten Wangen. Ich sehe, wie Willow nach vorne und hinten wippt, ein Gebet auf den Lippen, Tristans Arm um ihre Schultern.
Ich träume von Aero und einem leuchtenden Aurorahimmel. Von stürmischen Küssen und gierigen Händen. Von warmer Haut gegen feuchte Hitze und fieberhaftem Stöhnen. Ich träume von seinen Fingern und Lippen und seiner Zunge, die kostet, beißt und saugt. Davon, wie etwas, das sich gut anfühlen sollte, zur Qual wird, wenn es nur ein flüchtiger Moment der Erleichterung ist, eingeschlossen in einem Leben voller Schmerz.
Ich träume von den glotzenden Augen des Aufsehers und seinem ranzigen Atem. Von seinen grausamen Worten und sadistischen Absichten. Ich höre, wie ein Reißverschluss geöffnet wird, spüre die Blutergüsse an meinen Knien und versuche, nicht zu weinen. Versuche, das letzte bisschen Würde nicht herzugeben, an das ich mich klammere wie an ein sprödes Seil.
Mein Körper schmerzt, und ich fühle mich, als ob die Feuchtigkeit bis zu meinen Knochen vordringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemals wieder warm wird. Es kommt mir vor, als wäre ich seit Monaten oder Jahren hier drin. Aber das kann nicht sein.
Ohne den Regen ist meine Kehle wieder ausgetrocknet, meine Lippen sind aufgesprungen und bluten. Ich zittere vor Kälte, meine Kleidung trocknet nicht mehr, die Luft ist schwül und drückend. Wahrscheinlich fängt die Haut in meinen Achseln und zwischen meinen Zehen schon an, zu modern.
Bald werde ich eins sein mit dem Waldboden, aufgelöst und an die Erde zurückgegeben. Mit ein bisschen Glück werde ich an einem besseren Ort wiedergeboren.
Als sich wieder die übliche Stille über den Wald legt, kann ich nicht mehr zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Doch dann registriere ich etwas, irgendwo in den Wolken meiner Gedanken. Eine Veränderung in den Geräuschen. Die zerstörerische Stille wird durchbrochen von einem fernen Echo.
Das Geräusch von Metall auf Metall. Das Geräusch von Haut, die auf Stein aufschlägt. Das Geräusch von Schreien. Sie kommen vom Gefängnis.
Einmal mehr versuche ich, meinen Kopf zu heben, aber schaffe nur ein paar Zentimeter. Es klingt wie ein Aufstand. Ein großer. Ich habe bisher drei in Nostraza erlebt, und das Ergebnis waren immer mehr Tote als Überlebende. Tristan und Willow sind da drin. Ich hoffe, dass sie sich verstecken, aber ich weiß, dass Tristan mitten im Getümmel sein wird. Ich hoffe, dass er zumindest Willow in Sicherheit gebracht hat, bevor er sich mit seinem Sturkopf ins Geschehen gestürzt hat.
Ich flüstere ihre Namen in die Dunkelheit. Willow. Tristan. Als wir hierhergebracht wurden, war ich erst zwölf Jahre alt. Willow ist drei Jahre älter als ich und Tristan zwei Jahre älter als sie. Ich habe nur flüchtige Erinnerungen an meine Eltern, viele davon zusammengesetzt aus den Geschichten meiner Geschwister. Wir waren schon immer unzertrennlich. Waren immer füreinander da. Die frühen Jahre waren die härtesten, und ich bin mir nicht sicher, was uns so lange am Leben gehalten hat, aber ich danke Zerra für jeden Morgen, an dem wir drei aufwachen, um ein weiteres Mal den Kalender umblättern zu können.
Sie haben Tristan angezeigt, weil er drei Männer des Königs getötet haben soll, und Willow, weil sie angeblich ein wertvolles Artefakt des Königreichs gestohlen hat. Bei mir haben sie nicht mal versucht, sich ein offizielles Urteil auszudenken. Sie haben mich einfach hier reingeworfen und den Schlüssel weggeschmissen.
Ein kratziger Schluchzer, zerrüttet von Reue, entweicht meiner trockenen Kehle. Ich wollte uns unbedingt hier rausholen.
Die Geräusche aus dem Gefängnis werden lauter. Krachen und Kreischen hallen durch die Stille des Waldes. Das Aufeinandertreffen von Waffen und die Schreie der Verletzten. Die Kreaturen scheinen ebenfalls zuzuhören – alle halten gespannt inne. Die Gefangenen sind in der Überzahl, es kommen zwanzig Insassen auf eine Wache, aber sie sind hungrig, untrainiert und haben keine Waffen. Die Wachen haben auch die Magie auf ihrer Seite, den Schutzwall des Königs, der es unmöglich macht, das Gelände zu betreten, ohne zerfetzt zu werden.
Meine Augenlider fallen zu. Ich bin so müde und hungrig, aber ich darf nicht einschlafen. Ich muss hören, was geschieht. Tristan und Willow. Ich hoffe, es geht ihnen gut, und klammere mich an das Bild ihrer Gesichter, während ich immer wieder das Bewusstsein verliere. Ich weiß nicht, wie lange der Aufstand andauert, aber es müssen bereits Stunden vergangen sein. Die Zeit hat jeden Einfluss auf meine Existenz verloren. Vielleicht bin ich schon tot.
Doch dann höre ich einen dumpfen Schlag direkt neben meinem Kopf. Ich zucke zusammen und frage mich, welch grausames Biest seinen Weg in mein Grab gefunden hat. Meine Augenlider flattern auf und zu, und ich nehme einen schemenhaften Schatten über mir wahr. Es erklingt ein sanftes Rascheln. Warmer Atem auf meiner Haut.
Jemand berührt mich. Ich werde auf meinen Rücken gerollt und stöhne. Alles tut weh. Meine Haut brennt. Meine Knochen schmerzen. Ich kann jedes Haar auf meinem Kopf spüren, als wäre es ein angezündetes Streichholz, das auf meiner Kopfhaut brennt.
In dem Schleier meiner Wahrnehmung nehme ich Hände wahr, die mich bewegen. Sie sind sanft, aber bestimmt. Und dann werde ich hochgehoben. Träume ich? Bin ich gestorben? Werde ich in den Himmel geholt? Die Liste meiner Sünden ist mit Sicherheit viel zu lang, um irgendeine Form von Vergebung zu erhalten. Ich war zwölf Jahre lang im Gefängnis. Ich habe so viele Dinge getan, die Zerra nicht gutheißen würde, selbst wenn es notwendig war, um zu überleben. Es gibt keinen ewigen Frieden, der mich erwartet.
Ich habe gekämpft. Ich habe gestohlen. Ich habe meinen Körper verkauft. Ich habe so oft Blasphemie betrieben, meine Seele ist so schwarz wie Auroras Himmel im tiefsten Winter. Vielleicht werde ich zu den Gefallenen geschickt, um für immer bei ihnen zu leben. Dort gehöre ich hin.
Aber es spielt keine Rolle, ob das mein Schicksal ist. Ich habe schon so viele Jahre an diesem trostlosen Ort gelebt. Wie könnte eine Existenz in der Hölle schlimmer sein als das hier? Die Arme, die mich umfassen, heben mich hoch, und ich recke mein Kinn Richtung Himmel, bereit, dem Herrn der Unterwelt vor die Füße zu fallen, wo ich den Rest meiner elenden Ewigkeit verbringen werde.
Falls es der Ozziller ist, der doch noch gekommen ist, um mich zu holen, dann wird er meine Gliedmaßen einzeln abreißen. Ich wollte sterben, doch ein letzter Funke Selbsterhaltungstrieb regt sich in den Überresten meines Geistes, und ich schlage um mich. Mit allerletzter Kraft kralle ich mich fest und kratze alles, was ich erreichen kann, aber ich bin kein bisschen gefährlicher als ein neugeborenes Lamm. Ich versenke meine Zähne in Fleisch, ein Knurren entspringt meiner Kehle. Ich höre ein Grunzen und spüre einen starken Schmerz, der durch meine Schulter schießt.
Und dann erinnere ich mich an nichts als Dunkelheit.
Kapitel 4
Nadir ließ seine Fingergelenke knacken, rollte seinen Nacken und versuchte, mit aller Kraft aufzupassen, während er ein Gähnen unterdrückte. Er saß an dem runden Tisch in der Mitte des Ratszimmers seines Vaters mit acht anderen High Fae. Sie waren von unterschiedlichstem Stand, und alle von ihnen taten nichts lieber, als sich selbst beim Reden zuzuhören. Der Aurorakönig saß direkt zu Nadirs Linken und warf ihm gelegentlich missbilligende Blicke zu – ein nicht allzu subtiler Hinweis darauf, welch große Enttäuschung Nadir für ihn war. Sie hatten alle seit Stunden über die Besteuerung und die wachsende Unzufriedenheit in den Minen von Savahell diskutiert.
Nadir wusste, dass diese Dinge wichtig waren, aber für all diese Themen gab es einfache, eindeutige Lösungen. Das Problem war, dass diese Speichellecker alle Ergebnisse herbeiführen wollten, die ihnen und nur ihnen selbst zugutekamen. Es war nicht genug für sie, einfach zu gewinnen, sie mussten darüber hinaus sicherstellen, dass die anderen zumindest ein bisschen litten.
Und so drehten sie sich endlos im Kreis.
Die acht High Fae herrschten jeweils über einen von Auroras Distrikten, jeder nach einer der Primärfarben der Borealis benannt: Smaragd, Purpur, Silber, Violett, Indigo, Türkis, Bernstein und Fuchsia. Ihr Leben war ein einziger Kampf um Macht und Reichtum, und alle waren davon überzeugt, dass die Beiträge des eigenen Distriks die wertvollsten waren und deswegen die größten Belohnungen verdienten. Es war armselig.
Sein Vater könnte diesen Streitereien ein Ende setzen. Als König war seine Macht nahezu absolut. Aber Rion zog es vor, den Rat bei Laune zu halten, um die versprochenen Gefälligkeiten einzusammeln, wie mit Juwelen besetzte Schätze. Letztendlich waren die Gefallen, die sie ihm schuldeten, die wertvollste Währung für einen König, der keinen Bedarf an mehr Gold oder Reichtum hatte.
Wenn Nadir den Thron erben würde, würde er diesen Unsinn beenden. Für ihn kamen nur Lösungen infrage, die Unruhen in der Bevölkerung, so gut es ging, verhinderten und – noch viel wichtiger – es ihm ermöglichten, diese Ratssitzungen schnellstmöglich hinter sich zu bringen.
Tatsächlich genoss er die Vorstellung, ihre Pläne zu vereiteln, wenn auch aus keinem anderen Grund, als um ihre Gesichter zu sehen, wenn sie von jemandem, wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben, ein Nein zu hören bekamen. Es würde ihn nicht beliebt machen, aber ihm war scheißegal, was diese Schwätzer über ihn dachten.
Nadir sah zu, wie der König jedes Detail aufsaugte, wie er jedes Wort des Rats auskostete, als wäre es der feinste Wein, den er schlürfte, schluckte und wieder auspisste, wenn er fertig war. Wenn Nadir beeinflussen wollte, wie die Dinge hier liefen, müsste er zuerst seinen Vater loswerden, aber das war eine Herausforderung, der er schon seit Jahrzehnten gegenüberstand und von deren Lösung er noch immer meilenweit entfernt war.
Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach sie, und zehn Köpfe wandten sich ihr zu. Jeder wusste, dass der Rat für nichts gestört wurde, was nicht höchste Priorität hatte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: