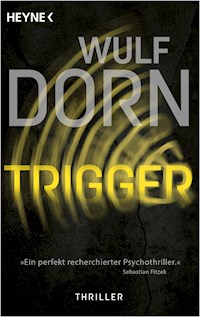9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Trigger-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das Böse kehrt zurück
Nach der rätselhaften Ermordung seiner Lebensgefährtin ist der Ex-Psychiater Mark Behrendt am Ende. Nur seiner besten Freundin Doreen verdankt er, dass er noch am Leben ist. Doch gerade, als Mark den Albtraum überwunden glaubt, kehrt der mysteriöse Mörder zurück und entführt Doreen. Er stellt Mark ein Ultimatum: Ihm bleiben knapp vier Tage Zeit, ein entsetzliches Verbrechen zu begehen. Wenn er sich weigert oder scheitert, wird Doreen sterben. Mark steht vor einer grausamen Entscheidung, und die Uhr tickt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Nach der rätselhaften Ermordung seiner Lebensgefährtin ist der Ex-Psychiater Mark Behrendt am Ende. Nur seiner besten Freundin Doreen verdankt er, dass er noch am Leben ist. Doch gerade als Mark den Albtraum überwunden glaubt, geschieht das Unfassbare: Der mysteriöse Mörder kehrt zurück und entführt Doreen. Er stellt Mark ein Ultimatum: Ihm bleiben knapp drei Tage Zeit, ein entsetzliches Verbrechen zu begehen. Wenn er sich weigert oder scheitert, wird Doreen sterben. Mark steht vor einer grausamen Entscheidung, und die Uhr tickt …
Der Autor
Wulf Dorn (*1969) war zwanzig Jahre in einer psychiatrischen Klinik tätig, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Mit seinem 2009 erschienenen Debütroman Trigger gelang ihm ein internationaler Bestseller, dem weitere folgten. Dorns Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und begeistern eine weltweite Leserschaft. Für seine Storys und Romane wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem französischen Prix Polar, dem ELLE Readers Award und dem Glauser Preis.
Lieferbare Titel
Trigger; Kalte Stille; Dunkler Wahn; Phobia; Die Kinder
WULF DORN
TRIGGER
DAS BÖSE KEHRT ZURÜCK
Thriller
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2022
Copyright © 2021 by Wulf Dorn
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Michelle Landau
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © Manitchaya / Bigstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-19682-0V002
www.heyne.de
Dies ist für euch, treue Leserinnen und Leser.
Lasst uns dorthin zurückkehren,
wo alles begonnen hat.
Und für Flo.
Du wirst trotzdem immer bei uns sein.
»Der Anblick des Bösen zündet Böses in der Seele an.
Das ist unvermeidlich.«
C. G. Jung
»Zivilisation im Übergang«
»Das Dumme am Tod ist nicht, dass er die Zukunft verändert, sondern dass er uns mit unseren Erinnerungen allein zurücklässt.«
Peter Høeg
»Fräulein Smillas Gespür für Schnee«
EIN BILD AUS DER HÖLLE (I)
So fühlt es sich also an, wenn man den Verstand verliert.
Das war sein erster Gedanke, der auf den Schock folgte. Und ja, es musste so sein, eine andere Erklärung konnte es nicht geben. Was er da vor sich sah, musste reine Einbildung sein. Eine böse Halluzination.
Aber warum, in Gottes Namen, halluziniere ich ausgerechnet so etwas Schreckliches herbei?
Weil die Grenze, die den klaren Verstand vom Wahnsinn trennt, nur eine feine Linie ist, flüsterte etwas in ihm. Und offenbar hast du diese Linie jetzt überschritten.
Ja, das war die offensichtliche Erklärung.
Er war übergeschnappt.
Einfach so. Als hätte jemand einen Hebel in seinem Kopf umgelegt.
Die ersten siebzehn Jahre seines Lebens war er ein intelligenter und aufgeweckter Junge gewesen, und heute – ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag – war er von einem Moment zum nächsten reif für die Klapsmühle geworden.
Aber konnte das wirklich sein? Konnte man ohne jegliche Vorzeichen plötzlich verrückt werden?
Oder war das alles vielleicht nur ein schlimmer Traum?
Auch das wäre gut möglich, überlegte er. Hatte nicht Albert Einstein gesagt, dass die Realität nur eine beharrliche Illusion ist? Jedenfalls behauptete das einer der vielen Aufkleber auf seiner Laptoptasche, deren Tragegurt er nun krampfhaft umklammert hielt.
Demnach könnte alles, was er in diesem Moment wahrzunehmen glaubte, nur eine gewaltige Täuschung sein. Eine von der Art, die sich verteufelt echt anfühlten.
Denn tatsächlich spürte er die Kälte des Winterabends, als würde er jetzt wirklich hier vor seinem Haus stehen. Er sah die Atemwölkchen, die stoßweise aus seinem Mund drangen – hektisch, weil er vor Entsetzen keuchte –, und er roch den Rauch, den der frostige Wind vom Schornstein herabwehte. Diesen unverkennbar würzigen Duft nach verbrannten Buchenholzscheiten, den er mit Winter und Weihnachtszeit verband.
Zudem glaubte er, die blinkenden Deko-Figuren im verschneiten Vorgarten zu sehen. Ihr bläuliches LED-Licht ließ den überfrorenen Schnee wie ein Meer aus winzigen Diamanten funkeln.
Er hatte das Rentier, den Engel mit den ausgebreiteten Flügeln, und den Weihnachtsmann, der sich mit einer »Ho Ho Ho«-Geste den dicken Bauch hielt, zusammen mit seinem Vater eine Woche vor Heilig Abend aufgestellt. Sie hatten erst die Metallgestelle zusammengeschraubt und die Figuren dann an den Steckdosen angeschlossen, die in einer Steinattrappe neben dem Hauseingang verborgen waren.
Das war jetzt acht Tage her. Er konnte sich noch deutlich daran erinnern. Das Kabel an dem blinkenden Weihnachtsmann war defekt gewesen, weshalb er im Baumarkt ein neues gekauft hatte. Bei der Verkäuferin mit der schwarzen Stoppelfrisur, auf die er heimlich stand, auch wenn sie schon über zwanzig sein musste.
Ja, bis zu diesem Punkt schien das Bild vor ihm bis ins Detail stimmig und real zu sein.
Dennoch war etwas anders. Etwas war mit diesem Bild ganz und gar nicht in Ordnung.
Er fühlte sich wie in einem bösen Fiebertraum. Santas starres Lachen kam ihm jetzt keineswegs fröhlich vor, sondern irgendwie boshaft und spöttisch. Ebenso wie das Pfeifen von Bing Crosby, dessen White Christmas aus der weit offen stehenden Haustür trällerte. Das war das liebste Weihnachtslied seiner Mutter, und dieser Tage gehörte es natürlich zu den Stammgästen auf der Playlist in ihrem Küchenradio.
Sein Blick wanderte weiter zu dem Tannenkranz, der über dem Briefkasten neben der Tür hing, verziert mit einer goldenen Schleife und vier roten Glaskugeln.
Auch dieser Kranz gehörte zum üblichen Weihnachtsritual, auf das seine Mutter bestand. Ihrer Meinung nach konnte das Haus sowohl innen als außen gar nicht genug dekoriert sein. Weil Weihnachten doch das schönste Fest von allen ist, sagte sie oft. Ein Fest für die Familie. Deshalb hing auch für jeden von ihnen eine Kugel an dem Kranz.
Aber nun waren drei dieser Kugeln zerborsten. Ihre feinen Scherben waren über den Fußabstreifer und die Stufen zum Vorgarten verstreut. Als wären sie geplatzt oder zerschlagen worden.
Und nicht weit davon entfernt lag …
… dort lag …
Nein!
Sein Verstand weigerte sich mit aller Kraft, das Bild als das anzuerkennen, was es so offensichtlich zu sein schien.
Es ist unmöglich, dachte er und hätte fast hysterisch losgelacht. Völlig unmöglich! Ich bilde mir ein, dort meine Mutter liegen zu sehen. Was für ein Blödsinn! Als ob sie sich einfach so in den Schnee legen würde. Das kann doch nur eine Einbildung sein! In Wirklichkeit ist sie jetzt bestimmt im Haus, läuft in der Küche hin und her und macht das Abendessen, so wie immer. Weil sie doch über die Feiertage ständig am Kochen und Backen ist.
Das stimmte definitiv. Ihre beste Freundin zog seine Mutter gern damit auf, dass sie während der Weihnachtszeit locker eine ganze Kompanie verköstigen könnte. Und da hätte ihr niemand aus der Familie widersprochen.
Also konnte die Frau da vor ihm nicht seine Mutter sein.
Niemals.
Weil sie ja in der Küche war.
Aber die Gestalt, die dort seltsam verrenkt auf dem Bauch lag, als wollte sie wie eine ungelenke Schwimmerin durch den knöcheltiefen Schnee kraulen, sah seiner Mutter täuschend ähnlich. Ihr Gesicht konnte er zwar nicht sehen, doch er erkannte den beigen Strickpullover mit dem Zopfmuster.
Genau so einen Pullover habe ich gestern meiner Mutter geschenkt. Sie hatte ihn sich gewünscht. Ich hatte ihn in rotes Geschenkpapier mit goldenen Weihnachtssternen verpackt. Sie hat sich so sehr darüber gefreut, dass sie ihn gleich angezogen hat. Und sie hat ihn auch heute Nachmittag angehabt, als ich aus dem Haus gegangen bin.
Also warum, zum Teufel, sollte jetzt eine Fremde den Pullover seiner Mutter tragen? Und ihre Jeans. Und die gefütterten Hausschuhe, die seine Mutter trotz Fußbodenheizung und dem Schwedenofen im Wohnzimmer immer trug, auch wenn sich alle anderen im Haus schon wie in einer Sauna fühlten. Wegen ihres niedrigen Blutdrucks klagte sie ständig über kalte Füße. Weshalb hätte sie ihre warmen Schuhe also einer anderen geben sollen?
Weil das da nicht meine Mutter sein darf!
Dieser Gedanke war so laut, dass er wie ein Schrei in seinem Kopf dröhnte. Dann schob sich ein weiterer Gedanke dazu – nicht mehr ganz so laut, aber nicht minder drängend:
Überleg doch mal. Die Frau da ist tot. Sie hat drei Löcher im Rücken. Das sind verdammte Einschusslöcher! Da ist jede Menge Blut, und ihr fehlt fast der halbe Kopf. Der wurde ihr weggeschossen! Ihre Haare, ihr Schädel, ihr Gehirn sind bis zu den Rosenbeeten verteilt!
Ja, das sah er. Oder vielmehr glaubte er, es zu sehen.
So oder so, er konnte und wollte weder die Leiche im Vorgarten akzeptieren noch die blutigen Handabdrücke an den Wänden im Flur, die er durch die offene Tür sehen konnte. Von dort aus musste sich diese Frau
(meine Mutter)
mit letzter Kraft ins Freie geschleppt haben, ehe man sie mit einem vierten Schuss niedergestreckt hatte.
Ebenso wenig wollte er wahrhaben, dass drinnen im Haus, am Ende des Flurs, zwei Beine in einer Blutlache aus der Wohnzimmertür ragten.
Denn das hätten dann die Beine seines Vaters sein müssen, wie man an den Schuhen erkennen konnte. Dann wäre ja auch sein Vater tot, und auch das konnte unmöglich wahr sein.
Aber er sah die Beine, sah das frische Blut, auf dem das Licht der Flurlampe glitzerte wie Sonnenstrahlen auf einem tiefroten Teich.
Und diese Schuhe … es waren dieselben, die sein Vater immer trug, wenn er in den Wald ging. Dasselbe derbe Profil. Dieselben Schnürsenkel. Weiß-rot, weil das die einzigen reißfesten waren, die der Schuhladen in der Innenstadt führte.
Nein, nein, nein!
Niemals würde er das glauben! Lieber zog er die Möglichkeit in Betracht, urplötzlich den Verstand verloren zu haben.
Sollten sie ihn doch in eine Zwangsjacke stecken und mit Medikamenten vollpumpen, das war ihm völlig egal. Irgendwann würde er schon wieder zu sich kommen, und wenn er dann nach Hause käme, wäre alles wie immer. Seine Familie wäre am Leben. Natürlich wäre sie das.
Weil sie, verdammt noch mal, NICHT TOT sein dürfen!
Aber dann dämmerte ihm trotz aller geistiger Gegenwehr, dass das Blinken um ihn herum nicht nur von den Figuren im Garten stammte. Die LED-Dekoration allein hätte diesen dunklen Abend nie so hell erleuchten können. Dazu brauchte es weit mehr als nur drei blinkende Figuren und eine Straßenlaterne.
Das eigentlich auffallende Blinken stammte von den Blaulichtern der Streifenwagen. Die hatte er schon von Weitem gesehen, als er vorhin nach Hause gekommen war. Immerhin bis zu diesem Punkt erklärte sich sein Verstand jetzt bereit, das Gesehene zu akzeptieren.
Und während damit die erste lähmende Welle seines Schocks nachließ, drang eine weitere Wahrnehmung in sein Bewusstsein vor: Jemand hielt ihn fest.
Ja, nun fiel es ihm wieder ein. Da waren diese beiden Polizisten. Sie waren vorhin sofort auf ihn zugelaufen, kaum dass er das Haus erreicht hatte.
Jetzt hielten sie ihn an den Armen gepackt und versuchten, ihn wegzuziehen. Weg von diesem furchtbaren Anblick.
»Komm schon, Junge«, sagte einer von ihnen. Welcher der beiden konnte er nicht sagen. Dafür reichte seine geistige Kapazität noch nicht aus. Aber er hörte sehr wohl das Entsetzen in der Stimme des Mannes.
»Na los, komm endlich mit! Schau da nicht mehr hin!«
Doch das ging nicht. Er fühlte sich wie gelähmt und konnte nur reglos auf diesen schrecklichen Anblick starren.
Eine weitere Männerstimme drang zu ihm. Diesmal von irgendwo aus dem Haus.
»Sanitäter! Hierher! Schnell!«
Das alles vernahm er noch immer seltsam gedämpft, als sei sein Kopf in Watte gepackt. Dennoch begann sein Verstand, wieder Oberhand zu gewinnen.
Er begriff – musste schließlich begreifen –, dass seine Familie wirklich tot war. Mit Schüssen aus dem Leben gerissen. Während er im Zimmer seines Freundes gesessen und auf virtuelle Gegner gefeuert hatte, um einen möglichst guten Score zu erzielen. Und das hatte er. Am Ende hatte er die Runde als Sieger verlassen.
Ein letztes Mal wünschte er sich, dass dies alles nur eine kranke Einbildung war. Nur ein beschissenes Level in einem beschissenen Videospiel. Dass vor ihm gleich Worte wie Game Over oder Neues Spiel starten erscheinen würden.
Aber so war es nicht. Auch wenn er in diesem Moment der feinen Linie zum Wahnsinn sehr nahe kam, erkannte er, dass er noch diesseits davon war. Dass alles, was er sah, die Realität war. Und auf einmal wich alle Kraft aus ihm.
Er taumelte rückwärts, und hätten ihn die Polizisten nicht gehalten, wäre er wie ein gefällter Baum der Länge nach umgefallen.
Als er so völlig erschlafft zwischen den beiden Männern hing, brach sein innerer Widerstand vollends, und er begann zu schreien.
Teil 1 JAHRESTAG
»So stemmen wir uns voran, in Booten gegen den Strom, und werden doch immer wieder zurückgeworfen ins Vergangene.«
F. Scott Fitzgerald
»Der große Gatsby«
Kapitel 1
Es heißt, einen Wahnsinnigen erkenne man daran, dass er immer wieder das Gleiche tut und erwartet, dass sich das Ergebnis verändert. Von wem auch immer dieser Spruch stammte, er hätte Mark Behrendt damit meinen können.
Wieder war es der 22. Oktober, und dieses Jahr hielt Mark bis zum Nachmittag durch, ehe er ins Schlafzimmer gehen und den Schuhkarton aus der hintersten Ecke seines Kleiderschranks holen musste. Zwar gab es derzeit niemanden, vor dem er den Karton hätte verstecken müssen, aber er zog es dennoch vor, auf Nummer sicher zu gehen, denn der Inhalt konnte ihn in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.
Seine Wohnung befand sich im sechsten Stock eines maroden Betonblocks aus den späten Siebzigerjahren. Die beiden winzigen Räume, die im Mietvertrag großspurig als Apartment bezeichnet wurden, waren zusammen kaum größer als sein früheres Wohnzimmer. Doch seit er seine ärztliche Zulassung verloren hatte, konnte er nicht mehr wählerisch sein. Auch wenn der Fahrstuhl schon seit Monaten defekt war, die Heizung nur sporadisch tat, was sie sollte, und sich an Regentagen wie diesem graue Wasserflecken an den Wänden zur Straße bildeten, war die Miete wenigstens erschwinglich.
Er ging zu dem Tisch neben der Küchenzeile, der ihm sowohl als Esstisch als auch als Arbeitsplatz diente, und musste erst das Laptop und einen Stapel Fachbücher beiseiteschieben, bevor er den Karton darauf abstellen konnte. Dann setzte er sich, atmete tief durch und nahm den Deckel ab.
Einst hatte der Karton ein Paar Laufschuhe der Marke Brooks in Größe 38 ½ enthalten, aber das lag Jahre zurück, und es kam ihm vor, als sei es in einem anderen Leben gewesen. Einem Leben, das von einer Sekunde zur nächsten beendet worden war.
Die Laufschuhe hatten Tanja gehört. Sie hatte sie an jenem Abend in Frankfurt getragen, auf den Tag genau vor sieben Jahren.
Mark fiel auf, dass er bis heute nicht wusste, was danach mit den Schuhen geschehen war. Wahrscheinlich waren sie damals an Tanjas Mutter geschickt worden, zusammen mit allem anderen, was Tanja an jenem Abend bei sich gehabt hatte – allem, bis auf ihre zerfetzte und blutige Kleidung. So viel Pietät würde die Polizei ja wohl gezeigt haben.
Aber ihre Schuhe waren heil geblieben, das wusste er. Sie hatten wie achtlos hingeworfen auf dem regennassen Asphalt gelegen, während er seine sterbende Freundin gehalten und um Hilfe geschrien hatte. Also hatte man die Schuhe höchstwahrscheinlich Tanjas persönlichen Gegenständen beigelegt. Ihre Mutter konnte er nicht mehr danach fragen, sie war vor zwei Jahren einem Krebsleiden erlegen.
Aber war der Verbleib dieser Schuhe nicht auch völlig unwichtig?
Nein, entschied er. Nichts an diesem Fall war unwichtig. Alles war von Bedeutung. Alles konnte ihn auf der Suche nach Tanjas Mörder weiterbringen. Schließlich war ein Kampf erst dann verloren, wenn man ihn aufgab.
Deshalb hatte Mark jedes noch so kleine Detail, an das er sich erinnern konnte, in dem schwarzen Notizbuch festgehalten, das obenauf in dem Karton lag. Akribisch hatte er aufgeschrieben, was er an jenem Abend gesehen und gehört hatte. Ja, selbst die Gerüche, die ihm aufgefallen waren, hatte er dokumentiert. Schließlich erinnerte man sich am deutlichsten an etwas, indem man sämtliche Sinne ansprach.
Aber nichts davon hatte ihn weitergebracht. Was er auf den knapp zweihundert Blankoseiten des Notizbuchs zusammengetragen hatte, war nicht viel mehr als ein Sammelsurium aus Eindrücken, Vermutungen und Spekulationen.
Dazwischen hatte er Tanjas Todesanzeige und die drei Presseartikel eingeklebt, die zu dem Vorfall erschienen waren. Die Schlagzeilen kannte er längst in- und auswendig.
FRAU BRUTAL ÜBERFAHREN
AMOKFAHRER ENTKOMMT UNERKANNT
WARUM MUSSTE TANJA M. STERBEN?
Letztere war in einem lokalen Boulevardblatt erschienen, und die großen fetten Buchstaben formulierten eben jene Frage, die Mark all die Jahre nicht losließ. Sie hatte sich in seinem Kopf festgefressen, ebenso wie der kreischende Zuruf von Tanjas Mörder – »Hey, Doktor!« –, ehe er aufs Gaspedal getreten und sie überfahren hatte.
Die Suche nach Antworten auf all das war für Mark längst zur Obsession geworden. Seit sieben gottverdammten Jahren.
Zwar hatte es eine kurze Zeit gegeben, in der er geglaubt hatte, sein Trauma überwunden zu haben – damals, ein Jahr nach Tanjas Tod, als er einer Freundin in London bei der Suche nach ihrem verschwundenen Mann geholfen hatte –, aber dann war etwas geschehen, das ihn vollends aus der Bahn geworfen hatte.
An einem Frühlingstag vor sechs Jahren, kurz nachdem Mark aus London zurückgekehrt war und Frankfurt gerade für einen Neuanfang verlassen wollte, hatte sich Tanjas Mörder bei ihm gemeldet. Er hatte Mark nur einen kurzen Brief zukommen lassen, aber der hatte ausgereicht, um ihn erneut in einen bodenlosen Abgrund zu reißen. Drei zornige Sätze in krakeligen Großbuchstaben:
DU ZIEHST WEG?
GLAUB NUR NICHT, DASS DU SO EINFACH DAVONKOMMST!
WIR SIND NOCH NICHT MITEINANDER FERTIG!
Diesen Zettel, der jetzt auf der letzten Seite des Notizbuchs klebte, hatte ihm ein Junge überreicht. Angeblich im Auftrag einer Frau, was die Sache noch rätselhafter gemacht hatte.
Mark ging jedoch davon aus, dass die Frau ebenfalls nur eine Botin gewesen war. Vermutlich hatte ihn der Mörder mit diesem Täuschungsmanöver zusätzlich verwirren wollen. Er schien es zu genießen, Mark im Ungewissen zu lassen und ihm nicht den kleinsten Anhaltspunkt auf seine Identität oder sein Motiv zu geben.
Aber wahrscheinlich war genau das sein Beweggrund: Er wollte Mark brechen – warum auch immer – und hatte Spaß daran.
Inzwischen wusste Mark, dass der Verfasser jener Zeilen männlich und damals zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahre alt gewesen sein musste. Ebenso, dass er Rechtshänder und beim Schreiben stark erregt gewesen war.
»Was die korrekte Interpunktion und die Wahl der Schreibung in Großbuchstaben betrifft, die eine genauere Deutung seiner Handschrift vermutlich erschweren sollen, könnte ich noch hinzufügen, dass der Schreiber über eine mittlere bis gehobene Schulbildung verfügt«, hatte der Grafologe erklärt, für dessen Gutachten ein Großteil von Marks letzten Ersparnissen draufgegangen war. »Aber das ist rein spekulativ und nur meine persönliche Meinung. Es ist ebenso möglich, dass er gar keinen Abschluss hat und einfach nur belesen ist.«
Der karierte Zettel selbst, auf dem die Nachricht stand, bot keinerlei Aufschluss. Er stammte aus einem Ringblock im A6-Format mit perforierter Abrisskante, wie es sie überall zu kaufen gab.
Dasselbe galt für die blaue Kugelschreibermine, bei der es sich um ein nichtssagendes Standardmodell handelte. Kein Lamy, Parker oder Scriveiner, sondern irgendein Billigfabrikat.
Mark hätte es nicht gewundert, wenn der Kugelschreiber ein Werbegeschenk der Autowerkstatt gewesen wäre, in die der Kerl seinen Wagen nach dem Mord wohl gebracht hatte. Das hätte seinem Zynismus noch die Krone aufgesetzt.
Womöglich hatte der Kerl dort behauptet, ein streunender Hund sei ihm vor die Motorhaube gelaufen, und wenn er es ganz geschickt angestellt hatte, hatte ihm seine Versicherung am Ende sogar noch den Schaden ersetzt. Nach allem, was Mark in den letzten Jahren hatte durchleben müssen, hatte er das Wort unmöglich längst aus seinem Wortschatz gestrichen.
Die Nachricht des Typen hatte Mark also trotz aller Bemühungen keinen Schritt weitergebracht. Trotzdem wollte er nicht aufgeben. Irgendwo in seinen Notizen und Erinnerungen musste es einen Hinweis auf den Mörder und sein Motiv geben.
Es musste einfach so sein, verdammt noch mal!
Als ehemaligem Psychiater und Experten für psychische Traumata war ihm sehr wohl bewusst, dass sein obsessives Verhalten längst pathologisch geworden war. Er litt unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom, das sich in Albträumen, Zwängen und Depressionen manifestierte.
Bei einem Patienten mit dieser Historie hätte Mark in seinem Befund zudem Begriffe wie chronisch und (noch aussagekräftiger) therapieresistent verwendet. Nicht umsonst hieß es ja immer, Ärzte seien die schlechtesten Patienten – allen voran die Angehörigen seiner Fachrichtung.
Er hatte sich nie an einen Kollegen gewandt. Aus seiner Sicht hätte das nichts gebracht, weil er jeden Therapieansatz durchschaut und sich – bewusst oder unbewusst – dagegen versperrt hätte. Stattdessen hatte er aus eigener Kraft versucht, sich zu helfen, trotz dem besseren Wissen, dass ein solcher Versuch nur in den allerwenigsten Fällen von Erfolg gekrönt war.
Zudem hätte er seinem Befund in der Rubrik für Begleiterkrankungen noch einen weiteren bedeutsamen Punkt hinzufügen müssen: exzessiver Alkoholmissbrauch.
Zwar hatte er seit einem Jahr keinen Tropfen mehr angerührt und hätte diesen Punkt somit in Klammern setzen können, aber wie hieß es doch so trefflich: Es gibt keine geheilten Alkoholiker, sondern nur Alkoholiker, die nicht mehr trinken.
Kurz gesagt hätte Mark einem solchen Patienten keine allzu optimistische Prognose ausgestellt. Deshalb lag auch das Stoffbündel in dem Schuhkarton.
Mark holte es heraus und schlug den Stoff beiseite. Einst war es die Vorderseite eines seiner Lieblings-T-Shirts gewesen, auf das die Schlüsselfrage aus David Lynchs Twin Peaks aufgedruckt war: WHO KILLED LAURA PALMER?
Diese zynische Anspielung auf seine eigene Situation war in der neuen Verwendung des Shirts durchaus beabsichtigt gewesen.
Die Pistole, die unter dem Stoff zum Vorschein kam, war eine Glock 19 mit abgeschliffener Seriennummer. Kurz nach der Kontaktaufnahme des Mörders hatte Mark sie bei einem Kerl gekauft, der in seinem Viertel nur als Jacko bekannt war.
Jacko war der Mann, von dem man alles bekommen konnte. Er hatte gegrinst, als er Mark die Pistole zusammen mit einem Päckchen 9-mm-Munition überreicht hatte, und dieses Grinsen war unmissverständlich gewesen. Ich weiß genau, was du damit vorhast, hatte es bedeutet.
Doch Mark selbst war sich bis heute nicht wirklich sicher, wofür er sich die Waffe besorgt hatte. Einerseits natürlich zum Selbstschutz, für den Fall, dass Tanjas Mörder seine Drohung eines Tages wahrmachen würde.
Zum anderen hatte Jacko mit seiner Vermutung aber auch nicht völlig danebengelegen. Sollte Mark den Kerl irgendwann doch noch ausfindig machen, wollte er sich die Option offenhalten, ihn eigenhändig zu töten. Das konnte er sich mittlerweile durchaus vorstellen, auch wenn er diesen Gedanken nie laut ausgesprochen hätte.
Und natürlich gab es noch eine dritte Möglichkeit.
Mark nahm die Pistole und spürte ihr tödliches Gewicht. Im vollen Magazin befanden sich fünfzehn Patronen, aber eine würde genügen.
Er zog den Schlitten durch, setzte sich den Lauf unters Kinn und schloss die Augen. Er spürte das kühle Metall und roch das Waffenöl, als er wieder einmal darüber nachdachte, dass es doch eigentlich ganz einfach wäre.
Es würde keine Sekunde dauern, und ich hätte endlich Frieden. Ich muss nur den Finger bewegen und abdrücken.
Sein Handy meldete sich, und nach dem dritten Klingeln legte Mark die Pistole auf den Tisch zurück. Er las den Namen auf dem Display und sah dann erschrocken auf die Zeitanzeige. Es war kurz vor acht.
Vier Stunden? Das ist doch nicht möglich! Habe ich tatsächlich wieder vier Stunden vor diesem verfluchten Karton gesessen?
Er rieb sich seufzend über Gesicht und nahm den Anruf an.
»Hi Doreen, tut mir leid, ich …«
»Du hast es vergessen, nicht wahr?« Das war nur zum Teil ein Vorwurf, in erster Linie hörte sich ihre Stimme besorgt an.
»Ähm, nein, ich habe nur gerade …«
»Keine Ausreden, Mark! Du weißt doch, wer andere belügt, belügt sich auch selbst. Und gerade das ist für Leute wie uns besonders gefährlich. Hast du getrunken?«
»Um Himmels willen, nein! Ich …«
»Gut, dann hör mir jetzt genau zu. Ich gebe dir noch eine halbe Stunde, um deinen Hintern hierherzubewegen. Keine Sekunde länger.«
Mark warf einen Blick auf die Pistole und schluckte.
Fast hätte ich es getan, durchfuhr es ihn, und er spürte, wie er zu zittern begann.
»Okay«, sagte er. »Ich bin gleich bei dir, versprochen!«
»Das hoffe ich«, entgegnete sie knapp und legte auf.
Eilig packte er wieder alles in den Karton und stellte ihn an die gewohnte Stelle im Kleiderschrank zurück. Dort würde die Glock wie immer geduldig auf ihn warten, aber ein Gefühl sagte ihm, dass er sie schon bald wieder herausholen würde. Sehr bald.
Und vielleicht würde er sie dann benutzen.
Kapitel 2
Eine halbe Stunde später stieg Mark aus der Straßenbahn und eilte durch den Regen auf den großen Wohnblock zu, in dem Doreen Nader wohnte. Es war bereits dunkel, und am wolkenverhangenen Oktoberhimmel tanzten Blitze mit den Blinklichtern der Flugzeuge um die Wette, die im Sinkflug auf den nahen Flughafen zusteuerten.
Auch wenn Doreens Wohnung nicht weit von seiner entfernt lag, unterschied sich diese Gegend doch grundsätzlich von seinem Viertel.
Der Gehweg war hell beleuchtet. Man musste keinen Glasscherben, Hundehaufen oder achtlos weggeworfenem Müll ausweichen. Die Hausfassaden waren nicht mit Tags besprüht oder mit Plakaten zugepflastert, und man fühlte sich deutlich sicherer, selbst wenn man allein unterwegs war.
Typen wie Jacko wären hier sofort aufgefallen.
Unterwegs hatte Mark kurz bei Sergios Ristorante haltgemacht, und nun drückte er mit einer Papiertüte in der Hand und einer Flasche unter dem Arm den Klingelknopf neben dem Hauseingang.
Der Türöffner summte, und als Mark gleich darauf in den Aufzug stieg, wurde ihm bewusst, wie bizarr dieser Moment doch war. Hätte Doreen ihn nicht angerufen, wäre er jetzt vielleicht nicht mehr am Leben.
Nein, nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher. Diesmal hätte er abgedrückt, und der einzige Grund, warum er es nicht getan hatte, war Doreen. Weil er sie nicht enttäuschen wollte. Jedenfalls nicht heute. Dieser gemeinsame Abend war ihr wichtig, daran hatte sie ihn mit ihrem Anruf erinnert. Also würde er sie in dem Glauben lassen, er habe sich mal wieder aus Unachtsamkeit verspätet, und sie würde enttäuscht sein, auch wenn sie es sich wahrscheinlich nicht anmerken lassen würde.
»Wahre Freunde sind wie ein Lotteriegewinn«, hatte ihm sein Vater schon früh beigebracht. »Wenn man mal das große Los gezogen hat, sollte man dessen Wert zu schätzen wissen, sonst ist all das Gute schnell wieder verloren. Schreib dir das hinter die Ohren, Junge.«
Das würde er in Zukunft besser beherzigen, nahm er sich vor – jetzt, wo er sich dazu entschieden hatte, noch ein wenig weiterzuleben. Mit seiner Trinkerei und seinem egozentrischen Verhalten hatte er in den letzten Jahren schon genug Menschen vergrault, die es gut mit ihm gemeint hatten, und Doreen wollte er auf gar keinen Fall verlieren. Doreen war nicht nur wie ein Lotteriegewinn, sie war für ihn wie der Jackpot des Jahrhunderts.
Als er aus dem Aufzug trat, erwartete sie ihn bereits in der offenen Tür zu ihrer Wohnung. Mark fand, dass sie heute Abend ganz besonders bezaubernd aussah. Statt des sonst üblichen praktischen Pferdeschwanzes trug sie ihr blondes Haar mit einer schwarzen Spange hochgesteckt, was sie zugleich elegant und einige Jahre jünger wirken ließ. Dazu hatte sie für den heutigen Anlass ein schulterfreies Kleid gewählt, dessen weinrote Farbe mit ihrem Nagellack und Lippenstift harmonierte. Hätte er es nicht besser gewusst, hätte er seine beste Freundin jetzt um zehn Jahre jünger auf etwa Anfang vierzig geschätzt.
»Guten Abend, der Herr«, sagte sie und deutete auf die Tüte. »Falls du mir ein Zeitschriften-Abo oder eine Versicherung andrehen willst, bist du an der falschen Adresse. Aber wenn das da drin etwas von Sergio ist, kommst du besser schleunigst herein.«
Wie er es vermutet hatte, überspielte sie ihre Enttäuschung. Also trug er seinen Teil dazu bei, indem er weitere Ausreden oder eine Entschuldigung vermied. Stattdessen grinste er und fächelte den Duft, der der Tüte entstieg, mit der Hand in Richtung Tür.
»Die besten Antipasti der Stadt, Signora«, sagte er, wobei er Sergios italienischen Akzent nachahmte. »Wie das schon duftet! Frutti di Mare mit frischen Kräutern, etwas Zitrone und einem Hauch von Knoblauch. Du wirst bei jedem Bissen das Meer rauschen hören.«
»Vor allem werde ich mir heute Nacht wohl keine Sorgen um Vampire machen müssen. Du hast es echt noch geschafft, in der kurzen Zeit was bei Sergio zu holen?«
Er zwinkerte ihr zu. »Na ja, an manchen Tagen bin ich zwar etwas vergesslich, aber ich kenne das Zauberwort.«
Sie hob amüsiert eine Braue. »Ach ja? Und wie lautet es?«
»Vorbestellung.«
Sie lachten beide, und damit war sämtliche Spannung zwischen ihnen verflogen. Dann zog ihn Doreen am Jackenärmel durch die Tür.
»Jetzt komm endlich rein. Ich sterbe schon vor Hunger.«
Das tat er und hielt dabei die mit einer Goldschleife dekorierte Flasche San Pellegrino hoch.
»Von unserem Freund, frisch aus den tiefen Quellen von Bergamo«, imitierte er den Italiener erneut. »Für unseren besonderen Abend.«
»Das ist aber nett von ihm«, sagte sie und schloss die Tür hinter sich. »Wie geht es unserem Lieblingsitaliener denn? Ich habe ihn bei den letzten Gruppentreffen vermisst. Er hat doch nicht etwa wieder angefangen?«
»Glaube ich nicht«, sagte Mark und stellte die Tüte in der Küche ab. »Sah eher so aus, als wäre viel zu tun bei ihm. Das Lokal war bis auf den letzten Platz besetzt, und Sergio wirkte so nüchtern wie der Papst. Ich soll dich übrigens von ihm grüßen.«
»Vom Papst?«
Mark nickte mit gespielt ernstem Blick. »Natürlich, von wem sonst?«
Doreen holte zwei Champagnergläser aus dem Küchenschrank und Mark goss ihnen das Mineralwasser ein.
»Auf dich, mein Lieber«, sagte sie und prostete ihm zu. »Auf dein erstes trockenes Jahr! Ich bin stolz auf dich, dass du durchgehalten hast. Erst recht, weil du dir dieses besondere Datum dafür ausgesucht hast. Dadurch hast du jetzt etwas Negatives durch etwas Positives ersetzt. Gratuliere!«
»Und auf dich«, erwiderte er, und war etwas verlegen. »Ohne dich hätte ich das nie geschafft.«
Sie schüttelte den Kopf. »Komm schon, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Ich war nur deine Sponsorin. Geschafft hast du es ganz allein, wie jeder von uns. Und irgendwann bist du dann hoffentlich auch so weit, jemand anderen aus der Gruppe auf diesem Weg zu unterstützen.«
»Mal sehen, erst muss ich selbst noch etwas durchhalten«, sagte er und hielt ihr sein Glas entgegen. »Dann eben auf uns beide. Denn ohne dich wäre ich auf jeden Fall im Guinnessbuch der Rekorde verewigt worden. Als die Leiche mit der höchsten jemals gemessenen Promillezahl.«
Darauf stießen sie an.
»Gut, dass es nicht dazu gekommen ist«, sagte Doreen, nachdem sie einen großen Schluck getrunken hatte. »Ich hoffe, das bleibt auch so. Schließlich wirst du noch gebraucht. Zum Beispiel, um uns zwei Teller zu holen, ich habe jetzt nämlich richtig Hunger.«
Mark tat, wie ihm geheißen, und sie genossen die reichhaltige Auswahl an Antipasti, die Sergio für sie zubereitet hatte.
Während des Essens führten sie Small Talk und lachten viel, und Mark kam es immer mehr wie ein böser Traum vor, dass er sich keine Stunde zuvor noch den Lauf einer Pistole ans Kinn gesetzt hatte, mit der ernsthaften Überlegung, den Abzug zu drücken.
An diesem unbeschwerten Abend, mit gutem Essen und Kerzen auf dem Tisch, nahm er seit Langem mal wieder wirklich wahr, dass er lebte. Wie so vieles andere, hatte er das Doreen zu verdanken.
Er bewunderte ihre Stärke. Auch sie hatte eine dunkle Phase in ihrem Leben hinter sich bringen müssen, aber im Gegensatz zu ihm schien sie sich nie völlig aufgegeben zu haben. Es war, als hätte sie Zugang zu einer geheimen Quelle, aus der sie Kraft schöpfen konnte.
Als sie nach dem Essen mit zwei Espressotassen aus der Küche kam, sah er sie ernst an.
»Vielleicht verderbe ich uns jetzt den Abend, aber darf ich dich etwas fragen?«
»Klar«, sagte sie und setzte sich. »Was willst du wissen?«
»Nun ja, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, und ich weiß, dass du etwas Schlimmes erlebt hast. In der Gruppe bist du nie ins Detail gegangen, aber vielleicht willst du ja mir erzählen, was es gewesen ist? Denk jetzt bitte nicht, dass ich aus Neugier frage. Ich versuche nur zu verstehen, wie du es geschafft hast, darüber hinwegzukommen.«
Sie wich seinem Blick aus und schob ihm seine Tasse zu. Dann nippte sie an ihrem Espresso, runzelte die Stirn und nickte.
»Ja, ich sollte es dir wohl sagen. Immerhin kenne ich ja auch deine ganze Geschichte. Quid pro quo, und so. Und vielleicht hilft es dir ja wirklich.«
»Du musst nicht, wenn du nicht willst.«
Sie winkte ab. »Doch, doch, das ist schon in Ordnung. Du bist schließlich ein sehr guter Freund. Aber du musst mir versprechen, dass du es niemandem erzählst, ja?«
»Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab.«
Abermals hob Doreen ihre Tasse, trank aber nicht daraus, sondern sah sie nur nachdenklich an, und stellte sie dann wieder auf den Untersetzer zurück.
»Weißt du, ich hatte mit meinen Beziehungen nie viel Glück«, begann sie. »Irgendwie hat es mich immer zu diesen Alphatypen hingezogen, die einen mit Haut und Haaren besitzen wollen. Mein Letzter war der schlimmste von allen. Die personifizierte Eifersucht. Sobald mich ein anderer auch nur angeschaut hat, hatten wir Stress deswegen.«
»Warum hast du dich dann nicht von ihm getrennt?«
»Tja, weil er eben auch sehr charmant sein konnte, und weil ich so dumm war, immer wieder darauf hereinzufallen. Und dann wurde ich auch noch schwanger von ihm.«
Sie starrte vor sich auf den Tisch, und als sie weitersprach, begann sie nervös an ihrer Serviette herumzunesteln. »Eines Abends bin ich dann mit einer Freundin ins Kino gegangen. Wir wussten nicht, dass der Film Überlänge hatte, aber ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht. Danach waren wir noch eine Kleinigkeit essen, und es war ein richtig schöner Abend. Aber als ich dann nach Hause kam, ist er völlig ausgerastet. Er unterstellte mir, dass ich ihn angelogen und mich mit einem anderen Kerl getroffen hätte. Er schrie rum und hörte mir gar nicht mehr zu. Schließlich drängte er mich in eine Ecke im Wohnzimmer und … Na ja, er hat mich geschlagen. Ziemlich heftig. Er war sehr stark, weißt du? Und dann …«
Sie brach ab, aber gerade als Mark sagen wollte, dass sie nicht weitererzählen musste, weil er glaubte, den Rest ihrer Geschichte zu ahnen, fuhr sie fort.
»Er hat mich vergewaltigt, Mark, aber das war nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer war, dass ich deshalb mein Baby verloren habe. Ich war damals im sechsten Monat. Danach konnte ich keine Kinder mehr kriegen. Das Leben hat mich also gleich doppelt gestraft.«
Nun rang sie mit den Tränen und wischte sich hastig übers Gesicht. »Ich wurde komplett depressiv und habe angefangen, meinen Kummer zu ertränken. Ich bin einfach nicht mehr anders klargekommen. Jedenfalls dachte ich das damals. So wie du und all die anderen von uns auch. Tja, und irgendwann brauchte ich diesen Zustand dann ständig. Ich war voll drauf. Am Ende war es eine Flasche Wodka am Tag, manchmal auch mehr.«
Sie schlug die Augen nieder, und für einen Moment blieb es so still im Zimmer, dass man das leise Sprudeln der Kohlensäure in den Wassergläsern hören konnte.
»Tut mir leid«, sagte Mark schließlich. »Ich hätte wohl besser nicht mit dem Thema anfangen sollen.«
Doreen hob den Blick und lächelte. »Nein, das ist schon in Ordnung. Irgendwie tut es ja auch gut, darüber zu sprechen, und nicht alles in sich hineinzufressen.«
»Was ist aus dem Kerl geworden?«
»Ich habe ihn angezeigt, und er ist in den Knast gewandert. Beim Prozess habe ich dann erfahren, dass er vorbestraft war, weil er schon einmal eine Frau geschlagen hatte. Und weißt du, wie viel er bekommen hat? Ein Jahr und einen Monat! Immerhin ohne Bewährung, ist das nicht toll?« Sie schnaubte verächtlich. »Ein Jahr und einen Monat für zwei zerstörte Leben.«
Sie stieß angesichts von Marks Sprachlosigkeit ein düsteres Lachen aus.
»Ich war so dumm, Mark! Ich hätte schon viel früher erkennen müssen, was für ein Arschloch er war, und dass ich mich niemals von ihm hätte abhängig machen dürfen. Aber er wäre nun mal der Vater meines Kindes gewesen, und manche Dinge will man wohl einfach nicht sehen, wenn man sonst etwas Grundlegendes verändern müsste.«
»Das ist wohl wahr«, stimmte er ihr zu. »Manchmal wartet man einfach zu lange, bis man das Richtige tut.«
»Das kannst du laut sagen«, stimmte sie ihm zu. »In der Zeit, in der er im Gefängnis war, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Ich habe sämtliche Brücken hinter mir abgebrochen, und bin dreimal umgezogen, weil ich eine Heidenangst hatte, dass mich dieser Scheißkerl nach seiner Entlassung suchen würde. Ich war regelrecht paranoid deswegen. Bei solchen besitzergreifenden Arschlöchern weiß man ja nie, wie weit ihre Fühler reichen und was die für Verbindungen haben, dachte ich. Dadurch ist das mit dem Trinken nur noch schlimmer geworden, und ich schäme mich bis heute dafür.«
Mark griff nach ihrer Hand und drückte sie. »Dafür gibt es keinen Grund. Du hattest Angst, das ist völlig verständlich. Und wenn man sich fürchtet, kann es schon mal passieren, dass man etwas Dummes tut.«
Sie lächelte ihn wieder an, aber diesmal erreichte das Lächeln nicht ihre Augen. Stattdessen sah er in ihrem Blick etwas Kaltes aufblitzen, das er noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte.
»Am Ende hat das Leben aber auch ihn bestraft«, sagte sie, und nun schwang verhaltener Triumph in ihrer Stimme mit. »Irgendwann habe ich erfahren, dass er drei Wochen vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine Hirnblutung hatte. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber seither sabbert der Dreckskerl in einem Rollstuhl vor sich hin und wird nie wieder eine Frau anfassen. Es gibt also anscheinend wirklich so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit im Leben. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann wäre es mir lieber gewesen, wenn ich ihn in diesen Rollstuhl verfrachtet hätte. Findest du, dass das ein abartiger Gedanke ist?«
Mark schüttelte den Kopf. »Nein, ist es nicht. Jeder von uns hat mal Rachefantasien. Das ist nicht abartig, sondern hilft der Seelenhygiene. Irgendwie muss man seine aufgestaute Wut ja ausleben können. Und solange das nur im Kopf passiert, ist es ja auch völlig okay.«
»Da hast du wahrscheinlich recht«, sagte sie und entzog ihm ihre Hand. »Aber trotzdem …«
Sie ließ diesen Satz unbeendet, griff nach ihrer Tasse und kippte nun den Espresso runter wie eine routinierte Trinkerin einen Schnaps. Dann sah sie Mark tief in die Augen.
»Mich hat damals auch jemand gerettet«, sagte sie. »So, wie ich dich. Sie war eine sehr gute Freundin von mir, und sie hat mich damals in meiner Wohnung gefunden, als ich kurz davor war, an einer Alkoholvergiftung draufzugehen. Du und ich, wir haben also ziemlich viel gemeinsam.«
»Sieht ganz so aus«, erwiderte Mark, und musste an jene Nacht vor etwas mehr als einem Jahr denken, als er versucht hatte, sich nach dem Verlust seiner Zulassung vollends ins Grab zu trinken. Ohne Doreens beherztes Eingreifen und einen fähigen Notarzt, der zufällig in der Nähe gewesen war, wäre ihm das auch gelungen.
»Hast du noch Kontakt zu dieser Freundin?«
»Nein«, sagte Doreen und schlug die Augen nieder. »Sie ist gestorben. Aber sie hat mir einen wichtigen Rat gegeben, und der wird mich immer an sie denken lassen. Es ist der wichtigste Rat, den ich jemals von jemandem bekommen habe: Wenn du einen Weg nicht mehr weitergehen kannst, dann geh einen neuen Weg.«
Nun war es Mark, der ihrem Blick nicht standhalten konnte. »Ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Aber so einfach ist das nicht.«
»Das habe ich auch nicht behauptet, Mark. Ich will dir damit nur sagen, dass du es wenigstens versuchen solltest. Du gibst dir ja nicht einmal eine Chance. Warum lässt du deine Vergangenheit nicht endlich los? Du kannst deine Freundin nicht mehr lebendig machen. Sie ist tot, aber du lebst noch!«
Seufzend rieb sich Mark mit den Händen übers Gesicht. »Ich kann das nicht, Doreen. Wenn ich Tanja jetzt loslassen würde, ohne ihr vorher Gerechtigkeit zukommen zu lassen, dann wäre das für mich so, als würde sie zum zweiten Mal sterben. Nur, dass es diesmal ich bin, der sie umbringt. Weil ich sie dann aufgeben würde. Kannst du das verstehen?«
»Ja, das kann ich. Aber ich sehe auch, was aus dir geworden ist. Weil du so sehr an ihr festhältst, hast du dich selbst aufgegeben. Du bestrafst dich immer noch für etwas, das du nicht verhindern konntest, musst dich deswegen jetzt als Ghostwriter für andere über Wasser halten und haust in einer Bruchbude. Dabei steckt so viel Potenzial in dir. Warum schreibst du deine Fachartikel nicht wieder unter deinem eigenen Namen und holst dir deine Reputation zurück? Das könntest du, davon bin ich überzeugt.«
Mark schüttelte den Kopf. »Ach, komm schon. Das ist illusorisch, und das weißt du auch. Ich bin wegen Körperverletzung vorbestraft, das habe ich dir erzählt. Deswegen habe ich ja meine ärztliche Zulassung verloren. Kein Fachmagazin, das etwas auf sich hält, würde einen wie mich auch nur mit der Kneifzange anfassen, geschweige denn veröffentlichen.«
»Dann mach eben etwas anderes«, beharrte sie. »Das habe ich auch getan. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon einmal erzählt habe, aber bis zu dem Vorfall damals war ich Kinderkrankenschwester. Kinder waren mein Ein und Alles. Aber danach konnte ich das einfach nicht mehr. Zwischendurch war es sogar so schlimm, dass ich die Straßenseite wechseln musste, wenn mir eine Frau mit ihrem Baby entgegengekommen ist oder wenn da auch nur ein Kinderladen war. Ich konnte das alles nicht mehr ertragen. Deswegen engagiere ich mich jetzt in unserer Selbsthilfegruppe und arbeite im Frauenhaus. Mit Kindern kriege ich das nicht mehr hin, aber ich kann zumindest ihren Müttern helfen. Auch das ist eine wichtige Aufgabe. Und so eine Aufgabe solltest du auch für dich finden.«
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach er. Dann hob er seine Tasse, um das Thema zu wechseln. »Möchtest du noch einen? Diesmal würde ich uns einen Espresso zaubern. Dafür habe ich ein Händchen, glaub mir. Vielleicht werde ich irgendwann sogar noch ein Barista.«
Sie grinste. »Ich versuche gerade, mir dich in so einer langen braunen Schürze vorzustellen. Könnte sexy aussehen, ganz besonders mit einer aufgedruckten Kaffeebohne auf der Brust.«
»Einer heißen, dampfenden Kaffeebohne«, sagte Mark und grinste ebenfalls.
»So sexy das auch klingt, mein Lieber, ich muss trotzdem ablehnen. Wenn ich um diese Zeit noch einen Espresso trinke, bekomme ich heute Nacht kein …«
Das Läuten ihrer Türglocke unterbrach sie.
»Erwartest du noch jemanden?«, fragte Mark verwundert.
Doreen sah zu ihrer Wanduhr. »Nein, aber ich kann mir schon denken, wer das ist.«
»Ach ja? Wer denn?«
»Mein Nachbar.«
»Um zehn nach elf?«
»Ja, wäre nicht das erste Mal«, sagte sie, und erhob sie sich mit einem Seufzer. »Der Gute ist zweiundachtzig, hat seit einigen Wochen einen neuen Fernseher und steht angeblich mit seiner Fernbedienung auf Kriegsfuß. Ich denke aber, dass er einfach nur einsam ist und hin und wieder ein nettes Gespräch braucht.«
Mark stand ebenfalls auf und deutete eine Verbeugung an. »Doreen Nader, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einfach zu gut bist für diese Welt?«
»Ja, du gerade. Ich bin gleich wieder da. Falls du dich in der Zwischenzeit für dich selbst als Barista versuchen willst, bedien dich ruhig.«
Sie war schon fast aus dem Raum, als sie sich noch einmal umdrehte.
»Wegen vorhin … Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich bin froh, dass du mich gefragt hast. Mir ist es wichtig, dass du Bescheid weißt, und es war gut, mit dir darüber zu reden.«
Er nickte. »Es war gut für uns beide. Danke.«
»Ich muss dir danken, mein Lieber. Und jetzt mach dir einen Espresso, ich bin gleich zurück.«
Damit ging sie in ihren kleinen Flur hinaus, und Mark machte sich auf den Weg in die Küche.
Im Gegensatz zu seiner winzigen Kochnische, in der es nur eine defekte Kochplatte, eine Mikrowelle und eine Kaffeemaschine gab, war Doreens Küche geradezu riesig.
Früher, in seinem alten Leben, hatte er leidenschaftlich gern gekocht. Damals hätte er sich nicht im Traum vorstellen können, dass er sich irgendwann mal fast nur noch von Mikrowellengerichten und Fast Food ernähren würde. Doch genau das hatte er in den letzten Jahren getan.
Ja, es war wirklich an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen und seine vernachlässigten Talente wieder aufleben zu lassen, dachte er.
Er füllte Kaffeepulver in den Filter, und dann stutzte er. Irgendwas in seinem Inneren sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Zuerst war ihm nicht klar, woher dieses Gefühl kam, aber dann dämmerte es ihm.
Es war viel zu ruhig.
Wenn Doreen im Flur stand und sich mit ihrem Nachbarn unterhielt, müsste er sie hören. Immerhin würden die beiden ja nicht im Flüsterton miteinander reden – schon gar nicht, wenn ihr Nachbar ein alter Mann mit einem vielleicht nicht mehr ganz so guten Gehör war.
Stirnrunzelnd kehrte Mark ins Wohnzimmer zurück und blieb erschrocken stehen.
Doreen stand mit weit aufgerissenen Augen im Durchgang zum Flur. Mit einer Hand stützte sie sich an der Wand ab, während sie die andere seitlich an den Hals gedrückt hielt. Sie schwankte und schien sich kaum auf den Beinen halten zu können.
»Mark«, stieß sie mit schwacher Stimme hervor. »Mark, er hat … er hat …«
Dann sank sie in sich zusammen.
Mark machte einen Satz nach vorn und konnte sie gerade noch auffangen, ehe sie auf dem Boden aufgeschlagen wäre.
»Doreen, um Himmels willen, was ist denn passiert?«
Doch sie hing nur schlaff in seinen Armen, und für einen Augenblick durchfuhr ihn ein schrecklicher Gedanke.
Sie ist tot! Mein Gott, sie ist tot!
Er legte sie auf den Boden und tastete nach ihrer Halsarterie.
Ihr Puls war noch da. Zum Glück! Aber er fühlte sich schwach und unregelmäßig an.
Als er seine Hand zurückzog, sah er einen kleinen Blutstropfen. Er wischte ihn weg und erkannte bei genauerem Hinsehen eine winzige Einstichstelle.
Noch während er zu verstehen versuchte, wie sie dorthin gekommen war, nahm er eine Bewegung hinter sich wahr und wirbelte herum. Im selben Augenblick traf ihn ein heftiger Fausthieb an der Schläfe.
Mark schlug mit dem Kopf neben Doreen auf dem Boden auf, und vor seinen Augen explodierte ein Sternenmeer. Er nahm undeutlich einen Schatten wahr, der sich über ihn beugte, und dann stach etwas in seinen Hals.
Verzweifelt versuchte er, nach dem Schatten zu schlagen, aber dann entglitt ihm sein Bewusstsein, und die Welt um ihn verschwand in Dunkelheit.
Kapitel 3
Das durchdringende Biiiiep-biiiiep-biiiiep des Weckers holte Mark aus dem Schlaf. Als er die Augen öffnete, wurde er vom Sonnenlicht geblendet, das durch die nur halb geschlossenen Lamellen der Jalousie ins Schlafzimmer fiel.
War für heute nicht Regen vorhergesagt?, überlegte er benommen. Da muss sich der Wetterdienst wohl geirrt haben.
»Oh nein, nicht jetzt schon«, murmelte Tanja in ihr Kopfkissen. »Nur noch ein paar Minuten.«
Sie tastete schlaftrunken nach dem Wecker und ließ ihn mit einem Klaps auf die Schlummertaste verstummen. Dann schmiegte sie sich mit dem Rücken an Mark, der seinen Arm um sie legte. Mit der anderen Hand strich er ihr Haar beiseite und küsste sie in den Nacken, worauf sie ein wohliges Grummeln von sich gab.
»Mmh, ja, das ist schön.«
»Weißt du, was noch viel schöner wäre?«, flüsterte er ihr ins Ohr.
»Was denn?«
»Wenn du nicht in deine Wohnung zurückmüsstest, um dich umzuziehen. Dann hätten wir jetzt noch Zeit für ein kleines Frühstück. Oder auch für etwas anderes.«
Er küsste abermals die Stelle unterhalb ihres Haaransatzes, wo sie es besonders gern mochte, und ließ seine Hand dabei sanft ihren Körper entlanggleiten.
»Ja, das wäre schön.«
»Dann lass es uns doch ändern«, schlug er vor.
Er ließ seine Hand unter die Decke wandern und fühlte, dass sie nichts als ihren Slip trug. Ihr straffer Bauch war warm und von einem feinen Film aus Schlafschweiß bedeckt.
Als er sanft ihre Brüste berührte, drückte sie sich noch fester an ihn. Ihr Po schmiegte sich gegen seinen Unterleib und verursachte ihm ein angenehmes Kribbeln.
»So könnte es jeden Morgen sein«, flüsterte er. »Dann hätte ich mehr Zeit, um dich hier zu küssen, und hier, und hier.«
Als seine Lippen ihre Schulter erreichten, wand sie sich ein wenig und drückte sich noch tiefer in ihr Kissen. »Jetzt nicht, Mark. Ich muss wirklich gleich los. Heute bin ich mit der Morgenvisite dran, da darf ich nicht zu spät kommen.«
»Siehst du, genau das meine ich«, sagte er, ohne von ihr abzulassen. »Wenn wir zusammenwohnen würden, wäre jetzt noch ein bisschen was möglich, ehe du losmusst.«
»Aber das geht doch nicht.«
»Was spricht denn dagegen? Wir könnten uns zusammen eine Wohnung suchen. Ich habe mich neulich mit einem Makler unterhalten. Er hätte ein paar interessante Angebote, und die sind gar nicht mal so teuer. Auf jeden Fall wäre das günstiger als die Miete für zwei Apartments. Wir könnten uns doch mal was davon ansehen, was meinst du?«
»Bitte, Mark, sag das nicht.«
Das Kissen dämpfte ihre Stimme, trotzdem glaubte Mark, sie jetzt schluchzen zu hören.
»Was ist denn los?«, fragte er erschrocken. »Was hast du denn?«
Urplötzlich schnellte sie hoch, wirbelte zu ihm herum und Mark blieb fast das Herz stehen.
Entsetzt starrte er in ein Gesicht, das keines mehr war. Tanja hatte keine Augen mehr. Selbstverständlich hat sie keine mehr, durchfuhr es ihn. Die Wucht, mit der ihr Kopf auf die Motorhaube geprallt war, hatte ihre Wangenknochen zerschmettert und ihre Augäpfel in den Schädel getrieben, wo sie wie Weintrauben zerquetscht worden waren.
Deshalb stand auch ihr Nasenbein unnatürlich zur Seite ab, und der Knochen leuchtete weiß aus einer roten Masse hervor, die einst von zarter Haut bedeckt gewesen war. Haut, die sie mit teuren Tages- und Nachtcremes gepflegt und mit Make-up und Rouge geschminkt hatte, ehe der Asphalt sie ihr wie grobes Schmirgelpapier vom Gesicht gerissen hatte.
Tanjas zertrümmerter Mund hatte kaum noch Zähne, und ihre Zunge zuckte schlangenartig, als sie ein gutturales Kreischen ausstieß.
»Es geht nicht, weil ich TOT bin!«
Kapitel 4
Mark wälzte sich hin und her, wobei er wild um sich hieb, um das grässliche Ding abzuwehren – dieses verunstaltete Monster, das einst die Frau gewesen war, die er geliebt hatte.
Er versuchte zu schreien, aber da war etwas Fettes, das seinen Mund ausfüllte. Etwas, das wie ein verwesendes Tier schmeckte und ihn erst recht in Panik versetzte. Wieder und wieder schlugen seine Fäuste ins Leere, und als sein Verstand endlich klarer wurde, begriff er auch warum.
Ein Traum, dachte er, halb erleichtert, halb noch im Schock, und dann ließ er die Arme sinken.
Es war nur ein Traum. Zum Glück war es nur ein Traum!
Sein Mund war völlig ausgetrocknet, und das fette Etwas darin stellte sich als seine eigene Zunge heraus. Sie klebte wie eine aufgeblähte Schnecke in seiner Mundhöhle.
Mark schmeckte seinen getrockneten Speichel, und ihm war speiübel. Aber noch schlimmer waren die Kopfschmerzen. Himmel, es fühlte sich an, als würde sein Schädel bei jedem Pulsschlag anschwellen.
Ächzend stemmte er sich hoch, worauf sein Kreislauf sofort energisch protestierte. Der Raum um ihn herum verschwamm und begann sich zu drehen, als säße er in der Mitte eines Kinderkarussells.
Als er es endlich geschafft hatte, sich halb aufzurichten, und sich die Schläfen massierte, ließen der Schwindel und das Pochen langsam nach. Es war wie mit diesem albernen Ratschlag, einen Fuß auf den Boden zu drücken, wenn sich im Suff alles drehte. Angeblich sollte das helfen – und genauso half das klischeehafte Schläfenreiben nun auch, warum auch immer.
Verdammt, dieser Zustand kam ihm erschreckend vertraut vor. Dabei hatte er doch gar nichts getrunken.
Oder doch?
Er konnte sich nicht erinnern. Sein Gehirn hatte den Betrieb noch nicht wieder ganz aufgenommen. Es setzte sich qualvoll langsam in Gang, und die Rädchen seines Verstandes befanden sich noch weitgehend im Leerlauf.
Deshalb höre ich wohl auch immer noch den Wecker, was ja gar nicht sein kann.
Schließlich hatte der ja nur in seinem Traum klingeln können, da dieser Wecker ebenso wie sein ehemaliges Schlafzimmer in der Frankfurter Wohnung nur noch eine Erinnerung war. Und selbst wenn Tanja, die ebenfalls nur noch in seinen Träumen existieren konnte, nur die Schlummertaste gedrückt hatte, sollte er den Traumwecker eigentlich nicht mehr hören können. Weil er jetzt wach war. So war das doch mit Träumen, oder nicht?
Trotzdem hörte er das Klingeln weiterhin. Das Geräusch gesellte sich zu dem Pochen in seinen Schläfen und zerrte an seinen Nerven.
Als er benommen nach der Quelle des Klingelns Ausschau hielt, sah er sein Handy. Es lag etwa einen oder zwei Meter von ihm entfernt – so genau konnte er das in seinem momentanen Zustand noch nicht einschätzen – und tanzte vibrierend über den Laminatboden.
Seltsam, wunderte er sich. In meiner Wohnung liegt doch gar kein Laminat. Nur billiges PVC.
Dann rasteten die Rädchen in seinem Kopf schließlich ein, und das Erste, was sein Verstand hervorbrachte, war ein einzelnes Wort.
Doreen!
Erschrocken schnellte er hoch, und wäre fast wieder umgefallen, als eine neue Woge aus Schwindel und Schmerz durch seinen Schädel rollte. Er konnte sich gerade noch am Esstisch festhalten und stützte sich mit den Händen auf der Tischplatte ab.
Dann verstummte das schmerzhafte Klingeln, das Handy beendete seine Kriechtour über den Boden und das Display erlosch.
Keuchend sah er sich um und registrierte dabei endlich, dass er sich in Doreens Wohnung befand. Er krächzte ihren Namen, wobei sich seine raue Stimme wie ein rostiges Scharnier anhörte, doch Doreen gab keine Antwort.
Er war allein.
Schließlich nahm sein Verstand vollends die Arbeit auf, und ihm fiel alles wieder ein. Jemand hatte ihn niedergeschlagen und mit einer Spritze in den Hals betäubt. Und zuvor hatte dieser Jemand dasselbe mit Doreen getan. Dass sie jetzt nicht mehr hier war, konnte nur bedeuten, dass sie entführt worden war.
Er erinnerte sich, dass all das um kurz nach elf Uhr nachts geschehen war. Aber nun war es draußen hell.
Wie viel Zeit war vergangen?
Mark sah zur Wanduhr, aber es dauerte eine Weile, bis sich seine Augen darauf fokussieren konnten. Als es ihm schließlich gelang, schrak er erneut zusammen.
Es war schon kurz nach neun.
Verdammt, ich war über zehn Stunden weggetreten!
Wieder fühlte er Schwindel aufkommen, wieder spielte sein Kreislauf verrückt und wieder musste er sich an der Tischplatte festklammern.
Wasser, ich brauche Wasser!
Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit verspürte er ein unbändiges Verlagen nach schlichtem klarem Wasser.
Auf Beinen, die sich kaum wie seine eigenen anfühlten, wankte er in die Küche. Er griff nach einem Glas, das neben dem Spülbecken stand, verfehlte es jedoch, und es schlug klirrend auf den Boden.
Also beugte er sich vor – wovon ihm erneut schwindlig wurde –, hielt sich am Spülbecken fest und trank gierig direkt aus dem Hahn.
Es war, als kehrte mit jedem Schluck ein Stück Leben in ihn zurück, und als er schließlich genug hatte, ließ er sich das kalte Wasser über den Kopf laufen.
Dann endlich verblassten der Schwindel, die Übelkeit und auch die Kopfschmerzen, und er fühlte sich etwas besser. Vor allem aber konnte er nun wieder klar denken.
Er trocknete sich mit einem von Doreens Spültüchern ab, ging zur Essecke im Wohnzimmer zurück und hob sein Handy vom Boden auf. Gerade als er die Nummer des Polizeinotrufs eintippen wollte, begann es wieder zu klingeln.
Er erschrak so heftig, dass er das Telefon beinahe fallen gelassen hätte. Im letzten Moment bekam er es wieder zu fassen und starrte auf die Anzeige.
Statt eines Namens stand dort nur ein einzelnes Wort.
ANONYM.
Eine unterdrückte Rufnummer.
Nervös leckte er sich die spröden Lippen, atmete tief durch und nahm dann den Anruf an.
»Hallo?«
»Hey, Doktor«, sagte eine Männerstimme, und augenblicklich fühlte Mark, wie etwas Eiskaltes über seinen Rücken kroch.
Diese Worte! Das kann doch nicht sein! Es sind genau dieselben Worte!
Der Anrufer hatte sie ruhig ausgesprochen, doch aus Marks Erinnerung kehrten sie jetzt als spöttischer Ausruf zu ihm zurück, gefolgt von einem blechernen Schlag und dem Kreischen von Autoreifen.
»Was ist los, Doktor? Hat es dir die Sprache verschlagen?«
Das hatte es tatsächlich, aber die Angst um Doreen holte Mark aus seiner Schockstarre zurück.
»Wo ist sie, du Scheißkerl? Was hast du mit ihr gemacht?«
»Nicht viel«, kam die Antwort, ruhig und – wie es schien – ein wenig amüsiert. »Sie ist hier bei mir. Es geht ihr gut, sie ist nur ein bisschen weggetreten. Ein kleiner Mix aus Propofol und Lorazepam. Das Gleiche wie bei dir. Fühlt sich an wie nach ein paar Drinks zu viel, aber das kennt ihr beiden ja, nicht wahr?«
»Wer bist du?«
Ein spöttisches Lachen. »Echt jetzt? Du fragst, wer ich bin? Dabei hast du mir doch selbst mal gesagt, dass du jeden Tag an mich denken musst. Ich sei deine … wie hast du’s genannt … ach ja, deine Obsession. Erinnerst du dich nicht mehr?«
Nein, daran erinnerte Mark sich nicht. Aber das spielte in diesem Moment auch keine Rolle. Jetzt zählte nur Doreen.
»Was willst du von uns?«
»Nicht von euch, nur von dir, Doktor. Also benimm dich und halt dich an die Regeln, dann muss es keinen zweiten Kollateralschaden geben.«
Das war zu viel für Mark. Dieses eine Wort genügte, um das Bild von Tanjas zerschmettertem Körper wieder in ihm heraufzubeschwören, als sie sterbend in seinen Armen gelegen hatte wie eine Marionette mit zerschnittenen Fäden. Ein unbändiger Zorn ergriff Besitz von ihm. Heftiger denn je.
»Kollateralschaden?«, schrie er in das Telefon. »Du verdammtes Arschloch nennst den Mord an meiner Freundin einen Kollateralschaden? Du hast sie doch nicht mehr alle, du Irrer! Warum kommst du nicht direkt zu mir? Los, komm, oder bist du zu feige? Regeln wir das von Mann zu Mann, hier und jetzt! Dann werde ich dir zeigen, was ein Kollateralschaden ist!«
Einen Augenblick lang blieb es still am anderen Ende der Leitung. Dann fragte der Anrufer in kühlem und keineswegs mehr amüsiertem Tonfall: »Bist du jetzt fertig mit deinen Machosprüchen?«
»Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, du feiger Drecksack!«, fauchte Mark. »Wenn du mich nicht sofort mit Doreen reden lässt, lege ich auf! Hast du das kapiert?«
Wieder entstand eine Pause, gefolgt von einem tiefen Seufzen.
»Na gut, Doktor, so etwas habe ich mir schon gedacht. Dann machen wir es eben anders. Pass mal gut auf.«
Doch es folgte nichts, nur Stille, und als Mark wieder auf das Display sah, war die Anzeige erloschen.
»Fuck! Das gibt’s doch nicht! Er hat aufgelegt. Der Drecksack hat einfach aufgelegt!«
Vor Wut und Aufregung zitternd ließ er sich auf den Stuhl sinken, auf dem Doreen noch gestern Abend gesessen hatte, und kam sich vor, als sei er von einem Albtraum direkt in den nächsten geraten.
Was sollte er jetzt tun?
Die Polizei rufen?
Keine gute Idee. Nicht, solange der Kerl Doreen hatte und er nicht wusste, wo die beiden waren.
Er konnte den Entführer mit der unterdrückten Nummer aber auch nicht zurückrufen.
»So eine Scheiße! So eine gottverdammte Scheiße!«
Ein fröhliches Pling! ließ ihn zusammenfahren, und die Anzeige meldete, er habe eine Videonachricht von ANONYM erhalten. Ob er sie ansehen wolle?
Nein, das wollte er ganz bestimmt nicht, aber er öffnete das Video trotzdem, und machte sich auf einen schlimmen Anblick gefasst. Und, ja, es war ein schlimmer Anblick.
Der Entführer hatte die Kamera direkt auf Doreens Gesicht gerichtet, und auch wenn Marks veraltetes iPhone nur einen kleinen Monitor mit bescheidener Auflösung hatte, genügte ihm völlig, was er sah. Doreen hatte die Augen geschlossen und ihre verlaufene Wimperntusche wirkte, als habe sie rußige Tränen geweint. Ihr Mund war von einem breiten Streifen aus schwarzem, reißfestem Gewebeband bedeckt, und an ihrer Nase hatte sich eine Rotzblase gebildet.
Diese an- und abschwellende Blase und die zuckenden Augenlider verrieten, dass sie noch lebte. Doch Mark war viel zu schockiert, um deshalb Erleichterung zu verspüren.
Als die Kamera ein Stück zurückgenommen wurde, erkannte er die kräftige Hand eines Mannes. Er hielt Doreens schlaffen Kopf am Kinn und drehte ihn von einer Seite zur anderen und wieder zurück.
Du Scheißkerl präsentierst sie mir, dachte Mark. Du willst mir zeigen, dass du sie buchstäblich in der Hand hast.
Der Zorn, der mit diesem Gedanken einherging, half ihm, den ersten Schrecken zu überwinden und sich auf weitere Details zu konzentrieren. Abgesehen von Doreens Oberkörper, an dem Mark das weinrote Kleid vom Vorabend erkannte, zeigte der Bildausschnitt nicht viel.
Mark glaubte, eine Holzwand im Hintergrund zu erkennen. Es waren dunkle Bretter, wie man sie vielleicht in alten Schuppen oder Kellerverschlägen vorfinden konnte. Gut möglich, dass das Video in so einem Keller aufgenommen worden war. Das einzige Licht schien von der Kameraleuchte zu stammen. Es gab keinen einfallenden Lichtstrahl, der auf ein Fenster hindeuten würde.
Andererseits muss das nichts heißen, dachte Mark. Er könnte die Aufnahme auch letzte Nacht gemacht haben, als es draußen dunkel war.
Das Video verschwand abrupt und wich der Meldung eines weiteren anonymen Anrufs.