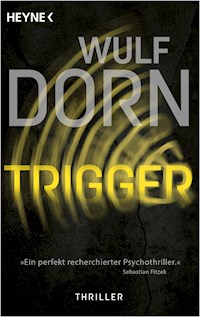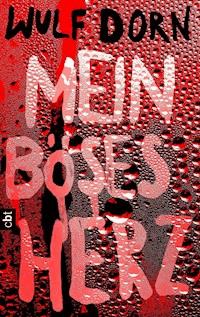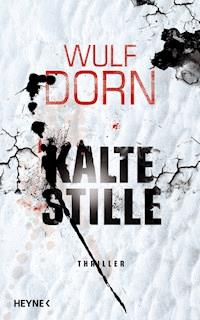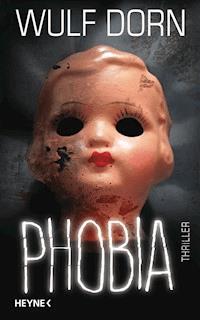Inhaltsverzeichnis
Widmung
Lob
Prolog
Teil 1 - Die Patientin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Copyright
Das Buch
»VERSPRICH, MICH ZU BESCHÜTZEN, WENN ER MICH HOLEN KOMMT!«
Der Fall einer brutal misshandelten Patientin wird für die Psychiaterin Ellen Roth zum Albtraum: Die Frau behauptet, vom Schwarzen Mann verfolgt zu werden. Kurz darauf verschwindet sie unter mysteriösen Umständen spurlos. Bei ihren Nachforschungen wird auch Ellen zum Ziel des Unbekannten. Er zwingt sie zu einer makaberen Schnitzeljagd - um ihr Leben und um das ihrer Patientin. Für Ellen beginnt ein verzweifelter Kampf, bei dem sie niemandem mehr trauen kann. Wer ist der Schwarze Mann, der alles über sie zu wissen scheint? Was für ein grauenvolles Geheimnis umgibt die namenlose Patientin? Immer tiefer gerät die Psychiaterin in ein Labyrinth aus Angst, Gewalt und Paranoia. Und das Ultimatum läuft …
Wulf Dorn hat mit seinem Debütroman einen Psychothriller vorgelegt, der seine Leser schonungslos in die Abgründe der menschlichen Psyche zieht.
Zum Autor
Wulf Dorn, Jahrgang 1969, schreibt seit seinem zwölften Lebensjahr. Seine Kurzgeschichten erschienen in Anthologien und Zeitschriften und wurden mehrfach ausgezeichnet. Die Faszination für das Unheimliche und Geheimnisvolle führte ihn zunächst in das Horror-Genre, ehe er die Spannbreite des Thrillers für sich entdeckte. Seit 1994 unterstützt der ausgebildete Fremdsprachenkorrespondent die Patienten einer psychiatrischen Klinik in der beruflichen Rehabilitation. Mit seiner Frau und einer Glückskatze lebt er in der Nähe von Ulm. Weiteres über den Autor erfahren Sie auf www.wulfdorn.de.
Für Anita die drei magischen Zahlen: 603
Und für K.-D. Wo immer du jetzt auch bist, du fehlst hier.
Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Niemand! Wenn er aber kommt? Dann laufen wir davon!
Kinderspiel
Prolog
Es gibt Legenden über Orte, die das Böse anziehen. Orte, an denen sich wiederholt Schlimmes zugetragen hat, als hungerten sie nach solchen Ereignissen.
Die Ruine des alten Sallinger Hofs war ein solcher Ort, davon war Hermann Talbach überzeugt. Alle in seinem Dorf dachten so. Manche behaupteten sogar, jeder, der diesem Ort zu nahe käme, würde sich dort den Wahnsinn holen. So wie einst Sallinger selbst, der in einer Mainacht seinen Hof in Brand gesteckt hatte, um mit seiner Frau und den beiden Kindern den Flammentod zu finden.
Dennoch konnte Talbach diese Ruine jetzt gar nicht schnell genug erreichen. Während er mit seinem Gesellen Paul den Waldweg entlanghastete, betete er darum, nicht zu spät zu kommen. Diesmal lag es an ihnen, Schlimmes zu verhindern.
Noch immer im Blaumann und die Hände mit Öl verschmiert, eilte Talbach an den mit Moos bewachsenen Trümmern des vormaligen Torbogens vorbei. Obwohl der Automechaniker die vierzig schon seit längerem hinter sich gelassen hatte und ihm seit einem Unfall an der Hebebühne seiner Werkstatt ein Hinken geblieben war, konnte der neunzehnjährige Paul kaum mit ihm Schritt halten.
Vielleicht lag dies aber auch an den Pentagrammen, die auf mehrere der Steinhaufen gemalt worden waren, um das Böse zu bannen. Viele der sogenannten Drudenfüße waren im Laufe der Jahrzehnte verblichen, aber sie waren noch gut genug erkennbar, um den Glauben an die dunkle Macht dieses Ortes zu erhalten. Und wie Pauls Benehmen den Anschein erweckte, schien keine Generation davor verschont zu bleiben. Bei der Verteilung guter Eigenschaften hatte Pauls Schöpfer den jungen Mann mit viel Fleiß und Zuverlässigkeit gesegnet, doch Mut und Schlauheit mussten ihm an jenem Tag ausgegangen sein.
Als Talbach den einstigen Innenhof erreicht hatte, blickte er zu Paul zurück, der keuchend auf ihn zulief. Dabei wischte er sich den Schweiß von der Stirn, wovon ihm ein breiter Ölschmierer blieb.
»Es muss irgendwo hier sein«, schnaufte Talbach und sah sich um. »Kannst du was hören?«
Paul schüttelte nur den Kopf.
Die beiden lauschten angestrengt in die leisen Geräusche des Waldes hinein. Vögel zwitscherten wie aus weiter Ferne, ein trockener Zweig gab mit einem Knacken dem Gewicht von Talbachs Sicherheitsschuh nach. Eine Hummel brummte über einen Vogelbeerstrauch hinweg, und das Sirren der Stechmücken schien allgegenwärtig. Talbach nahm kaum wahr, wie ihm die winzigen Blutsauger ihre Stachel in Hals und Arme bohrten. Er war ganz darauf konzentriert, einen menschlichen Laut zu hören, wie schwach er auch sein mochte.
Doch da war nichts. Nur die unheimliche Stille dieses verfluchten Ortes, die wie ein schweres, dunkles Tuch über ihm lag. Trotz der Mittagshitze spürte Talbach eine Gänsehaut.
»Da!«, rief Paul, und Talbach zuckte zusammen.
Er sah zu der Stelle, auf die sein Geselle zeigte, und dann entdeckte auch er das Glitzern. Es stammte von einem Stückchen Stanniolpapier, das der schmale Lichtfleck eines Sonnenstrahls erfasst hatte. Die beiden Männer liefen zu der Stelle und entdeckten niedergedrücktes Gras, Fußabdrücke und ein weiteres glitzerndes Papierstück, das hinter einem moosbewachsenen Baumstumpf lag.
Talbach hob eines der Papierchen auf. Es roch noch nach der Schokolade, die darin eingewickelt gewesen war.
»Sie waren hier, aber wohin …« Er sprach den Satz nicht zu Ende. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der Lichtung, auf der er weitere Spuren zu finden hoffte. Es musste einfach Spuren geben.
Dann fiel sein Blick auf das Dickicht, das den zugewachsenen Innenhof umgab. Als er näher darauf zuging, erkannte er umgeknickte Zweige und gleich dahinter überwucherte Steinstufen.
»Da ist es!«
So schnell es ihm auf der von Moos und faulem Laub glitschigen Steintreppe möglich war, eilte Talbach die Stufen hinab, dicht gefolgt von Paul. Gleich darauf erreichten sie den ehemaligen Eiskeller des Bauernhofs. Talbach stieß einen überraschten Laut aus, als er einen Blick auf die weit offen stehende Eichentür mit den rostigen Eisenbeschlägen warf.
Paul erstarrte neben ihm wie ein Jagdhund, der ein Kaninchen erblickt hatte. Doch was er sah, war kein Kaninchen. Was er sah, ließ ihn totenblass werden.
»Was zum Teufel …«, ächzte Talbach, mehr bekam er nicht heraus.
Entsetzt starrten die beiden Männer auf den Fleck an der linken Wand des kleinen Raums.
Das Blut war noch nicht getrocknet. Im einfallenden Schein der Nachmittagssonne schimmerte es auf den schmierigen Steinen wie purpurrotes Öl.
Teil 1
Die Patientin
»Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared!«
DAVID BOWIE
Kapitel 1
Willkommen in derWALDKLINIKFachkrankenhaus für Psychiatrie,Psychotherapie und Psychosomatik
Die Geschwindigkeitsbegrenzung für das weitläufige Klinikgelände betrug zwanzig Stundenkilometer, doch das Tachometer von Dr. Ellen Roth zeigte mindestens fünfzig an.
Ellen fuhr in Richtung des Gebäudes, in dem sich Station 9 befand. Zum hundertundersten Mal an diesem Morgen sah sie dabei aufs Armaturenbrett, als hoffe sie, die kleinen Digitalziffern der Uhr würden sich ihr zuliebe etwas mehr Zeit lassen. Stattdessen vermeldeten sie mit gnadenloser Genauigkeit, dass Ellen bereits über eine halbe Stunde zu spät war.
Erneut verfluchte sie die zahlreichen Autobahnbaustellen, die sich auf der Strecke vom Stuttgarter Flughafen bis hin zur Abfahrt Fahlenberg reihten und jegliche realistische Zeitplanung zu einer groben Schätzung werden ließen. Unterwegs war sie von einem Stau in den nächsten geraten, und auf den wenigen freien Strecken hatte sie dann gehofft, dass ihr keine Radarkontrolle auflauerte.
Wäre Chris jetzt bei ihr gewesen, hätte er sie bestimmt darauf hingewiesen, dass diese Raserei nichts brachte. Wenn man zu spät kommt, kommt man eben zu spät. Daran ändern auch ein paar Minuten nichts, hätte er gesagt.
Chris, ihr Freund und Kollege, der sich im Augenblick zehntausend Meter über dem Boden befand und den sie schon jetzt vermisste.
Dabei war er an diesem Morgen gar nicht zu Scherzen aufgelegt gewesen. Im Gegenteil, was er ihr gesagt hatte, war ihm überaus ernst gewesen. Sie musste an ihr Versprechen denken, und bei dem Gedanken daran war ihr alles andere als wohl in ihrer Haut. Was, wenn sie scheiterte und Chris enttäuschte? Das wollte sie sich lieber gar nicht erst vorstellen.
Kies spritzte, als Ellen auf dem Personalparkplatz bremste. Sie stellte den Motor ab und atmete tief durch. Ihr Herz hämmerte, als sei sie die sechzig Kilometer vom Flughafen gejoggt und nicht gefahren.
»Ruhig, Ellen, ganz ruhig. Du bist zu spät, und das ist jetzt eben so«, murmelte sie sich selbst zu, während sie einen eiligen Blick in den Rückspiegel warf.
Für einen Moment hatte sie den Eindruck, einer Fremden im Spiegel zu begegnen - einer Frau, die wesentlich älter war als sie. Unter ihren braunen Augen zeichneten sich Ränder ab, und das dunkle, kurzgeschnittene Haar, das ihr sonst einen kessen Ausdruck verlieh, wirkte stumpf und im Zwielicht des Autos beinahe grau.
Ellen seufzte. »Wirf deinen Ausweis weg und lass dich schätzen«, schlug sie ihrem Spiegelbild vor. »Dann kannst du schon mit neunundzwanzig Rente beantragen.«
Höchste Zeit für weniger Stress und mehr Schlaf.
Sie sprang aus ihrem Zweisitzer und schlug die Tür zu, nur um gleich darauf festzustellen, dass sie den Schlüssel hatte stecken lassen. Hastig riss sie die Tür wieder auf und zog den Schlüssel ab, als sich ihr Piepser meldete. Das war nun schon das zweite Mal, seit sie in seinen Empfangsbereich gekommen war.
»Ich weiß!«, fuhr sie das Gerät an und stellte es ab.
Doch als sie auf das Stationsgebäude zulief, meldete es sich schon wieder. Wie sie dieses kleine schwarze Plastikungeheuer hasste. Es war kaum größer als eine Streichholzschachtel und konnte dennoch gewaltig nerven. Zum Beispiel, indem es sich an den unmöglichsten Orten meldete - während der Mittagspause in der Kantine oder auch an dem Ort, zu dem selbst der Klinikleiter zu Fuß geht, wie Chris zu sagen pflegte.
An diesem Montagvormittag wurde Ellen durch das kleine Monster daran erinnert, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben zu spät zum Dienst erschien. Und die Tatsache, dass sich His Master’s Voice - ein anderer Ausdruck aus Chris’ scheinbar unerschöpflichem Repertoire - bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Minuten mit seinem nervigen Biiiieeep Biiiieeep meldete, ließ keinen Zweifel zu, dass sie dringend erwartet wurde. Ellen hoffte inständig, es möge nicht das eingetreten sein, was Chris befürchtet hatte.
Kapitel 2
Der Mann hieß Walter Brenner, und das Einzige, was er von sich gab, war ein unverständliches Kauderwelsch, das nur entfernt mit Sprache zu tun hatte. Es hörte sich an wie »Simmmmssssssäääääägnnnnn«.
Den persönlichen Angaben auf dem Überweisungsformular nach war Brenner fünfundsechzig und alleinstehend. Er trug eine abgewetzte braune Cordhose und ein Flanellhemd, das an der Brustseite mit Flecken übersät war. Wie es schien, hatte er eine Schwäche für Gerichte mit viel Bratensoße - oder zumindest für etwas, das in getrocknetem Zustand wie Soßenflecke aussah.
Hingegen schien ihm der Verwendungszweck von Kamm und Rasierer nicht geläufig zu sein. Bartstoppeln standen ihm wie gläserne Nadeln aus dem faltigen, hohlwangigen Gesicht, und seine Frisur - wenn man dieses Wirrwarr überhaupt als eine solche bezeichnen konnte - erinnerte Ellen an das bekannte Foto von Albert Einstein, auf dem er dem Fotografen die Zunge herausstreckt.
Hinzu kam Brenners strenger Geruch, der dem von überreifem Camembert ähnelte. Eine Mischung aus Urin, Schweiß und Talg, die die traurige Gestalt wie eine unsichtbare Wolke umgab.
Heute hätte ich mir mein Calvin-Klein-Parfüm besser unter die Nase gerieben, als es aufs Dekolleté zu sprühen, dachte Ellen, ließ es sich aber nicht anmerken. Stattdessen sagte sie »Guten Tag« und streckte ihm die Hand entgegen.
Brenner nahm sie nicht wahr, sondern glotzte wie hypnotisiert ins Nirgendwo.
»Herr Brenner wurde vorhin von der Notaufnahme des Stadtklinikums zu uns verlegt«, erklärte Schwester Marion und überreichte Ellen die Einweisungspapiere.
Die korpulente Krankenschwester musste die fünfzig schon eine Weile hinter sich gelassen haben. Weder Ellen noch das übrige Personal hatten viel Sympathie für sie übrig. Mit ihrem religiösen Missionarseifer und einer gluckenhaften Fürsorglichkeit schaffte es Marion immer wieder, selbst die geduldigste Person in Rage zu bringen. Dabei war sie schon so lange auf Station 9 tätig, dass böse Zungen behaupteten, man habe ihr bereits vor Jahren eine Inventarnummer eintätowiert.
»Der arme Kerl hat noch kein einziges klares Wort gesprochen«, fügte sie hinzu und tätschelte dabei Brenners Schulter, was dieser jedoch nicht mitzubekommen schien.
»Wissen wir, was zu seiner Einweisung geführt hat?«, wollte Ellen wissen.
»Eine Nachbarin hat ihn in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie gesehen hatte, wie er bei sich zu Hause im Treppenhaus herumirrte. Er ist nicht ansprechbar und völlig verwirrt. Außerdem leidet er unter Gleichgewichtsstörungen. Kann kaum gehen, der Arme.«
Wie um dies alles zu bestätigen, ließ Brenner seinem unsinnigen Gebrabbel einen Rülpser folgen. Dabei starrte er unbeirrt weiter auf einen Punkt, der sich irgendwo neben Ellens Stuhl am Boden befinden musste. Der Geruch aus seinem Mund veranlasste die beiden Frauen, sich von ihm abzuwenden.
»Uia«, stieß Marion aus. »Was haben Sie denn nur gegessen, Herr Brenner?«
»Pfummmmm«, lautete die Antwort.
Ellen glaubte deren Übersetzung zu kennen. Zumindest hatte sie einen Verdacht, was die Flecken außer getrockneter Bratensoße noch sein konnten.
»Möglicherweise Tierfutter.«
Die dicke Schwester sah sie erstaunt an.
»Er wäre nicht der erste Rentner, dem keine andere Wahl bleibt«, meinte Ellen und besah sich dann Walter Brenner genauer. »Billiges Hundefutter nährt besser als billiger Konserveneintopf. Habe ich recht, Herr Brenner?«
Brenner reagierte mit einem weiteren Zischlaut aus der Sprache der vollkommen Verwirrten. Ellen überging dies, testete seine Reflexe und erklärte ihm dann, sie werde sich nun seinen Aufnahmebogen durchsehen. Doch Brenner schien sich nach wie vor nur für den Fußboden zu interessieren.
Ellen sah sich das Einweisungsformular nach einem Hinweis auf neurologische Auffälligkeiten durch. Möglicherweise hatte der Patient einen Schlaganfall gehabt, der die Ausfälle von Sprachvermögen und Gleichgewichtssinn verursacht hatte. Es konnte sich jedoch ebenso gut um eine ausgeprägte Altersdemenz handeln, was erklären würde, weshalb eine gewisse Frau Dr. März es für sinnvoll gehalten hatte, ihn in die Psychiatrie zu überweisen.
Aber in diesem Fall hätte sich Brenner schon länger auffällig verhalten und wäre nicht in der Lage gewesen, sich allein in seiner Wohnung zu versorgen. Tierfutter hin oder her, er hätte es nicht einmal fertig gebracht, sich eigenständig welches zu kaufen.
Also keine Demenz. Warum aber dann in die Psychiatrie? Ganz gleich, wie sie es auch drehte und wendete, diese Verordnung ergab für Ellen keinen Sinn.
Sie blätterte zum Befund ihrer Kollegin. Was sie hinter dem Wort Diagnose zu lesen bekam, ließ sie staunen. Sie sah noch einmal Brenner an, dann wieder den Aufnahmebogen.
Diagnose: F20.0 war dort zu lesen. Der Code, mit dem die medizinischen Fachdienste untereinander korrespondierten, entstammte der durch die WHO weltweit anerkannten Klassifikationsliste für Krankheiten. F20.0 gehörte zu den am häufigsten gestellten Diagnosen, mit denen Ellen in ihrem Alltag zu tun hatte. Es war der Code für paranoide Schizophrenie.
Ellen schaute noch genauer hin, um sehen zu können, ob es sich nur um eine schlampig geschriebene Zahl handelte. Die Lesbarkeit dieser Handschrift ließ in der Tat einiges zu wünschen übrig - sieht hingerotzt aus, hätte der ordnungsliebende Chris gesagt -, aber dennoch war kein Irrtum möglich. Frau Dr. März hatte F20.0 eingetragen. Weshalb sonst hätte sie Walter Brenner in die benachbarte Fachklinik für Psychiatrie bringen lassen sollen, wenn sie nicht der Ansicht gewesen wäre, er sei schizophren?
»Waren Sie schon einmal bei uns, Herr Brenner?«, erkundigte sich Ellen, und da sie ohnehin keine Antwort erwartete, befragte sie den Stationscomputer. Brenners Name ergab ein Suchergebnis. Der Aktenvermerk stammte von ihrem Kollegen Mark Behrendt. Was Mark dort in kurzen Sätzen festgehalten hatte, verschlug ihr die Sprache.
Sie wandte sich wieder Herrn Brenner zu und griff nach seiner Hand, die sich wie die einer Mumie anfühlte. Dafür erntete sie zum ersten Mal Brenners Aufmerksamkeit. Seinem Blick fehlte jedoch jegliches Anzeichen für ein Erkennen seines Gegenübers, etwa im Sinne von »Aha, das ist eine Frau, die einen weißen Kittel trägt«. Stattdessen sagte die Art, mit der er sie ansah, genau das, was er auch artikulierte: »Agnnnngallll.«
Nun kniff Ellen in die lederartige Haut im Handrücken des Mannes. Wie ein Stück Knetmasse blieb die Falte stehen.
»Unglaublich!« Als sie den fragenden Ausdruck auf Schwester Marions Gesicht sah, fügte Ellen hinzu: »Geben Sie ihm Kochsalzinfusionen, so schnell wie möglich. Ich denke, dann werden wir in nur wenigen Stunden einen ganz anderen Herrn Brenner vor uns haben.«
Die Schwester legte die Stirn in Falten, was sie wie einen Mops aussehen ließ. »Wie bitte?«
»Nicht nur Gott kann kleine Wunder vollbringen. Nicht wahr, Herr Brenner?«
»Garrrrrssssssllll«, machte der Alte. Dann furzte er, und Ellen war heilfroh, den Raum verlassen zu können.
Sie eilte über den Gang, stürmte in ihr Büro und ließ die Tür ins Schloss fallen.
Es dauerte eine Weile, bis es der Schwester in der Notaufnahme des Stadtklinikums gelang, Frau Dr. März ans Telefon zu holen. Ellen wartete ungeduldig. Sie legte den Hörer neben sich und rief in ihrem Laptop noch einmal die Datei mit Herrn Brenners Vorgeschichte auf, während aus dem Hörer eine Synthesizer-Melodie dudelte, bei der es sich offenbar um eine Sequenz aus Mozarts Kleiner Nachtmusik handeln sollte. Mit jeder Wiederholung dieser Melodie schwoll Ellens Wut noch ein Stück weiter an.
Schließlich knackte es in der Leitung, dann meldete sich eine Frauenstimme mit einem hektischen »März!«.
»Dr. Roth, Waldklinik. Es geht um Herrn Brenner, den Sie zu uns überwiesen haben.«
»Hören Sie, Frau Kollegin, hat das nicht Zeit? Ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht. Meine Patienten …«
»Genau darum geht es. Um einen Ihrer Patienten. Sagen Ihnen die Begriffe Exsikkose und Dehydration etwas? Falls nicht, will ich es Ihnen leichter machen: Sie wissen doch, dass ältere Menschen gerne mal das Trinken vergessen.«
»Bitte?«
»Sie wissen bestimmt auch, dass Verwirrtheit, Ausfall des Sprechvermögens und die simple Tatsache, dass sich ausgetrocknete Haut aufstellen lässt, ohne sich wieder zusammenzuziehen, erste Anzeichen des Verdurstens sind. Und genau das, liebe Frau Kollegin, trifft auf Herrn Brenner zu, den Sie mir gerade haben bringen lassen. Den angeblich schizophrenen Herrn Brenner, um es deutlicher zu sagen.«
Ellen holte tief Luft und bot Dr. März Gelegenheit für einen Kommentar.
»Aha«, kam es aus dem Hörer. »Sind Sie denn mit seiner Vorgeschichte vertraut?«
»Was genau meinen Sie?«
»Die Nachbarin von Herrn Brenner hat mir berichtet, dass er schon einmal in Ihrer Klinik war. Damals hat ihn die Polizei zu Ihnen gebracht, nachdem er am helllichten Tag aus seinem Küchenfenster uriniert und wirres Zeug geredet hatte. Den vorbeigehenden Leuten hatte er zugerufen, sie sollten aus seiner Toilette verschwinden.«
»Meine liebe Frau März, das mag ja alles richtig sein. Allerdings hätten Sie besser nicht so vorschnell auf die Aussagen einer Nachbarin reagieren, sondern kurz mit uns Kontakt aufnehmen sollen. Dann hätten Sie erfahren, dass Herr Brenner auch damals dehydriert und deshalb verwirrt war. Es mag ja sein, dass sein Verhältnis zur Flüssigkeitsaufnahme gelegentlich gestört ist, schizophren ist er deswegen noch lange nicht. Sie können dazu auch gern Herrn Dr. Behrendt fragen, der Herrn Brenner damals behandelt hat.«
Für ein paar Sekunden herrschte Schweigen in der Leitung, dann fragte Dr. März: »Wollen Sie mir da gerade etwas unterstellen?«
»Ich unterstelle Ihnen nichts, ich stelle etwas fest. Durch Ihre Nachlässigkeit haben Sie Herrn Brenner einer lebensgefährlichen Situation ausgesetzt. Abgesehen davon trägt er nun auch noch die Diagnose Schizophrenie in seiner Krankengeschichte mit sich herum. Ich muss Ihnen ja wohl nicht erklären, was eine solche Eintragung bedeutet, ganz gleich, ob es sich dabei um eine Fehldiagnose handelt oder nicht.«
»Jetzt reicht’s!«, fauchte Dr. März in den Hörer. »Sie werfen mir vor, ich sei …«
»Inkompetent. In diesem Fall, ja.«
Die Antwort war Ellen schneller über die Lippen gegangen, als ihr Zeit geblieben war, sich einen diplomatischeren Ausdruck zu überlegen. Kaum hatte sie ausgeredet, als auch schon das Freizeichen ertönte. Konsterniert sah sie den Hörer an.
Hast du etwas anderes erwartet? Ein Dankeschön und einen Blumenstrauß? Standing Ovations vom Dr.-Ellen-Rothist-die-Größte-Fanclub?
Natürlich war sie ganz schön hart mit ihrer Kollegin ins Gericht gegangen, aber sie fühlte sich dennoch im Recht. Zwar hatte Ellen nicht vor, den Vorfall an die große Glocke zu hängen und ihre Kollegin - ganz gleich, ob fremde Klinik oder nicht - dadurch in ernste Schwierigkeiten zu bringen, aber sie hätte wenigstens hören wollen, dass Dr. März dieser Fehler leidtat. Das wäre sie Herrn Brenner schuldig gewesen. Dem armen Kerl, der höchstwahrscheinlich seine alten Tage mutterseelenallein in einer winzigen Wohnung verbrachte und sich ab der Monatsmitte dazu gezwungen sah, Nudeln aus dem Sonderangebot mit Hundefutter zu vermischen, während er sich einredete: Wenn alles drin ist, was gut für den Hund ist, dann wird auch alles drin sein, was gut für den Menschen ist.
Hätte es sich um einen jungen, gut verdienenden Patienten gehandelt, der sich einen kompetenten Rechtsschutz leisten konnte, hätte Frau Dr. März vielleicht tatsächlich mit allem ihr zur Verfügung stehenden Charme um Entschuldigung gebeten. Aber es waren Leute wie der alte Brenner, bei denen man sich auf Zeitdruck herausredete und dann wieder zum Tagesgeschäft überging.
Die Welt ist ungerecht, hart und brutal, dachte Ellen.
Das Wort brutal hallte noch eine ganze Weile in ihrem Kopf nach, während sie die nächste Stunde mit Patientengesprächen zubrachte. Danach war sie froh, in die Stille ihres kleinen Büros zurückkehren zu können, wo sie sich den Unterlagen widmete, die ihr Chris am vergangenen Abend nach Dienstschluss hinterlassen hatte.
Sie musste schmunzeln, als sie den gelben Haftzettel sah, eine der vielen kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen er sie gern überraschte. Diesmal hatte er einen Smiley darauf gemalt. Darunter stand in seiner unverkennbar gleichmäßigen Schrift:
Lass dich nicht stressen, Süße.
»Wenn du wüsstest«, murmelte sie und klebte den Zettel an die Wand über ihrem Schreibtisch.
Sie fühlte sich durchaus gestresst, müde und ausgelaugt. Die letzte Woche war äußerst arbeitsintensiv und anstrengend für sie gewesen, am Wochenende hatte sie dann noch Chris bei den Renovierungsarbeiten an seinem Haus geholfen, und die letzte Nacht hatte sie wegen der Fahrt zum Flughafen kaum Schlaf gehabt.
Gegen ihre Müdigkeit hatte auch der Energy-Drink nichts geholfen, den sie sich wider besseres Wissen am Flughafenkiosk gekauft hatte. Davon war sie nur aufgewühlt, aber nicht wirklich wacher geworden. Ein Espresso und eine Banane wären eindeutig die bessere Wahl gewesen, hatte die Ärztin in ihr sie geschulmeistert, aber da war die leere Dose schon auf dem Beifahrersitz ihres Sportwagens hin und her gekullert.
Alles in allem keine gute Startposition für eine Arbeitswoche, die gerade erst begonnen hatte. Ellen war fest davon überzeugt, in ihrem jetzigen Zustand bei einem Schlafmarathon ohne große Mühe den ersten Preis schaffen zu können.
Sie legte zwei Formulare für die Krankenkasse beiseite - bürokratische Quälgeister, die von Jahr zu Jahr mehr wurden -, überflog den Brief eines Betreuers und fand darunter schließlich das, was sie gesucht hatte.
Der Aufnahmebogen weckte ein Bild in ihr: Chris, wie er angespannt auf dem Beifahrersitz saß, neben ihm die Lichter des nahen Flughafens.
»Vielleicht sollte ich die Reise doch nicht machen«, hörte sie ihn in ihrer Erinnerung sagen. »Es ist zu wichtig, als dass ich jetzt einfach so …«
Sie hatte ihn unterbrochen und ihm zum hundertsten Mal an diesem Morgen versichert, sie werde sich um den Fall kümmern, er brauche sich keine Sorgen zu machen.
Daraufhin hatte Chris sie mit ernstem Blick angesehen und gesagt: »Ich will einfach keinen weiteren Fall Margitta Stein erleben müssen.«
Ellen hatte bei diesem Namen eine Gänsehaut bekommen, aber sie hatte es sich nicht anmerken lassen.
»Dazu wird es nicht kommen«, hatte sie ihm versprochen. »Egal, was passiert, ich werde mich um sie kümmern.«
Nun hielt sie das Formular zu dem neuen Fall in der Hand, und die Erinnerung an ihre Unterhaltung vor wenigen Stunden war derart stark, dass es ihr vorkam, als säße Chris noch immer neben ihr. Sie konnte den sorgenvollen und gleichzeitig eindringlichen Blick seiner blauen Augen beinahe spüren und widerstand dem irrigen Drang, sich umzusehen, ob er wirklich hier bei ihr im Raum war. Dann wurde ihr klar, dass es nicht Chris’ Blick war, der auf ihr lastete; vielmehr war es die Sorge, ihm ein Versprechen gegeben zu haben, von dem sie nicht sicher war, ob sie es tatsächlich halten konnte.
Sie schüttelte den Anflug von Selbstzweifel ab und konzentrierte sich auf das Formular. Normalerweise wurde es bei der Neuaufnahme eines Patienten ausgefüllt und dann der Akte beigelegt. Doch Chris hatte den Bogen ganz bewusst auf den BEARBEITEN-Stapel gelegt, um sie noch einmal daran zu erinnern, dass dieser Fall für ihn - und somit nun für sie - höchste Priorität hatte.
Sie las die oberste Spalte, in der Name und Vorname des Patienten eingetragen wurden.
Unbekannt.
»Ich kam in der kurzen Zeit, die mir blieb, nicht an sie heran«, hatte ihr Chris erklärt.
Auch die Angaben zu Wohnort und Herkunft trugen den Vermerk unbekannt. Darunter stand: Aufnahme erfolgte über Notfallambulanz des Stadtklinikums.
Ebenso wie der dehydrierte Herr Brenner, dachte Ellen. Nur, dass der Fall dieser unbekannten Patientin keinen Zweifel am Befund offenließ. Das bestätigte auch Chris’ Eintrag in der Rubrik Beobachtungen:
Weist Misshandlungsspuren auf. Reagiert mit Rückzug auf Kontaktaufnahme. Keine Angaben zur Person. Alter ca. 30 bis 35 Jahre. Vorläufige Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung.
Wer immer diese Frau auch sein mochte, sie musste Schlimmes erlebt haben. Und die von Chris erwähnten Misshandlungsspuren ließen Ellen nicht lange raten, was dieses schlimme Erlebnis gewesen sein mochte.
Sie seufzte. Vergewaltigung und eheliche Gewalt nahmen in den letzten Jahren immer mehr überhand. Man brauchte nicht viel Vorstellungskraft, um einen Bezug zu der hohen Arbeitslosigkeit, mangelnden Integration und dem steigenden Alkoholmissbrauch herzustellen. Was für eine verrückte Welt.
Dann sah Ellen die drei Buchstaben, die Chris in die untere Ecke des Aufnahmebogens geschrieben hatte:
BIF
Ein Besonders Interessanter Fall. Chris hatte schon häufiger diese Abkürzung verwendet, die nur Ellen und er kannten, aber er hatte sie noch nie unterstrichen. Schon gar nicht doppelt.
In die Spalte für zusätzliche Bemerkungen hatte er notiert: Patientin gibt an, in Gefahr zu sein. Ich glaube ihr.
»Also gut«, sagte Ellen zu dem Bogen, dann atmete sie tief durch. »Zeit, dich persönlich kennenzulernen.«
Kapitel 3
Zimmer 7 lag am Ende des Stationsflurs. Es handelte sich um eines von drei Einzelzimmern der Station 9, die mit besonders schwierigen Fällen belegt wurden. Zwar kam es gelegentlich vor, dass man aus Bettenmangel auch zwei Patienten darin unterbrachte, aber momentan beherbergte Nummer 7 nur einen einzigen Gast.
Jemand hatte die Vorhänge zugezogen. Die wenigen Sonnenstrahlen, die an den Rändern ihren Weg ins Zimmer fanden, sorgten für gespenstisches Halbdunkel. Obwohl es im Freien an die zwanzig Grad haben musste und sämtliche Zimmer klimatisiert waren, kam es Ellen in diesem Raum deutlich kühler vor. Am schlimmsten war jedoch der Gestank, der beinahe greifbar in der Luft hing.
Dagegen waren die Körperausdünstungen von Herrn Brenner regelrecht harmlos, dachte Ellen und musste ein Würgen unterdrücken.
Der Gestank in diesem Raum zeugte zwar ebenfalls von körperlicher Verwahrlosung, mischte sich jedoch mit etwas, das nur schwer zu beschreiben und noch schwerer zu ertragen war. Es war beinahe so, als könnte dieser Gestank zu bleibenden Schäden führen, wenn man sich ihm zu lange aussetzte.
Angst, schoss es Ellen durch den Kopf. Es ist der Geruch der Angst.
So unprofessionell dies auch war, ihr fiel kein passenderer Vergleich ein. Und als ob ihr Körper ihn bestätigen wollte, fühlte sie, wie sich die Härchen auf ihren Unterarmen aufstellten.
Dann erkannte sie die Gestalt, die am Boden zwischen Bett und Wand kauerte. Ihre Größe war in der Dunkelheit nur schwer abschätzbar. Sie hatte die Beine umschlungen und den Kopf auf die Knie gelegt. Langes dunkles Haar hing strähnig über die Trainingshose. Ein Knäuel Elend.
»Guten Tag«, sagte Ellen.
Zuerst zeigte die Gestalt keine Reaktion; nach einer Weile hob sie den Kopf, langsam wie in einer Zeitlupenaufnahme, doch es war zu dunkel, um ihr Gesicht erkennen zu können.
»Ich bin Dr. Ellen Roth. Und wer sind Sie?«
Keine Antwort.
»Darf ich näher kommen?«
Schweigen.
Vorsichtig ging Ellen auf die Frau zu, die sich nun dichter gegen den Heizkörper an der Wand drückte. Ellen hielt Abstand und setzte sich auf das Bett. Es sah noch unbenutzt aus. Hatte die Frau etwa die ganze Nacht in dieser Ecke zugebracht?
Der Körpergeruch der Patientin war aus der geringen Entfernung noch beißender, doch Ellen widerstand der Versuchung, das Fenster zu öffnen. Was immer dieser Frau auch zugestoßen sein mochte, im Augenblick war ihr der Schutz des geschlossenen und abgedunkelten Raums wichtig. Ellen zweifelte keine Sekunde daran, dass die Frau selbst das Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen hatte. Ein gekipptes Fenster würde sie möglicherweise verunsichern oder aufregen und damit jegliche Grundlage für ein Gespräch zunichtemachen. Zumindest vorerst.
Okay, Frau Doktor, jetzt heißt es professionell vorgehen, auch wenn dir danach zumute ist, die Nase zuzuhalten und aus dem Raum zu laufen. Jetzt heißt es: Vertrauen aufbauen und durch den Mund atmen. Und ist erst mal Vertrauen da, werden wir dieses Zimmer auf Durchzug stellen.
Sie musterte die Frau, die sich noch weiter in die Ecke drückte, als wolle sie rücklings in die Wand kriechen. Nun fiel ein wenig Licht auf ihr Gesicht. Es wirkte aufgeschwemmt, was durch die Schwellungen an Kinn, Wangen und Schläfen noch zusätzlich betont wurde. Die zahllosen Blutergüsse auf ihren Unterarmen und im Gesicht sahen im Halbdunkel wie Rußspuren aus, so als hätte die Frau mit bloßen Händen in einem Kohlenhaufen gewühlt und sich danach den Schweiß aus dem Gesicht gewischt.
Wer auch immer sie verprügelt haben mochte, hatte ganze Arbeit geleistet. Wahrscheinlich handelte es sich um keine Prostituierte, vermutete Ellen. Zuhälter schlugen selten ins Gesicht. Sie suchten sich weniger auffällige Stellen, so dass die Frauen wenigstens noch mündlich Einnahmen erzielen konnten.
Bei dem traurigen Anblick verstand Ellen, warum Chris dieser BIF so am Herzen lag und was er gemeint hatte, als er sagte: »Vielleicht ist es sogar besser, wenn du dich um sie kümmerst.«
Dass er als Mann zu dieser Frau keinen Zugang bekommen hatte, war nicht weiter verwunderlich. Nicht bei einem Misshandlungsopfer, das sich mit einem schweren Schock in die Ecke eines abgedunkelten Raumes verkrochen hatte. In solchen Fällen war es schon für eine Ärztin schwer genug, ein Gespräch von Frau zu Frau zu führen. Häufig verhielt sich das Opfer nicht nur wegen des Schocks, sondern auch aus Scham verschlossen und ablehnend gegen jegliche Hilfsangebote.
Es konnte jedoch noch einen dritten und wesentlich einfacheren Grund geben, warum die Frau auf ihre Fragen nicht reagierte: die Sprache.
In letzter Zeit hatte Ellen häufiger mit Osteuropäerinnen zu tun gehabt, die ihren Männern als Ventil für angestaute Aggressionen herhalten mussten. Die zunehmenden sozialen Brennpunkte selbst kleinerer Städte wie Fahlenberg waren der beste Nährboden für Gewalt. Meist traf diese Gewalt schwache und wehrlose Frauen, die schon allein wegen der Sprachbarriere nicht in der Lage waren, sich Hilfe zu holen. Möglich, dass es sich bei dieser Patientin um eine Osteuropäerin handelte. Ihr Aussehen, das dunkle Haar und die fast ebenso dunklen Augen sprachen dafür.
Andererseits hast du selbst dunkle Haare und braune Augen und stammst auch nicht aus Kasachstan oder Kroatien oder der Türkei.
»Sprechen Sie deutsch? Können Sie mich verstehen?«
Zwar erhielt Ellen auch diesmal keine direkte Antwort, aber zumindest zeigte die Frau eine Reaktion, wenngleich auch nur eine schwache - sie nickte, was ihr offensichtlich Schmerzen bereitete. Dabei erkannte Ellen einen weiteren Fleck auf der Wange der Patientin, der jedoch nicht von einem Bluterguss herrührte. Er sah vielmehr aus, als habe sie sich mit Schokolade bekleckert.
»Sie sind hier in Sicherheit. Niemand kann Ihnen etwas antun. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.«
Die Frau legte die Stirn leicht in Falten. Auch das schien ihr wehzutun.
»Mann.«
Es war nicht mehr als ein Flüstern.
»Hat Ihnen das ein Mann angetan?«
Ein zaghaftes Nicken, dann ein kaum hörbares »Ja«.
»Wollen Sie mir davon erzählen?«
Die Frau schwieg und legte den Kopf schief. Durch die fettigen Strähnen, die ihr ins Gesicht hingen, sah sie auf die nackte Wand gegenüber und wirkte dabei seltsam entrückt.
»Ist es Ihr Mann gewesen? Ihr Lebensgefährte?«
Ellen musste behutsam mit ihren Fragen vorgehen, keinesfalls durfte sie die Frau zum Reden drängen. Andererseits wollte sie so dicht wie möglich am Thema bleiben, solange die Patientin keine Anzeichen zeigte, dass es ihr zu viel wurde.
»Jeder hat so einen Mann.«
Die Stimme der Frau klang merkwürdig hoch, fast verstellt, wie bei jemandem, der versucht, die Sprache eines Kindes zu imitieren.
»Wollen Sie mir das genauer erklären?«
Ein ungutes Gefühl beschlich Ellen. Ein Mann, den jeder hatte, musste nicht zwangsläufig ein Ehemann sein. Womöglich meinte diese Frau eine öffentliche Person. Vielleicht einen Postboten, einen Polizisten oder einen Priester? In den vier Jahren, die sie nun schon als Fachärztin für Psychiatrie arbeitete, hatte Ellen vor allem eines gelernt: Nichts war unmöglich. Wirklich nichts.
Langsam, wie bei einer elektronischen Puppe, deren Batterien schwach geworden waren, drehte ihr die Frau den Kopf zu. Ihre Augen waren vor Angst weit geöffnet.
»Musst mich vor ihm beschützen, ja?«
Wieder dachte Ellen unwillkürlich an ein verängstigtes Kind. Ihr fiel der ausgeprägte Dialekt der Frau auf. Ihre Worte hatten einen leichten Singsang, wie man ihn in manchen Teilen Württembergs und dem badischen Raum zu hören bekam. Zweifellos kam sie nicht aus dieser Gegend. In der Region rund um Fahlenberg dominierte ein härter klingender, schwäbischer Dialekt.
»Natürlich werden wir Sie hier beschützen. Aber dazu muss ich wissen, wen Sie meinen.«
»Schwarzer Mann.«
»Ein schwarzer Mann? Meinen Sie einen Dunkelhäutigen? Vielleicht einen Afrikaner?«
»Der Schwarze Mann, der Schwarze Mann. Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?«, sang die Frau mit ihrer kindlichen Stimme. Dann stieß sie ein irres Kichern aus und entblößte eine Reihe verfärbter Zähne.
»Der Mann aus dem Kinderreim?«
Die Frau riss die Augen noch weiter auf. »Wenn er aber kommt, dann laufen wir davon!« Sie sah Ellen verzweifelt an. »Aber man kann nicht vor ihm davonlaufen. Geht nicht. Er ist zu schlau.«
Er wolle keinen weiteren Fall Margitta Stein erleben müssen, hatte Chris gesagt, und auch Ellen musste nun an die ehemalige Patientin denken. Vor zwei Jahren war sie auf die Privatstation aufgenommen worden, nachdem sie von ihrem Mann, einem angesehenen und mindestens ebenso gewalttätigen Großunternehmer, brutal verprügelt worden war. Völlig verstört war sie nachts aus dem Haus geflüchtet und einer Polizeistreife aufgefallen, die sie in die Waldklinik gebracht hatte.
Margitta Stein war genauso verängstigt gewesen wie diese unbekannte Frau. Dennoch hatte Chris ziemlich schnell Zugang zu ihr bekommen und bald schon erste Therapieerfolge gesehen. Zumindest hatte er das geglaubt. Tatsächlich hatte sich Margitta Stein zu einem drastischen Schritt entschieden. Am Tag vor ihrer Entlassung hatte sie beim Mittagessen ein Messer mitgehen lassen und sich mit der stumpfen Klinge die Halsschlagader durchtrennt. Als man sie fand, kam jede Hilfe zu spät. Kurz vor ihrem Tod hatte Margitta Stein mit ihrem eigenen Blut fünf Worte auf den Linoleumboden geschrieben:
ICH WERDE IHM NIE ENTKOMMEN
Es gab missbrauchte Frauen, die stark genug waren, um selbst den Absprung zu schaffen, die Scheidung einzureichen oder in Frauenhäusern Zuflucht zu suchen. Aber es gab auch die anderen, die diese Kraft nicht fanden. Diejenigen, die ein schnelles Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne Ende vorzogen. Chris fürchtete, die namenlose Patientin könnte sich dasselbe antun wie Margitta Stein.
Eine innere Stimme, die sich ganz wie die von Chris anhörte, schien Ellen das zu bestätigen. Dieses Mal trägst du die Verantwortung für ein Menschenleben.
»Hier wird er Sie nicht finden«, versicherte sie. »Hier sind Sie in Sicherheit.«
Im gleichen Moment meldete sich ihr Piepser. Die Frau in der Ecke und auch Ellen fuhren erschocken zusammen.
Dieses verdammte Mistding!
Die Klinikvorschriften erlaubten ihr nicht, den Piepser abzustellen, solange sie im Dienst war. Selbst während Patientengesprächen musste sie in Notfällen für Kollegen und das Pflegepersonal erreichbar sein. Ein weiterer Grund, weshalb sie dieses Plastikmonster so hasste.
Ellen griff sofort nach dem Ausschalter, während die Frau eine Reihe kurzer spitzer Schreie ausstieß.
»Alles in Ordnung«, versicherte ihr Ellen schnell. »Es ist alles in Ordnung. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Das bedeutet nur, dass ich kurz gehen muss. Ich komme aber gleich wieder zu Ihnen zurück.«
»Nein, nicht gehen! Lass mich nicht allein. Bitte!«
»Es ist wirklich nur für kurz.«
»Aber dann kommt er durch die Tür!«
»Der Schwarze Mann?«
»Ja.«
»Nein, das wird er bestimmt nicht. Er kann hier nicht herein. Und ich bin gleich zurück, ganz sicher.«
Die Frau verstummte und drückte sich noch enger an die Wand, als Ellen sich vorsichtig erhob. Sie mied jede schnelle Bewegung, die sonst möglicherweise als eine Bedrohung hätte missverstanden werden können.
Vom Flur drangen Stimmengewirr und das Durcheinander von Schritten bis in das Zimmer. Was, um alles in der Welt, war da nur los?
»Es dauert wirklich nicht lange.«
Die Frau reagierte nicht, sondern sah zu Ellen auf, wobei ihre Pupillen derart geweitet waren, dass sie wie schwarze Glasmurmeln aussahen.
Sie erinnerten Ellen an Kinderpuppen, die einen mit großen Kulleraugen anstarrten und denen manchmal eine Plastikträne auf die Wange geklebt war. Ein Anblick, der bei den meisten Menschen eine Art Beschützerinstinkt auslöst. Darin bestand das Geheimnis des Verkaufserfolgs dieser Puppen. Der Kunde erlag dem Drang, sie mitzunehmen - heim, in die eigenen vier Wände, wo sie vor der bösen Welt in Sicherheit waren. Und genau diesen Instinkt fühlte Ellen nun in sich geweckt, auch wenn es sich weder um eine Puppe noch um Tränen aus glasähnlichem Plastik handelte.
Aber da stand noch etwas in diesem Blick. Ellen deutete es als den Ausdruck, den Menschen im Gesicht haben, wenn sie dem sicheren Tod mit knapper Not entronnen sind.
Es fiel ihr schwer, dieses verängstigte Wesen mit der kindlichen Stimme, das die Hölle hinter sich gebracht haben musste, allein in dem dunklen Raum zurückzulassen. Doch als der Lärm auf dem Gang lauter wurde und sie das kleine schwarze Plastikungeheuer durch sein erneutes Biiiep Biiieeep an ihre ärztliche Pflicht erinnerte, gelang es ihr, sich von diesem Blick zu lösen.
Ellen war gerade bis zur Tür gekommen, als sie hinter sich ein Rascheln hörte. Sie sah sich um und wurde im nächsten Moment gegen die Wand geschmettert.
Ellen schlug mit der Schulter gegen einen Bilderrahmen. Das Bild - es zeigte einen Schutzengel, der wohlwollend auf ein betendes Kind mit blonden Locken herabsah - fiel zu Boden. Für einen Sekundenbruchteil erwartete Ellen, Glas splittern zu hören, aber die Bilder auf geschlossenen Stationen waren nicht hinter Glas gefasst. Die Gefahr, dass sich jemand mit einem Splitter selbst verletzen könnte, war zu groß.
Das Gesicht der Frau war nur wenige Zentimeter von Ellens entfernt. Ellen spürte eine gewaltige Kraft in den Händen, die ihre Oberarme umklammert hielten. Es war der Griff eines vor Angst völlig verzweifelten Menschen, und er tat höllisch weh.
»Wenn er kommt, musst du davonlaufen«, zischte ihr die Frau zu. Ihr Mundgeruch war übelkeiterregend. Ellen musste an Maden in einem verwesenden Hundemaul denken - was für eine absurde Assoziation - und all ihre Selbstbeherrschung aufwenden, sich nicht zu übergeben. Vor allem aber musste sie sich beherrschen, nicht laut loszuschreien. Zumindest noch nicht gleich.
»Versprich, mich zu beschützen, wenn er mich holen kommt!«
Die Stimme der Frau war eindringlich, aber noch immer gedämpft, so als habe sie Angst, ihr Peiniger könne sie hören. Sie sah Ellen furchtsam an, drängte sich noch fester gegen sie und wartete auf ihre Antwort.
Ellen zögerte. Heute Morgen auf dem Weg zum Flughafen war ihr dieses Versprechen leichter über die Lippen gegangen. Da hatte sie in erster Linie an Chris und sein Wohlergehen gedacht. Jetzt wurde ihr die Tragweite dieses Versprechens wirklich bewusst.
»Bitte! Versprich es mir.«
»Ich … verspreche es«, keuchte Ellen.
»Ehrlich?«
»Ja, ehrlich.« Ellen schluckte. Das konnte helfen, wenn man kurz davor war, sich zu übergeben. Und noch half es.
»Ehrlich«, wiederholte sie, diesmal eindringlicher.
O Mann, Chris, da hast du mir was eingebrockt!
Die Frau ließ von ihr ab und zog sich wieder in ihre Ecke zurück.
»Er ist ganz, ganz arg böse«, murmelte sie. »Und er ist schlau. Oh, er ist so verdammt schlau.« Dann begann sie die Melodie des Kinderreims vom Schwarzen Mann vor sich hin zu summen.
Ja, du bist wirklich ein BIF, dachte Ellen und rieb sich die schmerzende Schulter.
Wieder meldete sich ihr Piepser, und diesmal folgte Ellen endgültig His Master’s Voice.
Kapitel 4
Auf dem Stationsflur herrschte ein wahrer Menschenauflauf. Patienten drängten sich im Halbkreis um etwas, das Ellen von ihrer Position aus nicht sehen konnte, während das Pflegepersonal damit beschäftigt war, die kleine Versammlung aufzulösen. Etwas Spektakuläres musste geschehen sein, weshalb sich die meisten Patienten energisch gegen die Eingriffe der Pfleger zur Wehr setzten.
Unter den Pflegern erkannte Ellen auch einige unbekannte Gesichter. Jemand hatte Verstärkung angefordert, und man musste über keine hellseherischen Kräfte verfügen, um zu erraten, wer dieser Jemand gewesen war. Wie eine überproportionierte Statue stand Schwester Marion inmitten des Aufruhrs, das Telefon in der einen Hand und die andere wie bei einem Herzanfall auf die Brust gepresst.
Ellen glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Etwas Derartiges hatte sie noch nie auf ihrer Station erlebt. Jenseits der Schaulustigen hörte sie vom anderen Ende des Ganges die Schreie eines Mannes.
»Ich werde sie nicht essen«, gefolgt von einem hysterischen »NIEEEMAAAALS!«.
Beinahe gleichzeitig kam auch schon Schwester Marion auf sie zugestürmt.
»Frau Dr. Roth! Endlich! Ich habe Sie überall gesucht.«
»Nur nicht in Zimmer 7. Was ist denn hier los?«
»Herr Böck.« Marion nestelte aufgeregt an ihrem Kittel, und Ellen fiel auf, dass die massige Brust der Schwester mit irgendetwas wässrig Rotem bekleckert war. War das neben Marions Namensschild nicht ein Apfelkern? Es sah zumindest danach aus.
»Herr Böck? Der Herr Böck?«
Marion nickte.
»Aber er war doch vorhin noch völlig katatonisch?«
»Ja, schon. Er gab keinen Mucks von sich, wie immer. Bis ich …« Marion beendete den Satz nicht, sondern wandte sich um zum Ende des Flurs.
»Bis Sie was?«
»Der Herr sei mein Zeuge, ich weiß es nicht«, wimmerte die Schwester.
»Marion, jetzt reißen Sie sich mal zusammen! Was ist hier passiert?«
»Herrje, ich weiß es doch nicht!«
Ellen beschloss, dass diese Unterhaltung nichts brachte und ließ die hysterische Schwester einfach stehen. Sie schob sich an einem älteren Mann vorbei, der unablässig »Jessasmariaundjosef« vor sich hin murmelte und dabei hektisch von einem Bein aufs andere trat. Solche Unruhe war bei chronischen Psychotikern keine Seltenheit, aber nun, in all dem Gedränge, glich sein Trippeln fast schon einer Fred-Astaire-Nummer. Eine der Schwestern, die von der offenen Station zur Verstärkung angerückt waren, nahm ihn am Arm und führte ihn auf sein Zimmer zurück.
Was war hier nur geschehen, dass man sogar Personal zur Unterstützung holen musste? Ellen drängte sich durch die Versammlung und traf dann auf eine weitere Leihgabe aus dem ersten Stock. Ihr Kollege Mark Behrendt stand vor der Tür zum Gemeinschaftsbadezimmer, aus dem Herrn Böcks Schreie drangen.
Marks Haltung verhieß nichts Gutes. Er hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt, wodurch ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck Who killed Laura Palmer? unter seinem Kittel zum Vorschein kam, und durchwühlte mit der anderen Hand sein dunkles Haar. Sein Blick war starr auf die geschlossene Badezimmertür gerichtet.
»Herr Böck, bitte, machen Sie auf«, sagte er in bestimmtem Tonfall. Doch Herr Böck schien wenig beeindruckt. Stattdessen brüllte er zurück: »Kannibalen! Gottlose KANNIBALEN! Ja, das seid ihr!«
»Mark, was zum Kuckuck …«
Mark warf ihr einen flüchtigen Blick zu, einen Blick, der sagte: Es ist ernst, verdammt ernst! Dann widmete er sich wieder der Tür, so als könne er durch das blassgrüne Türblatt wie durch Glas sehen. »Verflixt, wo hast du gesteckt?«
»Patientengespräch. Was ist mit Böck los?«
»Keine Ahnung. Er scheint beim Mittagessen urplötzlich durchgedreht zu sein. Hat zuerst Marion angefallen und sich dann hier im Badezimmer verbarrikadiert.«
Wie alle Patientenräume hatte auch die Badtür kein Schloss, dennoch schien sie durch irgendetwas von innen blockiert zu werden. Marks wiederholter Versuch, sie zu öffnen, scheiterte nach nur wenigen Zentimetern.
»Lasst mich in Ruhe! Haut ab!«
Ellen war erstaunt, wie tief Böcks Stimme doch war. Sie hatte sie sich seinem zierlichen Erscheinungsbild nach um einiges höher vorgestellt. Tatsächlich hatten jedoch weder sie noch irgendjemand sonst auf Station 9 Herrn Böck bisher reden hören. Als er eingeliefert worden war, hatte er sich steif und mit starrem Blick auf sein Zimmer führen lassen und auf keinen Kontaktversuch reagiert. Dass sich dieser Zustand nun so abrupt verändert hatte, war einerseits erstaunlich, andererseits auf alle Fälle besorgniserregend.
»Wir können nicht so einfach weggehen, Herr Böck, und das wissen Sie«, rief Mark durch den schmalen Türspalt. »Lassen Sie mich zu Ihnen herein, und wir können reden.«
»Reden? REDEN? Ha! Ihr wollt, dass ich sie esse. Ihr wollt, dass ich MEINE FRAU AUFESSE! Aber das werde ich nicht tun. NIEMALS!«
»Was redet der da?«, fragte Ellen im Flüsterton. »Böck hatte einen Schock, aber er schien mir nicht wahnhaft.«
»Ob wahnhaft oder nicht, im Moment hat er auf jeden Fall keine Lust, seine Frau zu essen.« Mark rief wieder durch den Türspalt: »Herr Böck, Frau Dr. Roth ist jetzt bei mir. Sie erinnern sich doch noch an Frau Dr. Roth?«
»Sie soll verschwinden! Sie beide sollen verschwinden! Ich tu es sonst!«
»Was tun Sie sonst?«
»Das geht euch einen Scheißdreck an!«
Mark wechselte einen kurzen Blick mit Ellen. Beide schienen in diesem Augenblick dasselbe zu denken: Suizid.
Möglich, dass Böcks Drohung nur eine leere Phrase war, es war aber genauso möglich, dass Böck im Badezimmer etwas entdeckt hatte, womit er seine Drohung in die Tat umsetzen konnte. Nassrasieren war den Patienten zwar untersagt, aber wie leicht ließ sich eine Rasierklinge einschmuggeln. Ebenso waren ein Gürtel oder der Gurt eines Bademantels zusammen mit dem Gestänge für den Duschvorhang eine gefährliche Kombination.
»Herr Böck«, rief Ellen. »Wir wollen nur mit Ihnen reden, mehr nicht. Ich will Ihnen dabei in die Augen sehen können. Deshalb werden Dr. Behrendt und ich jetzt zu Ihnen hereinkommen.«
»Und wie, zum Teufel, gedenkst du die Tür aufzukriegen?«, fauchte Mark.
»Du bist doch stark, oder?«, flüsterte sie.
»Herrgott, das ist eine Metalltür, und ich bin nicht Bruce Willis!«
»Bleibt ja weg!«, kreischte Böck.
Ellen hörte Wasser rauschen. Eine Badewanne wurde eingelassen. Was immer Böck auch vorhatte, viel Zeit blieb ihnen nicht, es zu verhindern.
»Also gut, Herr Böck. Wir werden jetzt zu Ihnen kommen!«, rief Mark und winkte Schwester Marion zu. »Bringen Sie mir ein Kissen. Schnell!«
»NEEEEIIIIN!« Böck heulte. Dann platschte etwas ins Wasser. Sekunden später noch einmal.
»Was macht der bloß?«
Ellen sah sich nach etwas um, mit dem man die Tür hätte aufhebeln können - einen herrenlosen Infusionsständer oder etwas in der Art -, fand jedoch nichts.
Endlich kam Marion zurück. Mark riss ihr das Kissen aus der Hand, hielt es an seine Schulter und rannte mit einigem Anlauf gegen die Badezimmertür. Der junge Arzt
Originalausgabe 11/2009 Copyright © 2009 by Wulf Dorn
Copyright © 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House
Redaktion: Angela Kuepper
eISBN : 978-3-641-03762-8
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de