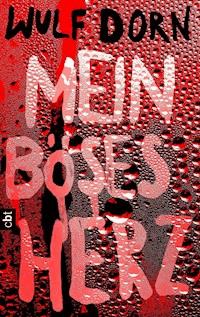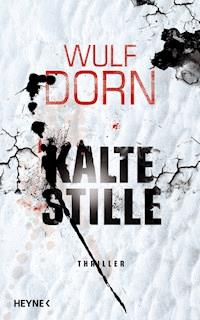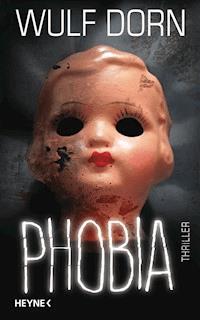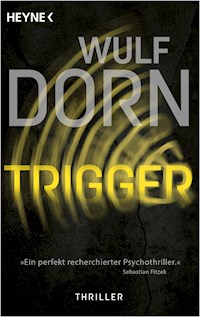6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Bände der "21"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Nikka. Ich wurde ermordet. Aber das war erst der Anfang …
Als die 16-jährige Nikka in einem Krankenhaus zu sich kommt, hat sie Mühe, sich zu erinnern, was passiert ist. War sie nicht eben noch mit ihrer Freundin Zoe auf dieser Party? Dann plötzlich ... Filmriss. Nikka erfährt, dass sie tot war – schockierende 21 Minuten lang. 21 Minuten ohne Herzschlag, aber keineswegs ohne Erlebnisse. Denn sie erinnert sich an einen dunklen Tunnel, in dem sie einem Licht entgegenirrte und in dem auch Zoe war. Schockiert erfährt Nikka, dass ihre Freundin seit der Party vermisst wird. Wurde sie ebenfalls ermordet? Nikka glaubt das nicht und macht sich auf die Suche ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wulf Dorn
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Arcangel Images/Victoe Habbick
ml • Herstellung: RW
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-22076-1V003
www.cbj-verlag.de
Für meinen Bruder Christoph, seine Kollegen
und alle, die tagtäglich Leben retten,
wobei sie nicht selten ihr eigenes riskieren.
»Die Geburt bringt nur das Sein zur Welt;
die Person wird im Leben erschaffen.«
THÉODORE JOUFFROY
»I was in the wrong place at the wrong time
For the wrong reason and the wrong rhyme
On the wrong day of the wrong week
I used the wrong method with the wrong technique.«
DEPECHE MODE
»Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod,
das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wandrer wiederkehrt,
den Willen irrt …«
WILLIAM SHAKESPEARE
POST MORTEM
Niemand kann sich an seinen allerersten Gedanken erinnern. An diesen einen ganz besonderen Moment, in dem für uns alles beginnt. Den Moment, in dem wir begreifen, dass es uns gibt. Den Moment, in dem wir beginnen zu sein.
Dabei haben wir bei unserer Geburt eigentlich schon ein vollständig entwickeltes Gehirn. Es hat etwa hundert Milliarden Nervenzellen und die sind durch fast hundert Billionen Synapsen miteinander verknüpft.
Diese Zahl ist unvorstellbar, oder? Kein Wunder, denn sie ist tausendmal größer als die Summe aller Sterne der Milchstraße.
Jeder von uns trägt also ein eigenes kleines Universum in sich, das wie die leere Festplatte eines Computers nur darauf wartet, mit Wissen, Gefühlen und Erfahrungen befüllt zu werden. Und das wird es ständig, denn unser Geist ist unermüdlich. Er arbeitet auch dann, wenn das Bewusstsein schläft.
Inzwischen wissen wir eine Menge über das Weltall, über ferne Galaxien und Planeten, die Lichtjahre von uns entfernt sind. Aber über dieses eine ganz besondere Universum, das wir in uns tragen und das uns zu einer eigenständigen Persönlichkeit macht, wissen wir noch immer viel zu wenig.
Wie entsteht ein Gedanke, wie eine Idee oder ein Gefühl?
Und was bleibt von uns, wenn wir einmal nicht mehr sind?
Im Durchschnitt hat jeder Mensch etwa sechzigtausend Gedanken am Tag. Manche sind vielleicht unbedeutend, aber viele davon können unser Leben verändern. Unsere Zukunft. Das, was aus uns werden wird – und aus anderen.
Wir lernen, verstehen, überlegen, planen, hoffen, wünschen und lieben, und das alles macht uns zu den Menschen, die wir sind. Bis wir dann irgendwann ein allerletztes Mal denken.
An diesen letzten Gedanken – meinen letzten Gedanken – kann ich mich erinnern. Ich hatte Angst, schreckliche Angst.
Mein Name ist Nikka.
Ich wurde ermordet.
Aber das war erst der Anfang.
I.
DER DUNKLE ORT
1.
Alles geschah ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Als hätte ein gewaltiger Hammerschlag mein Leben in tausend winzige Scherben zersplittert. In einem Moment war ich noch ein ganz normales Mädchen, das ein ganz normales Leben führte, und im nächsten Augenblick war nichts mehr wie zuvor.
Ich fand mich auf dem Rücken liegend am Boden wieder, ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen war. Ich konnte nicht mehr richtig sehen und hatte höllische Kopfschmerzen. Mein Herz raste, alles war verschwommen, mir war schwindlig und entsetzlich schlecht. Vor meinen Augen tanzten Lichtblitze, Farben und Schatten. Als sei ich in ein Kaleidoskop geraten, das sich immer schneller und schneller drehte.
Über mir kreisten schemenhafte Gestalten mit verwaschenen Gesichtern, und da war ein wildes Durcheinander von Stimmen, die ebenfalls nur verzerrt zu mir durchdrangen.
»Was ist denn mit der los?«
»Keine Ahnung, Mann.«
»Ist plötzlich zusammengebrochen.«
»Geht mal alle zur Seite!«
»Oh fuck! Was hat die denn?«
Die Stimmen dröhnten in meinem Kopf und hörten sich an, als würde man eine Aufnahme mal zu langsam, mal mit normaler Geschwindigkeit und dann wieder viel zu schnell abspielen.
»Hey! Hey du! Hörst du mich?«
Ich brauchte einen Moment, ehe ich begriff, dass das mir galt. Die Stimme klang unnatürlich tief, wie die eines Monsters, und die dazugehörige verschwommene Fratze hatte tellergroße schwarze Augen und einen wabernden Mund. Trotzdem war ich mir sicher, dass es ein Junge war, der sich da über mich beugte.
»Hey! Hörst du mich?«, schrie er wieder, und seine Monsterstimme zerriss mir fast das Trommelfell.
Natürlich höre ich dich, du Idiot! Und wenn du mich noch mal so anbrüllst, platzt mir der Schädel!
Das wollte ich sagen oder, noch besser, ebenfalls schreien, damit er endlich die Klappe hielt. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht mehr sprechen und mir auch nicht die Ohren zuhalten. Ich war vollkommen gelähmt, spürte weder meinen Mund noch meine Arme oder Hände und auch sonst nichts mehr. Als sei mein Körper auf einmal verschwunden.
»Wow, das ist ja krass!«, ertönte eine weitere Monsterstimme, die wohl ebenfalls zu einem Jungen gehörte.
»Hau ab, Mann! Lass sie in Ruhe!«
Monsterjunge Nr. 1 schien jetzt ganz dicht bei mir zu sein. Er schrie wieder, diesmal allerdings nicht in meine Richtung.
»Ruft einen Notarzt! Schnell!«
»Iiih, das ist ja voll eklig!«
Jetzt sprach ein Mädchen. Ihre schrille Stimme fühlte sich wie ein Zahnarztbohrer in meinem Gehirn an. Sie musste irgendwo über meinem Kopf schweben. Das war natürlich Blödsinn, aber so kam es mir vor.
Und was, zum Teufel, meinte sie damit? Was war so eklig?
Etwa ich?
»Lass den Scheiß und verschwinde«, brüllte Monsterjunge Nr. 1. »Hat jemand den Rettungsdienst angerufen? Verdammt, nun macht schon! Sie geht sonst drauf!«
Ich konnte immer noch nicht begreifen, was los war.
Warum lag ich hier?
Und warum war mir so furchtbar schwindlig?
Aber ich konnte nicht länger darüber nachdenken. Offenbar füllte sich mein Kopf nun mit irgendetwas Zähem an, das keinen klaren Gedanken mehr durchließ. Außerdem war ich entsetzlich müde. So müde, dass ich kaum noch die Augen offen halten konnte.
»Shit, bloß das nicht!«
Diesmal galt der Schrei des Monsterjungen wieder mir.
»Bleib da! Hörst du? Bleib da!«
Dableiben? Ich rührte mich doch gar nicht. Ich konnte mich ja nicht mal bewegen.
Ich wollte doch nur ausruhen.
Schlafen.
Ruhe haben.
Aber trotzdem geschah nun etwas mit mir. Ohne, dass ich es wollte, bewegte ich mich tatsächlich.
Abwärts.
Immer schneller und schneller.
Ich erschrak, war auf einmal wieder völlig wach und bekam Panik.
Nein!, wollte ich schreien. Haltet mich! Helft mir!
Ich wollte mich an irgendetwas oder irgendjemandem festklammern.
Aber weder Schreien noch Festhalten war möglich. Ich war völlig erstarrt und etwas sog mich unaufhaltsam in die Tiefe.
»Eis!«, rief der Junge. »Bringt mir Eis! Los, macht schon! Wo bleibt nur der verdammte Notarzt?«
Das war das Letzte, was ich hörte. Dann verklangen die Stimmen, die Lichter verschwanden, und Dunkelheit schlug über mir zusammen. So, als würde ich zum Grund eines tiefen, moorigen Sees sinken.
Und dann war alles still.
Viel zu still.
2.
Seither waren fast drei Tage vergangen, und eines wusste ich nun sicher: Der Tod unterscheidet nicht. Es spielt keine Rolle, wer du bist, was du tust oder was du im Leben vorhast – irgendwann stehst du auf seiner Liste, ob du nun dafür bereit bist oder nicht. Dann zählt nur noch, ob du dein Leben so gelebt hast, wie du es wolltest. Ob du getan hast, was du tun wolltest. Ob du der Mensch gewesen bist, der du sein wolltest.
Ich war erst sechzehn und ganz bestimmt noch nicht bereit zu sterben. Mein Leben hatte doch gerade erst so richtig angefangen. Ich hatte Pläne für die Zukunft, alles lag noch vor mir. Alles war noch möglich. Ich hatte alle Zeit der Welt dafür.
Hatte ich gedacht.
Aber die Wirklichkeit sah anders aus. Jetzt lag ich hier, in einem weißen Krankenbett auf der Intensivstation, und wusste, dass nichts im Leben sicher war.
Von irgendwo hinter mir hörte ich meinen Herzschlag als leises Piepen aus dem EKG-Gerät. Meinen Herzschlag, der mir nun nicht mehr selbstverständlich vorkam und der auch nie wieder selbstverständlich für mich sein würde.
Nicht, nachdem ich einundzwanzig Minuten lang tot gewesen war.
So lange hatte es gedauert, bis der Rettungsdienst eingetroffen war, um mich zurückzuholen. Der Arzt hatte sich deshalb bei mir entschuldigt. Kurz vor meinem Tod hatte es einen schweren Unfall auf der Autobahn gegeben und die Rettungskräfte waren dort im Großeinsatz gewesen. Bis sie an dem Club angekommen waren, in dem ich leblos neben der Tanzfläche gelegen hatte, war eine Weile vergangen.
Bis dahin hatte jemand, an den ich mich nur als den Monsterjungen erinnern konnte, versucht, mich wiederzubeleben. Er hatte mir dabei zwei Rippen gebrochen und er hatte nicht lockergelassen.
Der Arzt hatte gesagt, ich hätte großes Glück gehabt, dass dieser junge Mann im Club gewesen sei. Ohne ihn hätte ich es bis zum Eintreffen der Sanitäter nicht geschafft.
Dann wäre ich dort geblieben – auf der anderen Seite, an einem dunklen Ort, der mir jetzt wie die Erinnerung an einen bösen Traum schien.
Einundzwanzig Minuten hatten für mich über Leben und Tod entschieden.
Eigentlich war das keine lange Zeit. Mein Schulbus brauchte im Morgenverkehr manchmal länger. Eine Folge meiner Lieblingsserie lief mehr als doppelt so lange und kam mir dennoch immer viel zu kurz vor. Und mein Schwimmtraining dauerte fast dreimal so lange.
Aber wenn man das erlebt hatte, was ich erlebt hatte, wenn man dort gewesen war, wo ich gewesen war, bekam diese Zeit auf einmal eine völlig andere Bedeutung. Jetzt war die Einundzwanzig meine neue Definition von Ewigkeit.
»Nikka? Alles in Ordnung?«
Der Polizist sah mich besorgt an. Er hatte sich mir als Hauptkommissar Stark vorgestellt und war schon älter, vielleicht fünfzig oder so. Er hatte rötliche, kurz geschnittene Haare und ein ernstes Gesicht. Ich mochte seine grauen Augen, ihr Blick wirkte freundlich und verständnisvoll.
»Es geht schon«, krächzte ich und musste mich räuspern. »Es sind nur diese Halsschmerzen.«
Die hatte ich wegen des Schlauchs, mit dem man mich nach meiner Wiederbelebung intubiert hatte, weil ich anfangs noch nicht selbstständig atmen konnte. Seither fühlte sich meine Kehle an, als hätte ich mit glühenden Kohlen gegurgelt. Der Arzt hatte gesagt, das würde wieder vergehen, ebenso die Schmerzen der gebrochenen Rippen.
»Ich kann mich an kaum etwas erinnern«, sagte ich, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken hatte. »Dr. Mehra meint, dass das von der Droge kommt. Das fühlt sich ziemlich beschissen an.«
Der Kommissar nickte. »Ich kann mir denken, dass das nicht leicht für Sie ist, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Wir müssen herausfinden, was in dem Club vorgefallen ist. Nur so können wir Ihre Freundin finden.«
»Ich glaube, ich weiß, wer es getan hat«, sagte ich. »Zoe und ich haben jemanden gesehen.«
Der Kommissar rutschte mit erwartungsvollem Blick auf seinem Stuhl nach vorn. »Wen? Erzählen Sie mir alles, an das Sie sich erinnern können. Jedes Detail kann von Bedeutung sein.«
Ich trank einen weiteren Schluck und dann erzählte ich ihm von dem Abend. Dabei dachte ich ununterbrochen an Zoe, die jetzt spurlos verschwunden war. Meine beste Freundin, die es im Gegensatz zu mir vielleicht nicht geschafft hatte.
3.
DREI TAGE ZUVOR
Ich starb an einem Mittwoch. Es war der 31. Oktober, Halloween. Das Fest der bösen Geister. Wie passend!
Als hätte sich der Himmel mit dem Kalender abgesprochen, regnete es seit dem Morgen. Die Tage zuvor hatten wir noch einen tollen Indian Summer gehabt, der prima zu den Herbstferien passte, aber nun waren die bunten Farben über Nacht einem tristen Grau gewichen, und die Temperaturen hatten sich deutlich abgekühlt.
Die Idee, zu der Party zu gehen, war natürlich von Zoe gekommen. Keine zehn Minuten nachdem die Werbung dafür online gegangen war, hatte sie mir schon den Link geschickt.
DA MÜSSEN WIR HIN, hatte sie dazugeschrieben, in Großbuchstaben und von etlichen Emojis begleitet: zwei tanzende Figuren und eine lange Reihe breit grinsender Halloweenkürbisse.
Typisch Zoe. Keine Party ohne sie, und erst recht nicht, wenn es sich dabei um die Neueröffnung des einzigen Clubs im Ort handelte.
Ehrlich gesagt, war ich nicht besonders scharf darauf hinzugehen. Im Gegensatz zu meiner besten Freundin waren große Menschenansammlungen schon immer der Horror für mich. Aber ich wollte nicht als Partymuffel gelten – vor allem, seit mir Zoe prophezeit hatte, ich würde irgendwann als alte Jungfer enden, wenn ich nicht wenigstens ab und zu mal unter Leute ging.
»Das Leben spielt da draußen«, hatte sie gesagt. »Nicht in der Schwimmhalle, in deinem Zimmer oder im Kino und erst recht nicht in deinen Büchern.«
Damit hatte sie wohl recht, auch wenn ich mich meistens in meinen Büchern wohler fühlte als unter Menschen. Deshalb war Zoe wohl nicht nur meine beste, sondern auch meine einzige richtige Freundin.
Wir kannten uns schon seit dem Kindergarten und waren der beste Beweis dafür, dass Gegensätze sich anzogen. Zoe war groß, blond und lebhaft und ich … nun ja, das genaue Gegenteil eben.
Dass wir uns trotzdem so gut verstanden, lag daran, dass es zwischen uns von Anfang an eine Art besonderer Verbindung gegeben hatte. Wir dachten so oft das Gleiche, sprachen im selben Moment die gleichen Dinge aus und teilten den gleichen Humor, auch wenn Zoe ihn viel offener zur Schau trug. Das hatte keine von uns bisher mit jemand anderem so erlebt.
Wir waren Einzelkinder, und irgendwie war jede von uns für die andere wie die Schwester, die sie nie gehabt hatte. Wir waren immer füreinander da, passten aufeinander auf und teilten all unsere Geheimnisse.
Ich wusste, dass Zoe auf Miley Cyrus genauso wie auf Marilyn Manson stand. Dass sie sich gern Liebesschnulzen ansah, was sie aber niemals öffentlich zugegeben hätte. Dass sie unter ihrem Bett immer eine Notration Oreos für Frusttage versteckte und dass sie hin und wieder heimlich kiffte.
Für die letzten beiden Dinge hätte ihre Mom sie wahrscheinlich zu einem Daueraufenthalt in irgendeinem Beauty-Diät-Camp verdonnert. Vor allem wegen der Oreos.
Maria Wagner stellte sich für ihre Tochter eine Karriere als Schauspielerin oder als neue Heidi Klum vor, wohingegen Zoe selbst von einem Job in der Tourismusbranche träumte. »Am besten mit einem Büro in der Südsee«, hatte sie einmal gesagt. »Mit blauem Meer und Palmen vor dem Fenster.«
Zoes größtes Geheimnis war, dass sie sich nichts aus Jungs machte. Heutzutage eigentlich keine große Sache, sollte man meinen, und Fahlenberg war bestimmt keine Kleinstadt, in der man sich ständig über andere das Maul zerriss. Aber das war nur auf den ersten Blick so. Wenn man hinter die Kulissen schaute, war die Welt in den letzten Jahren irgendwie kleingeistiger geworden, fanden wir. Deshalb behielten wir Zoes Geheimnis für uns.
Ihr heimlicher Schwarm war Millie Bobby Brown, seit sie zum ersten Mal Stranger Things gesehen hatte, was fortan ihre Lieblingsserie war.
»Wenn ich jemals eine wie Eleven treffe, werde ich ihr einen Heiratsantrag machen«, hatte sie mir anvertraut, als wir letzten Sommer an unserem geheimen Lieblingsort oben auf dem Waldparkplatz abgehangen hatten.
»Warum gerade sie?«, hatte ich gefragt, und Zoes Antwort war wie aus der Pistole geschossen gekommen: »Na, weil sie sexy ist und Charisma hat.«
Nun, das konnte sie wohl besser beurteilen als ich. Für mich war schon immer klar, dass ich auf Jungs stand und auf einen ganz besonders. Aber Tom war natürlich schon vergeben, und Zoe war die Einzige, die wusste, dass ich in ihn verknallt war.
»Trag’s mit Fassung«, hatte sie mir geraten. »Ich werde Eleven ja auch nie heiraten können. Man bekommt im Leben eben nicht immer alles, was man sich wünscht.«
Das stimmte wohl. Genauso wie es stimmte, dass man manchmal genau das bekam, was man sich am allerwenigsten wünschte.
Das wurde mir an jenem Mittwochabend klar, als mir Zoe ein weiteres Geheimnis anvertraute.
Ein ziemlich unheimliches.
4.
Ich hatte meine Eltern nie kennengelernt. Einen Tag nach meiner Geburt erlitt meine Mom eine Gehirnblutung und fiel ins Koma. Eine Spätfolge der Wehen, vermuteten die Ärzte.
Mein Dad war sofort zum Krankenhaus gefahren und in seiner Aufregung hatte er einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. In dem Zeitungsartikel, den ich in meiner Andenkenkiste aufbewahrte, hieß es, er sei noch am Unfallort gestorben. Meine Mom folgte ihm zwei Tage später nach.
So wuchs ich bei meiner Großmutter auf, die es jedoch hasste, wenn man sie so bezeichnete. Dafür fühle sie sich viel zu jung, erklärte sie – obwohl sie inzwischen siebenundsechzig und somit für meine Begriffe alles andere als jung war. Deshalb hatten wir uns schon früh darauf geeinigt, dass ich sie bei ihrem Vornamen nannte: Ella.
Wir verstanden uns prima, auch wenn mir ihre Frömmigkeit und ihre ängstliche Art manchmal ziemlich auf den Geist gingen. Doch trotz ihrer ständigen Sorgen ließ sie mir meine Freiheiten, was sie bestimmt viel Überwindung kostete, und das fand ich ziemlich cool von ihr.
Als ich an diesem Abend nach dem Schwimmtraining mein Kostüm für die Party und ein paar Übernachtungssachen in meinen Rucksack packte, stand Ella in der Tür zu meinem Zimmer und gab mir zig Ermahnungen mit auf den Weg, wovor ich mich auf solchen Partys, wie sie es betonte, in Acht nehmen sollte. Vor allem natürlich vor den Jungs, die immer nur das eine wollten.
»Der liebe Gott passt nur auf die auf, die auch auf sich selbst aufpassen. Also steig zu keinem Fremden ins Auto, hörst du? Und auch nicht zu jemandem, den du kennst, wenn er etwas getrunken hat.«
»Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht«, versicherte ich ihr. Ich nahm Herrn Rossi hoch, der schnurrend meinen Rucksack inspiziert hatte – und sicherlich jeden Moment hineingekrochen wäre –, und setzte ihn auf den Boden.
»Falls du es dir anders überlegst und doch nach Hause kommen willst, dann nimm dir ein Taxi«, sagte sie und steckte mir einen Zehner in die Jackentasche.
»Ella, das braucht es doch nicht. Ich werde bei Zoe schlafen und ihr Dad fährt uns hin und holt uns auch wieder ab.«
»Das braucht es sehr wohl«, beharrte sie und nahm unseren alten Kater auf den Arm, der sich sofort an sie schmiegte. »Sicher ist sicher. Man liest jeden Tag die schlimmsten Dinge in der Zeitung, und ich will auf gar keinen Fall, dass dir etwas zustößt. Du bist doch der einzige Mensch, den ich noch habe.«
Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Wir hatten einfach zu viele geliebte Menschen verloren, um noch einen weiteren Verlust zu ertragen. Deshalb sah ich es ihr auch nach, wenn sie manchmal vergaß, dass ich in drei Monaten schon siebzehn wurde.
Ich nahm mir vor, den Zehner nicht anzurühren. Stattdessen würde ich ihn gleich nach meiner Rückkehr wieder in die Zuckerdose auf dem Küchenregal stecken, wo Ella ihr Extrageld für besondere Fälle aufbewahrte. Wir waren nicht arm, und es ging uns gut, aber uns stand eben nur das Einkommen einer Rentnerin zur Verfügung, und mein Taschengeld, das ich mir mit dem Austragen des Wochenanzeigers verdiente.
Nachdem ich Ella zum gefühlt hundertsten Mal versichert hatte, dass ich auf mich aufpassen würde, drückte ich ihr einen Kuss auf die Wange und machte mich auf den Weg.
Ich nahm den Sieben-Uhr-Bus und fuhr hinaus zum Stadtrand, wo die Wagners in einer schicken Siedlung wohnten. Ein stylishes Haus mit einem großen gepflegten Garten, an dessen Tor ein Messingschild für das Architekturbüro von Zoes Eltern warb.
Zoe erwartete mich schon und wir gingen sofort in ihr Zimmer. Nun, eigentlich war es kein Zimmer, sondern ein kleines Apartment im Obergeschoss. Es hatte sogar ein eigenes Bad.
Sie trug bereits ihr Kostüm und sah in ihrem schwarzen Outfit als Catwoman ziemlich sexy aus. Das einzig Bunte an ihr war unser Freundschaftsband, das keine von uns jemals ablegte.
»Wow«, sagte ich. »Halle Berry hat keine Chance gegen dich.«
Zoe sah mich fragend an.
»Du kennst den Film nicht?«
»Nein, ich fand einfach nur das Kostüm scharf.« Sie hielt mir einen Teller mit Karottensticks und einem grünlichen Dip hin. »Hier, willst du? Ist mit Avocado, aber ohne Knoblauch.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nicht so wirklich, danke.«
Sie grinste. »Ich kann dieses Gemüsezeug auch nicht mehr sehen, aber du kennst ja meine Mom. Fürchtet Kohlenhydrate wie der Teufel das Weihwasser. Hauptsache, es hält schlank, ist gesund und natürlich. Aber da gibt es ja auch noch andere Sachen.«
Damit zog sie einen Joint aus ihrem Ausschnitt und hielt ihn mir vors Gesicht. »Reine Bioware.«
»Du willst doch jetzt nicht …«, begann ich, doch Zoe lachte nur und öffnete das Fenster.
»Nur ein bisschen zur Auflockerung.« Sie steckte sich den Joint an, zog daran und hielt ihn mir hin. »Nimm auch ’nen Zug, entspann dich.«
»Danke, heute lieber nicht.«
Ich legte meinen Rucksack neben Zoes Katzenmaske auf dem Bett ab. Dann holte ich mein Schminkzeug und das Kostüm hervor, das eigentlich nichts anderes war als eines von Ellas weißen Nachthemden. Den Saum hatte ich über Nacht in schwarzer Wasserfarbe eingelegt, sodass er nun ziemlich schmuddelig aussah.
»Was soll das denn werden, wenn’s fertig ist?«, fragte Zoe und blies einen Mundvoll Rauch aus dem Fenster.
»Lass dich überraschen, ich hab’s gleich.«
Ich zog das Nachthemd über. Es war mir zwei Nummern zu groß und sah an mir eher wie ein Kleid aus, genau wie beabsichtigt. Dann nahm ich einen Kamm und etwas Gel und drapierte meine langen dunklen Haare vors Gesicht.
Schließlich wandte ich mich zu Zoe um.
»Und? Wer bin ich?«
»Hey, das ist cool! Das tote Mädchen aus Ring!«
Sie streckte beide Daumen in die Höhe und ich lachte.
»Genau! Hundert Punkte für dich. Ist zwar schon ein alter Schinken, fast so alt wie ich, aber immer noch der gruseligste Film, den ich kenne. Jetzt muss ich nur noch meine Augen so richtig dunkel …«
»Pst!«
Zoe legte den Finger an die Lippen und trat ein Stück vom Fenster zurück. Ihr Blick wurde schlagartig ernst.
»Was ist los?«
»Schau mal, da draußen«, flüsterte sie.
»Was ist da?«
»Da steht einer.«
Noch immer sprach sie mit gesenkter Stimme, und ich war mir nicht sicher, ob sie mich verschaukelte oder nicht.
»Wer soll da stehen? Michael Myers, weil Halloween ist? Haha.«
Zoe schüttelte den Kopf. »Im Ernst jetzt. Da ist ein Typ, der uns beobachtet.«
»Kein Scheiß?«
»Nein, echt nicht. Komm her!« Sie winkte mich ungeduldig zu sich heran. »Schau selbst. Da unten bei der Hecke.«
Ich zögerte einen Augenblick, ehe ich zum Fenster ging. Halb erwartete ich, dass Zoe gleich losprusten und mir etwas wie »Buh!« ins Ohr rufen würde.
Aber das tat sie nicht. Stattdessen sah ich im trüben Abendlicht tatsächlich jemanden im Garten stehen. Eine schlanke dunkle Gestalt mit einem Kapuzenpullover, die sich halb zwischen den Büschen am Tor verbarg. Die hohe Gartenhecke hielt das Licht der Straßenlaternen ab, und wenn man es nicht besser wusste, hätte man glauben können, dort unten stehe eine Statue.
Zoe stand mit dem Rücken zum Fenster, und der Typ musste wohl gedacht haben, er sei ihr nicht aufgefallen. Aber als ich nun ans Fenster kam und zu ihm herunterschaute, duckte er sich hinter die Büsche und tauchte nicht wieder auf.
»Himmel, was war denn das?«
Zoe trat neben mich und schaute ebenfalls wieder in den Garten hinunter. »Keine Ahnung. Der Typ war schon ein paarmal da und immer steht er nur da und glotzt zu meinem Fenster rauf.«
»Das war nicht das erste Mal?«
»Nein, das geht jetzt schon ungefähr vier Wochen so. Er taucht immer wieder mal auf.«
»Wow! Hast du das deinen Eltern gesagt?«
Sie schaute mich an, als ob ich sie etwas Dummes gefragt hätte. »Natürlich nicht! Soll ich meiner Mom einen Herzinfarkt bescheren? Du kennst sie doch, die würde sich nicht mehr vor die Tür trauen. Und ich hätte dann Hausarrest, bis der Kerl geschnappt ist.«
»Aber das geht doch nicht! Irgendwas muss man doch dagegen tun!«
»Ach ja, und was?«
»Na, die Polizei rufen oder so.«
»Süße, und was soll ich denen erzählen? Dass wir hier einen Spanner im Viertel haben? Der Typ ist doch immer gleich wieder weg, wenn ich ihn sehe. Glaubst du, der würde hier brav stehen bleiben und auf die Bullen warten?«
»Nein, aber … «
»Und selbst wenn die etwas unternehmen wollten, was sollten sie denn tun? Eine Streife vor unser Haus stellen? Bestimmt nicht! Mom würde durchdrehen. Außerdem würde das meinen Eltern die ganze Kundschaft vertreiben.«
»Na ja, es würde ihm wenigstens einen Schrecken einjagen«, sagte ich, auch wenn mir mein Vorschlag inzwischen selbst ziemlich naiv vorkam. »Vielleicht bleibt er dann weg.«
»Das glaubst du doch selbst nicht!« Zoe schnaubte abfällig den Rauch durch die Nase aus. »Bis jetzt hat es den doch auch nicht gejuckt, dass ich ihn gesehen habe. Nicht mal, nachdem ich neulich mein Handy hochgehalten habe. Er kommt immer wieder.«
»Du hast ein Foto von ihm gemacht?«
»Nein, ich war leider nicht schnell genug.« Sie seufzte und dann sah sie mich ernst an. »Okay, jetzt weißt du’s, aber das muss unter uns bleiben, verstanden? Meine Eltern dürfen das nicht wissen. Das musst du mir versprechen, okay?«
»Aber du kannst dem Kerl das doch nicht durchgehen lassen!«
»Werde ich auch nicht.« Zoe sah wieder in den Garten hinunter. »Ich erwische ihn schon noch. Aber bis dahin hältst du die Klappe, ja?«
»Okay, ich werde niemandem etwas sagen. Versprochen.«
Zoe schaute einen Moment schweigend zum Fenster hinaus. »Eigentlich wollte ich nur wissen, ob du ihn auch siehst«, sagte sie schließlich.
Ich hob verwundert die Brauen. »Was soll das denn heißen?«
»Na ja, er steht da unten immer im Dunkeln, und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich ihn mir vielleicht nur einbilde.«
Sie drückte ihren Joint auf dem Fensterbrett aus, schob den Rest davon zurück in ihren Ausschnitt und versprühte mit einem routinierten Handgriff Haarspray im Raum.
»Vielleicht sollte ich die Scheiß-Kifferei ja besser lassen.«
»Das solltest du auf jeden Fall«, riet ich ihr, denn eigentlich hatte ich das Zeug immer nur ihr zuliebe mitgeraucht. Ich fand, dass es ziemlich eklig schmeckte, und wirklich entspannt war ich danach auch nie gewesen.
»Und vor allem solltest du auf dich aufpassen«, fügte ich hinzu, wobei ich mich fast schon wie Ella anhörte. »Vielleicht reicht dem Typ das Spannen ja irgendwann nicht mehr.«
»Ach Quatsch!« Zoe winkte ab. »Das ist einfach nur irgendein Klemmi, bei dem ’ne Schraube locker ist. Und er kann Gift drauf nehmen, dass ich ihn erwischen werde. Das Video davon werde ich dann auf Youtube stellen, damit jeder sieht, wie klein sein Ding ist.«
Sie schnappte sich einen der Karottensticks und ließ ihn zwischen ihren langen Fingern baumeln. »Sooo klein.«
Sie lachte, und auch ich musste schmunzeln, und dann klopfte es. Zoes Mom streckte den Kopf zur Tür herein.
»Seid ihr so weit? Dein Vater will sein Spiel nicht verpassen.«
»In exakt zweiunddreißig Minuten ist Anpfiff«, rief Rolf Wagner aus dem Erdgeschoss zu uns herauf, »und ich will das Spiel von Anfang an sehen!«
»Wir haben es gleich«, sagte Zoe. »Samara braucht nur noch ihr Make-up.«
Maria Wagner sah uns stirnrunzelnd an. »Wer?«
»Oh Mom«, seufzte Zoe. »Wenn du immer nur deine öden Fernsehkrimis schaust, verpasst du die besten Sachen.«
»Das ist ja wohl Ansichtssache«, entgegnete sie und klang ein wenig gekränkt. »Und lüfte noch, bevor ihr geht! Bei euch riecht es ja, als sei ein Friseursalon explodiert.«
Zoe zwinkerte mir zu und diesmal lachten wir beide. Dann vollendeten wir eilig unsere Maskerade. Zoe half mir mit ihrem Eyeliner und einem dunklen Lidschatten bei meinem Augen-Make-up. Danach sah ich wirklich zum Fürchten aus.
Als wir wenig später in Rolf Wagners Volvo aus der Hofeinfahrt zurücksetzten, sah ich noch einmal zu der Stelle, an der die Gestalt gestanden hatte.
Natürlich war dort niemand mehr.
Etwas weiter die Straße runter liefen zwei Frauen und ein Mann mit einer kleinen Gruppe Kinder. Auch sie hatten sich verkleidet. Im Vorbeifahren sah ich eine Prinzessin, eine Hexe, zwei Bettlakengeister und einen ziemlich kleinen Darth Vader, dem sein Todesstern davonrollte.
Der Mann lief dem Ball nach, brachte ihn dem Jungen zurück und sagte etwas zu ihm. Mir fiel auf, dass er einen dunklen Kapuzenpullover trug wie der Typ vorhin im Garten. Nur hatte er die Kapuze nicht über den Kopf gezogen.
Ich fragte mich, ob wir vielleicht nur diesen Mann gesehen hatten. Vielleicht hatte sich der Ball des Kleinen auch in den Garten der Wagners verirrt?
Aber das konnte ja nicht sein, wenn Zoe den Typ schon öfter dort gesehen hatte.
Mich beschlich ein ungutes Gefühl, und ich dachte, dass ich an Zoes Stelle nicht so cool bleiben würde.
5.
Der P2-Club befand sich im Industriegebiet am anderen Ortsende. Eigentlich war es nur eine umgebaute Werkshalle, und soweit ich wusste, waren dort vor vielen Jahren Sportschuhe hergestellt worden. Jetzt aber erstrahlte der alte Bau in voller Beleuchtung, und auch wenn die Fassade schon ziemlich heruntergekommen war, schien gerade das die Leute anzulocken. Dieser Grunge-Look wirkte im Neonlicht irgendwie cool.
Ich war ziemlich aufgeregt, denn im Gegensatz zu Zoe, die knapp ein Jahr älter war als ich, war ich noch nie in einem Club gewesen. Das ehemalige P2 hatte vor über einem Jahr geschlossen und damals war ich noch zu jung dafür gewesen. Nun kam ich mir ziemlich erwachsen vor, endlich auch reinzudürfen.
Als wir eintrafen, war der Parkplatz bereits übervoll. Fahlenberg hatte etwas mehr als hunderttausend Einwohner und an diesem Abend stand gefühlt mindestens die Hälfte davon vor dem Club-Eingang an.
Nachdem uns Rolf Wagner die üblichen väterlichen Ratschläge mit auf den Weg gegeben hatte (»Trinkt nicht so viel«, »Lasst die Finger von Drogen«, »Ruft mich an, wenn ich euch holen soll, aber nicht erst um zwei Uhr morgens« – den Hinweis auf die Jungs sparte er sich), machte er sich eilig auf den Heimweg. Zum Anpfiff seines Spiels würde er es wohl nicht mehr pünktlich schaffen, und auch wenn er es während der Fahrt zu verbergen versucht hatte, war er nicht besonders erfreut darüber.
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. Als wir über den Parkplatz zur Warteschlange vor dem überdachten Eingang gingen, mussten wir einigen großen Pfützen ausweichen. Wir überholten zwei Mädchen, die in knappen Hexenkostümen vor uns herstöckelten, und stellten uns hinter einer Gruppe Zombies an.
»Mann, ich komme mir vor wie in einer Episode aus The Walking Dead«, sagte Zoe lachend, woraufhin sich einer der Zombies zu uns umdrehte.
Er war ein großer, sportlicher Typ, und sein Make-up sah echt cool aus, aber sein Grinsen wirkte ziemlich dümmlich und arrogant. Außerdem schien er nicht mehr ganz nüchtern zu sein.
»Mh, ein Kätzchen, die fresse ich besonders gern«, sagte er. Dann ging er dicht an Zoe heran, fasste sie bei den Hüften und sah sich mit noch breiterem Grinsen zu seiner Gruppe um. »Miau mal für mich, Kätzchen!«
Die anderen lachten, und ich dachte: Großer Fehler, Junge!
Dann wandte er sich wieder Zoe zu. »Echt jetzt, ich mag Katzen. Und so heiße wie dich ganz besonders. Willst du rausfinden wie sehr?«
Zweiter großer Fehler.
Zoe bedachte ihn mit ihrem berühmt-berüchtigten Eisblick, bei dem man unweigerlich Gänsehaut bekam und der trotz ihrer Maske funktionierte.
»Wenn du nicht gleich deine Finger von mir nimmst, zieht dich meine Freundin heute Nacht in deinen Fernseher und reißt dir die Innereien raus«, sagte sie in einem Tonfall, der selbst die Hölle zum Gefrieren gebracht hätte. »Damit dekorieren wir dann unser Schlafzimmer. Nicht wahr, Darling?«
Wie in solchen Situationen üblich ging ich auf ihr Spiel ein. Ich senkte den Kopf und starrte den Typ durch meinen Vorhang aus Haaren an, wobei ich mir richtig Samara-mäßig vorkam.
»Aber natürlich, Darling«, sagte ich mit ebenso drohender Stimme. »Ich liebe Zombiefleisch. Auch wenn an dem nicht besonders viel dran ist.«
»Stimmt«, pflichtete Zoe mir bei und musterte ihn abschätzend. »Wahrscheinlich überall.«
Dann machte sie eine Geste mit dem kleinen Finger, die sehr an den Karottenstick von vorhin erinnerte, und wir prusteten los.
Der Typ wich so schnell vor uns zurück, als habe er sich an Zoe die Finger verbrannt. »Dämliche Zicken!«
Zoe sah zu mir und wir klatschten uns ab.
»Zickenpower, Baby!«, riefen wir wie aus einem Mund.
Mit finsterem Gesicht wandte sich der Zombie wieder seiner Gruppe zu, von der er nun ebenfalls ein paar spöttische Kommentare zu hören bekam. Ich grinste. Vor dem würden wir nun unsere Ruhe haben.
Dann sagte jemand hinter mir: »Hey Samara!«
Ich schaute mich um und blickte einem dicklichen Minion ins Gesicht, der kaum größer war als ich.
»Cooles Outfit. Sieht total echt aus bei dir. Stehst du auf Horrorfilme?« Er gluckste, als habe er etwas Komisches gesagt. »Ich hab eine riesige Filmsammlung zu Hause. Vielleicht willst du ja mal vorbeischauen? Wir können auch auf der Party ein bisschen zusammen abhängen. Hast du Lust?«
Ich seufzte. Dieser kleine pummelige Kerl mit der hohen Stimme passte genau in das Schema von Typen, die sich für mich interessierten. Fehlten nur noch die Zahnspange, dicke Brille und/oder das Lieblingsthema Mama (Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich).
Es war frustrierend. Der einzige Vorteil war, dass man für diese Art Jungs nur einen einzigen Blick brauchte, um sie verstummen zu lassen. Keinen Eisblick, auch keinen Samara-Blick, sondern einfach nur einen mitleidigen.
Nun lachte Zoe noch lauter und auch ich musste mir ein Grinsen verkneifen. Das wollte ich dem Typ dann doch nicht antun.
»Ach, vergiss es!«, brummte er, senkte schmollend den Kopf und tippte auf seinem Handy herum, als habe er plötzlich die wichtigste Nachricht seines Lebens erhalten.
Dann ging es endlich wieder ein Stück vorwärts. Wir näherten uns dem Eingang, neben dem ein übergroßes Frankensteinmonster aus Pappe stand, auf dessen Brust das Wort NEUERÖFFNUNG in bunten Neonlichtern blinkte. Der Papp-Frankenstein hatte verblüffende Ähnlichkeit mit Donald Trump, und über seinem toupierten Blondschopf verkündete eine gewaltige Sprechblase: Wir machen die Cocktails wieder groß!
»Das glaube ich erst, wenn ich es sehe«, kommentierte Zoe das Schild. Dann erzählte sie, dass der Vorbesitzer des Clubs schließen musste, nachdem die Getränke immer teurer und kleiner geworden waren, aber ich hörte ihr nur mit halbem Ohr zu.
Stattdessen galt meine Aufmerksamkeit einem Jungen mit einer Scream-Maske. Auch er trug einen schwarzen Pullover mit einer Kapuze, die er sich bis zur Maske in die Stirn gezogen hatte.
Zoe schien ihn nicht bemerkt zu haben, und für einen Augenblick überlegte ich, sie auf ihn aufmerksam zu machen. Aber dann entschied ich mich dagegen.
An diesem Abend erhielten alle Kostümierten ein Freigetränk und für die Kurzentschlossenen gab es nicht weit vom Eingang entfernt einen Verkaufsstand mit Masken. Offenbar hatte dieser Junge seine Maske an dem Stand gekauft. Zumindest hingen dort noch etliche weitere davon. Es war also bestimmt nur Zufall.
Dennoch machte es mich nervös, wie er dastand und in unsere Richtung starrte.
Die Gestalt vorhin im Garten hatte keine solche Maske getragen, andernfalls hätten wir das leuchtend weiße Totenschädelgesicht gesehen. Aber sonst gab es durchaus Ähnlichkeiten. Auch er war groß und schlank und ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet.
Und auch er stand wie versteinert da und schien uns nicht aus den Augen zu lassen.
Aber vielleicht täuschte der Eindruck ja. Vielleicht galt seine Aufmerksamkeit gar nicht uns. Man konnte schließlich nicht sehen, wohin er hinter seiner Maske tatsächlich schaute. Vielleicht sah er sich einfach nur die Leute an – die Zombies, Purger, Vampire und sonstigen Monster in ihren teils wirklich coolen Kostümen – und sein Blick war nur zufällig an Zoes scharfem Outfit hängen geblieben. Immerhin wäre er nicht der einzige Junge, dem es so ging.
Außerdem verhielten sich maskierte Menschen meist etwas sonderbar. Es war, als setzte die Maske etwas in ihnen frei. Als käme dadurch etwas Heimliches zum Vorschein, das man sonst im Alltag verborgen halten musste.
Und so war es wohl auch bei diesem Jungen, der einfach nur reglos starrte und dadurch unheimlich wirkte. Wahrscheinlich hätte er das nicht getan, wenn man sein Gesicht gesehen hätte.
Aber noch bevor ich ihn weiter beobachten konnte, bewegte sich die Schlange wieder vorwärts. Schließlich hatten wir den Einlass erreicht. Wir zeigten unsere Ausweise vor, bezahlten und wurden endlich in den Club gelassen, wo ich die Scream-Gestalt vollends aus den Augen verlor.
Drinnen empfingen uns Gedränge, Hitze, Schweißgeruch und laut wummernde Musik. Bunte Lichter blitzten von der Decke, und alles war erfüllt von stickigem, künstlichem Nebel, der mir fast den Atem raubte.
Mann, worauf hatte ich mich da nur eingelassen?
»Cool, da läuft Birthday Massacre!«, rief Zoe mir zu. Sie schnappte meine Hand und zog mich mit sich in das Getümmel auf der Tanzfläche.
Wir schafften es gerade so zu den letzten Takten von Happy Birthday, dann verkündete der DJ: »Und jetzt wird’s noch mal richtig retro, Leute!«
Gleich darauf dröhnten The Cure aus den Lautsprechern: Why can’t I be you?
Das war wirklich ganz schön retro, aber die Menge ging ab und wir mit ihnen. Zoes Ausgelassenheit war herrlich ansteckend. Wir tanzten los und irgendwann war mir sogar die Menschenmenge egal. Gedränge hin oder her, wir hatten einen Heidenspaß.
Und so hatten die letzten Minuten vor meinem Tod begonnen, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern konnte.
Das Einzige, was mir von diesem Abend sonst noch in Erinnerung geblieben war, waren die Leute mit den Monsterstimmen. Der Junge, der unbedingt wollte, dass ich bei ihm blieb, während er versuchte, mir das Leben zu retten.
Und der dunkle Ort, an den ich lieber nicht denken wollte.
6.
Der Kommissar hörte mir aufmerksam zu und machte sich Notizen auf einem kleinen Block, der in braunes Leder gebunden war. Er stellte mir keine Fragen und ließ mir Zeit, als ahnte er, wie schwer es mir fiel, all das noch einmal zu durchleben.
Ich beendete meine Erzählung damit, wie ich im Krankenhaus wieder zu mir gekommen war. Ella und eine Krankenschwester waren bei mir gewesen und Ella hatte geweint. Sie hatte die ganze Zeit über an meinem Bett gewacht und richtig fertig ausgesehen.
Dann hatte die Schwester Dr. Mehra geholt. Ich kannte den netten Arzt mit dem indischen Namen noch von früher. Vor einigen Jahren hatte er meinen Opa behandelt, als er hier auf der Intensivstation im Sterben lag. Vielleicht sogar in diesem Zimmer – so genau konnte ich mich nicht mehr daran erinnern.
Dr. Mehra hatte einige Tests mit mir gemacht, mich nach meinem Namen und allerlei Dingen gefragt, um zu sehen, ob mein Gehirn Schaden genommen hatte.
Ich hatte ihm gesagt, dass ich Nikka hieß und dass man meinen Namen mit zwei K schrieb. Wie Nikka Costa, weil meine Mom ihre Musik so gemocht hatte – jedenfalls hatte Ella mir das so erzählt. Auch alle anderen Fragen hatte ich ihm problemlos beantworten können.
Erst als er wissen wollte, an was ich mich erinnern konnte, hatte ich passen müssen. Ich wusste noch, dass ich in dem Club zusammengebrochen war, aber ich wusste nicht warum.
Dr. Mehra hatte mir erklärt, dass das an der Droge lag, mit der man mich vergiftet hatte. Gamma-Butyrolacton, das hatte ich mir gemerkt.
Das Zeug ist eigentlich ein Reinigungsmittel, aber es wird häufig auch als K.-o.-Tropfen missbraucht, hatte er gesagt. Es ist hochgefährlich, führt zu Gedächtnisverlust, Atemnot und einem kompletten Blackout.
Manchmal konnte es sogar tödlich ausgehen, wie in meinem Fall. Bei mir hatten die Tropfen einen Kreislaufkollaps ausgelöst. Danach war mein Herz stehen geblieben. Hatte einfach aufgehört zu schlagen. Einundzwanzig Minuten lang.
Aber diese Tropfen hatten noch viel mehr angerichtet, dachte ich jetzt, als ich dem Kommissar davon erzählte. Sie hatten mein ganzes Leben verändert, mich fast für immer umgebracht und dann in einen Albtraum gestürzt, aus dem es kein Erwachen mehr gab. Weil die Wirklichkeit, weil mein Leben jetzt der Albtraum war.
Wer immer das getan hatte, hatte mir nicht nur jegliches Gefühl von Sicherheit, sondern auch meine beste Freundin genommen. Er hatte Zoe entführt. Davon war ich überzeugt.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass es keine Spur von ihr gibt«, sagte ich. »Irgendjemand muss sie doch gesehen haben.«
Der Kommissar blickte von seinen Notizen auf. »Laut einer Zeugin ist Ihre Freundin zu den Toiletten gegangen. Das war, kurz bevor Sie zusammengebrochen sind. Danach herrschte ein ziemliches Durcheinander im Club, und niemand kann sich erinnern, Frau Wagner noch einmal gesehen zu haben.«
»Zoe wäre bestimmt sofort gekommen, wenn sie mitgekriegt hätte, was mit mir los war«, sagte ich und war den Tränen nahe.
Er nickte. »Das sehe ich ebenso. Deshalb gehen wir davon aus, dass irgendetwas auf den Toiletten vorgefallen ist.«
»Gibt es dort einen Hinterausgang?«
»Ja, da ist ein Notausgang. Aber wenn jemand diese Tür geöffnet hätte, wäre ein Alarm ausgelöst worden.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist doch verrückt! Zoe kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben.«
»Ganz bestimmt nicht. Vermutlich hat jemand das Durcheinander genutzt, um sie unbemerkt aus dem Club zu bringen. Aktuell werten wir noch die Überwachungsvideos aus, aber …« Der Kommissar zögerte kurz, dann sagte er leise: »Ich will Ihnen nichts vormachen, Nikka. Wir haben noch keinen Anhaltspunkt, was mit Ihrer Freundin geschehen ist oder wo sie sein könnte.«
Ich hatte das Gefühl, als würde plötzlich etwas in meiner Kehle stecken, und musste schlucken. »Können Sie nicht ihr Handy orten oder so etwas?«
Der Kommissar atmete tief durch, und seine Körperhaltung verriet, wie angespannt er war. »Das haben wir natürlich getan. Es war in ihrer Handtasche, die in einem Mülleimer lag. Nicht weit vom Eingang des Clubs entfernt. Die Schlüssel Ihrer Freundin und ihr Geld waren ebenfalls noch in der Tasche. Es war also kein Diebstahl. Jemand wollte die Sachen loswerden.« Wieder warf er einen Blick auf seine Notizen. »Sind Sie sich denn sicher, dass der maskierte Mann vor dem Club dieselbe Person war, die Sie im Garten der Familie Wagner gesehen haben?«
Ich zuckte die Schultern, was einen Stich in meinen gebrochenen Rippen verursachte. »Nicht hundertprozentig, aber er muss es doch gewesen sein. Ich meine, das ergibt doch jetzt Sinn, oder? Warum sonst hätte er uns so anstarren sollen? Bestimmt war er es auch, der mich vergiftet hat.«
Der Kommissar schürzte die Lippen. »Nun ja, das wäre möglich. Es könnte aber auch sein, dass Ihnen jemand anderes diese Tropfen verabreicht hat. Das kommt inzwischen leider sehr häufig vor.«
Ich schnaubte verächtlich. »Das hat der Doktor auch schon gesagt. Mir ist klar, dass es da draußen jede Menge kranke Spinner gibt, aber denken Sie doch mal nach: Jemand vergiftet mich, und jemand anderes kidnappt meine beste Freundin, und das am selben Abend, zur selben Zeit? Das wäre doch ein sehr großer Zufall, finden Sie nicht?«
»Ich weiß, Nikka, das klingt weit hergeholt, aber wir dürfen diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Es ist durchaus denkbar, dass jemand spontan die allgemeine Verwirrung genutzt hat, um Ihre Freundin zu entführen. Gibt es denn sonst noch irgendetwas, an das Sie sich erinnern? Was war das Letzte, was Frau Wagner zu Ihnen gesagt hat?«
Ich überlegte krampfhaft und hoffte, dass mir wirklich noch etwas einfiel. Etwas, das mir wenigstens halbwegs real erschien.
Stattdessen kehrten meine Gedanken immer wieder zu dem zurück, was ich während der einundzwanzig Minuten erlebt hatte, in denen ich eigentlich tot gewesen war. Mir wollte dieser dunkle Ort nicht aus dem Sinn gehen, auch wenn er mir immer mehr wie ein böser Traum vorkam. Ich konnte nicht vergessen, was ich dort gesehen hatte. Aber das konnte ich dem Kommissar unmöglich sagen. Er würde mich für völlig durchgeknallt halten. Und vielleicht war ich das ja auch.
»Nikka? Geht es Ihnen gut?«
Er sah mich besorgt an, und ich starrte auf die blasse Narbe, die eine seiner Brauen teilte. Ich konzentrierte mich auf dieses kleine Detail ebenso wie auf das Piepen des EKG-Geräts und den Geruch von Regen, der von seiner Lederjacke ausging.
Details waren jetzt wichtig für mich. Sie sprachen meine Sinne an und halfen mir, nicht an meinem Verstand zu zweifeln.
»Ich bin okay«, murmelte ich. »Aber ich kann mich leider an sonst nichts mehr erinnern.«
Er nickte. »Es tut mir ehrlich leid, falls ich Sie noch mehr beunruhigt habe und dass ich Ihnen nichts Positiveres berichten kann«, sagte er und stand auf. Er war so groß, dass ich mir beinahe den Hals ausrenken musste, um ihn anzusehen. »Nun erholen Sie sich erst einmal. Ich lasse Ihnen meine Nummer hier. Bitte melden Sie sich, falls Ihnen doch noch etwas einfällt.«
Als er diesen Satz sagte, kam ich mir wie das Opfer in irgendeinem dämlichen Krimi vor. Aber das hier war die Realität, auch wenn es mir schwerfiel, das zu akzeptieren.
»Finden Sie Zoe«, sagte ich und kämpfte wieder mit den Tränen. »Bitte!«
Er schob das Notizbuch in seine Jackentasche zurück.
»Wir tun unser Bestes.«
Wieder so ein Routinesatz, der mir Zuversicht geben sollte. Aber er wirkte nicht, denn die grauen Augen des Kommissars wichen meinem Blick aus. Inzwischen waren schon drei Tage vergangen, und wir wussten beide, was das bedeutete. Die Chance, dass Zoe noch am Leben war, wurde von Minute zu Minute geringer.
Und ich kann nichts dagegen tun!
Der Kommissar nickte mir zu und ging. Ich sah ihm nach, dann zog ich mir die Decke über den Kopf und ließ meinen Tränen freien Lauf.
Wer auch immer uns das antat, hatte etwas in mir zerbrochen. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich so hilflos gefühlt.
So verzweifelt.
Und so wütend.
7.
Ella besuchte mich zur Mittagszeit. Sie sah ein wenig besser aus als am Vorabend, aber sie wirkte immer noch ziemlich mitgenommen. Trotzdem bemühte sie sich, locker und unbeschwert zu wirken und mir das Gefühl zu geben, dass alles wieder in Ordnung sei. Es brach mir beinahe das Herz.
Ich ertappte mich dabei, dass ich mich schuldig fühlte. Schuldig daran, dass es ihr so schlecht ging, weil Zoe und ich einen großen Fehler gemacht hatten. Wären wir nicht auf die Party gegangen, wäre das alles nicht passiert.
Dabei war das doch Blödsinn. Nicht die Party war schuld daran. Nicht Zoe und erst recht nicht ich.
Wieder kochte Wut in mir hoch. Wenn ich dieses Schwein nur in die Finger bekommen könnte! Ob er wusste, wie viel Leid er mir und Zoe und unseren Familien zufügte? Aber wahrscheinlich war ihm das scheißegal.
»Schau, was ich für dich habe.« Ella holte eine Pralinenpackung aus ihrer Handtasche. »Das sind die mit der Orangenfüllung, die du so gerne magst. Der Doktor sagt, das sei in Ordnung.«
»Danke.« Ich rang mir ein Lächeln ab. »Das ist lieb, Ella. Später vielleicht.«
»Gut, aber versprich mir, dass du sie essen wirst, ja? Ich bringe dir jederzeit neue. Du bist so dürr und blass geworden.«
»Versprochen.« Ich zwang mich erneut zu einem Lächeln.
Sie legte die Schokoladenpackung zu ihren früheren Mitbringseln auf meinen Nachttisch: einem Kruzifix und zwei gerahmten Bildern von Pater Pio und der Mutter Gottes. Ich wusste, dass sie es auch damit nur gut meinte, aber trotzdem machte mich dieser Anblick nur noch zorniger.
Wenn es die drei wirklich gab, warum hatten sie mich dann nicht beschützt? Wo war der liebe Gott, an den Ella so innig glaubte, oder die Schutzengel, von denen sie mir früher immer erzählt hatte?
Am liebsten hätte ich ihr gesagt, was wirklich auf der anderen Seite auf uns wartete. Dass ich dort keinen lieben Gott und keinen Jesus gesehen hatte, sondern etwas, das mir eine Heidenangst gemacht hatte. Etwas, an das ich mich nie, nie, nie wieder erinnern wollte.
Aber es wäre unfair gewesen, meine Wut an ihr auszulassen. Ella konnte wirklich am allerwenigsten dafür.
Die Schwester kam ins Zimmer und holte mich aus meinen Gedanken.
»Mittagessen«, sagte sie strahlend. Sie wünschte mir einen guten Appetit und verschwand wieder.
Ich hob den Deckel vom Tablett. Darunter kam irgendetwas Püriertes zum Vorschein – wahrscheinlich wegen meiner Halsentzündung. Es sah aus, als hätte sich der Koch auf meinem Teller übergeben. Als mir der Essensgeruch in die Nase stieg, hätte ich beinahe dasselbe getan.
Ich bekam keinen Bissen davon runter, aber Ella nötigte mich, wenigstens den Nachtisch zu essen. Mit viel Überwindung löffelte ich etwas Götterspeise, die einfach nur pappsüß und glibberig schmeckte.
Etwa zwanzig Minuten später erschien die Schwester wieder und erlöste mich, indem sie mich zur Untersuchung abholte. Sie brachte mich in die neurologische Abteilung, wo man einige Tests mit mir durchführen wollte.
Der Neurologe hieß Dr. Sander. Er war vielleicht Ende dreißig und ein ziemlicher Nerd. »Das ist interessant« schien einer seiner Lieblingssätze zu sein. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er einer von den Typen gewesen war, die es im Bio-Unterricht nicht erwarten konnten, Kuhaugen oder Frösche zu sezieren und dann stundenlang darin herumzustochern.
Er testete zuerst mein Reaktionsvermögen und meine Reflexe, die alle »interessant« für ihn waren. Ebenso wie meine Gehirnströme, für deren Messung ich eine Art verkabelter Badekappe aufsetzen musste, die mit einem Computer verbunden war. Abschließend scannte er noch meinen Kopf. Für diese Magnetresonanztomografie wurde ich in ein röhrenähnliches Gerät geschoben, das etliche Schnittbilder meines Gehirns aufzeichnete. Als diese dann auf Dr. Sanders Monitor abliefen, sah das wie ein wirrer bunter Videoclip aus. Auch dieses Ergebnis war für ihn »interessant«.
»Was genau meinen Sie damit?«, fragte ich, woraufhin er zusammenfuhr und mich dann ansah, als hätte er erst jetzt bemerkt, dass zu dem Gehirn auf seinem Monitor auch ein Mensch gehörte.
»Nun ja«, sagte er, nahm seine Brille ab und säuberte die Gläser mit einem Papiertaschentuch. »Du hast keinerlei Gehirnschädigungen. Deine Reflexe und Reaktionen sind alle optimal.«
»Dann ist doch alles in Ordnung, oder?«
»Ja, sicher, natürlich«, stammelte Dr. Sander und setzte seine Brille wieder auf. »Dieses Ergebnis ist nur etwas ungewöhnlich, wenn ein Gehirn länger als zehn Minuten ohne Sauerstoff gewesen ist. Ich meine, immerhin war das bei dir mehr als doppelt so lange der Fall. Aber dein Lebensretter muss wirklich alles richtig gemacht haben. Die Herzdruckmassage hat dafür gesorgt, dass dein Gehirn weiter durchblutet wurde. Und dein Blut muss noch mit genügend Sauerstoff angereichert gewesen sein. Normalerweise sind das etwa zwanzig bis dreißig Prozent, aber so wie es aussieht, muss das bei dir etwas mehr gewesen sein. Treibst du denn Sport?«
»Ich schwimme.«
»Regelmäßig?«
Ich nickte.
»Nur so oder auf Leistung?«
»Ich habe das silberne Leistungsschwimmerabzeichen und möchte irgendwann an den Landesmeisterschaften teilnehmen.«
»Ah«, machte Dr. Sander. »Das ist interessant. Als Schwimmerin hast du sicherlich gelernt, deinen Sauerstoffvorrat effizienter einzuteilen als Leute, die keinen Sport betreiben. Selbst dann, wenn du nicht bei Bewusstsein bist. So etwas geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über, wie man so schön sagt. Daran kann es liegen. Und bestimmt auch daran, dass dein Gehirn gekühlt wurde.«
Ich schaute ihn verdutzt an. »Gekühlt?«
»Ja, gekühlt. Hirn auf Eis, sozusagen.« Er grinste auf eine Art, die eindeutig sagte Ich-weiß-etwas-was-du-nicht weißt, was ihn nur noch nerdiger wirken ließ. »Hat Dr. Mehra dir das denn nicht gesagt?«
»Nein, was denn?«
»Der junge Mann, der dich wiederbelebt hat, war ein echter Profi. Er hat deinen Kopf in Eis gepackt und so dein Gehirn auf eine Temperatur von unter 32 Grad Celsius gekühlt. Dadurch wird der Verfall der Hirnzellen verlangsamt. In deinem Fall konnte er so die Nekrose sogar komplett aufhalten. Interessant, nicht wahr?«
»Ja«, murmelte ich. »Das ist wirklich interessant.«
»Sage ich doch«, strahlte Dr. Sander. »Aber eines ist noch viel interessanter.«
Er rollte mit seinem Stuhl wieder zurück zum Monitor und deutete auf die bunten Bilder, die einen Querschnitt durch meinen Kopf darstellten. Die Animation lief noch immer, und es sah aus, als würde mein Gehirn aufblühen und dann wieder in sich zusammenschrumpfen, wie eine Blume in Zeitrafferaufnahme. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich die äußere Form meines Schädels und meine Augäpfel, die zwischen dem dreieckigen Vorsatz der Nase wie hohle Pingpongbälle wirkten. Und natürlich sah ich mein Gehirn.
Ich musste daran denken, dass in diesem Organ meine gesamte Persönlichkeit zu Hause war. Jeder Gedanke, jede Erinnerung, jedes Gefühl, das ich jemals empfunden hatte. Liebe, Freude, Schmerz, Leid, Trauer – einfach alles.
Dabei sah dieser Querschnitt irgendwie nichtssagend aus. Wie das Innere einer Walnuss, nur dass die beiden Hirnhälften auf dem Monitor bunt hervorgehoben waren.
»Hier siehst du den Scan deines Kopfes«, sagte Dr. Sander, als ob ich das nicht selbst wüsste. »Die farblichen Hervorhebungen kennzeichnen die Hirnaktivität. Je kälter die Farbe, desto niedriger die Hirnfunktion. Bei einem Hirntoten wäre das Bild natürlich schwarz, aber bei einem Komapatienten zum Beispiel würden die Gehirnhälften vorrangig in Blau und Violett angezeigt werden.« Er schaute mich wieder an. »So weit verstanden?«
Ich seufzte entnervt und zeigte auf den Monitor. »Bei mir sehe ich in erster Linie Gelb, Rot und Orange.«
»Eben«, sagte er und grinste. »Und zwar sehr viel Orange. An manchen Stellen sogar ungewöhnlich viel Rot. Und das ist interessant.«
»Warum? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das doch ganz normal, oder?«
Nun wich sein Grinsen einem tadelnden Blick. »Ganz normal wäre weniger Rot und Orange und stattdessen mehr Gelb. Was ich damit sagen will, ist, dass du eine erhöhte Gehirnaktivität aufweist.«
»Okay«, murmelte ich und sah wieder auf die Bilder. »Ist das nun gut oder schlecht?«
»Es ist interessant«, sagte Dr. Sander. »Offenbar hat der Vorfall dein Gehirn stimuliert. Das ist nicht schädlich, falls du das so verstanden haben solltest. Mir kommen nur nicht oft Patienten unter, die eine so hohe Gehirnaktivität aufweisen. Jedenfalls nicht, wenn man sie unter normalen Bedingungen testet. Bei dir sieht es so aus, als würdest du gerade eine komplizierte Rechenaufgabe lösen wollen und dabei gleichzeitig auf einem Hochseil balancieren. Sämtliche deiner Sinne sind aktiv, und zwar überdurchschnittlich.«
»Aber so fühle ich mich überhaupt nicht«, sagte ich. »Ich komme mir ganz normal vor, wie immer. Na ja, den Umständen entsprechend eben.«
Dr. Sander beäugte mich, als wären mir plötzlich Antennen aus dem Kopf gewachsen oder als hätte ich ein drittes Auge bekommen.
»Interessant«, sagte er leise und schien dabei mehr mit sich selbst zu sprechen. »Ich wünschte, ich hätte eine Vergleichsaufnahme von davor.«
Ich spürte, wie ich immer zorniger wurde. Für ihn schien ich nicht mehr als ein interessantes Versuchskaninchen zu sein.
»Und was bedeutet das nun? Ist mit mir alles in Ordnung oder nicht?«
»Ja.« Er hob abwehrend die Hände. »Bei dir ist alles bestens. Im Gegenteil, ich denke, du hast riesiges Glück gehabt. Aber falls dir in den nächsten Tagen doch noch etwas Ungewöhnliches an dir auffallen sollte, melde dich sofort bei mir. Ich würde das gerne noch weiter beobachten.«
»Weil mein Gehirn interessant für Sie ist«, gab ich zynisch zurück.
»Ganz genau. Ich wüsste zu gern, was dich so beschäftigt.«
Ich schnaubte zornig. »Zum Beispiel dass ich tot war und dass meine beste Freundin entführt wurde. Ist Ihnen das eigentlich klar?«
»Natürlich ist es das, und es tut mir leid«, sagte er, wobei er sich nicht besonders mitfühlend anhörte. Stattdessen schaute er mich weiterhin prüfend an. »Aber ich glaube, da ist noch etwas. Vielleicht etwas Unterbewusstes?«
Ich hätte es ihm sagen können, aber dann hätte er mich wohl direkt in die Klapsmühle gesteckt.
8.
Ich war froh, als ich endlich wieder in meinem Zimmer war. Für eine Weile lag ich einfach nur auf dem Bett und starrte zur Decke. Dabei hallten die Worte dieses durchgeknallten Doktors wie ein Echo in meinem Kopf nach.
Großes Glück gehabt … Großes Glück … Großes Glück …
Auch Dr. Mehra hatte das gesagt. Und die Schwestern. Und Ella. Eigentlich jeder.
Ja, natürlich hatten sie recht, ich lebte noch, und das war wirklich großes Glück. Aber was war mit Zoe?
Allein der Gedanke an sie schnürte mir die Kehle zu. Was, wenn sie kein Glück gehabt hatte?
Ich schaute auf mein Freundschaftsband. Darunter hatte man mir ein Messband angelegt, das mit den Geräten verbunden war, die hinter meinem Bett leise piepten und summten.
Ich kam mir vor wie im Cockpit eines Ufos. Wahrscheinlich würden sich gleich ein paar Aliens zu mir beamen und mit mir davonfliegen. Tut uns leid, Nikka, würden sie sagen. Wir haben dich auf dem falschen Planeten abgesetzt. Aber jetzt bringen wir dich heim.
So fühlte ich mich zumindest.
Fremd, verloren und schrecklich einsam.
Doch statt der Aliens erschien nur Schwester Ramona, um meinen Blutdruck zu messen. Sie war vermutlich Mitte zwanzig und ich mochte sie. Sie hatte tolle braune Augen und ich war ein wenig neidisch auf ihre dunklen glänzenden Haare. Meine eigenen wirkten meist etwas stumpf, was am vielen Chlorwasser beim Training lag.
»Na, das ist aber ein hervorragender Blutdruck«, sagte sie lächelnd. »Hundertzwanzig zu neunundsiebzig, genau wie aus dem Lehrbuch. Wie geht es dir denn sonst?«
»Geht so«, sagte ich und bemühte mich, ebenfalls zu lächeln.
»Wie war’s bei Dr. Sander?«
»Interessant.«
Sie kicherte. »Ich weiß, er ist mit Abstand der schrägste Vogel, den wir hier in der Klinik haben. Aber fachlich hat er echt was drauf. Und jetzt wird es Zeit, dass du endlich etwas isst.«
Daraufhin brachte sie mir das Abendessen. Es war ein großer Teller Kürbiscremesuppe und zwei Scheiben Brot.
»Ich hole den Teller nicht eher ab, bevor du ihn nicht leer gegessen hast«, sagte sie mit gespielter Strenge. »Das ist ein Befehl, verstanden?«
»Jawohl!«
Ramona lachte und ging aus dem Zimmer.
Tatsächlich hatte ich jetzt etwas Hunger. Ich kostete die Suppe, und sie schmeckte besser, als sie aussah.
Während ich aß, dachte ich an das Bild meines Gehirns auf dem Monitor. Wahrscheinlich gierte es jetzt nach Nahrung und musste sich stärken, um weiterhin so aktive orange und rote Flecken zu erzeugen. Diese Vorstellung amüsierte mich irgendwie.
Dann plötzlich vernahm ich hinter mir ein Geräusch. Es klang seltsam, wie ein Tappen und dann wieder so, als würde man etwas über den Boden schieben. Ich schaute an der hochgestellten Rückenlehne meines Bettes vorbei, doch da waren nur die Messgeräte.
Ich musterte sie eingehend, aber keines von ihnen schien solche Geräusche von sich zu geben. Alles war wie immer.
»Seltsam.«
Ich musste es mir eingebildet haben.
Kopfschüttelnd setzte ich mich wieder zurecht und aß weiter. Doch dann hörte ich es wieder. Jetzt schien es noch näher zu sein.
Erneut schaute ich mich um und auch diesmal war nichts Ungewöhnliches zu sehen.
Aber ich war mir sicher, dass ich etwas gehört hatte. Etwas, das jetzt eigentlich ganz dicht bei mir sein musste.
Ganz dicht hinter mir.
Oder nein … über mir!
Ich schaute hoch – und sah in das entstellte Gesicht eines Mannes. Mir stockte der Atem.
Das konnte nicht sein. Das war unmöglich!
Aber ich sah ihn. So deutlich, wie ich auch alles andere im Raum sah.
Der Mann war wirklich dort oben. Er kroch wie eine Spinne an der Decke auf mich zu. Sein Gesicht sah entsetzlich aus, als sei er mit dem Kopf in einen Fleischwolf geraten. Da war keine Haut mehr, nur rohes blankes Fleisch, frei liegende Adern und Sehnen.
Die Reste seines blonden Haars ragten wie schilfbewachsene Inseln aus der wunden Kopfhaut, und seine weißen Zähne schienen mich aus dem lippenlosen Mund anzugrinsen, so wie auch ein Totenschädel zu grinsen scheint. Aber die Laute, die er von sich gab, wirkten schmerzhaft und gequält.
Er trug einen schwarzen Lederanzug und schwere Stiefel, und streckte jetzt seine behandschuhte Hand nach mir aus.
Ich schrie auf, stieß dabei das Tablett und den Teller mit der heißen Suppe zu Boden und sprang aus dem Bett.
Nach nur zwei Schritten blieb ich hängen und fiel hin. Diese verdammten Kabel! Ich war an die Geräte gekettet und konnte nicht weg!
Panisch versuchte ich, das Messarmband loszuwerden, während der Ledermann weiter auf mich zukroch. Die Hand hielt er immer noch nach mir ausgestreckt. Nur noch wenige Augenblicke, dann wäre er so nah, dass er mich packen konnte.
Mir schlug das Herz bis zum Hals. Verzweifelt zerrte ich am Verschluss des Armbands. Das nun wild piepende EKG-Gerät kippte um und krachte auf den Boden.
»Shit, Shit, Shit!«