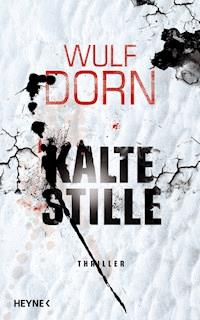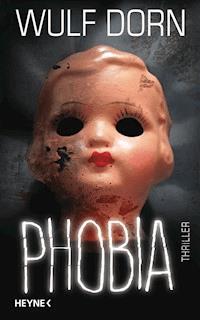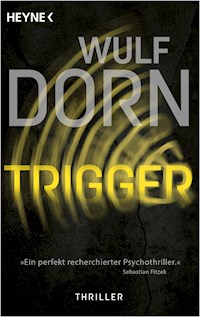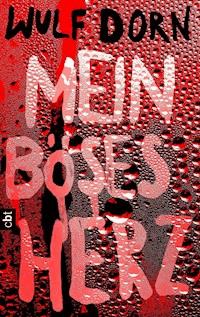
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein abgründiges Verwirrspiel um dunkle Geheimnisse – und die Angst vor dem »Bösen« in der eigenen Seele
Was tust du, wenn du nicht mehr weißt, was Realität ist und was Fantasie?
Seit dem Tod ihres Bruders wurde Doro von Halluzinationen verfolgt, aber eigentlich dachte sie, das in den Griff gekriegt zu haben. Doch als sie mit ihrer Mutter aufs Land zieht, scheint die neue Umgebung erneut etwas in ihr auszulösen. Stimmen verfolgen sie. Und eines Nachts sieht Doro in ihrem Garten einen Jungen: verstört, abgemagert, verzweifelt. Der Junge bittet sie um Hilfe – und ist dann verschwunden. Wenig später erfährt Doro, dass er schon vor ihrer Begegnung Selbstmord begangen hat. Doro kann nicht glauben, dass sie sich den Jungen nur eingebildet hat. Doch die Suche nach der Wahrheit wird schnell zum Albtraum. Und tief in Doros Seele lauert ein dunkles Geheimnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wulf Dorn
MEIN BÖSES HERZ
Wulf Dorn
MEIN BÖSES HERZ
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.cbt ist der Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2012
© 2012 cbt Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten
Wulf Dorn ist ein Autor der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de
Umschlaggestaltung: Zeichenpool, München,
unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock
(dinadesign, Neil Lang)
SK · Herstellung: AnG
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-06842-4V003
www.cbt-jugendbuch.de
Für Cinderella
und für
Jörg, Conny, Lilli, Christoph,
Dennis und Dismas
»Das Böse lebt nicht in der Welt der Dinge.
Es lebt allein im Menschen.«
Chinesische Weisheit
»If everything could ever feel this real forever.
If anything could ever be this good again.«
»Everlong«
FOO FIGHTERS
»Devil inside, devil inside,
every single one of us the devil inside.«
»Devil inside«
INXS
SCHWARZE ERINNERUNG
Was hast du getan, Doro? Was hast du nur getan …?
Da war jemand. Ein Eindringling, hier bei mir im Zimmer. Noch bevor ich die Augen aufschlug, spürte ich seine Gegenwart.
Kalt.
Finster.
Böse.
Sieh mich an, Doro!
Diese Stimme, so dunkel und verzerrt, sie konnte unmöglich zu einem Menschen gehören. Eher zu einem …
Nein, mein Verstand konnte kein Bild dazu formen. Alles, was er mir zeigte, war ein abgrundtiefes Schwarz. Was immer dieses Etwas auch sein mochte, war für mich unbeschreiblich. Ich konnte nur fühlen, wie böse es war.
Los doch, sagte die Stimme bedrohlich leise. Sieh schon her! Worauf wartest du noch?
Ich bekam keine Luft. Mein Körper war wie versteinert. Ich starrte auf meine Finger, die sich in die Bettdecke verkrampft hatten, während das Etwas hinter mir näher kam.
Seine Füße streiften kaum hörbar über den Teppich und mit jedem seiner Schritte wurde mir noch kälter. Als es dann unmittelbar hinter mir stand, ließ meine Lähmung nach, und ich begann, am ganzen Leib zu zittern, wie bei einem Schüttelfrost.
Du fürchtest dich vor mir, stellte das Etwas fest und kicherte. Dabei bist du es doch selbst, vor der du dich fürchten solltest. Nicht wahr, Doro?
Wieder das Kichern. Als ob Hagel auf ein Blechdach prasseln würde. Dann beugte es sich zu mir herab.
Ich wollte aufspringen, es abwehren, schreien – doch das ging nicht. Meine Angst vor dem, was ich zu sehen bekommen würde, war viel zu mächtig.
Ich wusste, wenn ich mich zu ihm umdrehte, würde ich vor Entsetzen verrückt werden. Also konnte ich nur daliegen, zitternd und hilflos.
Wir beide wissen, was du getan hast, raunte die Stimme mir zu, und ich fühlte ihren eisigen Hauch auf meiner Wange. Noch ist es unser hässliches kleines Geheimnis. Aber was wirst du tun, wenn die anderen davon erfahren? Was werden sie dann von dem lieben, netten Mädchen denken?
»Lass … mich … in Ruhe!«
Es kostete mich unglaubliche Anstrengung zu sprechen. Jedes meiner Worte hörte sich verwaschen an, wie das Lallen einer Betrunkenen.
Nein, hauchte das Etwas, ich werde dich nie wieder in Ruhe lassen. Nie wieder, verstehst du? Du hast mich in dein Leben gelassen und deshalb gehöre ich jetzt zu dir.
»Nein.« Ich schluchzte. »Geh weg! Lass … mich.«
Wie du willst, sagte das Etwas. Für den Augenblick. Aber ich werde wiederkommen. Wieder und wieder und wieder. Bis du zu dem stehst, was du getan hast. Niemand entkommt seinen Taten, Doro. Auch du nicht!
Auf einmal ließ die Kälte nach. Das Ding war fort. Es war ebenso plötzlich verschwunden, wie es gekommen war.
Weinend schreckte ich aus dem Albtraum hoch. Er war mir so realistisch vorgekommen, dass ich für einen Augenblick glaubte, ich würde die Fußabdrücke des Wesens auf dem Teppich sehen können.
Doch da war natürlich nichts. Nur das grüne Velours, auf das die Junisonne, die durch die Jalousie fiel, ein Streifenmuster warf.
Mein Wecker zeigte fünf vor acht. Von unten hörte ich das Klappern von Geschirr und gleich darauf die Stimmen meiner Eltern.
»Gerne«, rief Paps aus dem Bad und übertönte mit seinem kräftigen Bariton das Summen des Rasierapparats. »Zwei, bitte. Hart gekocht. Die kann ich heute brauchen.«
Aus der Küche drang Mums Lachen zu mir herauf.
An jedem anderen Sonntagmorgen hätte mich dieser frühe Lärm genervt, ich hätte mir die Bettdecke über die Ohren gezogen und weitergeschlafen. Heute war ich zum ersten Mal dankbar für die Störung.
Ich sprang aus dem Bett, schlüpfte in Jeans und T-Shirt und ging nach unten.
Mum stand in der Küche und löffelte Kaffeepulver in den Automaten. »Buon giorno, cara. So früh schon auf?«
Sie lächelte mich an und im Licht der Morgensonne glänzte ihr schwarzes Haar mit ihren bernsteinbraunen Augen um die Wette.
Jeder Mensch hat seine eigene Farbe und die meiner Mutter ist eben dieses wundervolle Goldbraun ihrer Augen. Ihre Eltern waren Sizilianer, und meine Großmutter hat immer gesagt, Italienerinnen seien die stolzesten und schönsten Frauen der Welt. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf alle zutrifft, aber bei meiner Mum hat sie auf jeden Fall recht gehabt.
Mum zwinkerte mir zu. »Bist du noch sauer wegen gestern?«
»Wegen gestern?« Ich schüttelte den Kopf. Im Augenblick war ich viel zu froh, aus dem Albtraum erlöst zu sein, um mich an gestern zu erinnern. »Nein, ich bin nicht mehr sauer.«
Mum schmunzelte. »Das freut mich, cara mia. Dann vergessen wir unseren Streit wohl am besten.«
»Ja, natürlich«, sagte ich und versuchte, mich zu erinnern, doch irgendwie gelang es mir nicht. Alles, was ich von gestern Abend noch wusste, war, dass wir uns angeschrien hatten. »Ich habe wohl ziemlich heftig reagiert, was?«
»Du hast eben Omas Temperament geerbt. Und jetzt Schwamm drüber.«
»So ist das also«, sagte Paps, der hinter mir in die Küche kam. Er beugte sich zu mir herab und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Ich roch sein Aftershave, auf dessen Fläschchen kristallfrisch stand. Ein Geruch, bei dem ich jedoch nicht an Kristalle denken musste, eher an Elfenbein. Das war die Farbe meines Vaters. »Wenn du das Aussehen von deiner Mutter und das Temperament von deiner Großmutter geerbt hast, was hast du dann von mir mitbekommen?«, fragte er.
»Den Zweitnamen deiner Mutter«, sagte ich und wischte mir den Elfenbeingeruch von der Wange.
Wie so oft, wenn ich zu ihm aufsah, fragte ich mich, warum ich es nur auf einen Meter zweiundsechzig geschafft hatte, und kam mir wieder einmal wie der Zwerg der Familie vor.
Paps war ein großer schlanker Mann mit einem kantigen Gesicht und tief liegenden blauen Augen. Er fuhr sich mit den Fingern durch das nasse braune Haar und musterte mich mit gespielter Ernsthaftigkeit. »Ich verstehe gar nicht, dass du den nicht magst.«
»Na, komm schon, Paps. Welches Mädchen will schon gern Dorothea heißen?«
»Du offenbar nicht.«
»Nein, ich finde den Namen spießig.«
»Ich weiß«, entgegnete er schulterzuckend, »aber deine Mutter mochte ihn. Nicht wahr, Schatz?«
Die Eieruhr rettete Mum vor einer Antwort. »Doro, Liebling, sei so gut und sieh nach deinem Bruder. Er ist bestimmt schon wach.«
»Och Mann, immer ich. Kann denn nicht Paps mal nach ihm sehen?«
Es war jeden Morgen das Gleiche. Allein schon der Gedanke an das schreiende kleine Monster machte meine gute Stimmung wieder zunichte. Nicht dass ich meinen eineinhalbjährigen Bruder nicht liebte, aber es nervte mich, ständig als Babysitter für »unser Nesthäkchen«, wie Tante Lydia ihn nannte, herhalten zu müssen.
Sicherlich hatte Kai sich wieder in die Windeln gemacht und ich hasste diesen Geruch auf nüchternen Magen.
»Ich bin bereits zum Brötchenholen abkommandiert worden.« Paps wedelte mit dem Autoschlüssel. »Also tu brav, was deine Mutter sagt. Vergiss nicht, dass auch sie das Temperament deiner Großmutter geerbt hat. Und noch dazu den Sturkopf deines Großvaters.«
»Ihr beiden seid unmöglich«, sagte Mum und lachte. »Und jetzt ab mit euch, die Eier werden kalt.«
Paps und ich wechselten einen kurzen Blick, dann mussten wir ebenfalls lachen.
Damals wusste ich es noch nicht, aber es sollte der letzte glückliche Moment in unserem Familienleben sein.
Die Erinnerung an das, was danach geschah, erscheint mir irgendwie dumpf und verzerrt. So wie man etwas wahrnimmt, wenn man den Kopf unter Wasser hält.
Ich kann weder Mum in der Küche hören noch den Motor unseres Autos, als Paps aus der Garage fährt. Stattdessen ist da ein hoher monotoner Laut, der meinen Kopf ausfüllt. Es ist schon viele Jahre her, dass ich einmal sehr hohes Fieber hatte. Auch damals war da dieser Ton gewesen. Eine Art Schwingen und Summen, die nur schwer zu beschreiben ist. Vielleicht am ehesten wie die Laute, die man unter Stromleitungen auf einem freien Feld hören kann.
Ich stehe im Flur und sehe zum Obergeschoss hinauf. Sonnenlicht fällt durch die Fensterwand auf die Stufen und taucht alles in ein unwirkliches Licht. Ja, es ist wie ein Fiebertraum.
Aus irgendeinem unerklärlichen Grund möchte ich nicht dort hinauf, aber dann gehe ich doch die Treppe hoch. Ich spüre die Teppichmatten unter meinen nackten Füßen. Die festen, engen Maschen. Fast ist es, als wollten sie mich zurückhalten.
Geh nicht weiter, sagt etwas in meinem Kopf. GEH NICHT WEITER!
Kais Zimmer liegt am Ende des oberen Stockwerks. Nachdem ich die Hälfte der Treppe hochgestiegen bin, kann ich den Hampelmann aus Pappe an der Tür sehen. Er leuchtet so hell, dass mich seine Farben blenden.
Ich blinzle und gehe zögerlich weiter. Dabei lausche ich durch den Summton in meinem Kopf hindurch nach Kais Stimme. Doch alles hier oben ist still.
Er muss uns doch unten in der Küche gehört haben. Warum schreit er dann nicht wie sonst?
Der Gang vor der Tür zieht sich unwirklich in die Länge, und plötzlich verschwindet das Sonnenlicht, als habe sich eine dunkle Wolke vor das Fenster geschoben.
Noch immer ist da diese warnende Stimme in meinem Kopf, die nicht möchte, dass ich weitergehe.
Aber trotzdem nähere ich mich Kais Zimmer. Schritt für Schritt. Ich kann einfach nicht anders.
Ich lege die Hand auf die Klinke und drücke sie vorsichtig nieder. Dann betrete ich das Halbdunkel des Kinderzimmers.Auch hier ist es unheimlich still. Vor mir sehe ich Kais Gitterbettchen. Das Mobile mit den bunten Disneyfiguren, das wie erstarrt von der Decke hängt.
»Kai«, flüstere ich. »Kai, bist du wach?«
Die Stille schnürt sich wie ein Band um meine Brust.
»Kai«, sage ich noch einmal, diesmal lauter. »He, kleiner Schreihals, was ist los mit dir?«
Er antwortet nicht.
Ich erkenne seine Umrisse unter der Sommerdecke, starre auf das Muster mit den lachenden Elefanten, die über den blauen Stoff tanzen. Doch Kai selbst bewegt sich nicht.
Irgendwoher weiß ich, dass es jetzt an der Zeit wäre, umzukehren und wegzulaufen, aber etwas zieht mich näher zum Bettchen meines kleinen Bruders hin.
Dann stehe ich am Gitterrand, sehe zuerst zum Fußende, wo Kais großer Plüschhase mit der Latzhose zu mir empor grinst. Alles in mir sträubt sich dagegen, zum anderen Ende des Bettchens zu sehen. Ich presse die Augen zu, so fest ich nur kann.
»Kai«, höre ich mich selbst sagen, »bitte …«
Aber da ist noch immer nur diese hässliche, böse Stille.
Ich habe ihm den Kopf zugewandt, schlucke, und dann öffne ich langsam die Augen.
Vor mir liegt Kai und starrt mich an. Seine Augen sind ebenso leblos wie die des grinsenden Latzhosenhasen. Aber Kai grinst nicht.
Er … er …
Sein Gesicht! Oh mein Gott, sein Gesicht!
Und dann endlich kann ich schreien.
Seit jenem Tag hat sich mein Leben von Grund auf verändert. Nichts ist mehr so, wie es war.
Sie brachten mich in eine Klinik und ich hatte viele Gespräche mit Psychiatern und Therapeuten. Sie wollten, dass ich mich erinnere, was in der Nacht vor Kais Tod geschehen ist. Aber es geht nicht. Statt Bildern klafft an dieser Stelle ein großes schwarzes Loch in meinem Gehirn, und irgendwo in diesem undurchdringlichen Dunkel höre ich die Stimme des unheimlichen Wesens flüstern. Tief, verzerrt und bedrohlich.
Was hast du getan, Doro? Was hast du nur getan …
Ich weiß es nicht.
Wirklich, ich weiß es nicht.
Alles, was ich von dieser Zeit in Erinnerung behalten habe, lässt sich am besten durch einen Kalenderspruch ausdrücken, den meine Zimmernachbarin in der Klinik über ihrem Bett hängen hatte:
Erst wenn wir alles verloren haben, verstehen wir, was es uns wirklich bedeutet hat.
Teil 1 FREAK
1
Vierzehn Monate später
»Herrje, was ist das denn?«
Mum trat so heftig auf die Bremse, dass ich nach vorn geworfen und gleich darauf schmerzhaft vom Sicherheitsgurt zurückgerissen wurde.
»Autsch!«
Irritiert sah ich zu Mum. Ich war auf der Fahrt eingenickt gewesen und nun schlug mir das Herz vor Schreck bis zum Hals.
»Du meine Güte«, stieß Mum hervor, ohne mich anzusehen.
»Was ist denn los?«
Ich blinzelte gegen das grelle Sonnenlicht an. Mühsam konnte ich die Autoschlange ausmachen, die sich keine fünfzig Meter vor uns auf der Landstraße staute.
»Ein Unfall?«
»Irgendetwas brennt da vorn.«
Mum zeigte zum Anfang des Staus, doch die tief stehende Sonne blendete viel zu sehr. Es kam mir vor, als versuchte ich, Details auf einem überbelichteten Foto zu erkennen.
Ich hob meine Sonnenbrille auf, die bei Mums abruptem Bremsmanöver in den Fußraum gefallen war, und dann sah auch ich die schwarze Rauchsäule, die kerzengerade zum wolkenlos blauen Himmel aufstieg.
Um uns herum flackerten Kornfelder und Wiesen in der drückenden Spätnachmittagshitze. Grillen zirpten und über der hügeligen Landschaft lag der süßlich schwere Sommergeruch von Beerensträuchern, trockenem Gras und Getreide.
Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn. Mein T-Shirt klebte mir am Leib und ich sehnte mich nach einer kalten Dusche. Mums alter Punto hatte noch keine Klimaanlage und ich kam mir vor wie ein Backhähnchen im Ofen.
»Wo sind wir eigentlich?«
»Kurz vor Ulfingen.« Da es nicht weiterging, stellte Mum den Motor ab und reckte den Kopf aus dem Fenster. »Sieht aus, als würde da vorn ein Feld brennen. Oder was meinst du?«
»Na prima«, murmelte ich und sah mich nochmals um. Weit und breit kein Haus. Nur Hügel, Felder und Felsen. Ich seufzte. Das sollte nun also meine neue Heimat werden. »Echt großartig.«
Ich musste an den Aufkleber denken, den mir Bea einmal geschenkt hatte – damals, als wir noch Freundinnen gewesen waren:
FAHLENBERG IST NICHT DER ARSCH DER WELT, ABER MAN KANN IHN VON HIER AUS SCHON SEHR GUT ERKENNEN.
Wer immer sich diesen Spruch ausgedacht haben mochte, hatte bestimmt vom Fahlenberger Kirchturm in die Richtung gesehen, in der irgendwo Ulfingen lag – Ulfingen, und sonst nichts außer dieser Einöde.
Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, dachte ich, konnte aber nicht wirklich darüber lachen.
»Warum musstest du ausgerechnet hierher ziehen, Mum?«
Mum lehnte sich wieder in ihren Sitz zurück, nahm die Straßenkarte vom Armaturenbrett und wedelte sich damit Frischluft zu. Dann wandte sie mir ihr Gesicht zu.
»Weil ich hier einen Job gefunden habe, ganz einfach.«
Ich sah mein Spiegelbild in den großen Gläsern ihrer Sonnenbrille: ein verschwitztes Mädchen, dessen kurze schwarze Haare in der Stirn klebten und das mit frustriertem Gesicht zu mir zurückblickte.
»Ich weiß«, sagte ich und seufzte. »Aber es hätte doch bestimmt auch andere Jobs gegeben. In diesem Nirgendwo will doch keiner tot überm Zaun hängen.«
»Nun hab dich nicht so, Schätzchen. Dir wird es hier bestimmt noch gefallen, wirst sehen. Ist ein schmuckes kleines Fleckchen, fast wie damals bei Oma in Cefalù.«
»Kleinsizilien auf der Schwäbischen Alb? Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.«
»Wo bleibt denn deine Fantasie, cara?«
Ich griff ihre Hand mit dem provisorischen Fächer und drehte sie so, dass sie auch mir etwas Luft zuwedelte. Viel brachte das allerdings nicht.
»Im Augenblick versteckt sich meine Fantasie vor der Hitze.«
Ich dachte an den Prospekt der Berliner Kunsthochschule, den ich gleich nach meiner Ankunft im neuen Haus an einer auffälligen Stelle platzieren würde, so wie in meinem ehemaligen Zimmer.
Dieser Prospekt war mein Nicht-mehr-lange-Motivator, der mir über die Tage hinweghalf, an denen ich glaubte, im Kleinstadtelend ersticken zu müssen.
Berlin war mein großes Ziel. Ich wollte endlich raus aus der spießigen Welt der Kaninchenzüchter, Blaskapellen und Kleingartenvereine, hinein ins pulsierende Großstadtleben.
Dort würden mich interessante Menschen erwarten, andere Kulturen, riesige Bibliotheken, Kunstausstellungen, Livekonzerte und Multiplex-Kinos mit Leinwänden, so groß wie die Außenfassaden der Dorfkinos, die ich bisher kannte.
Es würde ein Leben werden, von dem wohl jede Sechzehnjährige – fast Siebzehnjährige! – träumt.
Alles, was ich für diesen Neustart brauchte, war ein gutes Abi, und daran hatte ich die letzten Monate hart gearbeitet – trotz allem, was im vergangenen Jahr passiert war. Und bis es endlich geschafft war, musste ich einfach noch ein wenig durchhalten.
»Hier, trink etwas.«
Mum reichte mir die Flasche von der Rückbank. Das Mineralwasser war inzwischen lauwarm geworden und schmeckte übel.
»Hast du heute schon deine Tabletten genommen, cara?«
Ich verdrehte die Augen. »Ja, Mum.«
»Und du hast wirklich mit deinem Arzt wegen der Anschlusstherapie gesprochen?«
»Ja, hab ich.«
»Hast du auch an den Überweisungsschein gedacht?«
»Himmel, ja doch! Nun fang nicht schon wieder damit an.«
Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und lächelte verlegen, weil sie mich nun schon zum dritten Mal dasselbe fragte.
»Ich will doch nur dein Bestes, mein Schatz.«
»Ich weiß, Mum. Aber so allmählich nervt es mich, ständig danach gefragt zu werden, ob ich an alles gedacht habe. Die letzten vier Monate bei Tante Lydia waren schon Stress genug.«
»Nun sei nicht ungerecht, Doro! Du solltest froh sein, dass du bis zum Ende des Schuljahrs bei ihr wohnen konntest. Das hast du selbst so gewollt, vergiss das nicht.«
»Ich bin ihr ja auch dankbar«, entgegnete ich und meinte es auch so.
Es war ein wirklich netter Zug von Tante Lydia gewesen, mich bei sich aufzunehmen, damit ich nicht gleich nach der Trennung meiner Eltern die Schule hatte wechseln müssen. Ich hatte befürchtet, dass sich meine Noten verschlechtern könnten, wenn ich meine restlichen Klausuren für dieses Jahr an einer fremden Schule hätte schreiben müssen. Die vielen plötzlichen Veränderungen in meinem Leben hatten mich schon genug belastet.
»Aber du weißt doch, wie Tante Lydia so drauf ist. Mit ihrer übertriebenen Fürsorge kann sie manchmal eine echte Nervensäge sein. Also, bitte, Mum, werde du es nicht auch noch, okay?«
Mum schürzte die Lippen und nickte.
»Ich glaube, dein neuer Psychologe ist wirklich nett«, sagte sie, offensichtlich bemüht, das Thema zu wechseln. »Er hat mir gleich einen Kennenlerntermin für dich gegeben. Morgen Vormittag.«
»Morgen schon?«
»Ja, was ist so schlimm daran? Du hast doch Ferien.«
»Eben drum.«
»Doro, ich werde das nicht mit dir diskutieren, verstanden? Er ist übrigens unser Nachbar, wohnt gleich gegenüber.«
»Auch das noch. Superpraktisch! Da hast du ja genau das richtige Haus ausgesucht.«
Missmutig sah ich aus dem Seitenfenster zu einem Plakat, das für ein Benefizkonzert irgendeiner lokalen Rockband warb. EIN FREIGETRÄNK IM EINTRITT INBEGRIFFEN, stand unter dem Datum, und ich dachte: Ja, damit ködert man hier die Leute bestimmt.
»Na also«, sagte Mum erleichtert und setzte ihre Sonnenbrille wieder auf, »es geht weiter.«
Die Autoschlange hatte sich wieder in Bewegung gesetzt, allerdings ging es nur im Schneckentempo voran.
»Hat sich dein Vater eigentlich noch einmal bei dir gemeldet?«
Mums Frage klang beiläufig, aber ich wusste, dass es ihr nicht so gleichgültig war, wie sie vorgab. Mir ging es ja selbst nicht anders.
»Nein, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er einen Käufer für unser Haus gefunden hat. Ist aber schon wieder zwei Wochen her.«
»Dann ist er jetzt wohl zu ihr gezogen?«
Mum betonte das Wörtchen ihr, als würde sie es auswürgen. Gemeint war damit Simone, die ehemalige Kollegin meiner Eltern und der Hauptgrund, warum Mum ihre Stelle im Personalbüro der Fahlenberger Motorenwerke gekündigt hatte.
Zwei Monate nach Kais Tod hatte Paps eine Affäre mit ihr gehabt. So hatte er es jedenfalls bezeichnet. Eine Affäre. Als ob es dadurch weniger schlimm gewesen wäre. Er sei einfach schwach gewesen, hatte er uns erklärt, nachdem Mum davon erfahren und ihn zur Rede gestellt hatte. Kais Tod, Mums anschließende Depressionen, wegen denen sie wochenlang kaum aus dem Bett gekommen war, und mein Klinikaufenthalt nach dem Schock seien einfach zu viel für ihn gewesen. Als ob uns da einer gefragt hätte, ob es uns zu viel war!
Seine Entschuldigung hatte ich nicht gelten lassen können – und Mum schon gleich zweimal nicht. Für mein Gefühl hatte er nicht mal aufrichtig geklungen – und danach hatte er weder um Mum gekämpft noch seine angebliche Affäre beendet. Stattdessen hatte er sofort in Mums Scheidungswunsch eingewilligt und damit auch den letzten Funken Respekt verspielt, den sie ihm noch entgegengebracht hatte.
Ich konnte Paps nicht verstehen. Sein Verhalten machte mich ratlos und wütend. Er hatte uns beiden das Herz gebrochen – so kitschig das auch klingen mag, es war so.
Als er mir später anbot, ich könne gerne noch bei ihm wohnen bleiben, bis ich zu Mum nach Ulfingen ziehe, hatte ich abgelehnt und lieber bei seiner Schwester gewohnt – bei meiner überfürsorglichen Tante Lydia, die mir zum Abschied ein dickes Lebensmittelpaket in die Hände gedrückt hatte und die das Verhalten ihres Bruders ebenfalls nicht verstehen konnte.
»Männer eben«, hatte sie gesagt. »Mach es so wie ich, bleib ledig.«
»Das ist kein Feld«, sagte Mum und holte mich damit aus meinen Gedanken zurück.
»Was?«
»Das Feuer. Da vorne brennt etwas, aber nicht das Feld. Ist da nicht ein See?«
Die Sonne schien uns direkt ins Gesicht, und Mums Windschutzscheibe hätte dringend eine Reinigung gebraucht, aber die Sprühanlage der alten Klapperkiste war defekt. Erst als wir noch ein weiteres Stück vorwärtsgekommen waren, sah auch ich den See. Von Weitem hatte das dürre Schilf noch wie eines der vielen Getreidefelder ausgesehen, aber nun erkannte ich die große Wasserfläche, die hinter den hohen Halmen verborgen lag.
Und dann sahen wir den Grund für die schwarze Rauchsäule.
Nahe am Ufer stand ein brennender Kleinbus. Viel hatte das Feuer nicht von ihm übrig gelassen, die Karosserie war komplett verkohlt, und noch immer schlugen Flammen aus den geborstenen Scheiben.
Der Kleinbus stand leicht zur Seite geneigt, und ich roch den beißenden Gestank nach verbranntem Reifengummi und dem dampfenden Löschmittel, mit dem die Feuerwehr dem Brand Herr zu werden versuchte.
Ich löste den Sicherheitsgurt und stemmte meinen Oberkörper aus dem Seitenfenster. Am Anfang des Staus sah ich mehrere Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge und einen Sanitätswagen, der in diesem Moment ohne Blaulicht davonfuhr.
Kein gutes Zeichen.
Polizisten gestikulierten den Fahrern vor uns, sie mögen doch zügig weiterfahren, aber die meisten schlichen mit neugieriger Langsamkeit an dem brennenden Fahrzeug vorbei, ehe sie schließlich auf der Umleitung über einen Feldweg beschleunigten.
Als wir dicht an die Brandstelle herangekommen waren, konnte ich die Stimmen einiger Autofahrer und Polizisten hören. Im Dröhnen der Motoren verstand ich jedoch nur Satzfetzen.
»… aufpassen, dass die Flammen nicht übergreifen …«
»… Brandstiftung …«
»… diese jungen Leute …«
»… einfach unverständlich …«
Dann kamen wir endlich an der Absperrung an und Mum folgte der ausgewiesenen Umleitung.
Nun ging es schneller vorwärts. Holpernd fuhren wir den staubigen Feldweg entlang, und ich drehte mich nach hinten, um zu sehen, ob meine Taschen auch sicher auf der Rückbank lagen.
Durch die Staubwolke, die wir hinter uns aufwirbelten, erkannte ich die dunklen, lang gezogenen Umrisse eines Leichenwagens, der gemächlich über die Hauptstraße zur Unglücksstelle fuhr.
Der graubraune Staubwirbel ließ die Szene mit dem Leichenwagen aussehen wie in einem uralten Film. Die schwarze Lackierung des Autos glänzte in der Sonne und das Licht schien irgendwie unwirklich.
Wie damals bei Kai, dachte ich. Und plötzlich war mir trotz der Hitze eiskalt.
2
»Bitte, gib dem Haus eine Chance. Versprochen?«
Mum sah mich beinahe flehentlich an, als wir an unserem neuen Zuhause angekommen waren, einem ziemlich alten, zweistöckigen Fachwerkhäuschen, von dem an einigen Stellen der Putz abbröckelte.
Das einzig Neue an diesem Haus waren die Kunststofffenster, deren weiße Rahmen so auffällig waren wie ein makelloses künstliches Gebiss im Faltengesicht einer Hundertjährigen. Die dunklen Dachschindeln und die kleine Satellitenschüssel, die wie ein Fremdkörper von der Hauswand abstand, waren von Moosflechten befallen, ebenso wie ein knorriger Apfelbaum, dessen Äste über den Hauseingang ragten.
Unterhalb des Baumes verfiel eine verwitterte Hundehütte. Ihrer Größe nach musste ihr ehemaliger Bewohner wohl ein Dackel oder ein anderer kleiner Hund gewesen sein. Aber das lag sicherlich schon einige Jahre zurück.
Mum hatte mir erzählt, dass der Vorbesitzer des Hauses vor anderthalb Jahren gestorben war. Beim Einzug habe sie noch einige Fotos von ihm in einem alten Küchenbüfett gefunden und irgendwie habe sie der weißbärtige Mann mit den roten Pausbacken an den Weihnachtsmann erinnert.
Nun gehörte das Haus seinem Neffen, einem Bankangestellten aus Karlsruhe, der sich nicht mehr als nötig um dieses Erbe kümmern wollte. Er hatte mit Mum eine sehr günstige Miete vereinbart, unter der Voraussetzung, dass sie sich selbst um die kleineren handwerklichen Angelegenheiten kümmerte. Da habe sie nicht Nein sagen können.
Kein Vergleich mit unserem ehemaligen Haus, dachte ich und ertappte mich dabei, beinahe Heimweh nach Fahlenberg zu haben.
»Und?«, fragte Mum und sah mich unsicher an.
»Es ist nett«, schwindelte ich. »Ehrlich, Mum. Ein richtig nettes kleines Hexenhaus. Wie geschaffen für uns zwei.«
Sie lächelte mich erleichtert an. »Kleine Lügnerin. Aber wir werden das Beste daraus machen, ja? Innen sieht es deutlich wohnlicher aus, wirst sehen.«
Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Mach dir mal keine Sorgen. Die Hauptsache ist doch, dass wir beide zusammenhalten.« Ich sah den feuchten Schimmer in Mums Augen und fügte schnell hinzu: »Wir können in unserer Freizeit jede Menge Lebkuchen backen und sie an die Hauswand kleben. Was hältst du davon?«
Mum lachte und mir fiel ein Stein vom Herzen.
Was das Innere des Hauses betraf, hatte sie nicht übertrieben. Mum hatte sich viel Mühe gegeben, ein echtes Daheim für uns beide zu schaffen. Alles war ordentlich aufgeräumt, es roch nach Putzmitteln und einem fruchtigen Duftöl.
Im Gang neben dem Telefonschränkchen erwarteten mich eine hohe bauchige Vase mit frisch geschnittenen Sonnenblumen – meinen Lieblingsblumen – und eine Herzlich-Willkommen-Girlande über dem Treppenaufgang.
Ich schluckte gerührt und dachte: Ja, das soll ab jetzt die Farbe dieses alten Häuschens sein: ein sonniges Willkommensgelb.
Das Wohnzimmer hatte Mum mit alten und neuen Möbeln eingerichtet, sodass Ikea auf Erbstücke meiner sizilianischen Großeltern traf.
Die Küche war groß und geräumig, und trotz der improvisierten Zusammenstellung aus Baumarkt-Wandschränken, dem Küchenbüfett des Weihnachtsmannes und einer Campinggarnitur anstelle eines Esstischs fühlte ich mich dort sofort wohl.
Was das Familiengefühl betraf, war die Küche auch früher schon der wichtigste Ort für mich gewesen. Hier traf man sich, kochte und war zusammen.
»Wir werden das alles nach und nach erneuern«, sagte Mum mit einem entschuldigenden Seitenblick auf die beiden Klappstühle. »Aber das dauert noch ein bisschen. Der Umzug war teuer und ich musste fast meine ganzen Ersparnisse in die Einrichtung stecken.«
»Ich mag es«, sagte ich und nahm sie in den Arm. »Sehr sogar. Vor allem die Klappstühle. Die bleiben hier, das musst du mir versprechen.«
Wieder lachten wir und Mum gab mir einen Klaps auf den Po. »Nun bring erstmal deine Sachen hoch. Und während du auspackst, werde ich uns einen großen Salat und eine frische Limonade machen.«
Mein Zimmer lag im ersten Stock, gleich neben dem Bad. Mum hatte nicht gewollt, dass Paps beim Umzug dabei war, und ich hatte für meine Klausuren lernen müssen, also hatte sich Onkel Alfonso extra eine Woche Urlaub genommen, war aus Neapel angereist und hatte ihr bei allem geholfen.
Es war ein eigenartiges Gefühl, meine Möbel in einer neuen Umgebung wiederzusehen – mein Bett, den Kleiderschrank, die beiden Bücherregale und den Schreibtisch, die nun ganz anders verteilt im Raum standen. Mein ehemaliges Zimmer war quadratisch gewesen, dieses hier war länglich.
Einerseits fühlte es sich befremdlich an, meine Sachen hier zu sehen, andererseits aber gab es mir auch ein heimeliges Gefühl.
Ich hörte Mum in der Küche und dachte an ihre Limonade. Sie bereitete sie wie immer selbst zu, nach Omas Rezept, und es musste für sie sein wie für mich jetzt mit meinen Möbeln. Es war etwas Vertrautes mitten im Neuen, ein Stück Erinnerung an etwas, das einem viel bedeutet hat und das es nicht mehr gibt.
An einem der Umzugskartons lehnte meine Zeichenmappe, und ich beschloss, so bald wie möglich die Bilder herauszusuchen, die auch schon in meinem ehemaligen Zimmer gehangen hatten. Irgendwann würde ich sicherlich neue Zeichnungen anfertigen und aufhängen, aber im Augenblick war mir wie Mum nach etwas Vertrautem zumute, an dem ich mich festhalten konnte.
Mein Zimmer hatte zwei Fenster. Aus dem einen konnte ich in den Garten hinter dem Haus sehen. Es war ein großer Garten mit alten Obstbäumen, einem überdachten Brennholzstapel entlang einer moosbewachsenen Mauer und einer verwitterten Gartenlaube, die wie ein verwunschener Pavillon aus irgendeinem Märchen aussah.
Das zweite Fenster zeigte zum Nachbarhaus, ebenfalls ein Fachwerkgebäude, aber deutlich besser in Schuss als unseres und auch weitaus größer. Zwischen den akkurat geschnittenen Büschen, die die seitliche Eingangstreppe bewachten, funkelte mir ein Messingschild in der Abendsonne zu.
Ich lehnte mich weiter aus dem Fenster, kniff die Augen zusammen und las die schwarze Gravur
F. NORD
Psychotherapeut
Darunter stand noch etwas, das ich aus der Distanz jedoch nicht erkennen konnte. Sicherlich die Sprechzeiten.
Als hätte Mum das extra so für mich ausgesucht, dachte ich und fand diesen Gedanken auf einmal gar nicht mehr so abwegig. Gut möglich, dass sie bei ihrer Stellen- und Wohnungssuche die Nähe zu einem Therapeuten für mich im Auge behalten hatte. Mum war eine Planerin, die immer an alles dachte. Aber musste der Therapeut deswegen gleich unser Nachbar sein?
Gerade als ich mich wieder ins Zimmer zurückziehen wollte, ging die Tür des Nachbarhauses auf, und ein Junge kam heraus. Er musste in meinem Alter sein, höchstens ein oder zwei Jahre älter, und er sah gut aus, sehr gut sogar.
Er war groß und schlank und hatte dunkles halblanges Haar, das ihm ein wenig ins Gesicht hing. Seine Sneakers, die Bermudajeans und das T-Shirt mit dem Californication-Aufdruck waren schlicht, aber cool.
Doch es war nicht sein Aussehen, das mich überraschte. Es war seine Körperhaltung.
Etwas stimmte nicht mit diesem Jungen. Er ging langsam, ließ die Schultern hängen, und es schien, als trüge er eine sehr schwere unsichtbare Last.
Er sah verloren aus. Und so traurig, wie ich es bisher nur bei den Kindern und Jugendlichen auf der Psychiatriestation gesehen hatte. Sicherlich war auch dieser Junge einer von Nords Patienten.
Sein Anblick hatte etwas Ansteckendes und löste ein Gefühl in mir aus, das mein bisheriger Therapeut als Empathie bezeichnet hatte. Diese Empathie war unglaublich stark. Fast glaubte ich, seine Trauer am eigenen Leib zu spüren. Um mich gegen diese Gefühlswelle zu wehren, versuchte ich, aus der Entfernung die Farbe des Jungen zu erkennen, doch es wollte mir nicht gelingen.
Er ging zu einer Vespa, die auf der Straße vor dem Haus geparkt war, nahm den Helm vom Lenker, und gerade als er ihn aufsetzen wollte, sah er zu mir hoch. Unsere Blicke trafen sich und nun spürte ich seine Trauer noch deutlicher. Wie zwei schwere Hände, die auf meine Schultern drückten.
Ich nickte ihm zu und er hob kurz die Hand zum Gruß. Dann setzte er den Helm auf und fuhr davon.
Ich schloss das Fenster und musste mehrmals durchatmen, bis meine Beklommenheit endlich nachließ.
Dann setzte ich meinen Erkundungsgang durch das Obergeschoss fort. Außer dem Bad und Mums Zimmer, in dem es noch recht chaotisch nach Umzug aussah, gab es noch ein weiteres Zimmer. Es lag am Ende des Ganges und die Tür stand einen Spalt breit offen.
Drinnen war es dunkel und stickig. Das Fenster zeigte nach Süden, und Mum hatte die Vorhänge zugezogen, um wenigstens einen Teil der Hitze draußen zu halten, aber dennoch war es – wie im gesamten Obergeschoss – drückend warm im Raum.
Im Zwielicht erkannte ich einige Umzugskartons und weitere Gegenstände, die noch darauf warteten, ihren Platz im Haus zugewiesen zu bekommen: der Staubsauger, zwei zerlegte Wandregale, die in unserer ehemaligen Speisekammer gestanden hatten – hier gab es wohl keine –, und das Bügelbrett, das im Halbdunkel wie ein riesiges Insekt aussah.
Dieses Zimmer wirkte unangenehm grau auf mich, und ich wollte es schon wieder verlassen, als mir zwei lange Ohren auffielen, die aus einem offenen Umzugskarton ragten. Sie gehörten zu Kais Plüschhasen mit der Latzhose.
Es war ein so unerwarteter Anblick, dass mir für einen Moment der Atem stockte. Zögerlich ging ich auf den Karton zu, und als ich über dem Hasen stand, grinste er mir entgegen.
Ich spürte einen Schauder, als ob mich ein eiskalter Windzug streifte.
Hallo Doro, schien er mir mit einer hohen Cartoonstimme zuzuflüstern. Schön, dich wiederzusehen. Du erinnerst dich doch an mich? Natürlich erinnerst du dich. Zuletzt haben wir uns an jenem Morgen gesehen. Du weißt schon, der Morgen, seit dem du dich nicht mehr erinnern kannst, was in der Nacht davor geschehen ist. Die Frage ist nur, ob du es wirklich nicht kannst oder ob du einfach nicht willst. Nicht wahr, Doro?
Ich glaubte, plötzlich ersticken zu müssen, packte den Hasen an den Ohren und warf ihn in eine Ecke. Dort blieb er in einer skurrilen Verrenkung liegen und grinste mich weiter hämisch an.
Ich schüttelte mich und berührte den Karton, so wie ich es in meiner Therapie gelernt hatte. Fass etwas Reales an – irgendetwas, nur nicht dich selbst, denn in so einem Moment könnte dich dein Körpergefühl trügen –, damit du wieder weißt, was wirklich ist und was nicht.
Die Stimme des Hasen war es nicht, wohl aber der Karton. Mum hatte darin einige Erinnerungsstücke an Kai aufbewahrt: Spielsachen, Strampelanzüge und winzige Schuhe. Und da es der einzige geöffnete Karton in diesem Raum war, hatte sie wohl schon mehrmals hineingesehen.
Behutsam nahm ich das Fotoalbum heraus, auf dem der Grinsehase gesessen hatte. Ich strich über den blauen Ledereinband, in den mit goldener Schrift UNSER KIND eingeprägt war.
Als ich das Album aufschlug, sah mir Kai aus dem winzigen Bettchen der Neugeborenenstation entgegen. Er hatte die Augen weit offen, als sei er fest entschlossen, dass ihm von Anfang an nichts entgehen durfte.
Das war typisch für meinen lebhaften kleinen Bruder, dachte ich und musste gleichzeitig schmunzeln und mir die aufsteigenden Tränen aus den Augen blinzeln.
Neben dem Bild stand Mein erstes Foto und gleich darunter hatte Mum mit ihrer sorgfältigen und gleichmäßigen Schrift den Lückentext ausgefüllt:
Ich kam am 16. Dezember 2009 im Sternzeichen des Schützen auf die Welt. Um 11 Uhr in Fahlenberg, ärztlich betreut von Dr. Scholz. Ich wog 2980 Gramm und war 50 cm klein.
Ein Rascheln neben mir ließ mich zusammenfahren. Erschrocken sah ich zu dem Hasen, der in seiner Position verrutscht war.
Mein Herz raste. Ich versuchte, mich zu beruhigen, mir klarzumachen, dass der Hase einfach nur von der glatten Oberfläche des Kartons abgerutscht war, auf den ich ihn geworfen hatte.
»Ganz simple Physik«, flüsterte ich mir zu.
Aber da war noch etwas … Ein Keuchen und Röcheln, das ich sofort wiedererkannte, auch wenn ich es schon länger nicht mehr gehört hatte.
Es war das hässlichste Geräusch, das ich je gehört hatte. Und nun, hier in diesem stickigen grauen Raum mit den zugezogenen Vorhängen, dem widerlich grinsenden Plüschhasen und dem als Bügelbrett getarnten Rieseninsekt, war dieses unerträgliche Geräusch zu mir zurückgekehrt.
Ich hielt es keine Sekunde länger aus, schlug das Album zu und warf es zurück in die Schachtel. Dann lief ich so schnell ich konnte zu Mum in die Küche hinunter.
Als ich den großen Glaskrug mit frischer Limonade und die üppige Salatschüssel vor mir sah, begann sich meine Verkrampfung langsam zu lösen.
In dieser Nacht schlief ich sehr unruhig und wachte immer wieder schweißgebadet auf. Es mochte an der Sommerhitze liegen, die sich hartnäckig im Obergeschoss festgesetzt hatte. Oder an dem Gefühl, dass ich nicht allein im Dunkeln war.
3
Irgendwann gegen Morgen musste ich doch noch richtig eingeschlafen sein. Als ich erwachte, war es bereits halb elf, und ich erinnerte mich an meinen Termin mit dem Therapeuten – den Termin, den meine alles vorausplanende Mum bereits sechs Wochen vor meinem Einzug in unser neues Zuhause für mich vereinbart hatte.
Ich lief in die Küche, um noch schnell ein Glas Orangensaft und einen Marmeladentoast zu frühstücken, und fand eine Notiz auf dem Campingtisch.
Bin zur Arbeit. Denk an deinen Termin um 11!
Ich freue mich auf heute Abend.
Kuss Mama
Mama. Sie mochte es nicht besonders, dass ich sie Mum nannte. Das höre sich für sie wie aus einem dieser amerikanischen Filme an, hatte sie einmal gesagt.
Aber Mama fand ich inzwischen einfach zu kindlich und Mutter klang mir viel zu distanziert. Und da ich sie auf keinen Fall Antonella nennen wollte, auch wenn es ein schöner Vorname war, und mir nichts anderes einfiel, blieb mir nur das coole Mum – amerikanisch oder nicht.
Punkt elf Uhr läutete ich an der Praxis von F. Nord und er öffnete mir selbst die Tür. Das F. auf dem Namensschild stand für Frank, wie er mir auf dem Weg zu seinem Sprechzimmer erklärte.
Er führte mich in einen großen, hellen Raum neben dem Wohnzimmer. Durch eine breite Glaswand konnte man in einen Wintergarten und von dort auf die Terrasse zum Garten hinaussehen. Ein schöner Ausblick, und ich genoss den kühlen Luftzug, der durch die offen stehenden Glastüren hereinwehte.
Nord bot mir an, in einer Sitzecke mit vier Sesseln Platz zu nehmen. Dann setzte er sich mir gegenüber und goss uns beiden Wasser aus einer Kristallkaraffe ein.
Unser Gespräch eröffnete er mit einer harmlosen Plauderei, sodass uns beiden Zeit blieb, einen ersten Eindruck voneinander zu gewinnen.
Er fragte mich, wie es mit meinen Klausuren gelaufen sei, wie mir Ulfingen und unser neues Heim gefielen, und natürlich sprachen wir auch über den heißen Sommer.
Ich schätzte Frank Nord auf Ende vierzig, auch wenn sein schlankes Gesicht und seine angenehme Stimme ihn viel jünger wirken ließen. Er war mir sympathisch, und das nicht nur, weil er mich von Anfang an Doro und nicht Dorothea nannte. Bei Dr. Forstner in der Waldklinik hatte es deutlich länger gedauert, bis er verstanden hatte, dass ich meinen Kurznamen bevorzugte.
Nord hatte eine angenehme Farbe, die dem Sandbraun der bequemen Sessel und dem Geruch der hellen Eschenholzmöbel in seinem Sprechzimmer sehr ähnelte. Ebenso wie der weichen Cremefarbe seines Poloshirts, das er über einer leichten Stoffhose trug, und der seines blonden, kurz geschnittenen Haars, in dem sich erste graue Strähnen zeigten.
Die Art, mit der er sprach und mich ansah, hatte etwas Beruhigendes, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass er tiefer in mich hineinsehen konnte, als mir gleich bei der ersten Begegnung mit einem Therapeuten lieb war. Er schien mich zu durchschauen, und vielleicht war er gerade deshalb der Richtige. Vielleicht konnte er mir helfen, mich zu erinnern.
»Deine Mutter hat mir berichtet, dass du Synästhetikerin bist«, sagte er und setzte damit das Zeichen, dass er nun bereit für den therapeutischen Teil unseres Treffens war. »Synästhesie ist eine besondere Gabe«, fuhr er fort. »Sie wird meist vererbt. Gibt es denn noch weitere Personen in deiner Familie, die Zahlen, Gerüche, Menschen und Erinnerungen über Sinneseindrücke definieren können?«
»Mein Großvater konnte es«, erwiderte ich. »Er ist leider vor meiner Geburt gestorben, aber ich weiß von meiner Mum, dass auch er in Farben dachte. Eigentlich war er Olivenbauer, aber er hat auch sehr viele Bilder gemalt. Manche davon sehen wegen der Farbgebung ziemlich schräg aus.«
»Und du bist ebenfalls eine Künstlerin, nicht wahr?«
»Ich versuche es jedenfalls. Nach dem Abi möchte ich Kunst studieren.«
Nord nickte. »Du willst den Dingen in deinem Leben ihre wahre Farbe geben.«
»Ja, so in etwa.«
»Hast du denn deine eigene Farbe schon herausgefunden?«
Mit dieser Frage hatte ich gerechnet. Darauf sprach mich so gut wie jeder an, der erfuhr, dass ich eine Synnie war, und wie immer konnte ich nur mit den Schultern zucken.
»Ich glaube, es ist ein Blau, aber ich bin mir nicht sicher. Es auf sich selbst anzuwenden, ist sehr schwierig.«
»Was denkst du«, sagte Nord und legte den Kopf schief, »ist es ein eher dunkles oder ein helles Blau?«
»Mittelblau würde ich sagen. Ich habe mal auf einer Farbskala nachgesehen und Mittelblau traf es am besten.«
Wieder nickte er, als habe er mehr verstanden, als ich gesagt hatte. Dann nahm er eine Aktenmappe vom Couchtisch, auf der mein Name stand, und sah hinein.
»Um mich auf deine Therapie vorzubereiten, habe ich mich bei deinem bisherigen Therapeuten und deiner Mutter nach deiner Vorgeschichte erkundigt. Wie schon gesagt, ist Synästhesie eine besondere Gabe und keinesfalls eine psychische Störung. Aber natürlich sind derart feinsinnige Menschen auch empfindlicher. Vor allem wenn sie einen schweren Schock erleiden, so wie du. Ich denke, dort müssen wir ansetzen, wenn wir den Grund für deinen Gedächtnisverlust herausfinden wollen. Gibt es denn etwas, an das du dich erinnern kannst? Ich meine, was den Abend vor dem Tod deines Bruders betrifft.«
Ich schloss die Augen und rieb mir die Schläfen, um mich besser konzentrieren zu können. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, es gelang mir nicht. Es war jedes Mal das Gleiche. Ganz egal, wie sehr ich mich auch zu erinnern versuchte, da war nur ein dunkles schwarzes Loch.
»Nein«, sagte ich schließlich. »Ich weiß nur noch, dass ich mit meinen Eltern gestritten habe. Sie wollten ausgehen und ich sollte auf Kai aufpassen.«
»Aber das wolltest du nicht?«
»Nein.«
»Einfach nur so, oder gab es an diesem Abend einen besonderen Grund, warum du es nicht wolltest?«
»Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht.«
»Was für eine Farbe weckt dieses Gefühl in dir, dich nicht erinnern zu können?«
»Schwarz. So schwarz wie Tinte.«
Nord nahm sein Wasserglas, trank einen Schluck und schwenkte es nachdenklich vor sich.
»Es wird eine Weile dauern, bis die schwarze Tinte in deinem Kopf zu klarem Wasser werden wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Denn irgendeinen Grund muss es doch geben, warum du dir die Schuld am Tod deines Bruders gibst.«
Ich sah ihn verblüfft an. »Wieso denken Sie, dass ich mich daran schuldig fühle?«
Wieder sah er mich mit diesem Blick an, der mehr sehen konnte, als ich ihm zeigen wollte.
»Das liegt doch auf der Hand, Doro. Nach Kais Tod hast du unter schweren Halluzinationen gelitten und musstest klinisch behandelt werden. Siehst du deinen toten Bruder denn immer noch?«
Ich musste schlucken. »Nein, das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her.«
»Und wie sieht es mit dem Stimmenhören aus?«
Irgendwo weit hinter mir, jenseits der Wand, glaubte ich, ein hämisches Lachen zu hören. Es war ein Lachen, das nur grinsende Plüschhasen ausstoßen konnten.
Ich dachte an meine gestrige überraschende Begegnung mit Kais ehemaligem Lieblingsspielzeug und daran, wie sich der Karton angefühlt hatte, in dem Mum den Hasen aufbewahrte. Der Karton war real gewesen.
Ich habe es im Griff, dachte ich. Also hör auf zu lachen, du verdammter Hase! Ich habe es jetzt im Griff und dieser Therapeut muss nicht gleich alles von mir wissen. Ich gehe in keine Klinik mehr.
»Doro?« Nord musterte mich.
Ich atmete kurz durch, und das Lachen, das aus dem Zimmer im ersten Stock unseres Hauses zu mir herübergeklungen war, verstummte.
Nein, das stimmte nicht. Das Lachen war nicht von dort gekommen, es war in meinem Kopf gewesen. Aber jetzt war es weg.
»Auch keine Stimmen mehr«, sagte ich und bemühte mich, überzeugend zu klingen. »Schon länger nicht.«
Nord nickte, aber ich konnte ihm ansehen, dass er mir nicht glaubte.
»Sicherlich weißt du inzwischen längst, was ein Aneurysma ist«, sagte er, und ich verstand, worauf er damit hinauswollte.
»Eine angeborene Erweiterung eines Blutgefäßes«, sagte ich. »Bei Kai befand sie sich im Gehirn. Eigentlich ist so etwas harmlos, hat mir einer der Ärzte erklärt, mit denen ich darüber gesprochen habe. Aber manchmal, wenn man sich sehr anstrengt, kann so ein Ding platzen und eine Hirnblutung auslösen.«
»Richtig«, bestätigte Nord. »Und eben das war bei deinem Bruder der Fall. Leider kommt so etwas häufiger vor, als man denken mag, denn solange keine Beschwerden auftreten, bleibt ein Aneurysma meist unerkannt. Aber dann liegt man einmal zu lange in der Sonne, oder man hebt etwas Schweres oder strengt sich sonst irgendwie besonders an, und es passiert. Ohne Vorwarnung. Deine Mutter meinte, der Pathologe, der Kai untersucht hat, ist davon ausgegangen, dass Kai geschrien hat. Das hat er wohl häufiger getan, oder?«
»Ja, er konnte ziemlich trotzig sein und hat oft wie am Spieß geschrien, wenn es nicht nach seinem Kopf gegangen ist.«
»Vor allem morgens, wenn man ihn nicht gleich aus seinem Zimmer geholt hat, nicht wahr?«
»Hat Mum Ihnen das erzählt?«
»Ja, hat sie. Und sie sagte mir auch, dass es meistens du gewesen bist, die ihn zum Frühstück holen musste. So wie an jenem Morgen.«
Ich kämpfte gegen meine Tränen an und trank einen Schluck Wasser, damit Nord es nicht bemerkte.
»Ich habe meinen kleinen Bruder geliebt«, sagte ich mit belegter Stimme. »Natürlich gab es auch Tage, an denen ich den kleinen Schreihals am liebsten in der Wüste ausgesetzt hätte, aber das war nie böse gemeint.«
»Daran ist auch nichts Verwerfliches.« Nord nickte. »Das gehört nun einmal dazu, wenn man Geschwister hat, die so viele Jahre jünger sind als man selbst. Du hast dich bestimmt durch ihn eingeschränkt gefühlt.«
Nun umklammerte ich das Glas mit beiden Händen und spürte die angenehm weiße Kühle, die davon ausging. Sie war so realistisch. »Ja, das habe ich. Er war eben das Nesthäkchen, um das man sich mehr kümmern musste als um mich.«
»Warst du deshalb eifersüchtig auf ihn?«
»Ich hätte ihm niemals etwas antun können«, fuhr ich Nord an. »Verstehen Sie? Niemals! Sicher, Kai ist mir oft auf die Nerven gegangen, und dann noch dieses ständige ›Doro, mach dies, Doro, mach das‹, ›Doro, kümmere dich um deinen kleinen Bruder‹ … So was nervt tierisch, wenn man selbst genug Probleme hat. Ich bin anders, das weiß ich, und es ist nicht leicht, so wie ich zu sein. Außerdem bin ich auch nicht gerade Miss Superschlau in der Schule und die Vorbereitung aufs Abi ist anstrengend. Und dann auch noch ständig den Babysitter spielen zu müssen, zieht einem höllisch viel Energie ab. Aber deswegen tue ich doch meinem kleinen Bruder nichts an!«
»Das hat auch niemand behauptet«, sagte Nord ruhig. »Niemand außer dir, Doro. Und ich frage mich, warum?«
Mein Kopf begann zu schmerzen. Auf einmal war mir das Sprechzimmer zu hell geworden. Auch das Sandbraun um mich herum war plötzlich nicht mehr angenehm – im Gegenteil, ich konnte es jetzt nicht mehr ertragen.
»Können wir für heute Schluss machen?«, fragte ich. »Meine Mum hat heute Geburtstag, und ich will sie mit einem Essen überraschen, wenn sie von der Arbeit kommt.«
»Sicher«, sagte Nord und stellte sein Glas ab. »Ist das der einzige Grund?«
Ich schüttelte den Kopf und Nord sah mich verstehend an.
»Eines noch, bevor du gehst«, sagte er. »Einerseits bist du jetzt weg von allem, was dich mit den Geschehnissen des letzten Jahres konfrontiert. Das kann befreiend für dich sein. Aber du bist nun sehr vielen neuen Eindrücken ausgesetzt, und das wiederum kann Stress auslösen, auch wenn du es vielleicht nicht sofort als Stress erkennst. In diesem Fall wäre es denkbar, dass sich deine Symptome wieder bemerkbar machen. Vielleicht haben sie es ja auch schon?«
Er wartete kurz, ob ich dazu etwas sagen wollte, und als ich schwieg, sprach er weiter.
»Ich bitte dich, weiterhin deine Medikamente zu nehmen und dich umgehend bei mir zu melden, wenn du etwas Ungewöhnliches an dir feststellst. Wenn sich plötzlich wieder Stimmen oder andere Halluzinationen bei dir bemerkbar machen, zum Beispiel. Versprichst du mir das?«
»Ja«, sagte ich knapp. »Aber es geht mir wirklich besser, und ich will die Ferien nutzen, um meine Akkus wieder aufzuladen.«
»Eine gute Idee«, sagte Nord und lächelte. »Geh raus in die Natur oder zum Schwimmen oder in die Eisdiele, damit du ein paar neue Leute kennenlernst. Genieß den Sommer und das Leben. Man ist nur einmal sechzehn.«
Wir standen gleichzeitig auf und Nord begleitete mich zur Tür.
»Glaub mir, Doro, du wirst es schaffen, von dem Unbekannten, das dich belastet, freizukommen«, sagte er und legte mir eine Hand auf die Schulter. Sie fühlte sich warm und tröstend an. »Du brauchst nur etwas Geduld. Aber nun komm erst einmal gut in deiner neuen Umgebung an und dann meldest du dich für einen weiteren Termin bei mir.«
»Okay«, sagte ich und glaubte, wieder das Lachen des Plüschhasen zu hören.
Doch als ich aus dem Haus ging, waren es nur zwei kleine Jungs, die lachend die Straße hinunterrannten.
4
Auch wenn es sich für Nord wie eine dumme Ausrede angehört haben mochte – es stimmte, was ich ihm über Mums Geburtstag gesagt hatte. Und ich hatte mir eine besondere Überraschung für sie ausgedacht.
Mum hatte Omas Lasagne über alles geliebt und mir immer wieder erzählt, wie traurig sie darüber sei, ihre Mutter nie nach dem Rezept gefragt zu haben. Trotz etlicher Versuche hatte sie nie den typischen Geschmack hinbekommen, den sie als »Omas geheime Zutat« bezeichnete.
Während meines Psychiatrieaufenthalts hatte ich dann Stefano kennengelernt, einen schüchternen Jungen, der seine Eltern bei einem Autounfall verloren hatte und seither von ihren Stimmen verfolgt wurde. Oft hatte er sich tagelang in sich selbst zurückgezogen und war nicht ansprechbar gewesen. Aber dann hatte ich herausgefunden, wie man ihn aus seiner Verschlossenheit locken konnte.
Als eine Kochgruppe angeboten wurde, meldete ich mich an und fragte ihn, ob er ebenfalls Lust dazu hätte. Ich hatte ein Nein erwartet, aber zu meiner Überraschung war er plötzlich wie ausgewechselt, und als wir dann in der Therapieküche zu Werke waren, blühte Stefano auf.
Er erzählte mir, dass seinen Eltern ein kleines Restaurant gehört hatte und dass er eines Tages selbst Koch werden wollte, wie sein Vater.
Und so erfuhr ich von ihm das Rezept für eine perfekte Lasagne, deren Geheimnis in erster Linie darin bestand, auf die Béchamelsauce zu verzichten und stattdessen Rotwein, ein paar klein geschnittene Speckwürfel, viel Knoblauch und frische Kräuter zu verwenden.
Nach meiner Entlassung hatte ich das Rezept gleich ausprobiert und Tante Lydia war begeistert gewesen. Nun hoffte ich, dass auch Mum sich darüber freuen würde.
Ich zog mein altes Mountainbike aus der Garage, das ich vor zwei Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Mein neues Rad hatte man mir wenige Tage zuvor in der Schule gestohlen gehabt, und dieses hatte der Vorbesitzer mit einem schweinchenrosa Farbspray lackiert.
»Das klaut bestimmt keiner«, hatte er mir versichert und recht behalten.
Nun schnappte ich mir Miss Piggy, wie ich das klapprige Rad nannte, und fuhr in den Ort hinunter.
Ulfingen war klein, man konnte sich dort sehr schnell zurechtfinden.
In Berlin wird das anders sein, dachte ich, während ich zum Supermarkt am Ortsende radelte. Wahrscheinlich werde ich eine Weile brauchen, um das Landei in mir abzulegen.
Beim Betreten des Supermarktes überprüfte ich noch einmal mein Geld. Ein Zwanziger und ein Fünfer, das musste reichen.
Ich schob den Einkaufswagen durch die Regale, lud alles hinein, was ich brauchte, und rechnete im Kopf mit.
Als ich durch die Konservenreihen kam, entdeckte ich ein vertrautes Gesicht und blieb stehen. Es war der gut aussehende Junge, der gestern aus Nords Praxis gekommen war. Er hockte vor dem Regal mit den Fertiggerichten und schien sich nicht schlüssig, auf was er Appetit hatte.
Ich fragte mich, ob es niemanden gab, der für ihn kochte? Vielleicht war das der Grund, weshalb er so traurig gewirkt hatte.
Für einen Moment dachte ich darüber nach, ihn anzusprechen, ging dann aber weiter, bevor er mich sah. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich es eilig hatte und rechtzeitig mit dem Kochen fertig werden wollte, aber das wäre nur die halbe Wahrheit gewesen.
Ich war einfach zu schüchtern. Wenn man schon einmal als verrückt abgestempelt wurde und in der Klapsmühle gewesen ist, wird man sehr viel zurückhaltender. So ein angeknackstes Selbstbewusstsein kriegt man nicht so schnell wieder hin.
Nachdem ich alles für mein Überraschungsessen zusammenhatte, machte ich mich auf den Weg zur Kasse.
»Macht zweiundzwanzig neunzig«, sagte die Verkäuferin, nachdem sie meine Einkäufe mit unbewegter Miene über den Scanner gezogen hatte.
Ich legte ihr mein Geld hin und überlegte dabei, welche Farbe diese Frau hatte. Ein blasses Grün, stellte ich fest.
Dann schüttelte die Kassiererin den Kopf.
»Ich sagte zweiundzwanzig neunzig.«
Ich deutete auf mein Geld. »Ja, aber das sind doch fünfund…«
Ich stutzte. Als ich hinsah, lag da nur der Fünfer. Statt des Zwanzigers hatte ich meinen Einkaufszettel dazugelegt.
»Entschuldigung«, stammelte ich und durchsuchte die Tasche meiner Jeansweste, in der ich mein Geld aufbewahrt hatte. Sie war leer.
»He, junge Dame«, rief ein alter Mann aus der Schlange, die sich hinter mir bildete. »Geht’s auch etwas schneller? Ich habe meine Zeit nicht gestohlen.«
Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss, während ich nun auch die anderen Taschen durchsuchte. Doch außer einem angebrochenen Kaugummipäckchen fand ich nichts.
»Mist! Mir muss der Zwanziger vorhin aus der Tasche gefallen sein.«
Die blassgrüne Verkäuferin sah mich gleichgültig an. »Kannst ihn ja suchen, bevor ihn ein anderer findet. Soll ich dir die Sachen so lange zurücklegen?«
Meine Hände zitterten. Ich hatte den Schein in der Hand gehabt, machte ich mir klar. Ich hatte ihn gesehen und gefühlt. Er war da gewesen, also musste ich ihn irgendwo auf dem Weg vom Eingang zur Kasse verloren haben.
»Hier«, sagte eine Stimme neben mir.
Es war der Junge. Vor lauter Aufregung hatte ich nicht mitbekommen, dass er sich hinter mir angestellt hatte. Er hielt der Kassiererin einen Zwanziger entgegen, und noch bevor ich etwas sagen konnte, schnappte sie sich den Schein und gab mir das Wechselgeld.
Irritiert sah ich ihn an. »Das hättest du nicht tun müssen. Der Geldschein liegt hier bestimmt noch irgendwo.«
»Dann lass ihn uns suchen«, sagte der Junge und lächelte mich an. »Aber zuerst muss ich noch meine Sachen bezahlen, bevor mich der nette Herr hier mit seiner Tüte Hundefutter erschlägt.«
Er deutete mit dem Kinn auf den Alten und ich musste lachen.
»Ich bin übrigens Julian«, sagte er, während wir beide noch einmal meinen Weg durch die Gänge zum Eingang zurückverfolgten.
»Doro«, stellte ich mich vor.
»Warst du auch bei der Milch?«
»Wie? Nein, da nicht, aber drüben beim Käse.«
Wir suchten akribisch in jeder Ecke, doch der Schein blieb verschwunden, bis wir dann am Eingang angekommen waren.
»Scheiße«, sagte ich.
»He, das ist doch kein Problem. Du gibst mir die zwanzig zurück, sobald du wieder Geld hast. Okay?«
Ich sah zu ihm auf. Julian war bestimmt eins achtzig, aber nicht nur deshalb kam ich mir in diesem Moment kleiner vor denn je.
»Es ist nicht wegen dem Geld«, sagte ich. »Es ist nur …« Ich wusste nicht, ob ich es aussprechen sollte, aber dann musste ich an gestern denken. Daran, wie er ausgesehen hatte, als er aus der Praxis gekommen war. »Ich muss mir einfach sicher sein, dass ich den Schein hatte. Kannst du das verstehen?«
Er runzelte die Stirn und blies sich eine dunkle Strähne aus dem Gesicht. »Du hast doch gesagt, du hättest ihn vorhin am Eingang noch gehabt?«
»Ja, schon.« Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Aber?«
»Na ja, es ist nur so … Manchmal kann ich mir eben selbst nicht so völlig trauen.«
»Ach so«, sagte er ernst und nickte. »Ich verstehe.«
»Wirklich?«
»Ja, klar. Ich kenne so was.«
Psychos unter sich, dachte ich und musste lächeln, ohne es wirklich zu wollen.
»Dachte ich mir schon, dass du dieses Gefühl kennst. Ich habe dich gestern vor Nords Praxis gesehen. Bist du da schon lange in Therapie?«
Nun begann Julian zu lachen. »Nein, das heißt, eigentlich ja. Ich bin sein Sohn.«
Toll, dachte ich. Das ist mal wieder richtig toll. Stell mir fünfzig Fettnäpfchen in den Weg und ich werde garantiert in jedes davon treten.
»Tut mir leid«, sagte er schnell. »Ich wollte nicht, dass es dir peinlich ist.«
»Nein.« Ich winkte ab, wobei mein Gesicht mit den Tomaten auf dem Alles täglich frisch-Poster neben mir um die Wette leuchten musste. »Ist schon okay. Dann kann ich dir ja nachher das Geld rüberbringen.«
Julian sah auf seine Uhr und hob die Schultern. »Heute geht es nicht bei mir. Ich muss auch gleich los, bin schon spät dran. Aber ein anderes Mal gerne. Bis dann.«
»Bis dann.«
Er lief eilig zu seiner Vespa, befestigte seine Tüte auf dem kleinen Heckträger und fuhr los. Ich sah ihm kurz nach, dann ging ich zurück in den Supermarkt und suchte noch einmal nach dem Zwanziger.
Ohne Erfolg.