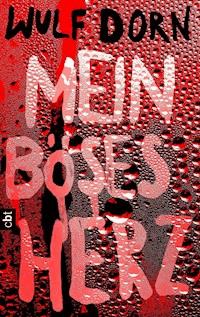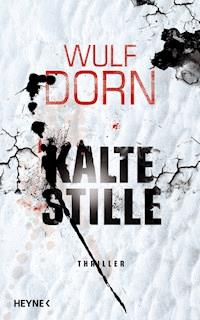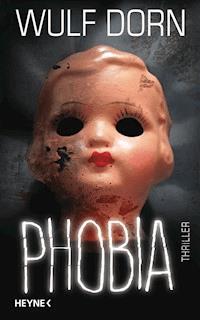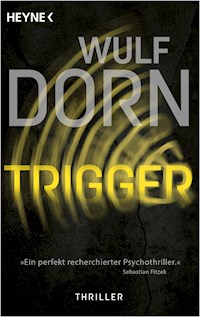4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie liebt. Sie lauert. Sie tötet
Ein Rosenstrauß ohne Absender. Geschenke vor der Haustür. Briefe unter dem Scheibenwischer ... Der Psychiater Jan Forstner wird von einer Unbekannten mit Liebesbezeugungen überhäuft. Anfangs glaubt Jan noch an die harmlose Schwärmerei einer ehemaligen Patientin. Doch dann bittet ihn ein Journalist um Mithilfe im Fall einer geistig gestörten Person und wird kurz darauf ermordet. Jan erkennt, dass er ins Visier einer Wahnsinnigen geraten ist. Und seine Verfolgerin schreckt vor nichts zurück.
Seit der Aufdeckung des Fahlenberger Klinikskandals ist der Psychiater Jan Forstner gegen seinen Willen zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Deshalb misst er den Geschenken einer unbekannten Verehrerin zunächst auch keine Bedeutung bei. Doch dann wird ein Journalist ermordet, der Jan um Mithilfe in einem mysteriösen Fall gebeten hatte. Ein Fall, der mit einer rätselhaften Frau in Zusammenhang stand.
Jan erkennt, dass er ins Visier einer Wahnsinnigen geraten ist, die ein perfides Spiel mit ihm treibt. Doch wer ist die Frau mit den zwei Gesichtern? Die Suche nach der Identität der Mörderin führt den Psychiater in einen Alptraum aus Paranoia und seelischer Grausamkeit, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Und die einzige Person, die ihm helfen könnte, ist zum Schweigen verdammt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2011 by Wulf Dorn Copyright © 2011 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
ISBN 978-3-641-06828-8V002
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter,auch wine sie keine Geistergeschichten mag.
Und für Xaver und Karoline.
Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt.
SPRICHWORT
»I’m your biggest fan, I’ll follow you until you love me.«
»Paparazzi« LADY GAGA
EIN UNSIGNIERTER BRIEF
Liebster Jan,
keine Geschichte hat ein Happy End. Mag Richard Gere noch tausendmal die Feuerleiter emporsteigen und seine Pretty Woman küssen, es ist alles nur Illusion.
Denn wie sehr wir auch darauf hoffen, wie sehr wir es uns auch ersehnen mögen, der Kuss vor dem Abspann ist dennoch eine Lüge. Er ist der als Ende getarnte Beginn. Entscheidender ist doch, was ihm folgt.
Hingegen sind die Märchen, die man uns in der Kindheit erzählt hat, sehr viel ehrlicher. Hast Du schon einmal über den Satz nachgedacht, den man am Ende fast jeden Märchens findet ?
Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
Darin steckt die unausweichliche Wahrheit. Denn am Ende steht immer der Verlust. Und das Zynische daran ist, dass er umso heftiger schmerzt, je glücklicher Du zuvor gewesen bist. Wenn Du eines Tages diesen Brief erhältst, werden wir beide gelitten haben, und der Schmerz wird unbeschreiblich sein. Es wird der Moment sein, in dem Du begreifst, was wahre Liebe wirklich bedeutet und dass nichts auf dieser Welt durch Zufall geschieht.
Glaub mir, so schlimm es auch werden wird, Du wirst mir für diesen Schmerz dankbar sein. Nein, mehr noch. Du wirst mich dafür lieben. So, wie ich Dich jetzt schon liebe. Jetzt, wo Du noch nicht einmal von mir weißt.
NACH DEM REGEN
Als der Schock ein wenig nachließ, waren die Krähen vor dem Fenster das Erste, das Jan Forstner wieder bewusst wahrnahm. Sechs dunkle Gestalten, reglos aufgereiht auf dem ausladenden Ast einer Blutbuche, und hinter ihnen der stahlgraue Himmel.
Die Krähen schienen auch ihn zu sehen. Sie hockten da wie sechs Richter in schwarzer Robe, bereit, das Urteil über Jan zu sprechen.
Schuldig.
Jan saß auf einem der Besucherstühle, die Hände um die Sitzfläche gekrampft. Er fühlte sich wie betäubt. Als ob ihn eine Glasglocke von der Welt abschirmte.
Der Widerhall der Stimmen und Schritte auf dem Krankenhausflur klang merkwürdig dumpf. All die Pfleger und Polizisten, Ärzte und Patienten, die an ihm vorbeieilten, kamen ihm gesichtslos vor. Er sah sie wie helle und dunkle Schatten, die man bei einer Karussellfahrt wahrnimmt. Surreale Bilder aus einer anderen Welt.
Nur sein Zittern fühlte sich real an. Jan fror. Gott, wie sehr er fror! Ein unkontrollierbarer Schüttelfrost, der seine Zähne klappern ließ. Nicht einmal die Wolldecke, die man ihm um die Schultern gelegt hatte, half dagegen. Wie auch? Diese eisige Kälte kam von innen. Sie war neurologisch bedingt, sagte der Arzt in ihm. Eine Reaktion auf den Schock.
»Zurückbleiben«, rief eine Männerstimme. »So bleiben Sie doch zurück!«
Jan wandte den Kopf zu dem Zimmer, in dem es geschehen war. Da war nur wenig Blut gewesen. Nur ein paar Spritzer auf dem Linoleum, und doch …
Jemand sprach ihn an. Eine Schwester. Er konnte ihr Gesicht dicht vor sich sehen, erkannte, dass sie etwas sagte. Doch er verstand ihre Worte nicht. Ihre Stimme klang wie aus weiter Ferne.
»Dr. Forstner, hören Sie mich?«
Er nickte.
»Bleiben Sie hier sitzen, der Arzt ist gleich bei Ihnen.«
Was glaubst du dämliche Kuh, was ich sonst machen werde, wollte er sie anschreien. Aufstehen und wegspazieren? Ich kann froh sein, wenn ich nicht gleich von diesem billigen Stuhl kippe.
Wieder nickte er nur und bekam ein Lächeln zum Dank, das wohl aufmunternd gemeint war. Dann wich die Schwester zurück und machte Platz für zwei Männer, die eine abgedeckte Bahre aus dem Krankenzimmer trugen.
Jan starrte auf die Bahre. Es schien, als würde sie an ihm vorbeischweben – langsam, ganz langsam –, und als sie genau auf Jans Höhe angekommen war, sah er die Hand, die teilweise unter dem Laken hervorschaute.
Drei Finger. Schlank. Bleich. Rotbrauner Nagellack. Dieselbe Farbe, die auch die Spritzer auf dem Boden des Krankenzimmers annehmen würden, wenn sie zu trocknen begannen.
Vor seinem geistigen Auge erschien Carla. Sie saß im Bademantel auf der Wohnzimmercouch und hatte die gewaschenen Haare unter einem Handtuchturban verborgen. In den Sandelholzduft ihrer Hautlotion mischte sich der beißende Geruch von frischem Nagellack. Sie lachte Jan an und pustete über ihre Fingerkuppen.
Magst du die Farbe?
»Nein«, flüsterte er. »Jetzt nicht mehr.«
Das Bild verblasste. Carla war verschwunden. Die Bahre war verschwunden. Stattdessen wieder die Karussellschatten um ihn.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter.
»Sie müssen jetzt stark sein, Jan.«
Jan sah hoch und erkannte den Polizisten mit der Narbe in der Braue. Wie war doch noch sein Name? Jan konnte sich nicht erinnern. Sein Kopf war so leer.
»Stark«, flüsterte er tonlos.
Noch immer hockten die Krähen vor dem Fenster. Jan spürte ihre anklagenden Blicke und glaubte, ihr Krächzen in seinem Kopf zu hören.
Es klang wie »Schuldig, schuldig, schuldig«, und er dachte: Ich hätte den Strauß nicht annehmen sollen. Diesen gottverdammten Rosenstrauß!
TEIL 1
LIMERENZ
»Ich weiß, viele der Nachrichten, die ich an Deiner Tür und in Deinem Briefkasten hinterlassen habe, waren eine Belästigung, aber ich dachte, es sei der einfachste Weg für mich, Dir meine Liebe auszudrücken.«
1
Nachdem die Sprechstunde beendet und seine letzte Patientin für diesen Tag auf ihr Zimmer zurückgegangen war, holte Dr. Jan Forstner ein belegtes Brötchen aus der Schreibtischschublade und trat ans Fenster. Lustlos kaute der Psychiater das fade, weiche Etwas, das ihm eine Cafeteria-Mitarbeiterin als »Ciabatta speciale« angepriesen hatte, und sah in den dunklen Oktoberabend hinaus.
Der Wetterdienst hatte für diese Woche anhaltenden Regen angekündigt und Recht behalten. Dicke Tropfen hämmerten gegen die Fensterscheibe und rannen tränengleich über das Glas. Ein starker Ostwind trieb schwarze Wolken über den Abendhimmel und wirbelte das Herbstlaub durch den Park der Waldklinik. Es war, als würde die Natur noch einmal gegen das nahende Ende des Jahres aufbegehren, ehe ihr der Winter das Leben raubte.
Hinter den meisten Fenstern der umliegenden Stationsgebäude brannte Licht, nur die ehemalige Direktorenvilla lag gänzlich im Dunkeln. Dort, wo sich einst deren Garten befunden hatte, standen nun mehrere Baucontainer, Paletten mit Gerüstteilen und zwei Plastiktoiletten.
Bald würde man mit den Umbauarbeiten beginnen, und eine neue Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie würde entstehen. Ein Projekt, für das sich Jan in den letzten Monaten starkgemacht hatte und das nun endlich umgesetzt werden sollte. Es war ein mühsamer Weg durch den Bürokratiedschungel der Behörden gewesen, und Jan hatte kaum glauben können, wer alles hierzu seine Zustimmung geben musste, doch letztlich hatten er und das Projektteam sämtliche Hürden gemeistert, worauf sie zu Recht stolz waren.
Jan sah eine gebeugte Gestalt, die im schwachen Schein der Parkleuchten durch den Regen eilte und dann um eine Wegbiegung verschwand. Gleich darauf fuhr ein Lieferwagen in Richtung der Pforte davon. Seine Scheinwerfer erhellten den Regen, der auf dem Asphalt tanzte.
Jan ließ den Rest des Brötchens im Papierkorb verschwinden und widmete sich dem Bericht über seine letzte Patientin. Eine verschüchterte Siebzehnjährige, die von einer Gruppe anderer Mädchen gezwungen worden war, sich einen Hundehaufen im Gesicht zu verreiben. Kurze Zeit später war das Handyvideo auf You Tube erschienen und hatte etliche »Mag ich«-Klicks erhalten, woraufhin sich das Mädchen die Pulsadern aufgeschnitten hatte.
Es klopfte, und Schwester Bettina streckte den Kopf zur Tür herein. Mit ihren einundzwanzig Jahren war sie kaum älter als Jans Patientin, doch er war überzeugt, dass diese Mädchen bei ihr keine Chance gehabt hätten. Die junge Frau mit dem Nasenpiercing und dem Punk’s not dead-T-Shirt unter ihrem Schwesternkittel hätte die Gruppe sicherlich aufgemischt. Zwar wirkte sie trotz ihrer Größe schlank und zerbrechlich, aber hin und wieder konnte man ein Funkeln in ihrem Blick sehen, das zu verstehen gab, dass man sie besser nicht unterschätzen sollte.
»Entschuldigung, Dr. Forstner. Störe ich?«
»Was gibt es denn?«
»Eine Überraschung.« Die Schwester lächelte verschwörerisch, dann öffnete sie die Tür vollends und trat mit einem großen Rosenstrauß ein. »Die sind für Sie.«
»Für mich?«
Bettina nickte, woraufhin ihr eine blondierte Strähne ins Gesicht fiel, die sie mit einer kessen Kopfbewegung wegblies. »Ja, sind gerade abgegeben worden. Toll, was? Das sind Baccara-Rosen.«
Verblüfft starrte Jan auf den Strauß, dann erinnerte er sich an den Lieferwagen und nahm die Blumen entgegen.
Carla war immer wieder für eine Überraschung gut, sei es nun ein Kerzenmeer im Wohnzimmer zum Geburtstag oder ein spontanes Picknick am Waldrand als Einstand für ein verlängertes Wochenende. Allerdings hätte er nach den letzten Wochen nicht mit einem solchen Zeichen gerechnet. Für diesen Rosengruß musste sie ein kleines Vermögen ausgegeben haben.
»Frau Weller ist wohl noch immer unterwegs?«
»Ja, aber in ein paar Tagen ist sie wieder zurück.«
Jan betrachtete den Strauß. Er vermisste Carla mehr, als er sich eingestehen wollte. Vor allem jetzt.
»Sagen Sie …« Bettina hüstelte. »Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten?«
Sie wirkte etwas verlegen, und Jan hätte nie gedacht, dass die sonst so selbstbewusste junge Frau rot werden könne. Aber als sie nun die andere Hand hinter dem Rücken hervorzog, wirkte sie wie ein schüchternes kleines Mädchen.
»Glauben Sie, Frau Weller würde es mir signieren, wenn sie wieder da ist? Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, Sie vielleicht auch, Herr Doktor?«
Sie hielt Jan das Buch entgegen. Jan nahm es und betrachtete den vertrauten weißen Schutzumschlag mit dem schwarzen Titelschriftzug
KALTE STILLE
VON CARLA WELLER
Der Untertitel lautete
DIE AUFDECKUNG EINES PSYCHIATRIESKANDALS
Dieses Buch hatte vieles in Jans Leben verändert. Carla berichtete darin über seine Geschichte, über das Verschwinden seines Bruders Sven im Januar 1985 und die lange Zeit der quälenden Ungewissheit, was mit dem Jungen geschehen war. Dreiundzwanzig endlos lange Jahre waren verstrichen, ohne dass man je auf eine Spur des Sechsjährigen gestoßen wäre.
Svens Verschwinden hatte für Jan und seine Familie fatale Folgen gehabt, und Jan wäre beinahe daran zerbrochen. Als er schließlich den schwärzesten Punkt seines Lebens erreicht hatte, war er zur Rückkehr nach Fahlenberg gezwungen gewesen und hatte eine Arztstelle in der Waldklinik angenommen. Nur wenig später hatte der Suizid einer jungen Frau dazu geführt, dass Jan einem Skandal auf die Spur gekommen war, der mit Sven und der Klinik in Zusammenhang gestanden hatte.
Während dieser Zeit hatte er die Journalistin Carla Weller kennengelernt, und die Ereignisse hatten die beiden zusammengeschweißt. Sie hatten ihr Leben riskiert, um die Wahrheit über eine Serie rätselhafter Selbstmorde herauszufinden, und sämtliche Medien hatten darüber berichtet.
Jan, der eine Schlüsselrolle in diesem Fall gespielt hatte, war in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. In zahllosen Artikeln war sensationsheischend über die Aufdeckung des Skandals berichtet worden, und der Trubel um Jans Person war ihm alles andere als recht gewesen – vor allem, weil nicht alles, was über den Fall geschrieben wurde, der Wahrheit entsprochen hatte. Viele Fakten waren schlagzeilenwirksam aufgebauscht und mit erfundenen Geschichten über Jan und seine Familie ausgeschmückt worden. Als ob das, was ihnen in Wirklichkeit widerfahren war, nicht schon schlimm genug gewesen wäre.
Selbstverständlich hatte auch Carla darüber geschrieben, und es hatte nicht lange gedauert, ehe ihr ein Verlag ein äußerst lukratives Angebot für ein Buch gemacht hatte. Sie hatte mit Jan über dieses Angebot gesprochen, und Jan war dagegen gewesen. Immerhin ging es um seine Geschichte, und er hatte endlich damit abschließen wollen. Doch Carla hatte darin eine »große Chance« gesehen – nicht nur für sich selbst, wie sie betont hatte. Zwar bedeutete dieses Buch für sie den großen Karriereschub von der Kleinstadtreporterin zur Buchautorin, aber sie sah darin auch die Möglichkeit, den Gerüchten, die ihre Pressekollegen in immer neuen Artikeln über Jans Geschichte in die Welt setzten, ein Ende zu bereiten.
Trotzdem hatte Jan sie zu überzeugen versucht, den Buchvertrag abzulehnen. Aus seiner Sicht war schon viel zu viel über seine Person an die Öffentlichkeit gelangt, und er hatte gehofft, dass der ganze Fall über kurz oder lang in Vergessenheit geraten würde, sobald ein neues großes Thema die Presse beschäftigte.
Doch Carla hatte sich nicht umstimmen lassen. Es sei auch ihre Geschichte, hatte sie ihm entgegengehalten. Schließlich sei sie dabei fast ums Leben gekommen.
So war das Buch zu einem Keil geworden, der immer tiefer in ihre Beziehung drang – erst recht, als es zu einem Bestseller wurde. Nun, ein Jahr nach den Ereignissen und wenige Wochen nach Erscheinen des Buches, trat Carla in Talkshows auf und gab Interviews, und wen immer sie auch trafen, das Erste, worauf sie angesprochen wurden, war Carlas Buch.
Die Folge war, dass Jan und Carla feststellen mussten, wie sehr sie sich voneinander entfernt hatten – Carla, die ihren Lebenstraum von der großen Story verwirklicht sah, und Jan, der nur das ruhige und normale Leben führen wollte, nach dem er sich so viele Jahre lang vergeblich gesehnt hatte.
Als Carla schließlich das Angebot für eine mehrwöchige Lesereise annahm, sahen sie beide darin eine Möglichkeit, für eine Weile getrennte Wege zu gehen, um über die weitere Zukunft ihrer Beziehung nachzudenken. Falls es noch eine Zukunft für sie gab.
Da er seit Carlas Abreise nichts mehr von ihr gehört hatte, war Jan überzeugt gewesen, dass es zwischen ihnen aus war. Doch der Rosenstrauß ließ neue Hoffnung in ihm aufkeimen. Denn trotz aller Differenzen in den letzten Monaten bedeutete das noch nicht, dass er nichts mehr für sie empfand. Im Gegenteil.
»Ich werde ihr das Buch zum Signieren geben, sobald sie zurück ist«, versprach er und zauberte damit ein breites Lächeln auf Bettinas Gesicht. Gleichzeitig bemerkte er eine Veränderung. Das kleine Mädchen, das in ihr zum Vorschein gekommen war, verschwand, und Bettina war wieder die selbstbewusste junge Frau Anfang zwanzig.
»Danke, Sie sind ein Schatz! Ist es okay, wenn ich heute ein wenig früher gehe? Ich müsste dringend … also, ich hätte da noch was zu erledigen.«
Jan hielt den Strauß hoch. »Aber vorher besorgen Sie mir bitte noch eine Vase.«
»Hab ich schon.«
Sie huschte zu ihrem Schreibtisch im Vorzimmer und kam gleich darauf mit einer Vase zurück.
»Danke, Bettina. Was wäre ich nur ohne Sie?«
Sie zwinkerte ihm zu. »Na, wenigstens gut, dass Sie es merken.«
Sein Telefon klingelte, und Bettina ließ ihn allein. Jan nahm den Hörer ab und ertappte sich bei der leisen Hoffnung, es könnte vielleicht Carla sein.
»Dr. Forstner?«, fragte eine aufgeregte Männerstimme. »Hier spricht Volker Nowak. Erinnern Sie sich an mich? Ich schreibe für den Fahlenberger Boten.«
Natürlich erinnerte sich Jan an ihn. Nowak hatte eine Weile mit Carla zusammengearbeitet, ehe Carla nach dem mehr als großzügigen Vorschuss auf ihr Buch ihren Job gekündigt hatte. Auch Nowak hatte über Jan geschrieben und war einer der wenigen gewesen, denen Jan ein Interview gegeben hatte.
»Ja, ich weiß noch, wer Sie sind.«
»Ich müsste Sie dringend sprechen, Dr. Forstner. Haben Sie heute Abend für mich Zeit?«
»Worum geht es denn?«
Für einen kurzen Moment herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung, ehe Nowak mit gesenkter Stimme antwortete: »Das würde ich Ihnen gerne persönlich sagen.«
»Na gut, ich bin noch bis acht in der Klinik. Kommen Sie doch einfach bei mir im Büro vorbei.«
»Das geht nicht. Es kann sein, dass ich beobachtet werde, und ich möchte Sie keinesfalls in die Sache mit hineinziehen. «
»Nun ja, das tun Sie doch auch, wenn Sie woanders mit mir darüber sprechen.«
»Es wäre trotzdem besser, wenn wir uns nicht bei Ihnen treffen, sondern an einem … unauffälligeren Ort. Ginge das?«
Nun wurde Jan erst recht neugierig. »Wollen Sie mir denn nicht wenigstens kurz sagen, worum es geht?«
»Sagen wir, ich brauche Ihre fachmännische Meinung. Kennen Sie das Old Nick’s?«
»Das irische Pub in der Innenstadt?«
»Ich könnte gegen halb neun dort sein.«
Jan überlegte kurz. Eigentlich war er dafür zu müde, aber Nowak machte ihn neugierig. Außerdem war heute Sonntag, und ein Feierabendbier nach dieser anstrengenden Arbeitswoche wäre vielleicht eine ganz gute Idee.
»Also gut, um halb neun.«
Nowak stieß einen erleichterten Seufzer aus und gab Jan seine Mobilnummer. »Nur für den Fall, dass Ihnen etwas dazwischenkommt«, sagte er und legte auf.
Verwundert sah Jan den Hörer an. Was hatte all das zu bedeuten?
2
Sie stand in einer dunklen Seitengasse und drückte sich gegen die Hauswand. Neben ihr prasselte der Regen auf einen Müllcontainer, und der Wind wehte eine zerrissene Plastiktüte an ihr vorbei.
Es tat gut, hier zu stehen. Hier fühlte sie sich unsichtbar. Kaum ein Mensch war unterwegs, und wenn doch einmal jemand vorbeieilte, war er viel zu sehr mit dem Unwetter beschäftigt, als dass er den schmalen Schatten in der Gasse wahrgenommen hätte. Denn mehr als ein Schatten war sie nicht – ein Schatten, der unentdeckt bleiben wollte, bis ihr großer Moment gekommen war. Das war seit langem ihr Plan gewesen, und bisher war dieser Plan stets aufgegangen.
Bisher. Denn seit zwei Tagen war alles anders. Jemand hatte sie erkannt. Dabei hatte sie sich doch so viel Mühe gegeben, unauffällig zu bleiben. Sie war nett, freundlich und hilfsbereit gewesen, und wenn es irgend möglich war, hatte sie sich aus allem herausgehalten, das die Aufmerksamkeit der Leute auf sie gelenkt hätte.
Doch dann hatte sie einen Fehler gemacht. Nur ein klitzekleiner Fehler, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit … Damit hatte sich alles verändert. Ihr Geheimnis war in Gefahr.
Und als sei das nicht schon schlimm genug, handelte es sich bei diesem Jemand um einen Journalisten, der im Ruf stand, besonders neugierig zu sein. Er würde Nachforschungen anstellen, davon war sie überzeugt. Vielleicht hatte er sogar schon damit begonnen?
Nein, nicht nur vielleicht, er hatte bestimmt schon damit begonnen. Wenn er herausfand, wer sie war, wäre es vorbei. Ihr Plan, ihr Glück … alles aus und vorbei.
Mit geballten Fäusten sah sie zu dem Haus auf der anderen Straßenseite hinüber. Dort oben, hinter dem Fenster im ersten Stock, wohnte er. Volker Nowak.
Natürlich hatte auch sie Nachforschungen über ihn angestellt. Viel hatte sie dafür nicht tun müssen, denn Nowak war in Fahlenberg kein Unbekannter. Er war der Mann, dessen Recherchen vor einem halben Jahr zur Ergreifung eines langgesuchten Drogendealers geführt hatten. Weil er beharrlich war, wenn er eine Story witterte. Das hatte in einem Presseartikel über ihn gestanden – einem Artikel, den ein Konkurrenzblatt über ihn geschrieben hatte.
Und dass Volker Nowak beharrlich sein konnte, hatte sie heute am eigenen Leib erfahren müssen.
Urplötzlich war er aufgetaucht und hatte mit ihr reden wollen – ein scheinbar belangloses Gespräch, aber sie hatte gemerkt, wie er sie dabei taxiert hatte.
Ja, verdammt, er wusste, wer sie war. Vielleicht war er sich vor diesem Gespräch noch nicht ganz sicher gewesen, vielleicht war er deswegen noch einmal zu ihr gekommen, aber als er wieder gegangen war, hatte er es gewusst. Sie hatte es in seinem Blick gesehen.
Er hatte sie erkannt, und seither fand sie keine Ruhe mehr. Wenn er zu recherchieren begann …
Nein, dazu durfte es nicht kommen!
Lange Zeit hatte sie geglaubt, das, was sie einst getan hatte, sei sicher verborgen, sei ihr wohlgehütetes Geheimnis – aber nun war sie doch entdeckt worden. Ausgerechnet von einem, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, seine neugierige Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken.
Was sollte sie nur tun?
War dies Gottes Strafe dafür, dass sie ihre Tat nicht bereut hatte? Wollte Gott sie zwingen, ihre Schuld einzugestehen, weil sie es bisher nicht aus freien Stücken getan hatte?
Gut, einverstanden, dachte sie. Ich bereue es. Ich bereue es sogar sehr. Aber bitte, lieber Gott, gib mir wenigstens noch eine Chance. Nur noch diese eine Chance! Hilf mir, wo ich doch so kurz vor dem Ziel bin.
Sie musste mit diesem Nowak reden. Sie durfte nicht zulassen, dass er ihr Glück zerstörte. Er musste das einfach verstehen.
Wenn nicht, dann … dann …
Erschrocken fuhr sie zusammen. Wieder hatte sie zu seinem Fenster hochgesehen, und nun war das Licht aus.
O nein!
Wann hatte er es ausgeschaltet? Sie war so in Gedanken gewesen, dass sie es gar nicht bemerkt hatte.
Ihr Herz begann wie wild zu hämmern. Sie hätte nicht einmal mit Sicherheit sagen können, wie lange sie nicht aufgepasst hatte. Vielleicht länger, als es ihr vorkam. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Wenn sie aufgeregt war, kam es immer wieder vor, dass sie die Zeit und die Welt um sich herum vergaß. Hatte sie etwa wieder einen ihrer Aussetzer gehabt?
Lieber Gott, bitte nicht! Bitte, bitte nicht!
Dann öffnete sich die Haustür, und Volker Nowak trat ins Freie.
Erleichtert atmete sie auf. Sie hatte ihn nicht verpasst. Er war noch da.
Danke, lieber Gott!
Sie zog die Ränder ihrer Kapuze noch weiter ins Gesicht und biss sich auf die Unterlippe.
Warum zögere ich? Das ist meine Chance. Jetzt muss ich nicht einmal zu ihm in die Wohnung gehen. Er kommt sogar zu mir. Ich muss ihn einfach nur ansprechen.
Vor Aufregung zitternd, beobachtete sie, wie er den Kragen seiner Jacke hochschlug und um das Haus herum in den Hinterhof lief. Dort parkte sein Wagen, das hatte sie vorher überprüft.
Wenn sie ihn jetzt noch erwischen wollte, musste sie sich beeilen. Doch das klang einfacher, als es war. Sie hatte Angst, mit ihm zu sprechen. Angst, ihm zu sagen, wer sie wirklich war. Angst, er könnte sie zurückweisen und auf seinem Recht bestehen, die Öffentlichkeit über sie und ihre Tat in Kenntnis zu setzen.
Aber ich muss es versuchen. Ich muss!
Sie atmete noch einmal tief durch, dann lief sie los.
3
Das Old Nick’s war eine der vielen Kneipen, die den Fahlenberger Marktplatz säumten. Früher hatte es hier vor allem Geschäfte gegeben, doch allmählich waren die Läden verschwunden, und die Gebäude hatte man nach und nach zu einer Gastronomiemeile umfunktioniert. Schuld daran waren die großen Supermärkte, die im Industriegebiet am Stadtrand entstanden waren. Niemand ging noch zum Metzger, Bäcker oder Drogisten, wenn man alles in einem haben und noch dazu direkt vor dem Eingang parken konnte.
Nikolas Mossner war einer der Fahlenberger Geschäftsleute gewesen, die aus dieser Not eine Tugend gemacht hatten. Als er seinen Lebensmittelladen schließen musste, verpachtete er das Gebäude an einen Pizzabäcker und eröffnete im Kellergewölbe des alten Fachwerkbaus ein Pub nach irischem Vorbild. Fortan zapfte er Guinness und Kilkenny, schenkte Whiskey aus und verdiente nicht schlecht damit.
Für Jan, der Mossner noch aus Kindertagen mit seiner weißen Schürze hinter dem Gemüseregal kannte, war es ein befremdlicher Anblick, »Old Nick« nun hinter der Theke zu sehen. Als Mossner ihn begrüßte und seine Bestellung entgegennahm, ertappte sich Jan bei dem Gedanken, dass nun bestimmt die Frage, ob es denn ein bisschen mehr sein dürfte, folgen würde. So wie damals, wenn Jans Mutter Obst oder Gemüse bei ihm abwiegen ließ und darauf achtete, dass Mossner nicht mit dem Finger auf der Waage blieb, was dem »Schlitzohr«, wie sie ihn nannte, gern mal unterlief.
»Na, satt geworden?«, fragte Mossner und räumte Jans leeren Teller ab.
»Noch einen Bissen, und ich platze«, entgegnete Jan, der die Wartezeit auf Volker Nowaks Eintreffen mit einem herzhaften Steaksandwich überbrückt hatte.
Eigentlich war es ihm ganz recht gewesen, dass Nowak sich verspätete – so hatte er noch etwas Anständiges zu essen bekommen –, aber jetzt wurde er doch ungeduldig. Immerhin war der Journalist nun schon seit fast einer halben Stunde überfällig, und Jan hatte ihn auch nicht auf seinem Handy erreicht.
»Noch ein Bier?«, wollte Mossner wissen und schwenkte erwartungsvoll ein Guinnessglas.
Jan winkte dankend ab und bezahlte. Mossner schob ihm das Rückgeld über die Theke.
»Da hat dich wohl jemand versetzt, was?«
»Sieht ganz so aus. Sagen Sie, kennen Sie Volker Nowak ?«
»Klar, der ist häufig hier. Warst du mit ihm verabredet?«
»Falls er doch noch auftauchen sollte, könnten Sie ihm bitte ausrichten, dass ich hier gewesen bin und dass er mich morgen Mittag wieder in der Klinik erreichen kann?«
»Sicher.« Mossner nickte und lehnte sich über den Tresen. Als Jan ihn so betrachtete, musste er denken, dass der alte Nick wirklich alt geworden war seit damals.
»Der Junge hat wohl Probleme, was?«, sagte Mossner mit gedämpfter Stimme, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: »Dachte ich mir schon. War erst gestern wieder hier und saß dort drüben in der Ecke vor seinem Bier. Hättest ihn sehen sollen. Hat nur auf sein Glas gestarrt, als hätte er sechs Richtige im Lotto und vergessen, den Schein abzugeben.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Klar hab ich das. Ich kenn den Volker doch schon, da konnte er noch nicht mal über die Ladentheke schauen. Aber ich bin nicht so ganz schlau geworden aus dem, was er gesagt hat. ›Nick‹, hat er gesagt, ›Nick, du kennst doch eine Menge Leute.‹ ›Darauf kannst du wetten‹, hab ich geantwortet, und er fragte, ob ich mich schon jemals in jemandem getäuscht hätte. ›Aber sicher‹, hab ich gesagt, ›das kommt immer wieder mal vor. Man kann schließlich nicht in die Köpfe der Leute hineinsehen.‹ Dann hat er mich angesehen, als ob ich ihn nicht richtig verstanden hätte, und gesagt: ›Nein, ich meine so richtig getäuscht. Du denkst, du kennst jemanden, und stellst dann fest, dass er jemand ganz anderes ist.‹ Ich hab gelacht und ihn gefragt, ob er denn nicht weiß, dass er mit einem geschiedenen Mann spricht. Aber er fand das nicht witzig.«
»Und dann?«
»Nichts.« Mossner zuckte die Schultern. »Er hat bezahlt und ist gegangen. Mit einem Gesicht, gegen das einem das Sauwetter da draußen wie ein Frühlingsmorgen vorgekommen wäre.« Er stemmte sich wieder vom Tresen ab und machte sich am Zapfhahn zu schaffen. »Ich sag dir, da steckt bestimmt irgendein Weibsbild dahinter. Kein Wunder, wenn er mit ’nem Psychiater drüber reden will. Diese Weiber bringen uns doch alle noch um den Verstand. Wie sieht’s aus, vielleicht doch noch ein Bier?«
Jan winkte nochmals ab und nahm sein Handy vom Tisch. Einen letzten Versuch wollte er noch unternehmen. Wenn er jetzt niemanden erreichte, dann musste Nowak ihn eben doch in der Klinik besuchen, wenn es ihm ernst war.
Jan drückte die Wahlwiederholung und hörte das Tuten des Freizeichens, gefolgt von einem Klicken. Er erwartete bereits die erneute Ansage von Nowaks Mobilbox, doch dann meldete sich eine Männerstimme.
»Ja?«
Jan drückte das Telefon fester ans Ohr und hielt sich das andere zu, um den Kneipenlärm zu dämpfen. »Herr Nowak, sind Sie das?«
»Mit wem spreche ich?«
Es war nicht Nowaks Stimme, aber dennoch klang sie vertraut, wenngleich Jan bei diesem Lärm nicht sagen konnte, woher er die Stimme kannte.
»Hier ist Jan Forstner. Und wer sind Sie?«
»Dr. Forstner«, sagte der andere und klang überrascht, »ich dachte mir doch gleich, dass ich diese Stimme kenne. Hier spricht Kröger.«
Konsterniert sah Jan auf das Display. Nein, er hatte die richtige Nummer gewählt. Aber wieso meldete sich der Polizist an Nowaks Anschluss?
Jan musste schlucken. Es gab schließlich nur eine plausible Erklärung: Volker Nowak war etwas zugestoßen. Wahrscheinlich ein Unfall auf dem Weg zum Pub, während Jan hier in aller Seelenruhe sein Abendessen verspeist hatte.
»Was ist los? Warum …«
»Was wollten Sie denn von Herrn Nowak?«
»Wir waren verabredet, aber er ist nicht gekommen.«
4
Jan erreichte Volker Nowaks Haus genau in dem Moment, als der Leichenwagen durch die Polizeiabsperrung gelassen wurde. Blaulichtgewitter spiegelte sich auf dem nassen Asphalt und blendete ihn. Durch den strömenden Regen auf der Windschutzscheibe wirkten die Polizisten mit ihren reflektierenden Jacken wie geisterhafte Schemen.
Er hielt hinter einem der Polizeifahrzeuge und schob sich an den Schaulustigen vorbei, die sich unter Schirmen und Plastikumhängen vor der Absperrung drängten. Dann entdeckte er Kröger, der gerade die beiden Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens zum Hinterhof wies, und rief ihm zu.
Heinz Kröger wischte sich mit der Hand übers Gesicht und kam zu ihm herüber. Sie hatten sich zuletzt bei einem Wohltätigkeitsbasar vor drei Monaten gesehen, und Jan überlegte, ob der Leiter der Fahlenberger Polizei seither noch ein paar Kilos zugelegt haben konnte. Sein Gang war watschelnd und schwerfälliger denn je, und als er schließlich bei Jan angekommen war, schnaufte er, als sei er auf ihn zugerannt.
»Danke, dass Sie gleich gekommen sind.«
Kröger wischte sich abermals übers Gesicht, doch der Regen floss unaufhörlich weiter an der Blende seiner Mütze vorbei über die geröteten Wangen. Sein übriges Gesicht war ungesund bleich, so dass es aussah, als hätte er Rouge aufgetragen.
»Himmel, was für ein Mistwetter«, stöhnte er. »Die reinste Sintflut. Wird wirklich Zeit für meine Pensionierung. Allmählich fühle ich mich zu alt für so etwas. Erst recht nach dem, was ich da hinten gesehen habe.«
Jan spürte einen säuerlichen Geschmack im Mund und versuchte, nicht an das Steaksandwich von vorhin zu denken. »Was genau ist denn passiert?«
»Kommen Sie mit«, sagte Kröger und ging los, ohne auf Jan zu warten.
Jan folgte ihm, und sie stellten sich unter das Vordach des Kellerabgangs an der Rückseite des Hauses. Von dort aus konnte man den Innenhof überblicken.
Auf den markierten Parkplätzen standen drei Fahrzeuge. Volker Nowak hatte einen blauen Seat Ibiza gefahren, der nun von vier Beamten der Spurensicherung untersucht wurde. In ihren weißen Plastikoveralls sahen sie wie Gespenster aus.
Kröger zeigte zu ihnen hinüber. »Der verdammte Regen ist unser größter Feind. Je nachdem, wie lange Nowak schon so dagelegen hat, werden wir nicht mehr viel finden.«
Jan beobachtete die beiden Angestellten des Bestattungsinstituts, die den Toten in einen Plastiksarg legten. Sie beeilten sich, und mit ihren Rücken verdeckten sie ihm die Sicht, doch Jan fiel auf, dass Nowaks Kopf wie der einer Marionette hin und her baumelte, als sei sein Genick gebrochen. Ansonsten wirkte der Körper unversehrt. Nach Krögers Andeutung von vorhin hatte Jan Blut zu sehen erwartet, doch dem war nicht so. Trotzdem hatte er den Eindruck, die beiden Männer hatten es nicht nur wegen des Regens so eilig, den Deckel zu schließen.
»Wer hat ihn gefunden?«
»Eine junge Frau aus dem Nachbarhaus, die hier einen der Parkplätze gemietet hat. Sie kam von der Arbeit nach Hause und sah die Innenbeleuchtung seines Wagens brennen. Die Tür war halb geöffnet, und Nowak …« Kröger sprach nicht zu Ende und schnaufte, als trüge er eine schwere Last. Mit düsterem Blick starrte er auf den Sarg. »Ich habe in meiner langen Laufbahn schon viele Tote zu Gesicht bekommen«, sagte er leise. »Unfallopfer, Selbstmörder und einmal die mumifizierte Leiche einer alten Frau, die wochenlang von niemandem vermisst worden war. Das sind schlimme Erlebnisse, aber irgendwie findet man sich damit zurecht. Das gehört zum Beruf. Aber das da …« Er fuhr sich wieder übers Gesicht, doch diesmal nicht des Regens wegen. »Mord ist etwas so Sinnloses. So etwas geht mir richtig an die Nieren. Ich meine, warum tut jemand so etwas? Was veranlasst jemanden, den Kopf eines anderen Menschen zwischen A-Säule und Fahrertür zu zerren und sich so lange gegen die Tür zu werfen, bis der andere an seinem gebrochenen Kehlkopf erstickt? Das ist so … so … krank!«
Jan sah den beiden Männern mit dem Plastiksarg nach.
»Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, wer es gewesen sein könnte?«
»Höchstwahrscheinlich eine Frau«, entgegnete Kröger und nickte in Richtung der beiden Wohnblocks, die hinter dem Hof aufragten. »Einer der Nachbarn glaubt, eine Frau und einen Mann gehört zu haben. Wahrscheinlich haben sie gestritten, meint er.«
»Aber sicher ist er sich nicht?«
»Nein, er hatte sich ein Formel-1-Rennen angesehen, und der Streit hat ihn genervt. Als Nowak dann auch noch zu schreien begann, hat der Nachbar die Balkontür geschlossen. « Kröger schnaufte wieder, und diesmal klang es verächtlich. »Können Sie sich das vorstellen? Jemand hört die Todesschreie eines Menschen und schließt die Tür, um bei seinem Fernsehprogramm nicht gestört zu werden. Gott, was ist nur aus dieser Welt geworden?«
Jan schüttelte ungläubig den Kopf. »Und die übrigen Nachbarn? Hat denn niemand etwas davon mitbekommen ?«
»Angeblich nicht. Wahrscheinlich haben alle vor dem Fernseher gesessen.«
Er sah Jan an, und Jan dachte, es sei wirklich an der Zeit für Kröger, in Rente zu gehen. Andernfalls würden sie sich bald in Jans Sprechstunde wiedersehen. Die Falten zwischen Krögers Brauen, die typisch sind für Menschen mit Depressionen, hatten eine besorgniserregende Tiefe bekommen. Und plötzlich begriff Jan, weshalb Kröger ihn gebeten hatte, an den Tatort zu kommen. Immerhin hätte er ihn auch später auf dem Revier befragen können. Aber er hatte ihn hierherbestellt, weil er jemanden brauchte – auch wenn er das sicher nicht zugeben würde.
»Wahrscheinlich sind Sie einer der Letzten gewesen, mit denen Nowak gesprochen hat«, sagte Kröger. »Können Sie mir sagen, was er von Ihnen wollte, oder fällt das unter Ihre Schweigepflicht?«
»Nein, er war kein Patient. Er wollte nur meine Meinung als Psychiater hören.«
Kröger zog die Brauen hoch. »Aha, und in welcher Angelegenheit ?«
»Ich weiß es nicht.«
»Hat er denn keine Andeutung gemacht?«
»Er sagte nur, dass er am Telefon nicht darüber sprechen wolle. Er wollte sich auch nicht in der Klinik mit mir treffen, weil er befürchtete, jemand könnte ihn dort sehen. Stattdessen hatte er sich im Old Nick’s mit mir verabredet. «
»Wer hätte ihn denn Ihrer Meinung nach nicht sehen sollen?«
»Ich vermute, es ging um eine persönliche Angelegenheit. Vielleicht hatte er ein psychisches Problem oder jemand, der ihm nahestand. Es kommt häufiger vor, dass mich jemand privat anspricht, weil er Hilfe benötigt und Angst hat, dass es publik werden könnte. Für viele ist die Hürde zu groß, den regulären Weg über den Hausarzt oder die Klinikambulanz zu nehmen. Also versuchen sie es erst einmal über den inoffiziellen Weg.«
Kröger nickte. »Kann ich mir denken. Es ist gewiss nicht leicht, sich eingestehen zu müssen, dass man allein nicht mehr klarkommt.«
Der Polizist sah zu Boden, und für einen kurzen Moment glaubte Jan, Kröger würde das Seil ergreifen, das er ihm zugeworfen hatte, und ihn nun auf seine eigenen Schwierigkeiten ansprechen. Doch dann sah Kröger wieder auf und wirkte wie jemand, der beschlossen hatte, sich zusammenzureißen.
»Hat er sonst noch etwas gesagt? Irgendetwas, das uns vielleicht weiterhelfen könnte?«
Jan zuckte die Schultern. »Wie schon gesagt, er fühlte sich beobachtet. Aber er sagte nicht, von wem. Und dann sagte er noch, er wolle mich in nichts hineinziehen.«
Kröger nickte nachdenklich. »Vielleicht ging es ihm aber auch gar nicht um Ihren ärztlichen Rat. Erinnern Sie sich noch an den Drogenring, den Nowak vor einiger Zeit auffliegen ließ?«
»Ja, die Presse hat doch lang und breit darüber berichtet. «
»Der Chef dieser Bande ist ein Rumäne, der sich Dagon nennt«, sagte Kröger. »Dank Nowak sitzt er noch für eine ganze Weile hinter Schloss und Riegel. Nowak hatte deswegen einige Morddrohungen erhalten. Unter anderem von Dagons Freundin. Ein gefährliches Frauenzimmer. Hat selbst schon mehrmals gesessen, einmal davon wegen Totschlags. Vor ein paar Wochen hat sie sich anscheinend abgesetzt. Wir vermuten nach Rumänien, aber sie könnte ebenso gut hier irgendwo untergetaucht sein. Wäre möglich, dass sie Herrn Nowak aufgelauert hat. Die Brutalität der Tat wäre ihr durchaus zuzutrauen.«
»Sie meinen also, es könnte sich hier um einen Rachemord der Drogenmafia handeln?«
Kröger hob die Hände. »Ist natürlich nur eine Vermutung. Aber denkbar wäre es.«
Jan runzelte die Stirn. »Aber warum wendet sich Nowak dann an mich und will meine fachliche Meinung wissen ? Wenn er sich von dieser Frau bedroht gefühlt hätte, wäre er doch sicherlich zu Ihnen gekommen.«
»Offen gesagt habe ich keine Ahnung«, gestand Kröger. »Vielleicht hatte das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Wie auch immer, der Fall geht jetzt ohnehin an die Kripo. Hauptkommissar Stark wird sich darum kümmern. Er ist schon auf dem Weg hierher. Wahrscheinlich wird ihn der Regen aufgehalten haben.« Er sah zum Himmel auf. »Dieser verfluchte Regen. Als ob einem das alles hier nicht schon genug auf die Stimmung schlägt.«
Der Polizist stieß einen tiefen Seufzer aus, und als er sich Jan erneut zuwandte, war die Falte zwischen seinen Brauen wieder tiefer geworden. »Tja, ich werde dann mal weitermachen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.«
»Keine Ursache. Sie können sich jederzeit wieder an mich wenden.«
5
Am nächsten Morgen, pünktlich um halb acht, hielt ein taubenblauer Opel Kadett vor der Fahlenberger Christophorus-Kirche. Es war ein altes E-Modell, Baujahr 1985, das aber immer noch aussah, als sei es erst vor kurzem vom Band gelaufen.
Die Fahrerin dieses gepflegten Oldtimers hieß Edith Badtke. Sie war gleichzeitig Haushälterin und Sekretärin der Pfarrei, und das nun schon seit mehr als sechsundzwanzig Jahren. Wie immer war sie in konservatives Grau gekleidet und hatte die Haare zu einem strengen Dutt zusammengesteckt. Ihr Erscheinungsbild und die kantigen Gesichtszüge hätten leicht auf eine pedantische und humorlose Persönlichkeit schließen lassen, doch wer Edith Badtke ein wenig näher kennenlernte, entdeckte schnell den liebenswerten Kern unter der nüchternen Schale.
Seit sie im Dienst der katholischen Kirche stand, hatte sie für sechs Pfarrer gearbeitet, und jeder von ihnen hatte sie schon nach kurzer Zeit ins Herz geschlossen. Sie war pünktlich, zuverlässig und korrekt und zeigte dennoch Verständnis für die kleinen Schwächen ihres jeweiligen Vorgesetzten. Im Gegensatz zu ihrem Exmann, der sie bereits nach zwei Jahren verlassen hatte, weil ihn ihre zwanghafte Ordnungsliebe angeblich »in den Wahnsinn« trieb, wussten die Herren Pfarrer die Qualitäten ihrer »guten Seele« sehr wohl zu schätzen.
Die Dinge müssen einfach ihre Ordnung haben, war ihre Devise, und dazu gehörte auch der Blumenschmuck am Altar, den sie allwöchentlich erneuerte. So auch heute.
Im Innern ihres Wagens roch es wie auf einer Frühlingswiese, denn auf der Rückband lagen säuberlich aufgereiht vier Gestecke und zwei Sträuße, die sie wie jeden Montagmorgen vor der Arbeit bei Bruni Kögels Blumenladen abgeholt hatte.
Sie nahm zuerst die beiden Sträuße von der Plastikfolie, mit der sie den Rücksitzbezug schützte, und bugsierte sie vorsichtig aus dem Wagen, um keinen Blütenstaub zu verteilen. Dann huschte sie durch den Regen zum Seiteneingang der Kirche.
An der Tür angelangt, beschloss sie, dass es wieder einmal an der Zeit war, ein ernstes Wort mit Josef Seif zu reden. Seif war Kunstschmied und hatte bereits vor über einem Monat die Reparatur des antiken Türschlosses versprochen. Doch außer dem Ausbau des kaputten Schlosses und einer provisorischen Drahtlösung war noch nichts geschehen.
»So kann das nicht weitergehen«, murmelte sie, entfernte die Drahtschlaufe, drückte die schwere Eichenholztür auf und schob sich mit den beiden Sträußen in die Kirche.
Drinnen angekommen, legte sie die Blumen behutsam auf dem Steinboden ab, zückte ein Taschentuch und tupfte sich die Regentropfen aus dem Gesicht. Als sie die beiden Sträuße wieder aufhob und sich umdrehte, fiel ihr eine Veränderung auf. Eine beunruhigende Veränderung.
In der Kirche war es wärmer als sonst. Das klassizistische Gotteshaus stammte aus dem frühen achtzehnten Jahrhundert und war trotz zahlreicher Renovierungen schlecht isoliert. In besonders kalten Wintern konnte man den eigenen Atem sehen, wenn man im zugigen Mittelschiff stand oder in einer der Gebetsbänke kniete. Und auch heute, wo draußen der Herbststurm heulte, hätte es hier sehr viel kälter sein müssen. Aber nun spürte sie einen warmen Luftzug, der vom vorderen Teil der Kirche zu ihr wehte.
Mit großen Augen starrte sie zum Eingang der Seitenkapelle neben dem Altar. In dessen Goldornamenten spiegelte sich Feuerschein und verhieß nichts Gutes.
Edith Badtke entwich ein fassungsloses »Um Himmels willen!« Dann eilte sie den Seitengang entlang, die beiden Sträuße weiterhin fest umklammernd, und das Klacken ihrer Absätze hallte vom hohen Deckengewölbe wie Hammerschläge wider.
6
Mirko Davolic war ein gut aussehender junger Mann. Äußerst gut aussehend, wie Jan ihm nicht ganz ohne Neid zugestehen musste. Athletische Statur, dunkler Teint, schulterlanges schwarzes Haar, wasserblaue Augen und ein Gesicht, das man auf dem Titelbild eines Hochglanzmagazins hätte zeigen können. Selbst die kleine Narbe auf seiner Wange, die durch den gepflegten Dreitagebart schimmerte, wirkte irgendwie passend.
Dennoch hatte Davolic bei seiner Einweisung in die Waldklinik wie ein Häufchen Elend gewirkt. Wie er Jan erzählt hatte, war er drauf und dran gewesen, sich das Leben zu nehmen, nachdem er seinen Job in einer Eisengießerei verloren hatte. Dort hatte er fast zehn Jahre gearbeitet, bis der Betrieb Konkurs anmelden musste. Danach fand der ungelernte junge Mann keine neue Stelle mehr, wurde zunehmend depressiv und verkroch sich irgendwann nur noch ins Bett, bis ihm sein Vermieter auch noch die Wohnung kündigte.
Verschuldet und ohne feste Bleibe war Davolic durch die Gegend geirrt und hatte sich schließlich auf der Donaubrücke am Fahlenberger Stadtrand wiedergefunden. Durch einen Zufall, den der Patient im späteren Verlauf seiner Therapie als »Gottes Wille« bezeichnet hatte, war er einer Polizeistreife aufgefallen, die ihn von dem Sprung in den Tod abhielt und in die psychiatrische Klinik brachte.
Seither waren vier Monate vergangen, und aus dem einstigen Häufchen Elend war wieder ein zuversichtlicher junger Mann geworden, der es schaffte, sämtliche Schwestern auf seiner Station mit einem einzigen Blick dahinschmelzen zu lassen.
»Das hab ich Ihnen zu verdanken, Dr. Forstner«, verkündete er in einem Akzent, der seine albanische Abstammung verriet, und lehnte sich leger im Stuhl zurück. »Wegen Ihnen geht’s mir jetzt wieder gut.«
Jan winkte ab. »Bedanken Sie sich bei sich selbst. Ich habe Ihnen nur den Weg aus dem Tal gezeigt. Gegangen sind Sie ihn selber.«
Davolic strahlte. »Das haben Sie sehr schön gesagt. Ja, ich hab’s geschafft. War ja auch wirklich Zeit. Jetzt hab ich auch wieder eine Wohnung und einen Job. Alles wird wieder gut.«
Überrascht sah Jan in den Entlassungsbericht. »Sie haben wieder Arbeit? Davon wusste ich noch gar nichts.«
Davolic rutschte auf seinem Stuhl nach vorn und wirkte ein wenig verlegen. »Ich wollte der Sozialarbeiterin nichts davon sagen«, erklärte er mit gesenkter Stimme. »Aber morgen geht’s dann los.«
»Was für eine Arbeit ist es denn?«
Nun wich Davolic Jans Blick aus. »Nicht falsch verstehen, Doktor, aber darüber will ich eigentlich nicht reden.«
»Ich hoffe, es ist nichts Illegales?«
Der junge Mann machte eine abwehrende Geste, die ein wenig übertrieben wirkte. »Nein, nein! Keine Angst. Ist halt bloß … also, ich werde gutes Geld verdienen und kann mein Zimmer bezahlen.«
»Na dann«, sagte Jan und verstand. Davolic war nicht sein erster Patient, der sich um einen Job bemühen musste, um den jeder andere lieber einen weiten Bogen machte. Und wer erzählte schon gern, dass er bei der städtischen Putzkolonne öffentliche Toiletten reinigte oder frühmorgens in der Innenstadt Müll vom Pflaster fegte?
Jan machte sich eine Notiz in dem Bericht, wünschte seinem Patienten alles Gute und verabschiedete ihn.
In der Tür blieb Davolic noch einmal stehen und grinste Jan an. »Nehmen Sie’s mir nicht übel, Doktor, Sie sind echt voll nett und so, aber ich hoffe, wir sehn uns nie wieder. «
Jan nickte. »Das hoffe ich auch. Zumindest nicht hier.«
Mit einer kleinen Sporttasche, die seine ganzen Habseligkeiten enthielt, marschierte Davolic aus dem Stationsgebäude.
Schwester Bettina, die gerade mit der Hauspost den Gang entlangkam, sah sich nach ihm um und kam dann auf Jan zu.
»Gut aussehender Kerl, nicht wahr?«, feixte Jan, doch Bettina schüttelte nur den Kopf.
»Was nützt eine tolle Hülle, wenn sie nur Luft enthält ?« Sie drückte Jan die Post in die Hand. »Der mag vielleicht nett fürs Auge sein, aber jemandem wie Ihnen könnte er doch nie das Wasser reichen.«
»Oho, vielen Dank.« Jan lachte. »Aber falls Sie heute wieder früher gehen wollen, muss ich Sie enttäuschen.«
Sie ging auf diesen Scherz nicht ein und wirkte auf einmal sehr ernst. »Nein, das meine ich wirklich so. Sie sind ein ganz besonderer Mensch. Diese Kinderstation zum Beispiel, die würde es ohne Sie in zehn Jahren noch nicht geben. Oder Ihre Patienten … Sie sollten mal hören, wie die über Sie reden. Ich kenne hier nicht viele Ärzte, die so beliebt sind wie Sie.«
»Das ist sehr nett«, sagte Jan, und ihm fiel auf, dass sie seinem Blick nicht standhalten konnte. »Aber ich tue hier einfach nur meine Arbeit. Die neue Station war längst überfällig, und die Pläne dafür gab es schon länger, als ich hier bin. Außerdem bin ich ja auch nicht der Einzige, der sich dafür starkmacht.«
»Sie tun mehr als nur Ihre Arbeit, Dr. Forstner.« Bettina klang entschlossen, auch wenn sie Jan dabei nicht ansehen konnte. »Sie wissen, wie es in den Menschen aussieht, und deshalb mögen sie Sie.«
Wie schon am Tag zuvor glaubte Jan wieder, das schüchterne Mädchen zu sehen, das sich hinter der koketten Fassade verbarg. Doch im nächsten Moment wechselte sie wieder zu ihrer frechen Art. »Außerdem müssen Sie sich ja auch nicht gerade verstecken«, sagte sie nun etwas lauter und zwinkerte ihm zu. »Für jemanden in Ihrem Alter sehen Sie doch noch ganz gut aus.«
»Na, solche Komplimente hat man gern.«
Sie grinste. »Sie sollen ja nun auch nicht übermütig werden.«
Damit ließ sie ihn stehen und verschwand mit dem übrigen Poststapel im Stationszimmer.
Zurück in seinem Büro, sah Jan in den Spiegel über dem Handwaschbecken. Er war nun sechsunddreißig, durch sein dunkles Haar zogen sich erste graue Strähnen, und um die braunen Augen zeigten sich einige Falten, die vor ein oder zwei Jahren noch nicht da gewesen waren. Aber alles in allem hatte er sich noch ganz gut gehalten, fand er – erst recht nach dem Kompliment einer jungen Frau, die genau genommen seine Tochter hätte sein können.
»Vorsicht, du eitler Gockel«, murmelte er seinem Spiegelbild zu. »Das sind die ersten Anzeichen einer Midlife-Crisis. «
Oder deiner Einsamkeit, fügte eine leise innere Stimme hinzu.
Carla fehlte ihm. Er hatte sie gestern Abend noch mehrfach zu erreichen versucht, war aber stets nur mit ihrer Mobilbox verbunden worden und hatte jedes Mal wieder aufgelegt, ehe der Piepton ertönte. Ihm war nicht danach gewesen, sich mit ihrem Anrufbeantworter zu unterhalten. Dafür war das, was er ihr sagen wollte, zu persönlich.
Mit gemischten Gefühlen sah er zu dem Rosenstrauß, der auf dem Aktenschrank neben dem Kaffeeautomaten thronte, und widmete sich dann der Post. Gerade als er das erste Kuvert geöffnet hatte, klingelte das Telefon. Jan meldete sich, doch am anderen Ende der Leitung war nichts zu hören.
»Hallo?«
Stille.
Zuerst glaubte Jan, die Verbindung sei unterbrochen – keine Seltenheit bei der veralteten Telefonanlage der Klinik – , aber dann vernahm er ganz schwach ein Atmen.
»Hallo, wer ist denn da?«
Doch der Anrufer antwortete nicht.
Jan sah auf das Display und las EXTERNER ANRUF, was entweder auf einen analogen Anschluss oder eine unterdrückte Rufnummer hindeutete. Möglicherweise war es einer seiner ambulanten Patienten. Aber warum meldete er sich nicht?
»Wenn Sie nichts sagen, werde ich auflegen.«
Keine Reaktion. Nur ein leises Rascheln war zu hören, bei dem es sich vielleicht um das Reiben von Stoff an den Sprechschlitzen handelte, begleitet von den kaum wahrnehmbaren Atemgeräuschen.
»Hören Sie, Sie haben den Anschluss von Dr. Jan Forstner in der Waldklinik gewählt. Wenn Sie mit mir reden wollen, dann sagen Sie etwas.«
Jan wartete noch kurz, und als er dann immer noch keine Antwort erhielt, legte er kopfschüttelnd auf. Er nahm wieder das Kuvert zur Hand, als das Telefon erneut klingelte.
Wieder nannte Jan seinen Namen, und wieder meldete sich der externe Anrufer nicht.
»Wer sind Sie?«
Nichts.
Jan seufzte. »Was soll das, hm?«
Auch dieses Mal erhielt er außer dem leisen Atmen keine Antwort.
»Also, falls das ein Scherz sein soll, dann …«
»Jan.« Die Anruferin sprach so leise, dass Jan sie fast nicht gehört hätte.
»Wer ist da?«
»Jan«, wiederholte die Stimme, eine junge Mädchenstimme, wie es Jan schien.
»Ja, hier ist Jan Forstner. Und mit wem spreche ich?«
»Ohne dich schaffe ich es nicht.«
Da sie flüsterte, war das Alter ihrer Stimme nicht genau auszumachen. Jan schätzte die Anruferin auf etwa zwölf bis vierzehn, und sie klang verzweifelt.
»Was schaffst du nicht?«
»Alles.«
»Kannst du mir das genauer erklären?«
»Bald«, war die geflüsterte Antwort, gefolgt von einem Klicken. Dann ertönte das Freizeichen.
Stirnrunzelnd legte auch Jan auf. Wer in aller Welt mochte das gewesen sein? Er hatte die Stimme nicht erkannt, aber dieses Mädchen hatte ihn mit seinem Vornamen angeredet, als würde es ihn kennen. Es war ein Hilferuf gewesen. Aber von wem?
Nachdenklich betrachtete er das Telefon und wartete, ob es noch einmal läuten würde. Für kurze Zeit geschah nichts, doch gerade als er sich wieder seiner Post zuwenden wollte, schrillte der Apparat erneut.
»Also gut«, sagte Jan. »Reden wir, aber bitte leg nicht gleich wieder auf.«
»Das habe ich auch nicht vor«, antwortete eine vertraute Stimme, begleitet von einer lautstarken Bahnhofsdurchsage.
»Carla! Na, das ist aber eine Überraschung.«
»Du hast gestern versucht, bei mir anzurufen. Gleich mehrmals.«
Ihre Stimme klang knapp und sachlich, was Jan verwirrte. Nach dem Rosenstrauß hatte er eigentlich etwas mehr Herzlichkeit erwartet.
»Nun ja, ich … wollte mich einfach nur bei dir bedanken. «
»Bedanken?«
Jan runzelte die Stirn. Sie klang erstaunt, als wüsste sie nicht, wovon er sprach.
»Hör mal, Jan, ich habe nicht viel Zeit. Ich werde gleich vom Bahnhof abgeholt und muss zu einem Interview. Ist irgendetwas passiert, oder weshalb hast du so oft angerufen? «
»Nein, bei mir ist alles in Ordnung«, sagte er und erkannte, dass es nicht der richtige Moment war, um über Rosen zu sprechen. Vor allem nicht, wenn sie nicht von ihr waren. »Ich wollte nur deine Stimme hören.«
»In den Nachrichten habe ich das von Volker gehört. Das ist ja furchtbar. Weiß man denn schon, wer es gewesen ist?«
Sie wich ihm aus, und Jan spürte einen unangenehmen Druck auf der Brust. »Nein. Sie vermuten, dass vielleicht die Drogenmafia damit zu tun hat.«
»Das würde mich nicht wundern. Volker hatte ein paar sehr heiße Eisen angefasst.« Jan konnte im Hintergrund eine Männerstimme hören, die Carla ansprach. Carla entgegnete etwas, wobei sie das Telefon von sich forthielt. Dann meldete sie sich wieder. »Mein Taxi ist da. Also, ich muss jetzt …«
»Warte noch einen Moment«, sagte Jan hastig. »Ich möchte dir noch sagen, dass ich dich vermisse.«
»Ja, du fehlst mir auch.« Diese Antwort verursachte Jan ein Kribbeln in der Magengegend. »Aber lass mir noch ein bisschen Zeit, ja?«
»Natürlich.«
»Weißt du, es ist nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich bin mir nur einfach noch nicht klar darüber, wie es mit uns weitergehen soll.«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Jan und musste gegen den Kloß in seinem Hals ankämpfen.
»Ich muss jetzt wirklich los.« Ihre Stimme klang leise und ging beinahe in einer Lautsprecherdurchsage unter. »Wir reden ein anderes Mal, okay? Pass auf dich auf.«
Noch ehe er antworten konnte, hatte sie aufgelegt.
7
Zum hundertsten Mal an diesem Morgen überflog Felix Thanner den Text auf dem Monitor seines Laptops und seufzte. Je öfter er den Entwurf durchlas, desto weniger gefiel er ihm. Auch wenn er mit seinen zweiunddreißig Jahren der bisher jüngste Geistliche der Fahlenberger Pfarrei war, hatte er dennoch schon genug Erfahrungen mit Reden sammeln können. Aber dieses Mal fühlte er sich blockiert. Es war, als müsse er sich jedes Wort einzeln aus den Fingern saugen.
Sicherlich lag diese Blockade an der Aufregung vor dem großen Abend, von dem viel abhing, versuchte er sich zu besänftigen. Andererseits war genau das der Grund, weshalb er besonders kritisch mit seinem Text ins Gericht gehen musste. Als Klinikseelsorger lag ihm die neue Psychiatrieabteilung für Jugendliche sehr am Herzen, und die Spendenaktion musste einfach ein Erfolg werden. Doch nun kam ihm jede Formulierung, die er am Abend zuvor noch für überzeugend und pointiert gehalten hatte, gezwungen und wenig stichhaltig vor.
Abermals seufzend schloss er die Augen und versuchte sich zu konzentrieren, als er Schritte durchs Pfarrhaus eilen hörte. Gleich darauf stürmte Edith Badtke in das Arbeitszimmer.
Thanner erschrak. Mit ihren weit aufgerissenen Augen sah seine Angestellte aus, als habe sie den Leibhaftigen gesehen.
»Herr Pfarrer, schnell, kommen Sie!«
»Um Himmels willen, Frau Badtke, was ist denn nur los?«
»Kommen Sie«, wiederholte sie mit krebsrotem Kopf. »Das müssen Sie sich ansehen!«
Noch ehe er fragen konnte, worüber sie sich denn so aufregte, machte sie bereits wieder kehrt.
Thanner sprang auf und folgte ihr aus dem Haus und über den Kirchhof. In der Aufregung hatte er seine Filzhausschuhe anbehalten, was ihm erst bewusst wurde, als er durch den Regen lief, der sich wie aus Sturzbächen über das Kopfsteinpflaster ergoss.
Die beiden kannten sich nun ein gutes halbes Jahr, seit Thanner seinen Vorgänger – einen siebzigjährigen Inder, der inzwischen in seine Heimat zurückgekehrt war – abgelöst hatte. Doch noch nie hatte er die sonst so unerschütterliche Edith Badtke derart aus dem Häuschen erlebt. Vor allem war sie noch nie, ohne anzuklopfen, in sein Arbeitszimmer geplatzt.
Während er versuchte, mit ihr Schritt zu halten, rechnete er mit dem Schlimmsten. Sicherlich ein Diebstahl oder eine Kirchenschändung. Beides war leider keine Seltenheit. Erst vor kurzem hatte er aus der Zeitung erfahren, dass Jugendliche eine Ikonentafel am Eingang seiner ehemaligen Arbeitsstätte mit eingeritzten Hakenkreuzen zerstört hatten. Ein jahrhundertealter Kunstschatz, in wenigen Minuten zerstört aus blankem Übermut oder bloßer Dummheit oder beidem.
Er folgte ihr durch die offen stehende Seitentür, und dann spürte auch er den ungewöhnlich warmen Luftzug, der ihm vom Altar entgegenwehte. Edith Badtke hielt auf die Seitenkapelle zu und blieb vor dem Eingang stehen.
»Da«, keuchte sie. »Sehen Sie nur!«
Thanners vollgesogene Hausschuhe schmatzten auf dem glatten Steinboden, und er hatte Mühe, nicht auszurutschen. Doch als er endlich bei ihr ankam, war alles andere vergessen.
»Aber, das ist doch …«
Der Anblick verschlug ihm die Sprache. Vor ihm flackerte ein Kerzenmeer. Unzählige kleine Lichter reihten sich aneinander, so dass der Mosaikboden der kleinen Kapelle nicht mehr zu erkennen war. Säuberlich aufgereiht ließen sie die Statue des heiligen Christophorus mit dem pausbäckigen Christuskind auf den Schultern wie eine überirdische Erscheinung erstrahlen.
Staunend sah Thanner an Fahlenbergs Schutzheiligem empor. Jemand hatte dem Kind einen roten Schal um Kopf und Schultern geschlungen, so dass es wie ein Mädchen aussah.
»Herrje, ich hätte es wissen sollen«, schimpfte Edith Badtke. »Das kommt davon, wenn man am Tag Arbeit liegen lässt. Aber gestern musste ich doch noch … Ach, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall hätte ich die Schachteln gleich wegsperren sollen.« Verärgert deutete sie auf zwei leere Pappkartons, die ordentlich gefaltet in einer Ecke der Kapelle standen. »Dreihundert Opferkerzen, gestern erst geliefert. Und diese Vandalen haben keinen einzigen Cent in der Opferkasse hinterlassen. Am besten, ich rufe gleich die Polizei.«
Verdutzt und gleichzeitig erleichtert, dass es sich um nichts Schlimmeres handelte, betrachtete Felix Thanner das seltsam dekorierte Bild des Heiligen. Was hatte das nur zu bedeuten?
»Nein, keine Polizei«, murmelte er nachdenklich. »Ich glaube nicht, dass das ein Streich sein soll. Wer immer das getan hat, muss ein sehr großes Anliegen auf dem Herzen haben.«
Edith Badtke verzog ihr kantiges Gesicht zu einer ärgerlichen Grimasse. »So oder so, man bezahlt für Opferkerzen. Das gebietet der Anstand. Na, auf jeden Fall werde ich diesem Schlosser noch einmal Feuer unterm Kessel machen. Der hält mich keinen Tag länger hin. Dann wird eben er für die Kerzen aufkommen. Hätte er das Schloss repariert, wäre das nicht passiert.«
Entschlossenen Schrittes stapfte sie davon und ließ Felix Thanner zurück.
Der Pfarrer starrte noch eine ganze Weile auf das mädchenhafte Christuskind mit dem roten Schal. Möglich, dass er sich täuschte und es sich tatsächlich nur um einen geschmacklosen Scherz handelte, dennoch hatte er bei diesem Anblick ein ungutes Gefühl.
Ein äußerst ungutes Gefühl.
8
An diesem Abend war der historische Festsaal der Waldklinik bis auf den letzten Platz gefüllt. Durch das altehrwürdige Gebäude, das noch aus der Gründungszeit der Klinik zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts stammte, wogte ein Meer aus Stimmen und Gelächter, das von der hohen Stuckdecke mit den Kronleuchtern widerhallte.
Über zweihundert Personen waren gekommen, um der Vorstellung des Konzepts für die neue Kinder- und Jugendstation beizuwohnen. Ärzte und Pflegepersonal, Patienten und Angehörige, aber auch wichtige Größen der Fahlenberger Lokalprominenz waren unter den Gästen, allen voran der Präsident des Lions Clubs und der Vorstand der Rotarier.
Vor allem auf Letztere zielte die Veranstaltung ab, da die Initiatoren auf Spendengelder für den weiteren Ausbau der Station angewiesen waren. Im weitläufigen Garten der ehemaligen Direktorenvilla sollte ein therapeutischer Kletterpark entstehen, und auch für das Kunstatelier im Westflügel der Station wurden weitere Geldmittel benötigt.
Jan und seine Kollegen hatten sich lange vorbereitet und ihr Bestes gegeben, um ihre Vorträge so interessant und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Sie informierten über die Entwicklungsgeschichte der Kinder-und Jugendpsychiatrie, stellten neueste Therapiekonzepte vor, und Felix Thanner ging auf die große Bedeutung der Klinikseelsorge ein.
Der Abend wurde ein voller Erfolg. Erfreut stellte Jan fest, dass sie ihr Publikum fest im Griff hatten. Abgesehen vom üblichen Husten und Niesen, gab es keinerlei Unterbrechungen. Niemand stand auf, um zur Toilette zu gehen oder sich Nachschub am Getränkeausschank zu holen, und nach der zwanzigminütigen Pause erschienen sämtliche Gäste wieder, um sich auch den zweiten Teil der Vorträge anzuhören.
Jan deutete das als ein gutes Zeichen, und sein Gefühl sollte ihn nicht trügen. Keine halbe Stunde, nachdem die Vorträge beendet und Professor Alfred Straub der – wie er es bezeichnete – »angenehmsten Verpflichtung eines Klinikleiters« nachgekommen war und das Büfett eröffnet hatte, sah Jan schon die ersten Schecks über den Spendentisch wandern.
Zufrieden und erschöpft suchte er sich eine unauffällige Ecke neben der Rednerbühne, stellte dort seinen Teller ab und stärkte sich mit ein paar Kanapees, die er sich am Büfett erkämpft hatte. Unweit von ihm stand Felix Thanner. Er unterhielt sich mit dem Direktor der örtlichen Sparkasse, der sich auf einen der Stehtische stützte und kopfnickend in sein Scheckbuch kritzelte. Für einen kurzen Moment sah Thanner zu Jan, lächelte ihm zu und reckte unauffällig den Daumen. Jan grinste, nickte zurück und schob sich ein Lachshäppchen in den Mund.
»Hallo, Dr. Forstner«, sagte eine Frauenstimme, und Jan wandte sich zu ihr um.