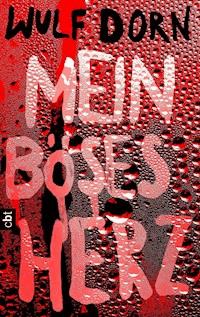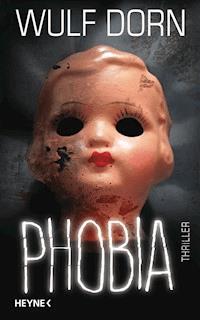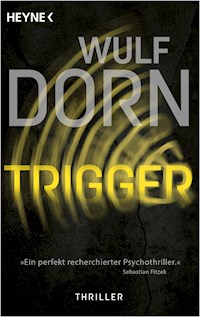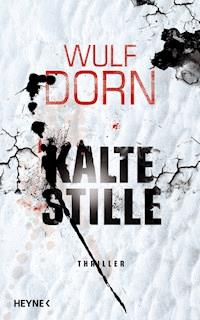
2,99 €
2,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn die Stille zum Alptraum wird ...
Eine Tonbandaufzeichnung, die in abrupter Stille endet – unerträglicher Stille. Mehr ist Jan Forstner von seinem kleinen Bruder nicht geblieben. Vor dreiundzwanzig Jahren ist Sven spurlos verschwunden. In derselben Nacht verunglückte auch sein Vater unter rätselhaften Umständen. Beide Fälle konnten nie aufgeklärt werden. Als Jan gezwungen ist, an den Ort seiner Kindheit zurückzukehren, holt ihn die Vergangenheit wieder ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,5 (96 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Vor der Stille
Kapitel 1 - Dreiundzwanzig Jahre später
Kapitel 2
Kapitel 3 - Freitag, II. Januar 1985
Copyright
Für Harrison, Snoopy, Sumi, Beh-ton und den Rest der alten Gang.
Für die, die wir waren, und die, die wir sind.
Und für Volker, der die Gang in einem Kino wieder zusammengebracht hat, das es eigentlich nicht mehr gibt.
»Glücklich, wer den Grund der Dinge erkennen kann!«
VERGIL
»And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.«
»The Sound of Silence« SIMON AND GARFUNKEL
Vor der Stille
Samstag, 12. Januar 1985
Der Scheibenwischer quälte sich über die zersprungene Windschutzscheibe, schob mit nachlassender Kraft den Schnee beiseite und sank dann wieder in seine Ausgangsposition zurück.
Vor Schmerzen wie von Sinnen starrte Bernhard Forstner auf das spinnennetzartige Rissmuster der Scheibe. Sein Blick folgte dem Wischer, dem ersterbenden Hin und Her, das an das Winken einer dürren Totenhand erinnerte.
Gleich nach dem Aufprall war der Motor abgestorben, die Scheinwerfer hatten ein letztes Mal geflackert, und seither herrschte die Dunkelheit der Winternacht.
Forstner hatte alles versucht, seinen ausbrechenden VW Passat unter Kontrolle zu bekommen, aber er war viel zu schnell gefahren, und die verschneite Fahrbahn war spiegelglatt gewesen. Entsetzt hatte er den Wald auf sich zukommen sehen und wie ein Wahnsinniger am Lenkrad gezerrt, doch der Wagen hatte ihm nicht mehr gehorcht. Mit einem gewaltigen Krachen war er frontal auf den Stamm einer dicken Tanne geprallt. Die gelb lackierte Motorhaube schob sich zusammen, als sei sie aus Papier, die Windschutzscheibe zerriss, und dann setzte der Schmerz ein.
Das alles hatte nicht mehr als ein paar Sekunden gedauert, doch Bernhard Forstner hatte jedes Detail wahrgenommen, als sähe er eine Zeitlupenaufnahme. Seither waren vielleicht zehn Minuten vergangen, die Forstner jedoch wie eine Ewigkeit erschienen.
Wie ein Soldat auf verlorenem Posten hatte der Scheibenwischer gegen die Schneemassen angekämpft, die aus dem Geäst der Tanne gefallen waren. Doch nun war er am Ende. Ein letztes Rucken, dann erstarrte er.
Auch Bernhard Forstner fühlte seine Kräfte schwinden. Eingeklemmt hinter dem Lenkrad, das ihn mit unbarmherziger Gewalt in die Lehne seines Sitzes presste, wusste er, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb.
Jeder Atemzug schmerzte, als würden Rasierklingen durch seinen Brustkorb schneiden. Er vermutete, dass mehrere seiner Rippen gebrochen waren. Mindestens eine musste die Lunge durchstoßen haben. Das verriet ihm der blutige Sprühnebel, den er nun immer häufiger aushustete. Seine Arme und Beine waren gänzlich gefühllos, was darauf hindeutete, dass seine Wirbelsäule ebenfalls Schaden genommen hatte, als ihn das eingedrückte Armaturenbrett zwischen Lenkrad und Sitz gequetscht hatte.
Er würde sterben, hier und jetzt, da machte sich Forstner nichts vor. Als Mediziner wusste er, wann dieser Moment gekommen war. Er litt unter Lähmungserscheinungen und inneren Blutungen. Er spürte, wie ihn die Müdigkeit in Wellen überfiel und mitzureißen drohte. Bald würde er den Kampf mit seinen immer wieder zufallenden Augenlidern verlieren und in den einen letzten Schlaf fallen, aus dem man nie wieder erwachte.
Doch etwas in ihm, ein verzweifelter, eiserner Wille, wollte dies auf gar keinen Fall zulassen. Wenn er jetzt starb, hier auf dieser gottverlassenen Straße mitten im Fahlenberger Forst, würde nicht nur er sein Leben verlieren.
Wenn er jetzt starb, war Sven verloren. Sein kleiner, sechsjähriger Junge, der sich zu Weihnachten einen neuen Bahnhof für seine Modelleisenbahn gewünscht und der fest darauf vertraut hatte, ihn zu bekommen. Weil er wusste, dass er sich immer auf seinen Vater verlassen konnte. Und auch jetzt, wo es um das Leben des Jungen ging, würde er sich auf die Hilfe seines Vaters verlassen - darauf, dass Bernhard Forstner kommen und ihn retten würde.
Ich muss am Leben bleiben.
An diesen Gedanken klammerte sich Forstner mit zäher Verbissenheit, während er gleichzeitig mit einer nahenden Ohnmacht rang. Er versuchte, sich auf den eisigen Wind zu konzentrieren, der ihm durch das zerbrochene Fenster der Fahrertür ins Gesicht biss. Gleichzeitig richtete er seine Gedanken auf das leise Klicken des erkaltenden Motors. Er versuchte, die Anzahl der Klickgeräusche zu zählen, ein Muster darin zu erkennen. Hauptsache, er blieb bei Bewusstsein.
Ich muss am Leben bleiben, bis man mich hier findet!
Was für ein vermessenes Vorhaben, schalt ihn die logische Seite seines Verstandes. Von Minute zu Minute füllte sich seine Lunge weiter mit Blut. Bald würde sein Kreislauf vollends zusammenbrechen und der Kampf gegen die Besinnungslosigkeit verloren sein. Schon jetzt setzte ein Gedankengewitter in seinem Kopf ein, all die längst vergessen geglaubten Erinnerungen und Gefühle seiner Kindheit, die ihm Wärme und Geborgenheit signalisierten - jene als Nahtoderfahrungen bekannten neurologischen Wunder des Gehirns, die uns das Sterben erleichtern sollen. Das letzte Geschenk, das die Natur uns macht, ehe sie uns in ihren Schoß zurückholt.
Zu dieser frühen Stunde und vor allem bei diesen Wetterverhältnissen würde kaum ein Mensch auf die Idee kommen, die abgelegene Waldstraße zu nutzen. Man würde ihn frühestens im Laufe des Vormittags finden, sobald der Räumdienst die Bundes- und Hauptstraßen von der Schneelast befreit hatte und die Nebenstrecken abfuhr. Aber dann würde es zu spät sein. Für Forstner und für Sven.
Vor seinen Augen begannen Lichter zu tanzen. Zuerst schwach, dann immer stärker. Das grün-graue Netz der geborstenen Windschutzscheibe begann zu leuchten. Gleich würde er das helle Licht sehen, von dem Menschen immer wieder berichteten, die dem Tod in letzter Sekunde entkommen waren. Nur, dass er ihm nicht entkommen würde.
Doch halt, nein! Diese Lichter waren keine Halluzination. Es waren keine Tricks seines Gehirns, um ihm das Sterben zu erleichtern. Diese Lichter waren echt! Es waren die Scheinwerfer eines herannahenden Wagens.
Schon konnte Forstner das Brummen des Motors hören, gedämpft vom Schnee, aber dennoch real.
Die Hoffnung verlieh ihm neue Kräfte. Forstner hob den Kopf, soweit es seine eingekeilte Position und die geschwächten Muskeln zuließen.
Der Wagen steuerte vorsichtig auf ihn zu. Nun waren die rechteckigen Scheinwerfer gut erkennbar. Dann wurde der Motor abgestellt und das Licht ausgeschaltet.
Eine neue Schmerzwelle durchfuhr Forstners Brust, doch seine Gedanken waren klar genug, um zu erkennen, dass irgendetwas mit dem anderen Wagen nicht stimmte.
Warum schaltet er das Licht ab? Warum steigt er nicht aus?
Da auf einmal strahlte ihm erneut Licht entgegen. Diesmal nicht von den Scheinwerfern, sondern von einer einzelnen Lampe. Der Strahl war grell und kam schwankend auf ihn zu. Schritte näherten sich, gruben sich knirschend in den Schnee und endeten neben seiner Fahrertür. Forstner vermochte nicht, den Kopf zu drehen. Er benötigte alle Kraft, um zu sprechen.
»Bitte … helfen Sie … meinem Sohn.«
Der Mann neben ihm - denn nach den Schritten zu urteilen, schien es sich um einen Mann zu handeln - sagte nichts. Stattdessen hörte Forstner, wie er einen Handschuh abstreifte, und spürte, wie er den Puls seiner Halsschlagader berührte.
»Bitte …«, keuchte Forstner. Er hob kurz den Kopf, doch er sank ihm gleich wieder auf die Brust, ohne dass Forstner etwas dagegen tun konnte. Lichtflecken, diesmal eindeutig halluzinatorischer Natur, tanzten hinter seinen geschlossenen Lidern.
Der Fremde entfernte sich. Er ging um den Wagen herum und zerrte an der rechten Hintertür. Doch die gesamte Karosserie war viel zu verzogen, als dass sie sich öffnen ließ. Forstner hörte mehrere dumpfe Schläge, ehe die Scheibe zerbarst. Etwas Glattes rieb am Stoffbezug der Rücksitzbank, und für einen irrwitzigen Augenblick sah Forstner das Bild seiner ledernen Aktentasche vor sich.
Dann kamen die Schritte zu ihm zurück. Wieder fühlte der andere Forstners Puls.
Bernhard Forstner fehlte die Kraft, noch einmal den Kopf zu heben. Er hatte Mühe zu atmen und hörte ein Rasseln in seiner Brust, die sich inzwischen ebenso taub wie sein übriger Körper anfühlte. Dennoch war sein Verstand klar genug, zu erkennen, wer der Mann neben ihm war.
Mit letzter Anstrengung sprach Forstner den Namen seines Sohnes aus. »Was … ist … mit ihm?«
Jedes seiner Worte wurde von einem warmen Blutschwall begleitet, der seinen Mund mit bitterem Kupfergeschmack füllte.
»Pssst!«, zischte ihm der Mann zu. »Es ist gleich vorbei.«
Das letzte große Gefühl in Bernhard Forstners Leben war hilflose Wut.
»Der Teufel … soll … dich holen!«
Er spürte die Gegenwart des anderen dicht neben sich. Hörte sein Flüstern.
»Er hat mich längst geholt.«
Dann wurde es für immer dunkel.
1
Dreiundzwanzig Jahre später
Die Stille in dem großen Büro war unerträglich. Nur das Heulen des Novemberwinds war von jenseits des großen Doppelfensters zu hören. Frost und Schnee verheißend, pfiff er durch das Parkgelände der Waldklinik, fegte die letzten Blätter von den Bäumen und zerrte an den Fensterläden des Altbaus.
Jan Forstner bemühte sich, seine Unruhe zu verbergen - dieses schleichende Unbehagen, das ihn stets befiel, wenn es um ihn herum so still wurde, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.
Stille rief schlimme Erinnerungen hervor, ganz gleich, wie sehr sich Jan dagegen sträubte. Wenn es still war, kamen Bilder in ihm hoch, die ihn schaudern ließen.
Nacht. Schnee. Der menschenleere Park …
Wäre er jetzt zu Hause oder mit dem Auto unterwegs gewesen, hätte er das Radio eingeschaltet. Irgendeinen Sender. Hauptsache Stimmen und Musik, die der Stille ein Ende setzten.
Doch hier, in Prof. Dr. Raimund Fleischers Büro, blieb ihm nichts anderes übrig, als auf einen Trick zurückzugreifen, der sich in solchen Situationen schon mehrmals bewährt hatte. Jan rief sich eine eingängige Melodie in Erinnerung - die nächstbeste, die ihm in den Sinn kam. Der Trick bestand darin, sich ganz und gar auf die Musik zu konzentrieren, bis er glaubte, sie tatsächlich im Raum zu hören. Diesmal war es »Clocks«, ein Stück von Coldplay, das im Radio gelaufen war, als Jan auf den Besucherparkplatz des Verwaltungsgebäudes gefahren war. Das Ablenkungsmanöver gelang leichter als gedacht. Die sich ständig wiederholenden Klavierakkorde und der stampfende Rhythmus hallten in Jans Kopf nach, und die Erinnerungen verschwanden.
Fleischer schien von alldem nichts mitzubekommen. Mit entrücktem Gesichtsausdruck saß der leitende ärztliche Direktor in seinem Ledersessel und studierte Jans Unterlagen, als wollte er jedes Detail darin auswendig lernen. Ein Anblick, der Jan an seinen Vater erinnerte, wenn er spätabends in seinem Arbeitszimmer gesessen, Akten durchgeblättert und Berichte diktiert hatte.
Wenn man erwachsen ist, erscheint einem vieles kleiner als in Kindheitserinnerungen, doch Fleischer bildete für Jan eine Ausnahme. Noch immer war der Professor für ihn ein Hüne. Der graue Kaschmirpullover spannte ein wenig an den breiten Schultern und verriet einen durchtrainierten Körper. Anders als die meisten Professoren, die Jan bisher kennengelernt hatte, schien Fleischer viel Wert auf Sport und eine ausgewogene Ernährung zu legen. Der Psychiater hatte die fünfzig längst überschritten, wirkte aber entschieden jünger. Sicherlich lag dies auch an seinem dichten graumelierten Haar, das er mit Frisiercreme zu bändigen versuchte. Mit seinen markanten Gesichtszügen, den breiten Wangenknochen, der Denkerfalte zwischen den buschigen Brauen und der großen Lesebrille erinnerte er Jan an Gregory Peck als Atticus Finch in dem Filmklassiker Wer die Nachtigall stört. Im Fall einer Neuverfilmung hätte Fleischer sicherlich beste Chancen auf die Hauptrolle gehabt.
Jan ließ den Blick durch das geräumige Büro wandern. In die Wand zur Rechten war ein Bücherregal eingelassen, das von oben bis unten mit medizinischer Fachliteratur und einigen Jahrgängen der Psychiatrischen Praxis gefüllt war. Die gegenüberliegende Seite des Raums nahm ein polierter Besprechungstisch ein, auf dem eine voluminöse Vase mit frischen Schnittblumen thronte. Die Wand dahinter zierte ein großformatiges abstraktes Gemälde, in dem Gelb- und Rottöne dominierten. Daneben hingen mehrere gerahmte Urkunden und Fotos.
Die meisten dieser Fotos zeigten Fleischer bei feierlichen Anlässen und Kongressen. Ganz unten hing eine deutlich ältere Aufnahme, auf der eine Gruppe junger Menschen dem Betrachter entgegenstrahlte. Jeder von ihnen hatte den Ausdruck im Gesicht, der typisch ist für Schüler auf Abschlussfotos - Erleichterung und Stolz, es geschafft zu haben, und Neugier auf das, was die Zukunft bringen wird. Jan konnte Fleischer sofort in der Gruppe ausmachen. Er überragte die Mitschüler in seiner Reihe um mindestens eine Kopflänge. Schon damals trug er sein dichtes Haar streng frisiert, nur seine Statur war um einiges hagerer als heute.
Am äußeren Rand der kleinen Galerie fanden sich zwei Familienfotos, die in einem Doppelrahmen gefasst waren. Auf dem älteren spielten zwei kleine Mädchen im Sand, während sich das Elternpaar in Liegestühlen sonnte und dem unsichtbaren Fotografen zuwinkte. Auf dem anderen Foto nahmen zwei hübsche junge Frauen ihren Vater in die Mitte und legten lachend ihre Köpfe an seine Brust.
»Mein ganzer Stolz«, sagte Fleischer, und erst jetzt merkte Jan, dass der Professor ihn beobachtet hatte. »Die ältere ist Livia. Ihre Schwester haben wir nach ihrer Großmutter benannt. Annabelle. Sie wird uns demnächst selbst zu Großeltern machen.«
Jan erwiderte sein Lächeln. »Aus Kindern werden Leute.«
Ein besserer Kommentar fiel ihm in diesem Augenblick nicht ein. Für Smalltalk war er viel zu aufgeregt, denn wie auch immer das Ergebnis dieser Unterhaltung ausfiel, es würde über Jans weiteren Werdegang entscheiden.
Er hatte sich schon mit dem Gedanken abgefunden gehabt, nie wieder zu praktizieren, als er plötzlich vor zwei Wochen Fleischers Einladung im Briefkasten fand. Zum ersten Mal schöpfte er wieder Hoffnung. Natürlich war ihm klar, dass die Einladung noch keine Zusage war, aber nach all den Absagen, die Jan in den letzten Monaten erhalten hatte, war dieses Vorstellungsgespräch zumindest eine Chance - und es war fraglich, ob er noch eine weitere erhalten würde. Nicht nach dem, was geschehen war.
»Wohl wahr. Aus Kindern werden Leute, und aus den Eltern werden alte Leute. Tja.«
Fleischer seufzte und sah ein wenig wehmütig drein. Dann legte er Jans Bewerbungsmappe vor sich auf den Tisch und nickte anerkennend.
»Und wie ich hier sehe, Jan, ist aus Ihnen auch etwas geworden. Hervorragendes Abitur, Studium der Medizin in Heidelberg, mehrere Assistenzstellen bei namhaften Kollegen und ein exzellenter Abschluss Ihrer Facharztausbildung. Noch dazu an einer der forensischen Einrichtungen, an denen einem die Arbeit ein ziemlich gutes Nervenkostüm abverlangt. Alle Achtung, Bernhard wäre stolz auf Sie.«
»Das Gebiet hat mich schon während meines Studiums interessiert«, warf Jan fast schon entschuldigend ein. Das Lob machte ihn verlegen.
»Triebtäter?« Fleischer hob die Brauen und nahm seine Lesebrille ab. »Kein einfacher Bereich, beileibe nicht. Umso beeindruckter bin ich von Ihrer Dissertation. Summa cum laude. Da waren Sie besser als ich. Wenn ich richtig informiert bin, wird das von Ihnen entwickelte Instrument zur Typisierung pädophiler Straftäter inzwischen an mehreren Institutionen angewandt.«
»An zwei, um genau zu sein. Wobei man sagen muss, dass sich der Fragebogen in einem Fall erst in der Erprobungsphase befindet und es noch nicht sicher ist, ob er tatsächlich implementiert werden soll.«
Fleischer grinste. »Mir kommt es vor, als säße ich Ihrem Vater gegenüber. Er war wie Sie, Jan, voller Ehrgeiz, aber mit Lob wusste er nichts anzufangen.«
»Nun ja, ich wollte nicht …«
»Nein, das ist schon in Ordnung«, unterbrach ihn Fleischer mit einer abwehrenden Handbewegung. »Das gefällt mir. Genau deshalb mochte ich Bernhard. Diese Haltung zeichnete ihn schon während unseres Studiums aus. Er war keiner dieser eingebildeten Kerle, die sich für die künftigen Halbgötter in Weiß hielten. Umso mehr freut es mich, nun auch bei Ihnen diesen Wesenszug wiederzufinden. Mir sind Menschen zuwider, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Wie heißt es doch so trefflich: Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Insofern haben Sie die besten Zukunftsaussichten.«
Im Moment liegen meine beruflichen Zukunftsaussichten eher im Nullbereich, und das wissen wir beide, dachte Jan.
»Wie Sie sich bestimmt denken können«, fuhr Fleischer fort, »habe ich Erkundigungen über Sie eingezogen, ehe ich Sie zu diesem Gespräch eingeladen habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich Sie seit jener … nun ja, sagen wir: seit jener Tragödie damals nie ganz aus den Augen verloren habe. Vor allem nicht, nachdem ich erfuhr, dass Sie in Bernhards Fußstapfen getreten sind, wenngleich auch auf einem anderen Fachgebiet.« Er tippte auf die Mappe und sah Jan mit wissendem Blick an. »Der Grund, warum Sie sich ausgerechnet darauf spezialisiert haben, liegt ja gewissermaßen auf der Hand - Ihre Vita lässt kaum einen Zweifel aufkommen. Nun frage ich mich, ob Ihre Suche nach der Wahrheit zu einem Ergebnis geführt hat?«
Jan musste schlucken. Er hatte sich lange auf dieses Gespräch vorbereitet, war sämtliche möglichen Fragen im Geiste durchgegangen, und hatte gewusst, dass es zwei große Hürden zu meistern galt. Natürlich spielte Fleischer mit seiner Frage auf Sven an, und es lag an Jan, diese erste Hürde zu nehmen, ohne dabei zu stolpern.
Wie immer, wenn jemand seinen Bruder erwähnte, kam es Jan so vor, als sei alles erst gestern geschehen. Jan hatte sich gut überlegt, wie er dieses heikle Thema angehen sollte. Er wusste, dass Fleischer von ihm die Wahrheit hören wollte, und dass diese Wahrheit sehr persönlich war. Jemandem, der ihn von Kindesbeinen an kannte, konnte und durfte er nichts vormachen. Dennoch hatte er sich vorgenommen, so sachlich wie irgend möglich zu antworten.
»Offen gesagt weiß ich nicht, ob ich wirklich zu einem Ergebnis gelangt bin. Ich wollte die Tat begreifen, indem ich versuchte, die Motivation des Täters zu verstehen. Jedes Jahr werden bundesweit fast zwölftausend Fälle von Kindesmissbrauch registriert, eine unfassbare Zahl, und die Dunkelziffer wird weitaus höher geschätzt. Doch ebenso unfassbar ist, dass nur etwa achtzig Prozent dieser Fälle aufgeklärt werden.«
Jan spürte, wie seine Hände zu zittern begannen. Er fühlte sich unwohler denn je. Am liebsten wäre er aufgestanden und hinausgerannt, doch das hätte das endgültige Aus für seine Karriere bedeutet. Dies war seine Chance auf einen Neuanfang - und alles, was er dafür tun musste, war, Fleischer gegenüber Ehrlichkeit zu zeigen.
Der Klinikleiter schien Jans Gedanken gelesen zu haben. Er sah ihn verständnisvoll an und nickte aufmunternd.
Jan atmete tief durch, ehe er fortfuhr. »Irgendwo in dieser Statistik befindet sich der Fall meines kleinen Bruders, von dem man nie mehr fand als seine …«, Jan schluckte, »seine Unterwäsche auf einem Autobahnparkplatz. Weder der Täter noch …«, wieder musste Jan schlucken, »noch Svens Leiche wurden je ausfindig gemacht. Und was mit meiner übrigen Familie geschehen ist, wissen Sie ja.«
Betreten sah Fleischer aus dem Fenster in den bleigrauen Himmel.
»Ja, das weiß ich. Und es tut mir alles aufrichtig leid für Sie.«
»Ich habe nach Antworten gesucht«, sagte Jan. »Also habe ich mit Sexualstraftätern gesprochen. Es waren fast ausschließlich Männer. Sie stammten aus allen Bevölkerungsschichten. Lehrer, Handwerker, Arbeitslose, Alkoholiker, Priester, einmal sogar ein Psychiater. Dabei machte ich die Beobachtung, dass alle Täter zwei Dinge gemein hatten. Einerseits hatten sich alle zu ihren Opfern hingezogen gefühlt. Sie sprachen von Liebe und inniger Zuneigung, wobei sie andererseits keinerlei Skrupel gehabt hatten, ihre Opfer aus Furcht vor Entdeckung zu töten.« Jan zuckte mit den Schultern. »Aus psychiatrischer Sicht waren bei den meisten eine starke Triebhaftigkeit und ein durchgängiges Verhaltensmuster hinsichtlich ihrer mangelnden Schuldeinsicht erkennbar, was man als Antwort hätte akzeptieren können. Doch für mich persönlich habe ich nie eine zufriedenstellende Antwort gefunden. Nicht in Svens Fall. Er ist und bleibt verschwunden.«
Nun war es heraus. Jan spürte, wie seine Anspannung ein wenig nachließ. Er hatte es endlich geschafft, über das düsterste Kapitel seines Lebens zu sprechen, auch wenn er sich dabei wie ein Referent angehört haben mochte.
»Mein Vater hat einmal gesagt, das Leben stellt uns manchmal Fragen, auf die es keine Antworten gibt«, fügte er hinzu. »Ich habe mich lange nicht damit abfinden können, aber inzwischen denke ich, dass er Recht damit hatte. Wenn Sie so wollen, ist das das Ergebnis meiner Suche.«
Für einen Moment herrschte wieder die für Jan unerträgliche Stille. Dann löste Fleischer den Blick vom Fenster und sah ihn an.
»Auf dieser Suche haben Sie sich weit vorgewagt, Jan. Das war überaus mutig, wenngleich Sie am Ende über Ihr Ziel hinausgeschossen zu sein scheinen.«
Nun waren sie also beim zweiten großen Thema angelangt: Jans Zusammenbruch. Der Grund, warum er beinahe seine Approbation verloren hatte. Davon hing nun alles ab. Fleischer die Hintergründe seines Werdegangs offenzulegen war das eine gewesen. Ob er ihn nun davon überzeugen konnte, dass er aus seinen Fehlern gelernt hatte, stand auf einem anderen Blatt.
»Vor knapp einem Jahr stand ich unter einer starken psychischen Belastung, was ich mir zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht eingestehen wollte«, erklärte Jan. »Meine Tätigkeiten als forensischer Gutachter und Stationsarzt lasteten mich völlig aus, aber ich sah darin eine berufliche Herausforderung und hatte zudem gute Chancen auf eine Oberarztstelle, die bald frei werden sollte. An manchen Tagen arbeitete ich fast rund um die Uhr. Kurz zuvor hatte meine Frau die Scheidung eingereicht, und ich hatte ihr zugesagt, mich nach einem Käufer für unsere gemeinsame Wohnung umzusehen. Als ich dann auch noch den Fall Laszinski übernahm, wurde mir alles zu viel. Leider habe ich das erst begriffen, als alles schon passiert war.«
»Laszinski«, sagte Fleischer und verzog das Gesicht. »Eine hässliche Geschichte.«
In der Tat. Der Fall Peter Laszinski hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein gefundenes Fressen für die Medien.
Bis zu seiner Verhaftung hatte der sechsundvierzigjährige Küster ein unscheinbares Leben in einer kleinen Gemeinde geführt. Er galt als höflich, wenn auch verschlossen, und die Tatsache, dass er trotz seines Alters noch immer Junggeselle war, schrieb man seiner als bösartig verschrienen Mutter zu. Laszinski hatte sie über viele Jahre aufopfernd gepflegt, und als sie vor drei Jahren ihrem Darmkrebsleiden erlegen war, gab es viele, die von einer Erlösung für den armen Peter gesprochen hatten.
Als im Januar letzten Jahres zwei kleine Mädchen aus Laszinskis Heimatort verschwunden waren, kam niemand auch nur im Entferntesten auf den Gedanken, er könnte etwas damit zu tun haben. Erst bei einem erfolgreichen Schlag gegen einen Kinderpornoring im Internet war das Bundeskriminalamt auf Laszinski aufmerksam geworden. Zwölf Tage nach dem Verschwinden der Mädchen stellte man Laszinskis Computer sicher, auf dem sich Tausende von Fotografien und Videos befanden. In einem Interview äußerte ein Pressesprecher der Behörde, die Aufnahmen dokumentierten sadistische Praktiken von unvorstellbarer Grausamkeit.
Bei einer weiteren Durchsuchung des alten Bauernhofs der Laszinskis fand man auch die beiden Mädchen im großräumigen Keller. Das eine Kind war in der Gefangenschaft gestorben, das andere hatte überlebt, schwebte aber noch lange Zeit in Lebensgefahr. Wie sich herausstellte, hatte Laszinski die Entführung von langer Hand geplant. Er hatte eigens hierfür zwei Zellen in das Gewölbe gemauert, in die er die Mädchen getrennt voneinander eingesperrt hatte.
Nach der ersten Sitzung, in der ihm Laszinski mit ungerührter Miene erzählte, was in diesem Keller vor sich gegangen war, hatte Jan ernsthaft überlegt, ob er dem Fall gewachsen war. Rückblickend wusste er, dass dies der richtige Moment gewesen wäre, den Fall abzugeben.
Was ihn dennoch veranlasst hatte, weiter mit diesem Mann zu arbeiten, war die Art des Verbrechens gewesen. Laszinski fiel nicht in das Schema der Pädophilen, mit denen Jan bis dahin zu tun gehabt hatte. Sein Handeln war nicht triebgesteuert oder spontan gewesen. Und ein inneres Gefühl sagte Jan, dass Svens vermutlicher Mörder vielleicht ähnlich gehandelt hatte.
Die Bilder, die Laszinskis Schilderungen in ihm hervorriefen, gingen Jan noch lange nach. Der Küster hatte die Mädchen nicht vergewaltigt. Abgesehen von der Entführung selbst, hatte er sie nie angerührt. Stattdessen zwang er beide, allabendlich nackt und frierend auf dem sandigen Kellerboden zu knien und das Ave Maria zu beten. Nur dann erhielten sie die - wie er es nannte - »Kommunion«: ein Glas Milch, in das er zuvor ejakuliert hatte. Anfangs hatten sie sich geweigert, aber nach ein paar Tagen hätten die Mädchen vor Hunger und Durst alles getan, hatte Laszinski behauptet, und die Gefühlskälte seiner Worte hatte Jan das Blut in den Adern gefrieren lassen.
Dennoch hatte sich Jan zu einer weiteren Sitzung mit ihm getroffen, um sein Gutachten abzuschließen. Und dabei war es zu jenem verhängnisvollen Vorfall gekommen.
Jan selbst konnte sich kaum noch an seine Raserei erinnern. Erst als ihn zwei Vollzugsbeamte gepackt und aus dem Raum gezerrt hatten, war er wieder Herr seiner Sinne gewesen.
Jan sah Laszinski, der sich heulend in einer Blutlache am Boden wand, und stellte fest, dass er selbst ebenfalls voller Blut war. Später hatte Jan erfahren, dass er unvermittelt auf den Küster losgegangen war und wie von Sinnen auf ihn eingeschlagen hatte.
Nun hoffte Jan inständig, dass Fleischer ihn nicht nach dem Grund für diesen Kontrollverlust fragen würde. Auf diese Frage hatte er keine Antwort parat.
Fleischer fragte nicht. Stattdessen nickte er Jan nur wieder aufmunternd zu.
»Nach diesem Vorfall wechselte ich meinen Wohnort«, fuhr Jan fort. »Ein Bekannter, mit dem ich seit dem Studium in Kontakt stand, bot mir an, für einige Zeit bei ihm zu wohnen. Also habe ich die letzten Monate im Allgäu verbracht. Der Abstand zu allem hat mir gutgetan. Ich fühle mich wieder stabil und möchte jetzt einen beruflichen Neuanfang unternehmen.«
Fleischer lächelte, und seine Stimme nahm einen väterlichen Ton an.
»Ich weiß nicht, wie ich mich in Ihrem Fall verhalten hätte, Jan. Nicht dass ich Ihre Handlungsweise gutheißen möchte, aber ich kann mir keinen Kollegen vorstellen, den dieser Fall kaltgelassen hätte. Berücksichtigt man noch Ihre private Belastung, empfinde ich die Haltung mancher Kollegen Ihnen gegenüber als ziemlich übertrieben. Deshalb habe ich Sie auch eingeladen. Ich finde, ein ehrgeiziger junger Arzt wie Sie hat eine zweite Chance verdient. Und damit wir uns richtig verstehen: Diese Haltung hat nichts damit zu tun, dass Ihr Vater und ich gute Freunde waren. Mein Angebot bezieht sich einzig und allein auf Ihre Leistungen.«
»Danke«, sagte Jan. »Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.«
Fleischer nickte und beugte sich dann wieder über den Tisch, wobei sein Ledersessel einen ächzenden Laut von sich gab.
»Unternehmen Sie Ihren Neuanfang hier, und wenn Sie erst einmal eine Weile in der Allgemeinpsychiatrie tätig waren, wird kein Hahn mehr danach krähen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Allerdings …«, er sah Jan eindringlich an, »allerdings knüpfe ich dieses Angebot an eine Bedingung.«
Jan hielt Fleischers Blick stand. »Und was für eine Bedingung ist das?«
Fleischer wiegte den Kopf, als wolle er seine Worte darin zurechtschütteln.
»Sehen Sie, Jan, ich kann mir nicht recht vorstellen, dass jemand, der so viele Jahre versucht, sein Kindheitstrauma zu bewältigen, nun auf einmal über alles hinweg ist. Wir sind beide lange genug in diesem Geschäft, um zu wissen, dass das nicht von heute auf morgen möglich ist.«
Jan spürte einen leichten Schauer. Natürlich hatte Fleischer Recht, aber dennoch stellten seine Worte eine gewisse Kränkung für ihn dar.
»Herr Fleischer, ich versichere Ihnen, dass ich mich wieder völlig im Griff habe. Dieser Bekannte aus Füssen, den ich erwähnte, ist ein hervorragender Psychotherapeut. Die Gespräche mit ihm waren mir eine große Hilfe, und wenn Sie mir eine berufliche Chance geben, werde ich Sie davon überzeugen.«
»Das glaube ich Ihnen gern«, entgegnete Fleischer. »Aber als Arzt und Freund rate ich Ihnen, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein langjähriger Freund und Kollege, Dr. Norbert Rauh, ist seit einiger Zeit wieder an unserer Klinik tätig. Er könnte Ihnen ein überaus erfolgversprechendes Therapieangebot machen. Selbstverständlich absolut diskret.«
Jan verstand, worauf Fleischer hinauswollte. »Das ist also die Bedingung?«
»Ich denke dabei nur an Sie, Jan«, sagte Fleischer und nickte. »Natürlich steht es Ihnen frei, mein Angebot abzulehnen, aber Sie sollten es zumindest überdenken. Ich möchte wirklich etwas für Sie tun und Ihnen nicht einfach nur einen Arbeitsplatz anbieten. Für Ihren Neuanfang bedarf es mehr, und ich denke, dies wäre auch ganz im Sinne Ihres Vaters. Hören Sie in sich hinein, dann werden Sie mir zustimmen.«
Jan sah nachdenklich aus dem Fenster. Was blieb ihm für eine andere Wahl? Konnte er Fleischers Bedingung ablehnen? Nicht, wenn er sich baldmöglichst rehabilitieren wollte. Andernfalls würde er über kurz oder lang irgendeinen Aushilfsjob annehmen und damit einen endgültigen Schlussstrich unter seine Karriere ziehen müssen. Welche Klinik würde noch einen Arzt beschäftigen, den man wegen schwerer Körperverletzung entlassen hatte und der nach längerer Auszeit sein Geld in einer Frittenbude oder bei irgendeinem Kurierdienst verdient hatte?
Abgesehen davon sah es auf seinem Konto inzwischen mehr als mau aus. Die Scheidung und der Verdienstausfall hatten den Erlös aus dem Verkauf seiner Wohnung längst aufgezehrt. Danach hatte er seine Ausgaben nur noch aus den Mieteinnahmen bestritten, die er für sein Elternhaus bekam - und das war nicht gerade die Welt, zumal er auch Rücklagen für Renovierungsarbeiten bilden musste -, ehe auch diese Einnahmequelle versiegt war.
Natürlich hätte er das Haus zum Verkauf anbieten und so die Zeit überbrücken können, bis er eine andere Stelle bekam. Bei den gegenwärtigen Immobilienpreisen in der Region Fahlenberg wäre dies allerdings eine überaus schlechte Idee gewesen.
Vor allem aber konnte Jan nicht darauf hoffen, dass er noch ein weiteres Stellenangebot bekam, das mit diesem mithalten konnte. Und vielleicht hatte Fleischer Recht. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, eine Therapie zu machen, statt nur mit einem Freund über seine Probleme zu sprechen. Es war zumindest einen Versuch wert.
»Also gut«, sagte Jan und sah, wie Fleischers Gesicht aufstrahlte. »Ich bin einverstanden. Wann kann ich anfangen?«
»Gleich am Montag, wenn es Ihnen passt.«
Als Jan wieder auf dem Parkplatz stand, sah er noch einmal zu Fleischers Bürofenster hoch. Es gab da noch eine Frage über die Vergangenheit, die er dem Professor gern gestellt hätte. Doch während ihres Gesprächs hatte er sich dagegen entschieden. Andernfalls hätte Fleischer ihm nie geglaubt, dass er mit den Geschehnissen von damals abgeschlossen hatte. Tief in seinem Innern glaubte Jan auch, dass Fleischer die Antwort nicht gewusst hätte.
Manchmal stellt das Leben Fragen, auf die es keine Antworten gibt, dachte er und stieg in seinen Wagen. Aber es gibt uns immer wieder die Möglichkeit für einen Neuanfang.
2
Nichts bleibt, wie es ist. Diese alte Weisheit kam Jan in den Sinn, als er mit seinem VW Golf - einem klapprigen 3er-Modell, das die nächste TÜV-Plakette wahrscheinlich nicht mehr erleben würde - von der Schnellstraße abbog und in Richtung Innenstadt fuhr.
Mit den Überbleibseln eines vergangenen Lebens auf der Rückbank kehrte er nun in eine noch weiter hinter ihm liegende Zeit zurück. An den Ort, an dem er ein unbeschwertes, glückliches Leben begonnen und an dem dieses Leben die schlimmste nur denkbare Wendung genommen hatte. An einen Ort, der ihm einst vertraut gewesen war und der ihm nun vollkommen fremd erschien.
Fahlenberg hatte sich verändert. In den fast zwanzig Jahren, seit Jan der Stadt den Rücken gekehrt hatte, war sie um ein beachtliches Stück gewachsen. Die ausladenden Grünflächen am Ortseingang, auf denen Jan und seine Freunde einst Fußball gespielt und sich im Winter ausgelassene Schneeballschlachten geliefert hatten, waren nun mit einer Autowaschanlage und diversen Discountern zugebaut. Die Schrebergartensiedlung mit den bunten Hütten hatte zwei gewaltigen Baumärkten weichen müssen, und auf den Feldern hinter dem Friedhof ragten jetzt mehrere Hochhäuser und Betonbauten empor.
Als Jan an einer Ampel halten musste, sah er zu den grauen Scheußlichkeiten hinüber und dachte an die erste und einzige Zigarette seines Lebens, die er dort mit seinem Freund Dieter heimlich geraucht hatte - verborgen von hohen Maisstauden, die in der Herbstsonne auf die Ernte gewartet hatten. Fünfundzwanzig Jahre musste das jetzt her sein, doch noch immer sah er alles genau vor sich. Die beiden filterlosen Roth-Händle, die Dieter seinem Vater geklaut hatte, das billige Plastikfeuerzeug, das zuerst nicht hatte funktionieren wollen, und wie sie sich die Zigaretten angesteckt und nach dem ersten Lungenzug sofort wieder ausgedrückt hatten, weil ihnen schwindlig geworden war. Jan hatte einen Hustenanfall bekommen und sich vorgenommen, nie wieder zu rauchen.
Nun stellte er fest, dass sich in einem der Betonklötze eine Spielhalle befand. Der Bau daneben - Jan glaubte seinen Augen nicht zu trauen - beherbergte ein Eros-Center namens Love Palace. Einen unpassenderen Platz hätte man für dieses zweistöckige Etablissement nicht finden können. Wer dort aus dem Fenster schaute, sah direkt auf die Leichenhalle des Friedhofs hinüber.
Daneben wies ein Schild auf das Industriegebiet hin, das sich dort ausbreitete, wo es einst nur eine Ledergerberei und eine Maschinenfabrik gegeben hatte.
Die ganze Stadt schien verändert. Markante Gebäude hatten Straßenverbreiterungen weichen müssen. Der Tante-Emma-Laden an der Hauptstraße und die alte Bäckerei daneben waren zu einem Handyladen und einem Döner-Imbiss geworden. Mehrere der ehemaligen kleinen Geschäfte standen leer. Ihre mit Tüchern oder Karton verhängten Schaufenster kamen Jan wie blinde Augen vor, als er sich seinen Weg durch den Vormittagsverkehr bahnte.
Nur hin und wieder sah er Altvertrautes. Natürlich stand die Kirche noch. Auch der Schreibwarenladen, in dem er früher seine Schulhefte gekauft hatte, war noch am selben Ort, und Jan fiel wieder ein, dass er von dem Geld, das ihm seine Mutter mitgegeben hatte, immer ein bisschen abgezweigt hatte, um sich Comic-Hefte kaufen zu können. Und den Fotografen, bei dem er einst für seine Kommunions- und Schultütenbilder posiert hatte, gab es ebenfalls noch. Bestimmt hat inzwischen der Sohn das Geschäft übernommen, dachte Jan.
Doch trotz dieser kleinen Vertrautheiten empfing ihn Fahlenberg kalt und gleichgültig. Zwar hatte Jan nicht unbedingt erwartet, mit offenen Armen empfangen zu werden - dafür war einfach zu viel Zeit ins Land gegangen -, aber er hatte zumindest gehofft, etwas zu empfinden, was bei einem Menschen einem erkennenden Kopfnicken gleichgekommen wäre.
Der Eindruck der Fremdartigkeit wich erst, als Jan die Abzweigung zum Stadtpark nahm, die in ihrem weiteren Verlauf zu seiner alten Heimat führte. Je näher Jan seinem ehemaligen Elternhaus kam, desto vertrauter wurde alles. Hier sah noch vieles wie früher aus. Noch immer wirkte der Stadtpark groß und weitläufig. Durch das Geäst der kahlen Bäume schimmerte die novembergraue Fläche des Fahlenberger Weihers.
Jan versuchte, nicht in diese Richtung zu sehen und sich nur an die angenehmen Dinge zu erinnern, die er mit Park und Weiher in Verbindung brachte. Er versuchte, sich den Kiosk vor Augen zu rufen, an dem er und seine Freunde im Sommer Eis und Limonade gekauft hatten, wenn sie an den Weiher zum Baden gekommen waren.
Dennoch spürte er eine Gänsehaut, denn da waren noch andere, stärkere Erinnerungen.
Als Jan schließlich sein Ziel erreicht hatte und aus dem Wagen stieg, kam er sich vor wie der Zeitreisende in H. G. Wells’ Roman. Er hatte das surreale Gefühl, diesen Ort nie wirklich verlassen zu haben, sondern lediglich ein Stück in die Zukunft gereist zu sein.
Der Eindruck, sich in einem seltsamen Traum zu bewegen, hielt noch an, als er an Rudolf Marenburgs Gartentor angekommen war. Gleich gegenüber befand sich das Haus der Forstners, in dem bis vor kurzem ein altes Ehepaar zur Miete gewohnt hatte. Vor wenigen Monaten war der Mann gestorben, woraufhin die Frau in ein Seniorenheim gezogen war. Das Haus befand sich noch immer in tadellosem Zustand, stellte Jan fest. Hin und wieder hatte er geträumt, es wäre irgendeiner Katastrophe oder einem Brand zum Opfer gefallen, und jedes Mal, wenn er danach erwacht war, hatte er eine morbide Form der Erleichterung verspürt.
Dieses Haus hatte so viel Leid gesehen, dass Jan davon überzeugt war, es müsse einen Teil davon für alle Zeiten in seinen Mauern gespeichert haben. Jan würde sein Elternhaus nie wieder betreten können, das stand für ihn fest. Aber jetzt, wo er ihm zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder gegenüberstand, fragte er sich trotzdem, wie sehr es sich wohl im Inneren verändert haben mochte. Ob es noch immer so roch wie in seiner Kindheit - nach getoastetem Brot, nach dem Putzmittel mit Zitronenduft, das seine Mutter stets großzügig verwendet hatte, und nach der Holzpolitur des Treppengeländers? Jene Gerüche, die Jan so vertraut gewesen waren, dass er diesen anderen, fremdartigen Geruch nicht wahrgenommen hatte - damals, in jenem Sommer, als er übers Wochenende nach Hause gekommen und die Treppe hinaufgelaufen war. Als er …
»Jan?«
Die Stimme riss ihn aus seinen Erinnerungen. Jan wusste, dass es der alte Marenburg war, noch ehe er sich nach ihm umgedreht hatte. Die kehlige und ungewöhnlich hohe Stimme war unverkennbar. Rudolf Marenburg litt unter einer angeborenen Anomalie der Stimmbänder, weshalb sich die Kinder im Ort über ihn lustig gemacht hatten. Sie hatten ihn Kermit genannt, weil er klang wie der Frosch in der Muppet Show.
Marenburg hatte es den Kindern nicht übelgenommen - zumindest hatte er nie geschimpft oder sie zum Teufel gejagt. Im Gegenteil, nach all den schlimmen Dingen, die Jan und seiner Familie widerfahren waren, blieb Marenburg über die Jahre hinweg sein zuverlässiger, väterlicher Freund. Er hatte ihm den Rücken freigehalten, indem er sich um die Vermietung des Hauses und die anfallenden Reparaturen kümmerte, weil er wusste, wie dringend Jan den Abstand von seinem ehemaligen Zuhause gebraucht hatte. Mehrmals hatte Marenburg versucht, das Haus zu verkaufen, es dann aber wieder aufgegeben, immer mit der Begründung, bei den derzeitigen Immobilienpreisen wäre es ein Verlustgeschäft.
Jan vermutete aber auch, dass Marenburg es vielleicht nicht ganz so ernst mit seinen Verkaufsbemühungen genommen hatte. Denn dadurch hätte er für Jan auch das letzte Verbindungsstück nach Fahlenberg gekappt - und somit zu sich. Umso mehr hatte er sich über Jans Anruf gefreut, als dieser seine Rückkehr ankündigte, und es war für ihn eine Ehrensache gewesen, dass Jan die erste Zeit bei ihm wohnen würde, bis er etwas Geeignetes gefunden hatte.
Vielleicht verändert sich doch nicht alles mit der Zeit, dachte Jan, als er seinen Freund auf sich zukommen sah.
Natürlich war auch Marenburg älter geworden, hatte deutlich mehr Falten als früher, und seine einstmals roten Haare waren längst schlohweiß, aber seine äußerliche Aufmachung entsprach noch immer dem Bild, das Jan von ihm in Erinnerung hatte: eine ausgebeulte braune Cordhose, dazu ein helles Flanellhemd mit hochgekrempelten Ärmeln und Filzpantoffeln.
Es war ein herzliches Willkommen, und als ihn Marenburg an sich drückte, konnte Jan dasselbe strenge Rasierwasser riechen, das ihn schon vor über zwanzig Jahren umhüllt hatte.
»Schön, dass du wieder da bist, Junge«, sagte Marenburg und sah Jan prüfend an. Dann nickte er in Richtung des Forstner-Hauses. »Ich habe beobachtet, wie du es dir angesehen hast. Es war, glaube ich, der gute alte Cicero, der einmal gesagt hat, es sei die sorgenfreie Erinnerung an vergangenen Schmerz, die uns Frieden bringt.«
Jan sah noch einmal zum Haus, dann zuckte er mit den Schultern. »Der hatte leicht reden. Er musste ja nicht darin leben.«
Marenburg grinste. »Na komm, jetzt bringen wir erst mal deine Sachen rein, und dann musst du mir alle Neuigkeiten erzählen. Bis ins kleinste Detail.«
Das Gefühl, in die Zukunft gereist zu sein, verflüchtigte sich schlagartig, als Jan das Haus betrat. Hier herrschte noch immer der Einrichtungsstil von einst. Im Flur empfingen ihn eine wuchtige Garderobe aus Kirschbaumholz, daneben ein gerahmtes Bild, das einen röhrenden Hirsch vor einem Bergsee zeigte, und zu allem Überfluss bewachte eine hölzerne Nachtwächterstatue mit Laterne das Telefonkästchen, auf dem ein uralter Wählscheibenapparat mit samtigem Schonbezug stand.
Jan folgte Marenburg über die teppichbezogenen Stiegen in den ersten Stock, wo Marenburg ein Zimmer für ihn vorbereitet hatte. Als Jan sah, in wessen Raum er in den nächsten Wochen wohnen sollte, beschlich ihn ein beklemmendes Gefühl. Zwar deuteten nur noch ein Regal voller Kinder- und Jugendbücher und ein Poster an der Wand auf die ehemalige Bewohnerin hin, aber für einen kurzen Moment hatte Jan den Eindruck, als sei Alexandras Geist noch immer anwesend.
»Ich hoffe, das stört dich nicht.«
Marenburg deutete auf das Poster über dem Bett. Es zeigte einen jungen David Bowie, dem ein roter Blitz übers Gesicht gemalt war. Darunter standen die Worte Aladdin sane, und Jan fiel das darin verborgene Wortspiel auf: A lad insane, ein verrückter Kerl.
Marenburg machte eine hilflose Geste. »Weißt du, sie war ganz vernarrt in diesen Kerl. Irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, es abzuhängen. Na ja, ich beziehe auch jede Woche ihr Bett neu, obwohl du seit vielen Jahren der Erste bist, der darin schläft. Ihr Psychiater habt bestimmt eine Erklärung für so etwas, oder?«
»Dazu muss man kein Psychiater sein, Rudi«, sagte Jan und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Nicht, wenn es um Liebe geht.«
Marenburg wich Jans Blick aus und ging zur Tür. »Schön, dich hierzuhaben, Junge. Jetzt komm erst einmal in Ruhe an, und dann feiern wir deine neue Stelle mit einem leckeren Essen. Ich hoffe, du magst noch gute alte Hausmannskost?«
»Na klar.«
Marenburg verschwand auf dem Gang, und gleich darauf knarrten die Treppenstufen, als er sich auf den Weg zur Küche machte. Jan seufzte und nahm sich vor, gleich morgen mit der Wohnungssuche zu beginnen. So gern er Rudi mochte, war dies hier wirklich nur eine Übergangslösung und keinesfalls der richtige Ort für einen Neuanfang.
Er besah sich noch einmal den verrückten Kerl auf dem Poster, den Alexandra so vergöttert hatte, und trat dann ans Fenster. Es war ein seltsames Gefühl, aus diesem Fenster auf sein Elternhaus zu blicken.
Vor mehr als dreiundzwanzig Jahren hatte er häufig und lange von seinem Zimmer aus zu diesem Fenster hinübergesehen. Vor allem abends, wenn in dem Zimmer, in dem er nun stand, Licht gebrannt hatte und der Rollladen noch nicht heruntergelassen war. Dann hatte er Alexandra Marenburg beobachtet, die sechs Jahre älter als er gewesen war. Er hatte ihr zugesehen, wie sie an ihrem Tisch gesessen und gelesen oder gezeichnet hatte. Manchmal hatte sie dabei Kopfhörer auf und starrte mit entrücktem Blick zur Decke. Damals hatte er gerätselt, was sie sich anhörte, welche Art von Musik sie mochte. Jetzt stellte er sich vor, wie sie sich von David Bowie in die Welt des verrückten Kerls hatte entführen lassen - eine Welt, in der Verrückte wie sie etwas ganz Normales waren.
Jans Vater hatte den Ausdruck verrückt nicht gemocht, für ihn waren diese Menschen psychisch krank gewesen. Er hatte Alexandra mehrmals behandelt, das hatte Jan gewusst. Doch für Jan war sie weder verrückt noch psychisch krank gewesen. Für ihn war sie eine hübsche junge Frau gewesen, mit langen dunklen Haaren, traurigen Augen und einer geheimnisvollen Aura.
Die Faszination, die er für sie empfunden hatte, ließe sich heute wahrscheinlich als eine Art frühpubertärer Schwärmerei erklären. Er war nicht verliebt oder - wie man als Teenager sagte - verknallt in sie gewesen, vielmehr hatten ihn ihre unnahbare, fast schon mysteriöse Ausstrahlung und die Anmut ihrer scheuen Bewegungen in ihren Bann gezogen, wenn er sie heimlich durchs Fenster beobachtet hatte oder bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er ihr auf der Straße begegnet war.
Doch dann war jene Nacht gekommen, in der diese Schwärmerei ein abruptes Ende genommen hatte.
Ihm wurde kalt, als er daran dachte. An jene Nacht, in der das Unheil seinen Lauf genommen hatte.
3
Freitag, II. Januar 1985
Es war noch dunkel, als Jan durch das Klingeln des Telefons im Erdgeschoss geweckt wurde. Er hatte einen merkwürdigen Traum gehabt - von Blättern, aus denen man Stücke herausgeschnitten hatte, und von Kirlianfotografien, auf denen diese Blätter von einer geheimnisvollen Korona umgeben waren, die sie wieder unversehrt erscheinen ließ. Darüber hatte er in einem Buch über rätselhafte Phänomene gelesen, das er sich zu Weihnachten gewünscht hatte. Einem Buch voller spannender Themen für einen fantasiebegabten Zwölfjährigen: Spukerscheinungen, UFOs, Kornkreise und noch vieles mehr.
Es war ein interessanter Traum gewesen. Umso mehr ärgerte sich Jan über das permanente Klingeln auf dem Flur.
Der Wecker zeigte 4:48 Uhr an, als Jan gähnend aus dem Bett kletterte und auf den Gang hinausschlurfte. Wie immer musste er über Rufus steigen, der vor seiner Tür am Boden lag. Der alte Golden Retriever öffnete zuerst nur ein Auge, als wolle er abschätzen, ob es sich lohnte, auch das zweite zu öffnen, dann schien er neugierig geworden und trottete Jan hinterher.
Gerade als Jan die Treppe erreicht hatte, huschte sein Vater aus dem Schlafzimmer. Bernhard Forstner trug einen blauen Pyjama mit dunklen Streifen - ebenfalls ein Weihnachtsgeschenk -, über sein Gesicht zog sich eine rote Schlaffalte, und das Haar stand ihm wild vom Kopf ab.
»Geh wieder ins Bett«, flüsterte er und eilte an Jan vorbei. »Wird ohnehin für mich sein.«
»Kannst du denen in der Klinik nicht mal sagen, dass wir in den Ferien ausschlafen wollen?«, maulte Jan ihm hinterher, doch sein Vater hatte bereits den Hörer abgenommen.
Längst hatte sich Jan mit den nächtlichen Rufbereitschaften seines Vaters abgefunden. Sie gehörten eben zu seinem Beruf. Nur eines nervte ihn nach wie vor: Wenn er erst einmal wach war, war er wach. Einfach wieder zurück ins Bett gehen und weiterschlafen funktionierte bei ihm nicht.
Jan beneidete seine Mutter, die das ohne Probleme konnte, und sein kleiner Bruder Sven ebenso. Sven brachte es sogar fertig, im Wohnzimmersessel einzupennen, wenn ein spannender Film im Ferienprogramm gezeigt wurde.
»Du bist eben ein nervöses Hemd«, pflegte seine Mutter zu sagen, und Jan hasste diesen Satz. Es hörte sich so schreckhaft an, so als ob er sich beim kleinsten »Buh!« in die Hosen machen würde. Dabei hatte er doch nur eine lebhafte Fantasie, wie es sein Klassenlehrer einmal ausgedrückt hatte. Eine lebhafte Fantasie, um die ihn manch einer beneiden würde, und Jan hatte gedacht: Mag ja sein, aber für den Rest bin ich das nervöse Hemd - der, den man leicht erschrecken kann, was ja immer sooo komisch ist, ha-ha.
Nun stand das nervöse Hemd am Treppenabsatz, streichelte Rufus’ Kopf und sah seinem Vater beim Telefonieren zu.
Es musste sich um etwas Ernstes handeln, das stand Bernhard Forstner deutlich ins Gesicht geschrieben. Oft genügte nur eine kurze Anordnung an das Pflegepersonal, dann war die Sache bis zum Morgen erledigt und Forstner konnte in sein Bett zurückkehren. Doch diesmal war es anders.
Statt dem obligatorischen »Dann verabreichen Sie am besten den Bedarf« oder einem »Notfalls müssen Sie fixieren« stieß Bernhard Forstner ein »Komme sofort« aus, knallte den Hörer auf die Gabel und eilte zurück ins Schlafzimmer.
»Was ist denn los?«, fragte eine verschlafene Stimme hinter Jan.
Sven lugte aus seinem Zimmer. Er trug seinen heißgeliebten He-Man-Schlafanzug und rieb sich die Augen.
»Paps muss zur Arbeit«, erklärte Jan. »Schlaf weiter.«
Sven nickte nur und verschwand wieder hinter der Tür.
Auch Jan ging wieder in sein Zimmer, ließ sich aufs Bett plumpsen und starrte missmutig auf das Duran-Duran-Poster an seinem Kleiderschrank.
»Toll«, sagte er zu Rufus, der ihm hechelnd gefolgt war, »jetzt bin ich wach, und es ist noch nicht mal fünf.«
Keine zwei Minuten später war Bernhard Forstner aus dem Haus. Jan hörte noch das Brummen des Motors, als sein Vater aus der Hofeinfahrt fuhr.
»Und was mache ich jetzt?«
Wie um Jan diese Frage zu beantworten, setzte sich Rufus vor ihn und sah ihn mit erwartungsvollem Gassi-Blick an.
Jan hob kapitulierend die Hände. Also gut, dachte er. Dann würde er jetzt eben mit Rufus Gassi gehen. Vielleicht war er danach wieder müde genug, um noch einmal ins Bett zu fallen und bis zum Mittagessen durchzuschlafen. Immerhin war dies der vorletzte Ferientag, und den wollte er auskosten. Dafür waren die Ferien schließlich da.
Das Haus der Familie Forstner lag am östlichen Stadtrand, und bis zum Fahlenberger Park waren es nur ein paar Gehminuten.
Rufus zerrte erwartungsvoll an der Leine, und Jan stapfte ihm durch den Schnee hinterher. Die letzten Tage waren sonnig gewesen, und es war kaum Neuschnee gefallen, doch die Nächte fielen eisig aus. Das Thermometer neben dem Hauseingang hatte neun Grad unter null angezeigt, aber der frostige Nachtwind erweckte den Eindruck, als sei es noch wesentlich kälter.
Einsam und verlassen empfing sie der Park im orangefarbenen Licht der Natriumdampflampen. Bäume und Büsche warfen lange Schatten auf den gefrorenen Boden, und über allem lag winterliche Stille.
Im Gegensatz zu Jan, der sich in einen dicken Steppanorak
Copyright © 2010 by Wulf Dorn
Copyright © 2010 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Heiko Arntz
Herstellung und Layout: Helga Schörnig
eISBN : 978-3-641-04859-4
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de