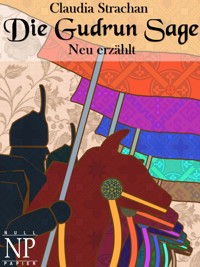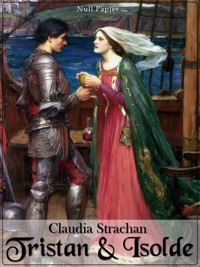
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Frisch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer hat nicht von Tristan und Isolde gehört? Eine der ältesten Liebesgeschichten, die wir kennen, doch was passiert eigentlich? Diese Nacherzählung hält sich strikt an die mittelalterliche Urfassung Gottfrieds von Straßburg, lässt sich aber so leicht lesen wie ein historischer Roman. Lassen Sie sich ins sechste Jahrhundert entführen und folgen Sie der tragischen Legende, in der zwei Menschen um ihre verbotene Liebe kämpfen. Auszug: Isolde fischte wie jeden Abend die Zweige aus dem Wasser, prüfte, ob sie auch Tristans Zeichen trugen, und machte sich sofort auf den Weg. Ihr Herz hüpfte vor Freude. Sie hatten noch mindestens zwei Tage, vielleicht konnten sie sich sogar dann noch an der Quelle treffen, wenn Mark wieder zurück war. Schon konnte sie den Baum sehen, am liebsten wäre sie gerannt. Ihr Körper ächzte vor Sehnsucht nach Tristans Zärtlichkeiten. Dann aber stutzte sie. Er stand so still! Sonst war er immer auf sie zugekommen, hatte ihren Namen geraunt, die Arme ausgebreitet. Heute Nacht stand er dort wie angewurzelt, stocksteif. Das war nicht normal. Vielleicht sollte es ein Zeichen sein? Wurden sie beobachtet? Die Neuerzählung macht die Geschichte nachvollziehbar und leicht lesbar – ein Lesevergnügen für alle, die sich für die Grundfesten unserer Kultur interessieren. Die Autorin lebt seit 1993 in England. 2009 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, "Mrs Mahoney's Secret War", das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Strachan
Tristan und Isolde
neu erzählt
Claudia Strachan
Tristan und Isolde
neu erzählt
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954186-73-0
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Personenverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nachwort
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Tristan und Isolde -- Neu erzählt
Wer hat nicht von Tristan und Isolde gehört? Eine der ältesten Liebesgeschichten, die wir kennen, doch was passiert eigentlich? Diese Nacherzählung hält sich strikt an die mittelalterliche Urfassung Gottfrieds von Straßburg, lässt sich aber so leicht lesen wie ein historischer Roman. Lassen Sie sich ins sechste Jahrhundert entführen und folgen Sie der tragischen Legende, in der zwei Menschen um ihre verbotene Liebe kämpfen.
Isolde fischte wie jeden Abend die Zweige aus dem Wasser, prüfte, ob sie auch Tristans Zeichen trugen, und machte sich sofort auf den Weg. Ihr Herz hüpfte vor Freude. Sie hatten noch mindestens zwei Tage, vielleicht konnten sie sich sogar dann noch an der Quelle treffen, wenn Mark wieder zurück war. Schon konnte sie den Baum sehen, am liebsten wäre sie gerannt. Ihr Körper ächzte vor Sehnsucht nach Tristans Zärtlichkeiten. Dann aber stutzte sie. Er stand so still! Sonst war er immer auf sie zugekommen, hatte ihren Namen geraunt, die Arme ausgebreitet. Heute Nacht stand er dort wie angewurzelt, stocksteif. Das war nicht normal. Vielleicht sollte es ein Zeichen sein? Wurden sie beobachtet?
Personenverzeichnis
*
Blancheflûr: Tristans Mutter, Schwester König Marks. Verliebt sich in Riwalîn. Stirbt bei der Geburt ihres Sohnes.
Brangaene: Isoldes Verwandte und engste Vertraute, die am irischen Hof erzogen wurde. Tut alles, um Tristan und Isolde zu helfen.
Curvenal: Tristans Lehrer und treuer Begleiter.
Floraete: Frau von Rual. Adoptiert Tristan.
Gormund: Isoldes Vater, König von Irland, dem Cornwall zu Tribut verpflichtet ist.
Isolde: Irische Königstochter, wunderschön, aber sehr eigenwillig.
Isolde: Isoldes Mutter, Frau von Gormund und Königin von Irland. Sehr gewandt in Heilkünsten.
Isolde mit den weißen Händen: Eine weitere Isolde, die später in der Geschichte auftaucht.
Jovelin: Herzog von Arundel, Vater von Isolde mit den weißen Händen.
Kâedîn : Jovelins Sohn, Bruder von Isolde mit den weißen Händen.
Mark: König von Cornwall und England, wohnhaft auf der Burg Tintagel.
Marjodo: Marks Truchsess, der als erster von Tristan und Isoldes Verhältnis erfährt und seinen Herrn warnt.
Melot: Vertrauter König Marks. Beherrscht die Kunst, in den Sternen zu lesen. Spioniert Tristan und Isolde nach.
Morold: Isoldes Onkel, gefürchteter irischer Landesfürst. Treibt für den König den Zins ein, den Cornwall an Irland zahlen muss.
Riwalîn: Tristans Vater, Fürst von Parmenien, wohnhaft auf der Burg Kanoel. Abenteuerlust treibt ihn nach Cornwall, wo er sich in Blancheflûr verliebt.
Rual li Foitenant: Riwalîns treuer Marschall, Floraetes Mann. Adoptiert Tristan.
Tristan: Sohn von Blancheflûr und Riwalîn, Neffe von Mark. Von Floraete und Rual wie ihr eigener Sohn erzogen. Hochgebildeter Ritter, dem alles zu gelingen scheint.
1.
Tintagel sah noch beeindruckender aus, als man es ihm berichtet hatte. Hoch oben auf den Klippen thronte es, zugänglich nur über einen steilen, schmalen Weg, der den Pferden den Schweiß in die Flanken trieb. Es muss unmöglich sein die Burg zu überfallen, dachte Riwalîn mit einer Mischung aus Neid und Respekt. Von Land aus erreichte man sie nur über diesen schmalen Pfad, der direkt zum Tor führte, es gab keine andere Möglichkeit. Tief unter der Burg tobten die Wellen; das Brausen der Brandung donnerte bis hierher. Niemand würde sich unentdeckt auf dem Seeweg nähern können.
»Fürst Riwalîn Kanelengres aus Parmenien«, kündigte sein Knappe ihn an. Der schwere Torbalken wurde zur Seite geschoben, um Riwalîn mit seinen zwölf Gefährten Einlass zu gewähren. Auf dem Hof herrschte reges Treiben, überall wurde gearbeitet und geredet, hier wurde ein Karren repariert, dort ein Stein behauen, durch ein offenes Tor konnte man den Schmied bei der Arbeit sehen, der gerade einen Helm mit hoher Kunstfertigkeit bearbeitete, während ein Knecht dabei war, Sensen zu schleifen. Riwalîn sah sich anerkennend um. Es war eine gute Entscheidung gewesen, Mark von Cornwall zu besuchen, befand er.
Mit Schwung stieg er vom Pferd und warf seinem Knappen die Zügel zu. Seine Vasallen taten es ihm nach, und noch bevor der letzte von ihnen abgestiegen war, kam Mark ihnen bereits entgegen. Er war wesentlich jünger, als Riwalîn es sich vorgestellt hatte, nicht viel älter als er selbst. Dennoch strahlte er eine so natürliche Achtung aus, dass sich jeder geschmeichelt fühlte, dem er seine Aufmerksamkeit schenkte.
»Seid gegrüßt, Riwalîn von Parmenien«, sagte Mark mit ausgebreiteten Armen. Sie klopften sich gegenseitig auf die Schultern und gingen in die Burg, um den Willkommenstrunk einzunehmen.
»Was führt Euch zu mir? Ihr habt einen langen Weg zurückgelegt.« Riwalîn nickte. »Nichts anderes als Euer Ruf, Mark von Cornwall. Nach dem, was ich gehört habe, liegt es mir sehr am Herzen, bei Euch meine ritterlichen Fähigkeiten zu vervollkommnen.« Mark strich sich geschmeichelt über den Bart. Bis ins Frankenland war also sein Ruf gedrungen, das würde ihm bei Freund und Feind entsprechenden Respekt einbringen. »Eure Burg sieht aus, als könnte sie niemand überfallen. Meine eigene Festung liegt auch an der Küste, aber so uneinnehmbar wie Eure ist sie nicht. Wenn Eure Kampffähigkeiten so beeindruckend wie Eure Burg sind, kann ich viel von Euch lernen«, fuhr Riwalîn fort. »Es hat auch noch niemandem geschadet, die Sitten und Gebräuche eines anderen Landes kennenzulernen.«
»Dann sollt Ihr bei mir willkommen sein, solange Ihr bleiben wollt«, war Marks Antwort. »Wir werden in Kürze ein Fest halten, wie immer im Mai, mit Kämpfen und Unterhaltung, von dem Du noch lange sprechen wirst.« Er wies seinen Gästen die besten Schlafplätze an und sandte Botschaft an seine Vasallen, um sie zum Fest zu bitten. Riwalîn hätte sich seinen Besuch nicht besser ausmalen können. Schon bald trafen die ersten Landesfürsten mit ihrem Gefolge ein, stattliche Ritter und die schönsten Damen, die er je gesehen hatte, strömten nach Tintagel.
Das Maifest sollte traditionsgemäß auf dem Festland gehalten werden, und überall wurden eifrige Vorbereitungen getroffen. Unterkünfte, Essen, Kampfbahnen und kostbarste Kleidung wurden herangeschafft. Fast täglich legte ein Schiff an der geschützten Südostseite der Felseninsel an, deren Ladung auf Booten an Land gebracht wurde. Riwalîn staunte über den Überfluss seines Gastgebers. Wein, Öl und Gewürze kamen den ganzen Weg von Byzanz, zusammen mit Seidenstoffen, die eine noch viel längere Reise hinter sich hatten. »Wie bezahlt er das alles?«, fragte er erstaunt den Kämmerer. Der tippte sich vielsagend an die Nase. »Zinn. Jeder braucht es, und wir graben es schon von alters her aus.« Davon hatte Riwalîn gehört, sah aber erst jetzt, welche Reichtümer daraus entstanden. Vor seinen Augen verwandelte sich der grüne Hügel unweit der Burg in die größte Festwiese, die er jemals erblickt hatte. Hütten und Zelte wurden aufgebaut, Kampfbahnen abgesteckt und Koppeln eingezäunt, Feuerholz wurde gebracht und enorme Mengen von Stroh und Decken aufgehäuft. Und er sollte Ehrengast sein!
Während mehr und mehr Gäste eintrafen, kam auch der Frühling mit Sang und Klang. Die Sonne schien immer öfter durch die grauen Regenwolken, der Wind hatte an Schärfe verloren und wenn er einmal nachließ, spürte man bereits eine sommerliche Wärme. Das Wetter war wesentlich milder hier, bereits jetzt schlugen selbst die letzten Bäume aus, standen die Wiesenblumen in voller Blüte und die Vögel sangen um die Wette. Die Stimmung war dementsprechend, überall wurde angeregt gesprochen und gelacht, gespielt, gesungen und getanzt. Wer nicht mitmachen wollte, der schaute sich das Spektakel an, niemandem fehlte es an Unterhaltung.
Riwalîn zog mit seinen Gefährten über die riesige Festwiese. Nachdem sie hier und da stehen geblieben waren, um ein Gespräch zu führen, wandten sie sich der Musik zu. Die besten Spielmänner waren gekommen und es wurde so ausgelassen getanzt, dass man kaum seine Augen abwenden wollte, wenn man sich dem Essen und den Getränken widmete. Die Frauen sahen so schön aus, als wären sie ausnahmslos königlicher Herkunft, allein ihre Gewänder mussten ein Vermögen gekostet haben.
Als Riwalîn sie bewunderte, blieb seine Aufmerksamkeit plötzlich an einer jungen Frau hängen, die an Marks Seite stand. Ihre Schönheit, mit dem weißen Gesicht und den wallenden, rotbraunen Haaren, stellte sogar die der Tanzenden in den Schatten. Sie hatte sich Mark zugewandt, der gerade eine Bemerkung gemacht hatte, die sie zum Lachen brachte. Ihre Augen strahlten dabei, und sie warf den Kopf so unbeschwert in den Nacken, dass ihre Fröhlichkeit selbst auf die Entfernung hin ansteckte, dabei hatte Riwalîn noch nicht einmal die Bemerkung gehört. Neugierig näherte er sich.
»Blancheflûr, meine Schwester«, stellte Mark ihm das schöne Mädchen vor. Riwalîn verneigte sich und wurde selbst vorgestellt. Mein Gott, dachte Riwalîn, sie ist so bezaubernd, dass man ihren Anblick nie wieder vergessen kann. »In meinem Land bedeutet Euer Name ›weiße Blume‹. Man hat ihn sehr treffend gewählt«, sagte er charmant. Blancheflûr errötete und senkte verlegen die Augen, lugte aber sofort wieder von unten herauf, und Riwalîns Herz schwoll in diesem Moment auf seine doppelte Größe an. Er hatte kein Interesse mehr daran sich von Marks Seite zu entfernen, solange Blancheflûr ihm Gesellschaft leistete, doch wurden gerade die Kampfspiele ausgerufen und so nahm er bedauernd seinen Abschied und mischte sich unter die Männer.
Riwalîn hatte sich erhofft, viele neue Kampftechniken zu lernen, denn das war einer der Hauptgründe, warum er die Reise nach Cornwall angetreten hatte. Er beobachtete die mächtigen Landesfürsten mit ihrem jeweiligen Gefolge, die sich um den Kampfplatz scharten. Wie sie alle gekleidet sind, dachte Riwalîn kopfschüttelnd. So viele kostbare Stoffe hatte er noch nie zur gleichen Zeit an einem Ort gesehen; auch die Pferde hatte man in Brokat und Seide gehüllt, in allen Farben des Regenbogens, und sie mit den üppigsten Verzierungen herausgeputzt. Riwalîn war nicht der einzige, der tief beeindruckt war, auch bei den Damen konnte man Bewunderung erkennen. Überall steckten sie die Köpfe zusammen, flüsterten miteinander, kicherten und ließen vielsagende Blicke schweifen. Endlich ging es los.
Riwalîn war heftige Zweikämpfe bei Ritterfesten gewohnt, doch was sich ihm hier bot, kam einer wirklichen Schlacht nahe. So mancher Ritter erlitt schwere Verwundungen, auch wenn es nur darum ging, Gefangene zu nehmen und sie für ein entsprechendes Lösegeld wieder laufen zu lassen. Wer nicht bezahlen konnte oder wollte, der verpflichtete sich mit seiner Treue und Untergebenheit dem Sieger. Das Wort eines Ritters stand in hoher Achtung, einmal gegeben, wirkte es wie ein Eid. So sammelten die besten Ritter auch die meisten Lösegelder oder Gefangenen, und Riwalîn hatte schon bald die Führung übernommen. Schließlich wollte er seinem Gastgeber zeigen, dass dieser nicht irgendeinen hergelaufenen Ritter bei sich aufgenommen hatte, sondern Kanelengres persönlich.
Bei den Franken hatte sich Riwalîn, trotz seiner Jugend, einen gefürchteten Namen gemacht. Schon als junger Ritter war er ohne Angst und Nachsicht gegen seine Feinde vorgegangen, doch sein Feldzug gegen Herzog Morgan hatte sein Ansehen gesichert, oder auch seinem Ruf geschadet, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtete. Als Herrscher von Parmenien hatte er Morgan Gefolgschaft geschuldet, doch eines Tages war er gegen den Herzog in den Krieg gezogen, indem er ohne erdenklichen Grund in sein Land einfiel und begann, seine Städte und Güter in Schutt und Asche zu legen.
Morgan ließ sich das natürlich nicht einfach so bieten. Er setzte Riwalîn sein Heer entgegen und verwickelte ihn in heftige Kämpfe. Dennoch gelang es Riwalîn immer wieder ihn zurückzuschlagen, auch wenn er dabei hohe Verluste erlitt. Sein Heer legte alles in Brand, was es zuvor ausgeraubt hatte, und von Riwalîns Kriegsführung wurde viel gesprochen: während er Morgans Burgen und Städte belagerte, veranstaltete er Ritterspiele und Turniere direkt vor ihren Toren. Schließlich hatte sich Riwalîn Geld und Gut, Burgen und ganze Städte des Herzogs angeeignet. Es war schwierig gewesen, doch nach langem Hin und Her, Siegen und Verlusten hatte Riwalîn schließlich die Oberhand gewonnen und Herzog Morgan dazu gebracht, sich zu einer einjährigen Waffenruhe überreden zu lassen. Der Handel wurde mit gegenseitigen Schwüren bekräftigt und man gab einander Geiseln, um das Einhalten des Friedens zu sichern. Riwalîns Vasallen wurden großzügig belohnt und in Ehren zu ihren Ländern zurückgeschickt.
Friede war für den jungen, stürmischen Riwalîn jedoch nicht ereignisreich genug. Er wollte kämpfen, sein Gut, seine Länder und seinen Ruhm vergrößern, er wollte ein Ritter sein, von dem die Welt sprechen würde. Dazu gehörte, andere Länder und Sitten kennenzulernen und vor allem, sich ritterliche Fähigkeiten anzueignen, die sonst niemand hatte oder gar kannte. Als er dann vom mächtigen König Mark von Cornwall hörte, war sein Beschluss gefasst. Der Mann, der die befeindeten Fürsten und Könige Cornwalls und Englands dazu gebracht hatte, sich unter seiner Schirmherrschaft zu einigen, musste an Macht und Ansehen kaum zu übertreffen sein. Er würde nach England fahren, um an Marks Hof seine Ritterlichkeit zu vervollkommnen.
Während seiner Abwesenheit würde ihn sein treu ergebener Marschall, Rual li Foitenant, nach bestem Gewissen vertreten, davon war er überzeugt. Rual kannte bereits die spontanen Ideen seines Herrn und wusste, dass jeglicher Versuch ihn umzustimmen zwecklos war. Wenn Riwalîn einmal ein Vorhaben im Kopf hatte, dann wurde es ohne Wenn und Aber ausgeführt. Vielleicht würde sich sein junger Herr ja auf der Reise etwas die Hörner abstoßen und tatsächlich um einige ritterliche Fertigkeiten reicher. Zumindest das Erlernen feiner Sitten konnte ihm durchaus nicht schaden. So wurde ein Schiff mit allem beladen, was Riwalîn und seine auserwählten Gefährten für ein Jahr benötigen würden, und die Fahrt nach Cornwall angetreten.
Jetzt, auf dem festlichen Kampfplatz, fühlte sich Riwalîn voll in seinem Element. Wie gewohnt schlug er ohne Furcht und Zögern zu, und schon bald wurde er zum beliebten Favoriten des Publikums. Das Schlachtfeld wogte einmal in diese, einmal in jene Richtung, bis es schließlich in die Nähe Blancheflûrs getrieben wurde, die mit ihren Gefährtinnen auf eigens dafür hergerichteten Sitzen zuschaute.
Die Damen konnten ihre Blicke kaum von Riwalîn abwenden. Sein Schwert und Schild schienen mit ihm verwachsen zu sein, so schnell und geschickt ging er damit um. »Und wie er aussieht! Ist er nicht das Bild eines Mannes? So hochgewachsen, so gutaussehend! Wie er die Haare trägt und wie gut ihm seine Kleider stehen!« Blancheflûr hörte dem schwärmerischen Raunen ihrer Gefährtinnen zu und biss sich auf die Lippen, um nicht lauthals mit einzustimmen. Es musste ja niemand wissen, dass sie diesen fremden Ritter ebenfalls bewunderte; die Schwester des Königs ließ sich nicht so einfach hinreißen. Doch auch sie konnte ihre Augen nicht von ihm lösen. Mit hocherhobenem Kopf und wahrhaft königlicher Haltung drehte und wand er sich so schnell in alle Richtungen, dass ihn niemand mit einem Hieb überraschen konnte. Stattdessen besiegte er einen Gegner nach dem anderen. Blancheflûr bekam Angst, dass er sich vielleicht verletzen würde, und es brachte sie aus der Fassung, dass ihr das Schicksal eines fremden Ritters so viel ausmachen sollte.
Als die Ritterspiele zu Ende waren, ritt Riwalîn zu den Damen. Sein Erfolg im Kampfspiel hatte ihn übermütig gemacht, und so wandte er sich Blancheflûr direkt zu, strahlte sie an, neigte höflich den Kopf und sagte auf Französisch: »Gott behüte Euch, meine Schöne!«
Seine Haare sahen zerzaust aus, und am liebsten hätte Blancheflûr sie ihm glatt gestrichen, doch sie ließ sich nichts anmerken. »Ich danke Euch, Edler Ritter, möge Gott Euch ebenfalls beschützen und Euch Glück und Freude schenken. Allerdings würde ich Euch gern wegen etwas zur Rede stellen, das Ihr mir angetan habt.« Etwas angetan! Hatte er einen ihrer Freunde im Kampf verletzt? Bestürzt dachte Riwalîn, dass er damit seine Chancen bei ihr wohl mit einem Schlag zunichte gemacht hätte, es sei denn, sie gäbe ihm eine Gelegenheit sich noch einmal zu beweisen. »Bitte, sagt mir, was ich tun kann, um es wieder gut zu machen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn Ihr mir böse wäret oder mich ablehnen würdet!«
Blancheflûr legte den Kopf schief und überlegte. »Es ist nicht so, dass ich Euch dafür hasse. Aber es heißt auch nicht, dass ich Euch liebe. Lasst mich darüber nachdenken, wie Ihr es gut machen könnt, gebt mir etwas Zeit.« Der besorgte Riwalîn beschloss, sich erst einmal zurückzuziehen. Als er sich jedoch von ihr entfernte, entfuhr ihr ein tiefer Seufzer und sie murmelte gerade so, dass er es noch hören konnte: »Gott segne Dich, lieber Freund!«
Was konnte sie nur gemeint haben? Riwalîn war völlig verwirrt. Er hatte ihr etwas angetan, und er ging davon aus, dass sie böse auf ihn war. Dann aber hatte sie ihm mit einem so herzhaften Seufzer einen Segenswunsch auf den Weg gegeben, dass sie ihm unmöglich böse sein konnte. Was bedeutete das? Mochte sie ihn nun oder mochte sie ihn nicht?
Nach langem Hin und Her kam er zu dem Ergebnis, dass beide ihrer Bemerkungen darauf hindeuteten, dass sie ihn liebte. Jawohl, sie hatte sich in ihn verliebt, das war es, was er ihr angetan hatte! Und so ließ sich auch der Seufzer erklären. Riwalîns Schritte wurden plötzlich leicht und federnd, der Ausdruck in seinen Augen verträumt. Wer ihm zuschaute, der schüttelte den Kopf oder zuckte die Achseln; er war nicht mehr ansprechbar. Er malte sich aus, wie er einfach wieder zu ihr zurück ging und die Hand ausstreckte, wie sie ihn anlächelte, seine Hand nahm und mit ihm ging. Er würde sie einfach mitnehmen, und was für ein Paar sie abgeben würden! Blancheflûr, die Schöne, und Riwalîn, der Held. König Riwalîn und seine Königin Blancheflûr. Weltvergessen stand er mitten im Gedränge und hörte und sah nichts mehr, bis sich auf einmal wieder Zweifel in ihm regten. Sie hatte ihm doch gar nicht ihre Liebe gestanden, was bildete er sich nur ein? Vielleicht hasste sie ihn doch! In dem Fall musste er sofort Cornwall verlassen. Aber was für ein Riesenfehler wäre das, wenn sie ihn doch liebte?
Innerlich zerrissen zwischen Hoffnung und Zweifel, wurde Riwalîn in den folgenden Tagen immer unglücklicher. Das Fest nahm seinen Lauf, doch er bemerkte nichts davon. Alles, was er sah und woran er dachte, war Blancheflûr -- ihre Augen, ihre Haare, ihre Haut. Ihre Haltung, ihr Lachen, ihre Lippen. Er verging fast vor Sehnsucht und vor der Angst, dass sie ihn vielleicht nicht mochte. Allen fiel auf, wie verstört Riwalîn auf einmal wirkte, auch Blancheflûr. Sein unbeschwertes Auftreten, sein fröhliches Lachen waren verschwunden, stattdessen starrte er nur düster vor sich hin.
Auch in Blancheflûr ging eine Veränderung vor. Ihr schien überhaupt nichts mehr Spaß zu machen. Alles, was sie bisher immer mit Freuden getan hatte, ließ sie jetzt unberührt. Früher hatte sie sich zum Spinnen oder Sticken hingesetzt und mit Geduld und guter Laune ihre Tage damit zugebracht. Jetzt hatte sie sich kaum mit ihrem Garn hingesetzt, da sprang sie auch schon wieder auf und ging ruhelos im Zimmer herum, wollte wieder auf die Festwiese und sehen, ob Riwalîn da war. Wenn sie noch vor wenigen Wochen mit ihren Gefährtinnen über dieses und jenes geredet und gelacht hatte, so erschien ihr jetzt alles unwichtig und langweilig. Was war nur mit ihr los? Sie hatte doch wirklich genug Männer getroffen, die gut aussahen, die gute Kämpfer oder galant waren, wieso kreisten ihre Gedanken immer nur um diesen einen Ritter? Es war seine Schuld, dass ihr nichts mehr gut genug war, also schadete er ihr! Vielleicht hatte er sie sogar mit einem bösen Zauber belegt, dass sie an nichts mehr Vergnügen fand? Dann verdiente er nichts anderes als den Tod, denn was hatte sie ihm schon getan?
Sobald sie in Gedanken an diesem Punkt angekommen war, erschrak sie und sagte sich, dass es ja nun wirklich nicht seine Schuld war, wenn sie ständig an ihn denken musste. Wie konnte sie nur so ungerecht sein! Schließlich hatten ihn die anderen Hofdamen ja alle beim Kampfspiel angehimmelt, sie war nicht die einzige. Aber er hatte sie »meine Schöne« genannt, sie und keine von den anderen, oder etwa nicht? Hieß das nicht, dass er sich auch in sie verliebt hatte?
Jedes Mal, wenn sie ihn in der Menge erblickte, betrachtete Blancheflûr den Mann, der ihr so viel Grübeln verursachte, mit zunehmender Hingabe. Es dauerte nicht lange, bis Riwalîn sich ihrer zärtlichen Blicke bewusst wurde. Seine Hoffnung flammte wieder auf, seine Zweifel wurden geringer. So, wie sie ihn anschaute, musste sie dasselbe fühlen wie er. Langsam, unaufhaltsam, wurden sich beide immer sicherer. Voller Ungeduld warteten beide auf die nächste Gelegenheit, einander wieder zu begegnen und tauschten lange, verliebte Blicke, wenn sie sich unbeobachtet fühlten.
Schließlich ging der Mai und damit auch das Fest zu Ende. König Mark wandte sich wieder seinen Herrschaftsangelegenheiten zu und erfuhr in einer Besprechung mit seinen Vasallen, dass einer seiner Erzfeinde in sein Land eingedrungen war und so großen Schaden anrichtete, dass er dringend eingreifen musste. Mark trommelte sofort ein großes Heer zusammen und ritt seinem Feind entgegen, um ihn zurückzuschlagen. Er gewann in kürzester Zeit die Oberhand und nahm jeden Feind, der nicht getötet wurde, gefangen. Riwalîn hatte es sich nicht nehmen lassen, mitzukommen und seinen Gastgeber zu unterstützen. Im heftigen Kampfgetümmel wurde er jedoch von einem Speer in die Seite getroffen und so schwer verwundet, dass er auf einer Trage nach Tintagel zurückgebracht werden musste. Man machte sich keine großen Hoffnungen, dass er seine Verletzung überlebte.
Die Nachricht, dass der junge Kanelengres tödlich verwundet wurde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wer es hörte, war tief bestürzt, denn es gab kaum jemanden, der Riwalîn nicht ins Herz geschlossen oder ihn doch zumindest bewundert hatte. Besonders Mark tat es leid, seinen jungen neuen Freund zu verlieren. Der ganze Hof sprach von nichts anderem mehr, und als Blancheflûr davon hörte, verlor sie fast den Verstand. Es konnte nicht wahr sein, nicht Riwalîn! Er konnte doch jetzt nicht sterben, nachdem sie endlich beide voneinander wussten, dass sie sich liebten!
Blancheflûr wusste nicht, wie sie die Verzweiflung bewältigen sollte, die sie überfiel. Nichts half ihr, mit dem Aufruhr der Gefühle fertig zu werden, die auf sie einstürzten. Würde sie ihn nie mehr sehen? In ihrer Ausweglosigkeit begann sie, sich mit voller Gewalt die Faust auf die Brust zu trommeln, so dass es wehtat, immer wieder, immer wieder. Mit Schmerz konnte sie umgehen, Schmerz war etwas Wirkliches, etwas Greifbares, etwas, was sie von dem inneren Schrei wegführte, der sie zum Ersticken brachte. So schlug sie weiter zu, immer wieder, dorthin, wo das Herz lag, das den Gedanken nicht ertragen konnte, Riwalîn zu verlieren. Irgendwann, als sich ihr Brustkorb anfühlte, als wäre sie unter eine Steinlawine geraten, hörte sie auf und brach weinend zusammen. Erst dann wurde ihr plötzlich bewusst, dass er ja noch nicht tot war. Was machte sie nur, es war ja noch nicht zu spät, sie musste zu ihm gehen! Ja, sie wollte ihn noch einmal sehen, wenigstens ein einziges Mal.
Wie allerdings sollte sie zu seinem Krankenlager gelangen? Niemand wusste, dass die beiden sich liebten, sie waren einander nicht versprochen. Man würde sie nicht zu ihm lassen, nicht die Schwester des Königs, das wäre vollends gegen die höfischen Regeln der Tugend. Blancheflûr zermarterte sich den Kopf, bis ihr eine Idee kam: ihre Kinderfrau würde bestimmt helfen, sie hatte ihr noch nie eine Bitte abgeschlagen, und diesmal ging es immerhin um Leben und Tod.
Blancheflûr ging zu den Frauen in die Lichtstube, winkte ihrer Kinderfrau und nahm sie zur Seite. Mit nervös schweifenden Blicken und gesenkter Stimme erzählte sie der alten Frau ihr Anliegen. Schon wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen, und als sie ihre Geschichte zu Ende erzählt hatte, war ihr Gesicht so nass, dass die Kinderfrau aus alter Gewohnheit ein Tuch nahm und ihr damit die Wangen trocknete. »Verstehst Du jetzt, dass ich ihn sehen muss? Bitte, hilf mir! Alles hängt davon ab, dass ich ihn noch einmal sehe, mein Glück, mein Leben, alles! Ich werde es Dir nie vergessen. Bitte?«
Die alte Kinderfrau dachte eine Weile nach, konnte aber nichts Falsches darin sehen, Blancheflûr zu helfen. Wenn er ohnehin bald stirbt, macht es keinen Sinn ihr den Wunsch zu verweigern, überlegte sie. Stattdessen wird sie mir auf immer und ewig dankbar sein, das kann mir eines Tages durchaus zugutekommen. »Kopf hoch, Herrin, noch ist er nicht tot. Ich werde herausfinden, wie und wo sie ihn untergebracht haben und wie Ihr zu ihm gelangen könnt, und auch, auf wen Ihr dabei aufpassen müsst. Ich bin bald wieder zurück!«
Mit verkrampften Händen sah Blancheflûr ihrer Kinderfrau hinterher, die sich sogleich auf den Weg machte. Obwohl sie wirklich nicht lange warten musste, kam es ihr wie eine Ewigkeit vor, bis sie zurückkam. »Und?«, fragte sie atemlos, »Hast Du ihn gesehen?« Die alte Frau nickte. »Ich habe ihm heimlich gesagt, dass Ihr ihn sehen wollt und dass er Euch in Kürze erwarten soll. Er muss ja wissen, dass Ihr auf dem Weg seid, damit Sitte und Anstand gewahrt werden.« Hierbei sah die weise Kinderfrau ihrem Schützling streng in die Augen. Blancheflûr errötete, hatte aber keine Zeit sich zu verteidigen, denn die Kinderfrau hatte bereits einen Plan ausgearbeitet und zog sie mit sich. Sie gab ihr abgetragene Kleider aus der Gesindekammer, schlang ihr ein Tuch über den Kopf und brachte sie in den Teil der Burg, in dem sie Riwalîns Krankenlager eingerichtet hatten. Wenn sie jemanden trafen, erzählte die Kinderfrau, sie bringe eine Heilerin zu dem Kranken, und Blancheflûr zog sich das Tuch über die Augen, um nicht erkannt zu werden.
Riwalîn hatte, sobald die Kinderfrau sein Gemach verließ, seinen Knappen und seine Gefährten unter dem Vorwand weggeschickt, er wolle ein wenig allein sein, er brauche etwas Ruhe. Tatsächlich hatte er allerdings die größten Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben. Blancheflûr war auf dem Weg zu ihm! Als sich die schwere Holztür endlich öffnete, konnte er sein Glück kaum fassen; er ahnte sofort, um wen es sich bei der ärmlich gekleideten Frau handeln musste. Die treue Kinderfrau ließ Blancheflûr eintreten, verriegelte die Tür und zog sich lautlos zurück. Riwalîn hielt den Atem an.
Vorsichtig sah sich Blancheflûr im Raum um und trat näher, als sie sah, dass sie allein waren. Alle Schüchternheit, alle Zweifel, die es mal gegeben hatte, waren verschwunden. Sie sank auf Riwalîns Bett, doch statt seinen Blick zu erwidern, schien sie ins Leere zu starren. Nicht einmal das leichte Nicken, mit dem er sie grüßte, schien sie zu bemerken. Ein hoher, schriller Ton machte sich in ihrem Kopf breit, und sie fühlte sich mit einem Mal völlig überwältigt. »Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden«, stieß sie hervor, »dann wäre mir dieser Moment verschont geblieben. Meine ganze Hoffnung ist dahin, wenn Du stirbst.« Langsam, ganz langsam neigte sie ihren Kopf zu ihm herunter, bis sich ihre Wangen berührten, dann wurde ihr auf einmal schwarz vor Augen. Die Aufregung war schlichtweg zu viel gewesen.
Riwalîn wagte nicht sich zu rühren und fragte sich ernsthaft, ob sie jetzt aus lauter Kummer und Mitgefühl selbst gestorben war. Zum Glück kam dann aber doch wieder Leben in sie, wobei ihr schlagartig bewusst wurde, dass sie Kopf an Kopf mit ihrem Geliebten lag und er noch am Leben war. Sie nahm ihn in die Arme und küsste ihn, nicht zaghaft und scheu, sondern mit einer Leidenschaft, die sie selbst noch nie erlebt hatte. Dabei presste sie sich an ihn, als wollte sie ihn erdrücken. Riwalîn, noch vor kurzem davon überzeugt, dass sein Leben verwirkt war, spürte seinen Körper reagieren. Er vergaß alles um sich herum und stöhnte vor Verlangen, während sich Blancheflûr nur noch enger an ihn klammerte. Dann ging alles ganz schnell. Zuerst schrie sie auf, dann er, und ob es vor Schmerz oder aus Lust war, hätten beide nicht sagen können.
Was Riwalîn eigentlich den Todesstoß gegeben haben müsste, stellte sich als ausschlaggebenden Moment seiner Heilung heraus. Noch lange wurde über das Wunder der mysteriösen Heilerin gesprochen, die man danach nie wieder gesehen hatte. Riwalîn wurde wieder gesund, und gleichzeitig verwandelte sich Blancheflûr, die in letzter Zeit so verstört gewirkt hatte, in eine glückliche, erfüllte junge Frau. Beide hatten nur noch Augen füreinander, wo der eine war, da sah man auch die andere; beide wollten nichts anderes, als einander nahe zu sein, wenngleich es stets in Anwesenheit anderer geschah, damit der höfische Anstand gewahrt wurde. Das Leben hätte für die beiden immer so weiter gehen können, doch sollte ihr Glück nicht lange anhalten.
Kaum war Riwalîn wieder zu Kräften gekommen, da erreichte ihn auch schon ein Bote mit schlimmen Nachrichten von Parmenien. Trotz des einjährigen Friedenshandels war Morgan, sein Erzfeind, mit einem gewaltigen Heer in sein Land einmarschiert und wollte sich offenbar für Riwalîns Vermessenheit rächen. Nach dem, was das Parmenische Heer in Morgans Ländern angerichtet hatte, gab sich Riwalîn keinen Illusionen hin. Sein Land würde dem Erdboden gleichgemacht, wenn er nicht schnellstens eingriff.
Sofort ließ er ein Schiff für die Reise ausrüsten, mit Pferden und Verpflegung für seine Männer. Blancheflûr wollte nicht wahrhaben, dass Riwalîn sie verlassen wollte. Er war doch gerade erst von seiner tödlichen Verwundung genesen, unmöglich, dass er schon wieder in den nächsten Krieg zog! Sie waren so glücklich gewesen, aber nur für eine so kurze Zeit! Was, wenn er diesmal ums Leben kam? Sie würde es ihm sagen müssen ....
Blancheflûr wünschte erneut, sie hätte sich nie in Riwalîn verliebt, dann wäre es ihr jetzt egal, ob er Tintagel verließ oder nicht. Wieso musste sie so leiden? Liebe sollte etwas Schönes sein, etwas Erhabenes, das Glück schlechthin. Stattdessen bezahlte man einen kurzen Moment des Glücks mit unerträglichen inneren Qualen und unvorhergesehenen Konsequenzen!
Als hätte er gespürt, dass Blancheflûr mehr oder weniger dabei war, ihre Liebe zu ihm zu bereuen, trat genau in diesem Moment Riwalîn ein. »Lebt wohl, meine Schöne, Ihr wisst, dass ich los muss. Möge Gott Euch beschützen, bleibt gesund und glücklich!«
Tapferkeit war nicht Blancheflûrs Stärke. Das also war der Abschied, sie würde ihn wahrscheinlich nie wieder sehen. Noch während sie nach Worten rang, begann der Raum um sie herum plötzlich zu schwanken, wie es in letzter Zeit immer öfter geschah, und sie fiel in Ohnmacht. Zu Riwalîns Verwirrung schien ihre Erzieherin damit zu rechnen, sie breitete die Arme auf und konnte sie gerade noch auffangen, so dass ihr Kopf nicht auf den Boden schlug. Bestürzt sah Riwalîn zu. So konnte er sie nicht zurücklassen, er musste zuerst sehen, dass sie sich beruhigte. Unten warteten seine Männer auf ihn, aber dann mussten sie eben warten.
Riwalîn kniete sich besorgt neben Blancheflûr und wartete darauf, dass sie wieder zu sich kam. Behutsam nahm er ihre Hände und küsste sie auf die Wangen, auf die Augen und auf den Mund, so lange, bis er sah, dass ihre Kräfte zurückkehrten. »Ach, Riwalîn, mein Herr und mein Geliebter«, sagte sie schließlich, »Ihr glaubt ja nicht, was Ihr mir antut, wenn Ihr nur wüsstet .... Jetzt muss ich es Euch wohl sagen: Ich trage Euer Kind, und ich weiß nicht, ob ich die Geburt ohne Gottes Hilfe überleben werde – wie Ihr wisst, bin ich nicht die Stärkste. Was aber noch schlimmer ist, könnt Ihr Euch sicher denken: Wenn mein Bruder und mein Vater davon erfahren, bin ich erst recht des Todes. Sie werden mir die Schande nicht verzeihen. Selbst wenn sie mich am Leben lassen, werden sie mich enterben. Ich werde für den Rest meiner Tage in Schande leben, und das Kind wird ohne Vater aufwachsen. Stellt Euch vor, was das bedeutet! Das Ansehen meiner königlichen Familie steht auf dem Spiel; in Cornwall und in England wird man voller Verachtung auf uns sehen, und es ist meine Schuld!«
Riwalîn war bereits blass geworden, als Blancheflûr in Ohnmacht fiel. Nun war alle Farbe aus seinem Gesicht gewichen. Ein Kind! Und das jetzt, wo er gerade losziehen wollte, um seinen Feind Morgan aus Parmenien zu vertreiben, bevor es zu spät war. Er konnte Blancheflûr unmöglich im Stich lassen, das brachte er nicht übers Herz, er liebte sie! Ein Brautlauf war allerdings unmöglich, allein die Organisation würde Wochen, wenn nicht Monate kosten, Zeit, die er nicht hatte.
»Mein Liebling, ich werde alles tun, damit Ihr durch mich keinen Kummer mehr habt, ich werde alles wieder gut machen, ich verspreche es! Ihr habt mich zum glücklichsten Menschen gemacht, da werde ich mich doch nicht von Euch lossagen! Wenn Ihr wollt, dass ich hierbleibe, dann bleibe ich hier bei Euch. Und wenn Ihr mit mir kommen wollt, dann soll alles, was mir gehört, Euch auch gehören. Ihr entscheidet, ob ich gehe oder bleibe, Euer Wunsch ist mein Befehl!«
Damit hatte er Blancheflûr eine ganz neue Möglichkeit geboten. Sie sprang auf, lief grübelnd hin und her, aber ihre Entscheidung war im Grunde schon gefallen. »Hier kann ich nicht bleiben, ich kann meinen Zustand nicht mehr lange verbergen. Möge Gott Euch dafür belohnen, dass Ihr so ehrenhaft und ritterlich seid und mich nicht in meiner Lage allein lasst, ich danke Euch von ganzem Herzen! Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie heimlich wegstehlen, wie soll ich das nur tun?«
»Verlasst Euch auf mich«, sagte Riwalîn, noch während er fieberhaft nach einer Lösung suchte. Er musste sie mitnehmen, sie hatte sich gerade aus freien Stücken dafür entschieden und er würde sein Wort halten. »Ihr müsst noch heute Abend heimlich zu meinem Schiff kommen. Nehmt nur das mit, was Ihr unbedingt braucht, damit es nicht auffällt, und kommt allein. Geht zu meinem Gefolge und wartet dort auf mich. Sobald ich mich hier verabschiedet habe, werde ich Euch finden.«
Riwalîn ging auf direktem Weg zu König Mark, um ihm von der Lage in Parmenien zu berichten und ihm zu sagen, dass sein Schiff bereits auf ihn wartete. Mark verstand, dass sein Gast auf dem schnellsten Weg abreisen musste und verabschiedete sich wohlwollend. Sein junger Gast war ihm ans Herz gewachsen und der ganze Hof war traurig über seine Abreise. Riwalîn bedankte sich gebührlich für die Gastfreundschaft, die er hier genossen hatte, und machte sich auf den Weg zum Schiff. Er fand Blancheflûr wie verabredet unter seinen Männern, sie war aufgeregt und nervös, so plötzlich und unerwartet ihre Heimat verlassen zu müssen, und ihre Hand fuhr immer wieder ungewollt zu ihrem Bauch, als wollte sie sich selbst daran erinnern, dass sie keine andere Wahl hatte. Ohne weitere Verzögerungen wurden die letzten Sachen an Bord gebracht und das Schiff legte los, sobald alle an Bord waren.
Blancheflûr schlief kaum in dieser Nacht. Das Schaukeln des Schiffes verursachte ihr noch mehr Übelkeit, als sie ohnehin schon verspürte, und es fiel ihr schwer, sich so königlich zu verhalten, wie es von ihr erwartet wurde. Die meiste Zeit stand sie an Deck und starrte auf das schwarze Wasser unter ihr, tief in Gedanken, voller Fragen. Wie würde ihr Bruder reagieren, wenn er am Morgen erfuhr, dass sie mitgefahren war? Er würde sofort wissen, warum. Ob sie Cornwall je wiedersehen würde? Und was, wenn man sie in Parmenien nicht anerkannte?
Wenn Riwalîn sich neben sie stellte, legte sie den Kopf an seine Schulter und suchte Trost in dem Gedanken, dass sie ihm nahe war. Als sie endlich im Morgengrauen vor Anker gingen, betrachtete Blancheflûr die fremde Landschaft. Es sah ihrem vertrauten Cornwall gar nicht mal so unähnlich, allerdings war es relativ flach und wirkte trotz der Bäume nicht so grün, wie sie es gewohnt war. Der Wind blies hier weniger heftig, der Himmel war weniger wolkig und der Tag versprach eine sommerliche Wärme. »Ihr werdet Euch bei mir wohlfühlen, keine Angst«, versprach Riwalîn und drückte ihre Hand. »Seht Ihr die Burg dort, auf dem Hügel? Dahin bringe ich Euch. Mein Gesinde wird sich gut um Euch kümmern, dafür sorge ich!«
Die Burg sieht so abweisend aus, dachte Blancheflûr, fast bedrohlich, doch dann rief sie sich zur Vernunft und erinnerte sich daran, dass Burgen schließlich dazu da waren, die Bewohner vor Feinden zu schützen. Riwalîn ließ als erstes ein Gemach für sie einrichten, bevor er seinen Marschall Rual li Foitenant kommen ließ, um sich über die Lage zu informieren. »Es ist so schlimm, wie man Euch berichtet hat, aber dank Gott seid Ihr noch rechtzeitig gekommen«, sagte Rual. »Das Glück wird sich jetzt für uns wenden, da bin ich sicher. Aber wer ist die Frau, die Ihr mitgebracht habt?«
Riwalîn erzählte ihm, um wen es sich handelte. Da er wusste, dass er Rual absolut vertrauen konnte, verschwieg er auch nicht, dass Blancheflûr ein Kind von ihm erwartete. Zu seiner Erleichterung sah Rual die ganze Geschichte als etwas Positives, sogar mit einer richtigen Begeisterung. »Damit wird sich Euer Ansehen und Euer Ruhm erhöhen, Herr. Lasst ein gewaltiges Fest ansagen, und nehmt sie in aller Öffentlichkeit zu Eurer Frau. Alle Verwandten und all unser Gefolge sollen dabei sein, es soll ein prächtiges Fest werden, von dem man noch lange sprechen wird. Allerdings rate ich Euch, zuvor den Bund mit ihr von der Kirche segnen zu lassen, um den christlichen Segen einzuholen. Das wird dann auch die Pfaffen zufrieden stellen.« Riwalîn sah seinen Marschall erleichtert an. Eine ausgezeichnete Idee, damit würde er allen gerecht, besonders Blancheflûr, und Rual würde alle nötigen Vorbereitungen treffen.
Die Heimholung der Braut wurde mit allem gefeiert, was dazu gehörte, obwohl ihr Bruder nicht da war, um sie Riwalîn zu übergeben. Blancheflûr, die sich noch an das neue Land und die Sprache gewöhnte, kam alles wie ein Traum vor. Nun war sie Riwalîns Frau, und ihr Kind konnte in Ehre und mit Anstand geboren werden. Es hatte einen Vater und würde ein Erbe bekommen, so, wie es seiner königlichen Herkunft entsprach. Damit musste auch Mark nicht mehr um ihr Ansehen bangen. Was ihr Glück jedoch überschattete, war der Gedanke, dass ihr Mann jeden Moment gegen Morgan in den Krieg ziehen musste.
Rual brachte Blancheflûr zum Schloss Kanoel, von dem Riwalîn seinen Namen Kanelengres hatte. Er übergab die neue Herrin seiner Frau Floraete, bevor er sich wieder auf den Weg zu seinem Herrn machte, der bereits das Heer aufrüstete. Schweren Herzens blickte Blancheflûr ihm nach. Sie würde Tag und Nacht für die unversehrte Rückkehr ihres Geliebten beten, etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Floraete war die Güte selbst und kümmerte sich rührend um die junge Herrin, die allein in einem fremden Land ihr erstes Kind erwartete, ohne eine einzige bekannte Seele um sich herum.
Währenddessen liefen die Vorbereitungen für den Kriegszug auf Hochtouren. Boten wurden ausgeschickt, um sämtliche Vasallen und ihr Gefolge zusammen zu trommeln, Waffen und Rüstungen zusammengetragen, Pläne ausgearbeitet, wie man sich Morgan entgegenstellen wollte. Als das Heer endlich loszog, wurde es bereits von Morgan erwartet. Heftige Kämpfe brachen aus, und es gab auf beiden Seiten gewaltige Verluste. Jeder focht um sein Leben, es war schwer zu sagen, wer die Oberhand hatte, und es dauerte nicht lange, bis das Schlachtfeld mit Toten und Schwerverletzten übersät war. Inmitten des Kampfgetümmels schrie plötzlich jemand auf, dass Kanelengres selbst verletzt worden sei. Sofort scharten sich seine Krieger, soweit sie es schafften, mitten im Gefecht um ihren Herrscher, der auf der Erde lag, und prüften, wie schwer seine Verletzungen waren. Zu ihrem Entsetzen stellten sie fest, dass er gar nicht mehr lebte.
Sie sammelten ihn auf und trugen ihn unter dem Schutz seiner treuen Ritter an den Rand des Gefechtes. Man würde ihn hier begraben, wo er ehrenhaft bei der Verteidigung seines Landes erschlagen wurde, beschloss man einstimmig. Es gab kaum jemanden, der nicht tief betroffen von Riwalîns Tod war. Sein Ansehen galt viel, seine Ritterlichkeit war in aller Munde und er hatte erst kürzlich eine Frau heimgeholt. Laut wurde sein Tod beklagt, noch während die Schlacht tobte, und zwei Krieger blieben zur Totenwache zurück bei ihrem Herrn.
Sobald die Kämpfe beendet waren, schaufelten die Männer Riwalîns Grab. Sie kreuzten seine Hände über der Brust, wickelten ihn in ein Totentuch und bestatteten ihn, wie es einem großen Herrscher gebührte. Sie scharten sich noch ein letztes Mal um die Grabstelle und erwiesen ihm die letzte Ehre, bevor sie schweren Herzens den Rückweg antraten.
Der Bote, der mit der Schreckensnachricht nach Kanoel geschickt wurde, berichtete danach, dass Riwalîns junge Frau keinen Ton herausgebracht hätte. Kein Wort hätte sie gesagt, keine einzige Träne geweint, doch hätte man ihr ansehen können, dass ihr in dem Moment, als sie von Riwalîns Tod erfuhr, das Herz brach. In der Tat war Blancheflûr wortlos zusammengebrochen. Im selben Moment setzten die Wehen ein, obwohl es noch gar nicht die Zeit dafür war.
Vier Tage lang wand sich Blancheflûr unter entsetzlichen Schmerzen, als würde ihr Körper von innen aufgerissen. Sie schrie aus Leibeskräften, vier Tage lang, ununterbrochen, so dass die hilflose Hebamme sich nur noch bekreuzigte, die ein solches Leiden noch nie bei einer Gebärenden erlebt hatte. Am vierten Tag bäumte sie sich ein letztes Mal auf und das Kind wurde geboren. Es war ein Sohn, doch noch bevor er seinen ersten Atemzug tat, hörte das Schmerzensgeschrei seiner Mutter plötzlich auf und eine tödliche Stille breitete sich im Raum aus.
Floraete, die Frau des Marschalls, schlug die Hände vor dem Mund zusammen und starrte die Hebamme an, die sich erschöpft auf einen Stuhl fallen ließ. Beide konnten nicht fassen, was gerade passiert war. »So viel Unglück auf einmal, Jesus, Maria und Josef, so viel Unglück«, jammerte die Hebamme. In diesem Moment begann Blancheflûrs kleiner Sohn zu wimmern, und die Frauen beeilten sich, ihn zu säubern und in Tücher zu wickeln, bevor sie sich um die Tote kümmerten. Liebevoll betrachtete Floraete den Kleinen in ihren Armen, strich ihm über die Wangen und flüsterte: »Du armes Kind! Wie traurig die Umstände Deiner Geburt sind! Ich werde mich um Dich kümmern, das verspreche ich Dir am Totenbett Deiner Mutter.«
2.
»Was machen wir jetzt mit dem Kind? Wir brauchen eine Amme.« Floraete wusste nicht, wie es weiter gehen sollte. Rual saß ihr gegenüber, tief in Gedanken. »Die Leute dürfen nichts von ihm erfahren, wenn er überleben soll«, meinte er schließlich. »Es gibt zu viele Feinde, die sich nichts mehr wünschen als seinen Tod, jetzt, wo seine Eltern beide tot sind.«
»Also verstecken wir ihn«, schlug Floraete vor. »Aber wo ist er sicher?« Rual rieb sich grübelnd den Bart. »Richtig sicher ist er nirgendwo. Morgan wird alles daran setzen, ihn umzubringen, und irgendjemand wird ihn irgendwann verraten, davon können wir ausgehen.« Bedrückt schwiegen sie, bis Rual plötzlich mit einem Ruck aufschaute. »Wie weit würdest Du gehen, um dem Kleinen zu helfen?« Floraete begegnete seinem Blick misstrauisch. »Wie meinst Du das? Ich würde alles für ihn tun, das weißt Du doch. Er ist Riwalîns Sohn! Wir waren ihm immer treu, das ändert sich auch jetzt nicht.« Rual nickte. Auch seine Loyalität stand außer Zweifel. »Ich habe eine Idee, aber es wird schwierig sein, sie durchzuführen. Es hängt alles von Dir ab, und es würde bedeuten, dass der Kleine womöglich nie sein Erbe antreten kann.« Floraete sprang aufgeregt auf. »Ich bin bereit! Was kann ich tun?«
Rual zögerte. »Wir müssen so tun, als sei das Kind bei der Geburt gestorben. Wir verstecken es nur eine kurze Zeit, während Du vorgibst, schwanger zu sein. Wenn Du Dein angebliches Kind zur Welt bringst, legen wir Dir den Kleinen in die Arme und alle werden denken, dass es unser Sohn ist.« Floraete starrte ihren Mann mit großen Augen an. Der Plan war genial, aber ob sie damit durchkommen würden? Sie sprachen die ganze restliche Nacht darüber, wie sie vorgehen sollten. Alle Möglichkeiten wurden besprochen, alle Schwierigkeiten erwogen, wie und wo man das Kind versteckte, wo sich die angebliche Schwangere ins Wochenbett legen würde, welches Gesinde man einweihen und welcher Hebamme man vertrauen konnte. Als alles besprochen war, graute bereits der Morgen, doch trotz der Müdigkeit fühlten sich Rual und Floraete von dem Gedanken beflügelt, eine Lösung gefunden zu haben.
Blancheflûrs Begräbnis wurde zum Volksereignis. Alle kamen, um den dreifachen Verlust zu beweinen. Die Totenglocke schlug den ganzen Tag. Parmenien hatte seinen Herrscher mitsamt seiner Thronfolge verloren; jetzt war man Herzog Morgans Zorn hilflos ausgeliefert, der keinen Grund hatte, Land und Leute zu verschonen.
Als Marschall setzte Rual sofort nach der Bestattung alles in Bewegung, um die Bevölkerung zu schützen. Er beriet sich mit Riwalîns Vasallen und überredete alle, sich Morgan zu ergeben. Nur wenn sie um Gnade flehten und sich mit Leben und Besitz unter seine Herrschaft stellten, würden sie unbeschadet überleben können. Es gab keinen anderen Weg, das sah selbst der störrischste Landesherr ein. Ohne Herrscher konnten sie den Krieg gegen Morgan unmöglich weiterführen, geschweige denn gewinnen. Somit kehrte Friede ins Land zurück.