
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Hänsel und Gretel? Könnte es sein, dass auch dieses Märchen einen wahren Kern hat? Gehen wir davon aus, dass sich die Geschichte im 30jährigen Krieg abspielte, dann werden die Ereignisse plötzlich plausibel. Wer damals nicht an der Pest starb, der wurde Opfer marodierender Soldaten oder erlag dem Hunger. Die verzweifelte Bevölkerung suchte nach Gründen, und wie stets machte man Minderheiten für Not und Elend verantwortlich – woran sollte es sonst liegen? "Hexenbrot" ist eine realistische Version dessen, was der Geschichte von Hänsel und Gretel zugrunde liegen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Strachan
Hexenbrot
Hänsel und Gretel neu erzählt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Katharinas Lebkuchenrezept
Impressum neobooks
Vorwort
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Hänsel und Gretel? Könnte es sein, dass auch dieses Märchen einen wahren Kern hat?
Gehen wir davon aus, dass sich die Geschichte im 30jährigen Krieg abspielte, dann werden die Ereignisse plötzlich plausibel. Wer damals nicht an der Pest starb, der wurde Opfer marodierender Soldaten oder erlag dem Hunger. Die verzweifelte Bevölkerung suchte nach Gründen, und wie stets machte man Minderheiten für Not und Elend verantwortlich – woran sollte es sonst liegen? „Hexenbrot“ ist eine realistische Version dessen, was der Geschichte von Hänsel und Gretel zugrunde liegen könnte.
1.
Keine einzige Nacht, in der ich nicht schweißgebadet aufwache und alles wieder durchlebe. Die Geräusche vor dem Haus – diesmal hat er mich gefunden, ich bin sicher. Ich erwische mich dabei, wie ich im Bett sitze und vor und zurück schaukele, wie ein verängstigtes Kind, vor und zurück, mein rasendes Herz schlägt bis zum Hals, mein Nachthemd ist nass, meine Hände verkrampfen sich um Jacobs Kappe.
Doch er hat mich nicht gefunden, es sind nur die Wölfe. Wie sie wieder heulen, dabei ist es noch nicht einmal Vollmond. Am liebsten würde ich mit einstimmen. Jacob, will ich heulen, warum nur? Was soll ich tun, wenn er mich findet? Wird ihm diesmal gelingen, was er damals nicht geschafft hat? Nochmal überlebe ich es nicht, soviel ist klar.
Ich quäle mich aus dem Bett. Noch immer macht mir mein Rücken zu schaffen und ich humpele unter Schmerzen, meinen Kopf kann ich nicht mehr heben und wenn ich aufblicken will, muss ich eine Schulter nach unten verdrehen. So arbeite ich mich zur Tür, nehme Topf und Kochlöffel, schiebe den Eisenriegel zurück und mache Lärm, um die Wölfe zu vertreiben. Wenn ich Glück habe, findet der Wildhüter einen von ihnen in der Grube, die er ausgehoben hat, doch ich weiß, dass auch dann die Alpträume nicht aufhören werden.
2.
Der Tag war von Anfang an dunkel und grau gewesen, gleich morgens schon wollte die Sonne nicht richtig aufgehen. Ein Tag, an dem man am liebsten gar nicht aufgestanden wäre, und das hätten Jacob und Katharina am liebsten auch getan, doch sie mussten auf den Markt und es gab noch viel zu tun.
Sie standen auf, heizten den Backofen an, kehrten die Asche aus und schoben schon bald die ersten Brote in den Ofen. Als Jacob auf den Hof ging um für den nächsten Tag das Holz zu hacken, hörte er sie kommen. Der Boden dröhnte, die Vögel hörten auf zu singen und schon bald konnte man die Rufe der Männer ausmachen. „Soldaten!“ Katharina wusste, was das bedeutete. Es war zu spät, die ersten Brote verbreiteten bereits ihren üblichen verführerischen Geruch. Sie ließ alles stehen und liegen, schoss aus dem Haus und folgte Jacob in den Wald.
Sie waren bereits darin geübt, auf die alte Eiche zu klettern und sich in ihrem dichten Laub zu verstecken. Wie stets, half Jacob seiner Frau auf den ersten Ast hinauf, bevor er sich selbst hoch zog. Von dort aus konnten sie die weiteren Äste erreichen; Katharina hatte sich den Saum ihres Kleides in den Gürtel gesteckt und in Windeseile saßen sie weit oben in der Krone, vor allen Blicken geschützt.
Diesmal war es eine relativ kleine Gruppe, etwa ein Dutzend Söldner, die in einer unbekannten Sprache Befehle schrien. Sie stiegen ab, banden die Pferde am Zaun fest und zogen einen ihrer Männer vom Pferd, der schlaff wie ein Mehlsack von zwei anderen getragen wurde. Sie gingen direkt aufs Haus zu und riefen unverständliche Anweisungen. Dann schleppten sie den Mann hinein.
Katharina und Jacob hielten den Atem an und beteten, dass sich die Männer einfach satt aßen, nicht nach den Bewohnern des Hauses suchten und nicht alles in Brand steckten, wie es die Söldner seit Jahren in der Gegend zu tun pflegten. Die Zeit verging langsam, bis die Männer wieder heraus kamen. Sie riefen erneut in ihrer unverständlichen Sprache, durchsuchten die umliegenden Büsche und Bäume, fanden jedoch nicht die Eiche. Bevor sie wieder auf ihre Pferde stiegen und davon ritten, griffen sie sich noch zwei der Hühner, drehten ihnen den Hals um und nahmen sie mit. Die anderen Hühner waren mit großem Gezeter in alle Richtungen geflohen und die Ziege war gleich beim Herannahen der Männer in den Wald gerannt, was ihr das Leben gerettet hatte. Jacob und Katharina sandten ein Dankgebet zum Himmel und kletterten den Baum wieder hinunter, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass die Soldaten wirklich weg waren.
Sie traten ins Haus, um den Schaden zu begutachten. Bevor sie jedoch nachsehen konnten, wieviele ihrer Vorräte geplündert worden waren, erstarrten sie vor dem Anblick, der sich ihnen bot. Auf dem Tisch lag ein Mann, offenbar einer der Soldaten, in schrecklichem Zustand. Er stöhnte und wand sich vor Schmerzen, war kreidebleich, schweißüberströmt und hatte überall auf Gesicht und Hals dunkel verfärbte Beulen, die zum Teil aufgebrochen waren und deren blutig-eitriger Inhalt über Gesicht, Hände, Wams und Hose verschmiert war. Katharina und Jacob schien er kaum wahrzunehmen, man konnte selbst dann, wenn man seine Sprache nicht kannte, hören, dass er im Fieberwahn wirres Zeug sprach. Plötzlich wurde er von einem Hustenanfall geschüttelt, der ihn noch mehr zu schwächen schien, und ein blutiges Rinnsal lief ihm aus dem Mundwinkel.
Katharina schrie auf und klammerte sich an ihren Mann. „Jacob, das ist der Schwarze Tod, ich weiß es. Fass ihn nicht an, sonst geht es uns genauso!“ Jacob klopfte ihr beruhigend auf den Rücken und schob sie dann von sich. „Wir können ihn hier nicht liegen lassen, das ist Dir doch selbst klar. Halt mir die Tür auf, ich bringe ihn in den Schuppen.“
Kurzentschlossen ging er auf den Tisch zu, zog den wimmernden Mann an den Armen hoch und hievte ihn über seine Schulter. Katharina hielt ihm die Tür auf und lief voraus zum Schuppen, um dort Platz zu schaffen. Nur mit Mühe konnte sie ein plötzlich aufkommendes Schuldgefühl unterdrücken, dass sie den Fremden nicht im Haus pflegen wollte. Sie bekämpfte ihre Gewissensbisse erfolgreich, indem sie sich die Schreckensgeschichten ins Gedächtnis rief, die seit Jahren über die Söldner auf beiden Seiten berichtet wurden. Zudem hatten sie am eigenen Leib regelmäßige Plünderungen erlitten und konnten sich glücklich schätzen, dass nicht auch ihr Haus in Schutt und Asche lag und sie überhaupt noch am Leben waren.
Gerade in dem Moment, als Jacob den Mann im Schuppen zu Boden gleiten ließ, platzte eine der Beulen am Hals des Kranken auf und verspritzte ihre rotgelbe, schleimige Flüssigkeit. Katharina, die sah, wie sich Jacob angeekelt mit dem Ärmel das Gesicht abwischte, wurde hysterisch. Sie rannte zum Brunnen, zog so wild an der Kette, dass die Hälfte des Wassers aus dem Eimer schwappte und stürzte zum Schuppen zurück. Sie schüttete Jacob das Wasser über den Kopf, der sich lauthals beschwerte, und zog ihn auf den Hof hinaus. „Geh sofort zum Bach, Du musst Dich waschen. Schnell!“
Jacob brummte, tat aber, wie geheißen. Inzwischen ging Katharina ins Haus zurück und besah sich den Schaden. Die beiden Stühle, die Jacob so liebevoll gezimmert hatte, lagen umgeworfen auf der Erde, zusammen mit Kochgeschirr und den Blumen, die Katharina erst am Vortag ins Fenster gestellt hatte. Das Spinnrad war kaputt, doch nicht so sehr, als dass Jacob es nicht wieder richten könnte. Sie hatten das Mehl nicht angerührt und zum Glück war der Steintopf mit dem Honig noch da. Die Eier waren verschwunden und sämtliche fertigen Brote auch, der Milchkrug lag zerbrochen auf dem Boden und aus dem Ofen quoll schwarzer Rauch mit beißendem Geruch. Katharina begann aufzuräumen, hielt dann aber inne, überlegte kurz und seufzte ergeben.
Sie nahm einen Eimer Wasser und einen Becher und ging zum Schuppen. Vorsichtig stieß sie die Tür auf. Ihre Augen gewöhnten sich nur langsam an das Dämmerlicht, das durch die Bretter drang. Auf dem Boden lag noch immer der Fremde; er sah sie mit fiebrig glänzenden Augen flehend an und stöhnte etwas Unverständliches. Katharina gab ihm den Becher mit Wasser und nahm einen Lappen aus ihrer Schürze, tauchte ihn ins Wasser und wischte dem Kranken damit über das schmutzige, verschmierte Gesicht. Sein Blick war voller Dankbarkeit, doch Katharina fühlte sich seltsamerweise noch schuldiger als zuvor, denn sie würde ihn nicht wieder aus dem Schuppen holen.
Bevor sie zurück ins Haus ging, gab sie dem Mann noch einmal etwas zu trinken und schob etwas Stroh unter seinen Kopf. Dann begann sie aufzuräumen. Als Jacob vom Bach zurückkam, hatte sie den Tisch wieder so weit in Ordnung gebracht, dass sie etwas essen konnten. Das einzig Essbare, was die Söldner zurückgelassen hatten, war ein alter, steinharter Lebkuchen gewesen, den Katharina jetzt in Wasser aufweichte und mit Jacob teilte.
Am darauffolgenden Tag, als Katharina nach dem Fremden im Schuppen schauen wollte, fand sie ihn tot. Vorsichtig stieß sie ihn an, doch er rührte sich nicht. Sie rief Jacob, der sich schon dachte, was passiert war. Er vergewisserte sich, dass der Mann wirklich nicht mehr lebte, und zog dann los um ein Grab auszuheben. Sie trugen ihn zusammen zu seiner letzten Ruhestätte und waren sich nicht sicher, ob sie ein paar Worte sprechen sollten oder nicht. Schließlich einigten sie sich darauf, ein Vaterunser zu beten.
Im Verlauf der nächsten zwei Tage hatten sie die verbleibenden Hühner wieder eingefangen, die Ziege war von allein zurückgekommen, als sie gemolken werden musste und sie hatten wieder genug Zutaten um zu backen. Diesmal wollten sie bis nach Hanau zum Markt gehen, um Brote und Lebkuchen zu verkaufen. „Wenn wir rechtzeitig aufstehen und beide tragen, was wir können, haben wir genug Geld, um Gewürze zu kaufen; wir brauchen wieder Zimt und Kardamom“, bemerkte Katharina. Jacob antwortete nicht. Irgendwie war er heute nicht recht bei der Sache, der Kopf tat ihm weh und er fühlte sich, als ob er eine Erkältung habe.
„Eine Erkältung im Sommer?“ Katharina schüttelte ungläubig den Kopf. Als Jacob allerdings eine kurze Zeit später beim Holzhacken Gleichgewichtsstörungen bekam und sie aus der offenen Tür heraus sah, wie er mit einem Mal taumelte, machte sie sich Sorgen. Sie lief aus dem Haus, stützte ihn und zwang ihn, sich auf den Hauklotz zu setzen. Misstrauisch fühlte sie seine Stirn. „Du glühst ja richtig! Komm ins Haus, Du musst Dich hinlegen!“ Noch besorgniserregender als seine hohe Temperatur war die Tatsache, dass er sich von ihr widerstandslos ins Haus führen ließ.
Katharina sah zu, dass sich Jacob ins Bett legte und entschied kurzerhand, dass es das Beste sei, eines der Hühner zu schlachten. Zwar hatte Jacob ihr ausdrücklich gesagt, wie sehr sie die Eier brauchten, doch hätten die Söldner schließlich auch noch ein drittes Huhn mitnehmen können. Es war für das Wohl ihres Mannes, wenn sie die Knochen richtig auskochte und eine gute Brühe machte, das würde ihn schon bald wieder auf die Beine bringen, und schließlich hatten sie dann immer noch zwei Hühner übrig. Katharina machte sich an die Arbeit.
Noch bevor das Huhn halb gar gekocht war, hörte sie Jacob bereits rufen. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und lief zur Bettstatt. Er schlotterte von Kopf bis Fuß, während sein Kopf so heiß war wie die Brühe auf dem Herd. Katharina holte Wasser, gab ihm etwas zu trinken und tränkte dann ein Tuch, um ihm damit die glühende Stirn zu kühlen. Jacob stöhnte auf und sprach unsinniges Zeug, von dem Katharina nur das ein oder andere Wort verstand. „... Die Füchse, natürlich ....“, „.... und dann nach Frankfurt, jaja, und Philipp Moritz selbst ....“, „Nein! Nein, tut das nicht, wir können gar nicht .....“ Es machte wirklich keinen Sinn. Katharina wischte ihm den Schweiß ab und gab ihm erneut etwas zu trinken. Plötzlich kam ihr diese Handlung auf unheimliche Art bekannt vor. Hatte sie nicht vor wenigen Tagen genau dasselbe für den fremden Söldner getan?
Nein, nicht Jacob. Er würde es überstehen, selbst, wenn er dieselbe Krankheit wie der Fremde hatte. Sie würde ihm Hühnersuppe geben, im Nu wäre er wieder auf den Beinen. So sehr Katharina sich aber einredete, dass Jacob die Krankheit überstehen würde, so aussichtslos war doch ihr Kampf. Sie saß Tag und Nacht an seinem Bett, flößte ihm Brühe ein, gab ihm Wasser zu trinken und kühlte seine brennende Stirn. Sie sah mit Entsetzen, wie sich eine Beule unter seinem Ohr bildete und heulte sich die Augen aus, als könne ihr Klagen etwas gegen den unaufhörlichen Verlauf der Krankheit ausrichten.
Mit einem Mal wurde sie durch eine plötzliche Bewegung Jacobs gewahr, dass sie vor Erschöpfung eingeschlafen sein musste. Verwirrt schaute sie auf ihren Mann, der sie mit einem Mal ganz klar ansah und nicht mehr im Fieberwahn sprach, sondern bei vollem Bewusstsein zu sein schien. Katharina schrie auf vor Freude und ergriff seine Hände, doch Jacob strengte sich unglaublich an, um ihr etwas zu sagen, so dass sie sich zu ihm hinunter beugte und fragte, was er wollte. Er krallte sich an sie, zog sich mit übermenschlicher Anstrengung in eine Sitzposition und sprach in kurzen, abgehackten Worten. Katharina hatte alle Mühe, ihn zu verstehen.
„Söldner .... wieder .... Base ... Spessart, das Haus .... Köhler, weißt Du .... Dammbach .... Versprich mir das! .... Limes zuerst .... Krotzen-burg.... Fluss .... Aschaffenburg .... Nulekaim .... Walstat .... Heim-buchen-thal .... Dammbach .... Du musst .... sag Du es!“ Katharina versuchte ihn zu beruhigen, „Schhhh! Sprich nicht so viel, es geht Dir bald besser“, doch Jacob wurde fast böse, so sehr bemühte er sich um Katharinas Aufmerksamkeit. Bald begriff sie, was er von ihr wollte und wiederholte, was er ihr sagte. „Limes zuerst. Krotzenburg, dann der Fluss. Aschaffenburg, Nulekaim, Walstat, Heimbuchenthal, Dammbach.“ Erst, als Katharina es genauso sagte, wie Jacob es ihr vorzusprechen versuchte, ließ er seinen Griff locker und sank zurück. Da sie ihm offenbar eine Freude damit machte, wiederholte Katharina die Worte noch einige Male in derselben Reihenfolge, und tatsächlich, ein fast friedlicher Ausdruck legte sich auf Jacobs Gesicht. Er schloss die Augen und seufzte tief.
Katharina lächelte, stand auf und ging zurück zum Herd, um mehr Holz aufzulegen und noch etwas Brühe für Jacob zu holen. Als sie wieder zurück zur Bettstatt ging, hatte Jacob noch immer den friedlichen Ausdruck im Gesicht, und Katharina lächelte erneut. Dann jedoch erstarb ihr das Lächeln auf den Lippen. Jacobs Ausdruck hatte sich nicht einen Deut verändert, seit sie aufgestanden war. „Jacob?“ Sie wusste, dass er tot war, noch bevor sie vor Verzweiflung aufheulte, noch bevor sie fühlte, wie sein Körper steif wurde und langsam erkaltete.
Katharina blieb am Bett sitzen. Draußen wurde es Nacht und sie war völlig erschöpft, doch sie blieb immer noch sitzen ohne einen klaren Gedanken fassen zu können. Es war, als wären sämtliche Gefühle und die Fähigkeit, Entschlüsse zu fassen, von ihr gewichen. Sie saß wie versteinert und starrte nur auf ihren Mann, dessen Gesichtsausdruck im schwindenden Licht noch immer die friedliche Erleichterung zeigte, über die sie gelächelt hatte.
Irgendwann wachte sie auf, noch immer auf dem Stuhl am Bett sitzend und mit steifem Hals. Die nächtliche Schwärze hatte sich in ein kaltes Grau verwandelt und plötzlich wurde ihr die Situation mit einer Wucht klar, die ihr den Atem nahm. Jacob war tot. Sie war allein. Was sollte sie jetzt tun?
Sie glättete die Decke, konnte es aber nicht übers Herz bringen, sie ihm über den Kopf zu ziehen. Stattdessen strich sie ihm noch einmal liebevoll über die Haare und erschauerte, als sie spürte, dass alle Wärme von ihm gewichen war. Langsam stand sie auf. Sie musste den Pfarrer holen, allein konnte sie Jacob nicht begraben. Doch was, wenn er das Kreuzzeichen des Schwarzen Todes auf die Tür malte und Jacob nicht auf dem Friedhof beisetzen wollte? Sie biss sich auf die Lippe, holte Jacobs Halstuch und wand es ihm mit Mühe um, so dass man die Beule nicht mehr sehen konnte.
Als nächstes ging sie zu dem Versteck im hinteren Ende des Schuppens, in dem sie und Jacob die Schmuckstücke aufbewahrten, die sie über die Hungerjahre als Bezahlung empfangen hatten. Damals hatte sie sich zunächst geziert, etwas anderes als die vereinbarten Pfennige anzunehmen, doch Jacob hatte sie überredet. Es sei alles, was die Leute noch hätten, und wenn es zu wertvoll war, dann würden er und Katharina sich eben verpflichten, ihnen mehrere Wochen hintereinander Brot zu bringen. Das hatten sie dann auch getan, verkauften oder tauschten immer wieder einige der Schmuckstücke, um wieder Mehl und Honig für die Lebkuchen oder ein Huhn zu kaufen und hatten dennoch genug übrig, um es vor den plündernden Soldaten verstecken zu müssen. Jetzt nahm Katharina eine silberne Kette und einen Ring heraus, betrachtete sie einen Augenblick und entschied dann, dass es als Stolgebühr für die Beerdigung ausreichen würde. Sie schloss die kleine hölzerne Kiste wieder und verstaute sie sorgfältig an ihrem Platz hinter dem Holzstapel. Dann nahm sie ihr Umhängetuch und machte sich schweren Herzens auf den Weg zur Pfarrei in Krotzenburg.
3.
Manchmal, wenn Martha die Kinder anschrie, ertappte sich Anton dabei, wie er wehmütig an Amalie dachte. Seltsam, dass man das Glück nicht als solches begriff, solange man es hatte. Erst hinterher wurde einem bewusst, dass man glücklich war, auch wenn der Hunger und die Not alles andere in den Schatten stellten. Amalie hatte ihn geliebt und die Kinder auch, sie waren nicht einfach nur da und mussten sich ihren Unterhalt nicht verdienen. Wie oft hatte sie an ihrer Bettstatt gesessen und ihnen Geschichten erzählt bevor sie einschliefen, ihnen liebevoll über den Kopf gestrichen, sie spielen lassen anstatt ihnen Arbeit aufzutragen. Sie hatte ihren letzten Apfel aufgehoben, nur um ihn den Kindern zuzustecken, wenn Anton nicht hinschaute, sorgfältig darauf bedacht, dass jedes ein gleichgroßes Stück bekam.
Dann waren die Missernten gekommen und mit ihnen der Hunger. Mit einem Mal ging es nur noch ums Überleben. Amalie hatte einen unglaublichen Erfindungsreichtum entwickelt, um Essen auf den Tisch zu bringen. Sie hatte mit den Kindern Wettbewerbe veranstaltet, wer die meisten Eicheln finden konnte, sie dann mühevoll geröstet und gemahlen, um daraus Brot zu backen. Brennesselspitzen verwandelte sie in Salate und Suppen, Tannennadeln in Tee. Anton hatte seinen Teil dazu beigetragen, indem er seine lebenslange Gesetzestreue aufgab und das Wildern anfing. Er würde nicht zusehen, wie seine Frau und seine Kinder verhungerten, während die noblen Herrschaften mit ihren überfüllten Vorratskammern aus Spaß zur Jagd gingen, so oft es ihnen gefiel. Nein, er würde vorsichtig vorgehen, niemand würde es merken, solange er geschickt war.
Mit den Jahren hatte seine Geschicklichkeit zugenommen. Er war zu einem Meister des Fallenstellens geworden, obwohl Amalie ihn anflehte, es zu lassen. Sollte er erwischt werden, musste er entweder jahrelang als Galeerensträfling rudern, oder er wurde aufgehängt. Wenn er Glück hatte, wurde er lediglich geblendet und konnte für den Rest seines Lebens nicht mehr sehen. Anton hatte aber weiter gemacht, war den Schergen des Kurfürsten immer wieder erfolgreich ausgewichen, wenn auch manchmal um Haaresbreite, und kannte inzwischen die besten Stellen, um Fallen zu legen, Stellen, die dem Wildhüter entgingen, nicht aber den Tieren.
Jetzt kam Anton auf das Haus zu, einen Hasen in der Hand, den er an den Ohren trug und der bei jedem seiner Schritte hin und her schaukelte. Die Kinder würden sich freuen, endlich wieder Fleisch essen zu können und er wusste, dass Martha nicht einen einzigen Teil des Tieres ohne Verwendung lassen würde. Die einzige Gefahr war der verlockende Geruch, so dass die Kinder zum vermeintlichen Spielen stets strategisch platziert werden mussten, wenn er etwas gefangen hatte. Kam jemand des Weges, gab ein Kind vor, sich verletzt zu haben und das andere jammerte zum Herzerbarmen. Das genügte als Warnsignal für Martha, die sofort den Topf vom Feuer nahm, ihn versteckte und Salbei in die Flammen warf, um damit den Fleischgeruch zu vertreiben. Zeit hatte sie reichlich, wenn die Kinder ihre Rollen gut spielten.
Als Anton jetzt auf das Haus zukam, betrachtete er seinen Sohn Hans, der ihn noch nicht bemerkt hatte. Hans hockte vor dem Haus und summte verträumt vor sich hin, vergaß dabei wieder einmal alles um sich herum, einschließlich der Eicheln, die er eigentlich zwischen zwei Steinen hätte mahlen sollen. Sein strohblondes Haar stand in alle Richtungen, und seine Beine waren so dünn, dass sie wie Streichhölzer aussahen. Anton musste lächeln, doch in diesem Moment schoss Martha aus dem Haus und gab Hans eine Ohrfeige, die ihm fast die Balance kostete. „Dich kann man aber auch nicht mal zum Eichelnmahlen gebrauchen, nutzloser Bengel“, schimpfte sie verärgert. Anton tat es in der Seele weh, als er sah, wie sein Sohn den Kopf zwischen die Schultern steckte und einen Arm hob, um einen eventuellen zweiten Schlag abzuwehren. Schnell rief er: „Schaut mal her, was ich hier habe“, und hielt den Hasen hoch.
Martha blickte auf und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Beim Anblick des Tieres verwandelte sich ihr Gesichtsausdruck in Erleichterung. Der Junge sprang hoch und lief seinem Vater begeistert entgegen, der ihm liebevoll übers Haar ruffelte. „Na, Hänsel? Wieder mal am Träumen?“ Hans ging nicht darauf ein, stattdessen griff er den Hasen und untersuchte die Wunde, die die Schlinge hinterlassen hatte. „Wann nimmst Du mich endlich mit, um es mir zu zeigen?“
„Sobald Du alt genug bist. Im Moment ist es noch zu gefährlich für Dich, und damit auch für mich, und das weißt Du. Wo ist Deine Schwester?“ Hans wies auf den Waldrand, wo sich ein Bach durch die Wiese schlängelte. Dort hockte Grete und wusch Wäsche. Anton seufzte. Sicher war es gut, die Kinder zur Selbständigkeit zu erziehen, doch ging es nicht ein bisschen zu weit, einer Achtjährigen allein die Wäsche aufzubürden? Anton schritt ihr über die Wiese entgegen.
„Gretel! Was für ein großes Mädchen Du bist! Machst Du die Wäsche jetzt schon ganz alleine?“ Grete ließ den Unterkittel, den sie gerade schrubbte, fallen und warf sich strahlend in Antons Arme, so dass ihre Zöpfe flogen. Anton ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie viel aufgeweckter als ihr zehnjähriger Bruder war, doch auch unüberlegter und ständig Gefahr laufend, bei Martha anzuecken. Er schwang seine Tochter durch die Luft und brachte sie zum Lachen. Dann sah sie jedoch, wie der Unterkittel den Bach entlang getrieben wurde und an einem Strauch hängen blieb. Schnell machte sie sich los, rannte zum Ufer zurück und rettete das Wäschestück, das dabei jedoch einen Riss bekam. Gretes fröhliche Miene wechselte sofort in einen sorgenvollen Ausdruck. Was würde Martha tun, wenn sie das sah? Beklommen wrang sie den Kittel aus, nahm die anderen Wäschestücke und folgte ihrem Vater mit hängendem Kopf zurück zum Haus.
„Das müsste für zwei, drei Tage reichen“, sagte Anton zufrieden, als er Martha den Hasen übergab. „Das täte es, wenn es nur wir zwei wären, aber mit vier hungrigen Mündern ....“ Martha brummte vor sich hin, als sie das Tier nahm und gleich damit vors Haus ging, um ihm das Fell abzuziehen. „Hol Wasser!“, rief sie Grete zu, die sofort der Anweisung nachkam. „Und häng die Wäsche auf! Hans, wenn Du fertig mit den Eicheln bist, kannst Du Holz hacken.“
Während die Kinder ihren Aufgaben nachgingen, überlegte Anton, ob er Martha nicht etwas sagen sollte. „Meinst Du nicht, dass wir sie auch mal einfach nur spielen lassen sollten, wenigstens ........“ Martha, die bereits die Hälfte des Fells abgezogen hatte, hielt in ihrer Arbeit inne und sah ihn entrüstet an. „Willst Du mir etwa noch mehr zu tun geben? Ich werde mich noch in Grund und Boden schuften, hast Du auch nur die geringste Ahnung, wie schwer es mir in meinem Zustand fällt? Sie sind ohnehin zu nichts zu gebrauchen, die beiden Gören, ich muss ihnen ständig auf die Finger schauen. Dafür essen sie uns noch die Haare vom Kopf.“ Anton legte ihr besänftigend eine Hand auf die Schulter. Ihm war nicht entgangen, dass ihr Bauch angefangen hatte sich zu wölben. Sie sollten sich auf den Neuankömmling freuen, doch stattdessen machten sie sich nur Sorgen über einen weiteren hungrigen Mund. „Es wird schon alles wieder gut, ewig kann das schlechte Wetter ja nicht andauern. Dann gibt es auch wieder genug für uns und die Kinder, Du wirst schon sehen.“
Martha sah ihn verächtlich an. Wie konnte er nur so naiv sein? Als sie zustimmte, ihn zu heiraten, war sie davon ausgegangen, dass er sie versorgen konnte. Dafür musste sie zwar seine Kinder aufziehen, aber die würden ihr eben zur Hand gehen und die Arbeit mehr und mehr abnehmen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass er die Gören total verzogen hatte; sie waren überhaupt keine Arbeit gewohnt, fielen ihr zur Last und hatten ständig Hunger. Sie hatte getan, was sie konnte, um die beiden daran zu gewöhnen, dass sie sich ihr Brot verdienten. Anstatt ihr dankbar zu sein, dass sie sich um sie kümmerte, hatten sie jedoch ständig nach ihrer Mutter gejammert und konnten nicht einmal die einfachsten Arbeiten verrichten. Der Junge träumte ständig und vergaß alles um sich herum und das Mädchen war so tolpatschig, dass ihr mehr kaputt ging als dass sie etwas schaffte. Ihre eigenen Kinder würden nicht so verhätschelt, da war sie sich sicher.
Alles wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, wenn sie wenigstens genug zu essen hätten. Martha konnte sich kaum erinnern, wie es sich anfühlte, so richtig satt zu sein. Sie ertappte sich dabei, vom Essen zu träumen, von Schweinefleisch und von weißem Brot, von frischem Obst und süßen Pasteten, von Eierspeisen und von Kuchen. Dann blickte sie auf die kümmerliche Suppe auf dem Herd, in der ein paar Steckrübenstücke schwammen, der die bereits zweimal ausgekochten Eichhörnchenknochen einen Hauch von Geschmack gaben, blickte auf die krümeligen Reste des Eichelnbrots mit seinem bitteren Geschmack. Nein, Anton hatte wirklich keine Ahnung, wie schwer es ihr fiel, und dieses Gerede, dass alles schon wieder besser würde, machte sie böse.
Martha hatte den Hasen abgezogen, jetzt nahm sie ihn aus und steckte ihn in den Topf mit dem Wasser, das Grete geholt hatte. In wenigen Minuten breitete sich ein angenehmer Essensgeruch im Haus aus. „Geh raus, Grete. Was stehst Du so unnütz herum? Wir müssen aufpassen, dass niemand kommt und merkt, dass wir Fleisch haben. Zieh Unkraut, und wenn Du jemanden siehst, weißt Du, was zu tun ist.“ Grete lief gehorsam aus dem Haus, nahm eine Harke und machte sich daran, Unkraut zu hacken, immer den Blick auf den Weg gerichtet, der zum Haus führte.
Als Martha ein paar Kräuter aus dem Garten holte, fiel ihr Blick auf den beschädigten Unterkittel. Ungläubig nahm sie ihn von der Leine und schrie: „Was hast Du denn jetzt schon wieder gemacht? Schau Dir doch mal diesen Riss an! Kannst Du denn nicht einmal die Wäsche waschen, ohne sie kaputt zu reißen? Das nähst Du selber, und zwar noch vor dem Essen, sonst bekommst Du nichts davon, hast Du verstanden?“ Grete biss sich auf die Lippe, nickte und arbeitete weiter.
Später, als sie zusammengedrängt im Bett lagen, bat Grete ihren Bruder mit unterdrückter Stimme: „Erzähl mir nochmal von Mutter, wie es war!“ Hans kam der Bitte nur zu gern nach. Auch er wollte die Erinnerung wach halten, immerhin konnte er sich noch an die Mutter erinnern, sie nicht. „Sie hatte lange blonde Haare, so golden wie die Sonne selbst. Wenn sie Dich auf dem Arm hatte, hast Du ihr in die Haare gegriffen und versucht, daran zu ziehen. Mutter hat gelacht und Dir ins Gesicht gepustet, so dass Du losgelassen hast.“ Hans flüsterte eine Reihe von solchen Erinnerungen, bis Grete schläfrig wurde. Er musste aufpassen, dass Martha nichts davon mitbekam; sie hasste es, wenn die Kinder ihre Mutter verherrlichten und empfand es als undankbar. Daher mussten sie mit unterdrückten Stimmen sprechen, denn es gab keine gesonderten Schlafzimmer. Die Bettstatt der Kinder war durch einen notdürftig angebrachten Vorhang von der Stube getrennt, genau wie die der Eltern. So konnten sie zwar meistens die Gespräche zwischen Martha und dem Vater mitbekommen, doch umgekehrt war es genauso.
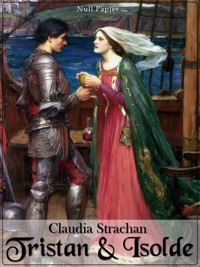
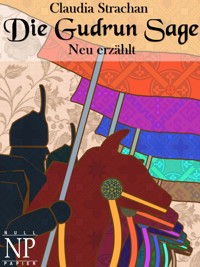













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











