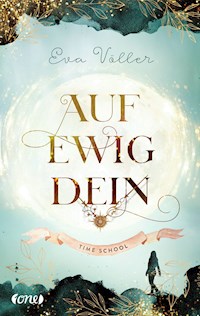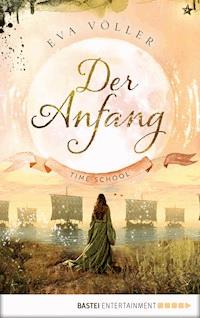9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amsterdam, 1636. Pieter, der neue Lehrling von Rembrandt van Rijn, ist ein Sonderling. Vor allem seine Begeisterung für höhere Mathematik weckt Befremden. Seine Begabung kann er indessen unverhofft anwenden, als auf einmal die Preise für Tulpenzwiebeln in schwindelnde Höhen steigen und Pieter gewisse Gesetzmäßigkeiten erkennt. Doch dann werden mehrere Tulpenhändler tot aufgefunden, und Pieters Meister gerät selbst in den Sog dieser rätselhaften Mordserie. Denn alle Opfer wurden von Rembrandt porträtiert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Amsterdam, 1636. Pieter, der neue Lehrling von Rembrandt van Rijn, ist ein Sonderling. Vor allem seine Begeisterung für höhere Mathematik weckt Befremden. Seine Begabung kann er indessen unverhofft anwenden, als auf einmal die Preise für Tulpenzwiebeln in schwindelnde Höhen steigen und Pieter gewisse Gesetzmäßigkeiten erkennt. Doch dann werden mehrere Tulpenhändler tot aufgefunden, und Pieters Meister gerät selbst in den Sog dieser rätselhaften Mordserie. Denn alle Opfer wurden von Rembrandt porträtiert ...
ÜBER DIE AUTORIN
EVA VÖLLER hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.« Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
EVA VÖLLER
TULPENGOLD
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2018 by Eva Völler
Copyright Deutsche Originalausgabe © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Unter Verwendung von Motiven von © akg-images und © shutterstock: T.Eniko | AKaiser | Buravsoff | shtiel
Tulpen-Illustrationen im Innenteil: © shutterstock: mari.nl
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN: 978-3-7325-5598-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Alles ist nicht Gold, was gleißt,
wie man oft Euch unterweist.
Manchen in Gefahr es reißt,
was mein äuß’rer Schein verheißt.
(William Shakespeare, »Der Kaufmann von Venedig«)
Für Henri
»Diesem Mann kann niemand mehr helfen«, sagte der Medicus. Er richtete sich auf und wischte sich die Hände an seinem schwarzen Umhang ab.
Ein Raunen erhob sich unter den Zuschauern, die sich am Fundort der Leiche versammelt hatten – einem Fischmarkt im Zentrum von Amsterdam.
»War der Fisch an seinem Tod schuld, Doktor Bartelmies?«, fragte der Polizeihauptmann, der neben ihm stand. »Ist er vielleicht an einem Bissen erstickt?«
»Dazu bedürfte es näherer Untersuchung, auch wenn es nicht ausgeschlossen ist«, erklärte Doktor Bartelmies. »Bis jetzt steht nur eines fest, und das ist der Exitus.«
»Ich höre wohl nicht richtig!«, rief einer der Umstehenden, seinem Geruch nach ein hart arbeitender Fischhändler. Seine Stimme klang aufgebracht. »Was soll dieses Gerede bedeuten?«
»Exitus«, sagte ein Jüngling hinter ihm. »Ausgang. Im medizinischen Sinne auch Tod. Maskulinum. U-Deklination. Exitus, exitūs, exituī …«
Der Fischhändler drehte sich wütend um. »Willst du ein paar Backpfeifen?«
»Nein«, sagte der Jüngling.
»Dann halt gefälligst den Mund, sonst fängst du dir eine.«
»Nicht doch, Mijnheer«, sagte der ältere Mann neben dem Jungen freundlich, aber bestimmt. »Er meint es nicht böse.«
Der Fischhändler wandte sich ab und betrachtete den Toten vor seinem Stand. Normalerweise hätte man kein Aufheben um einen solchen Fall gemacht, schließlich starben jeden Tag Leute. Allerdings konnte er sich an keinen Fall erinnern, bei dem jemand mitten auf dem Fischmarkt einfach tot umgefallen war. Bedeutsam war dabei wohl auch, dass es sich bei dem Dahingeschiedenen nicht um einen armen Schlucker handelte – für so einen hätte man gewiss nicht eigens den Polizeihauptmann und den Medicus hergeholt –, sondern um jemanden von Rang und Namen. Das sah man schon an der Kleidung. Der Tote trug einen Umhang aus schwerem, wertvollem Tuch und teure Lederstiefel. Und an seinem Gürtel hing eine dicke Börse, auf die sich viele begehrliche Blicke richteten, einschließlich die des Fischhändlers. Er fragte sich, bei wem das gute Stück – oder zumindest ein Teil des Inhalts – wohl landen würde. Beim Medicus, der bereits angedeutet hatte, dass zur Ermittlung der Todesursache noch eine Leichenschau nötig sei, oder beim Polizeihauptmann, der den Abtransport des Toten organisieren würde? Oder womöglich bei allen beiden, weil sie meinten, es sich für ihre Mühen verdient zu haben, und eine gerechte Aufteilung als sinnvoll erachteten?
Der Fischhändler sann darüber nach, dass wenigstens ein Teil des Geldes mit Fug und Recht ihm selbst zugestanden hätte, schließlich hatte er den Schaden davon, dass dieser feine Herr direkt vor seinem Stand zusammengebrochen war, ein Stück Räuchermakrele in dem weit aufgesperrten Mund. Wer von den Leuten ringsum nicht gerade auf die fette Geldbörse starrte, grauste sich nun gewiss vor dem Fisch, obwohl es an diesem nicht das Geringste auszusetzen gab. Das Ende vom Lied würde sein, dass er die gesamte Ware wieder mit nach Hause nehmen musste, weil niemand ihm mehr etwas abkaufte. Zum Glück war es recht kühl, der Fisch würde sich schon noch eine Weile halten, doch das war auch der einzige Trost.
Der Fischhändler hätte seinen Groll gern an jemandem ausgelassen, beispielsweise an diesem vorlauten Burschen, der sich über ihn lustig gemacht hatte, indem er mit seinen Lateinkenntnissen prahlte. Ein paar tüchtige Ohrfeigen hätten diesem Maulhelden nicht geschadet. Allerdings war er trotz seiner Jugend von drahtiger Gestalt, womöglich würde er zurückschlagen.
Aufschreie der Umstehenden ließen ihn zusammenzucken. Der Polizeihauptmann hatte den Toten vom Rücken auf die Seite gedreht (wollte er etwa jetzt schon die Börse verschwinden lassen?) und dadurch unabsichtlich dafür gesorgt, dass dem Mann der Fischbissen aus dem Mund rutschte, gefolgt von weißlichem Erbrochenen.
»Damit hat sich eine genauere Untersuchung wohl erübrigt«, sagte der Medicus. Er beugte sich nochmals über den Toten und betrachtete eingehend den offen stehenden Mund, indem er mithilfe eines Stöckchens die Lippen von den Zähnen zurückschob. »Dieser Mann wurde zweifellos Opfer einer Vergiftung.«
*
Der daraufhin einsetzende Aufruhr war beträchtlich. Der Fischhändler stimmte ein empörtes Geschrei an, als der Polizeihauptmann ihn von zwei Bütteln ergreifen und fortschleppen ließ. Den Einwand von Doktor Bartelmies, dass es keineswegs zwingend am Fisch gelegen haben müsse, hörte kaum noch jemand. Der eine oder andere aus der Menge versuchte inmitten der Unruhe auf beiläufige Weise, sich dem Toten (oder besser: dessen Börse) zu nähern, doch der Polizeihauptmann hatte ein scharfes Auge auf den Leichnam und verscheuchte mit gut gezielten Knüppelschlägen jeden, der sich auf Armlänge herantraute.
»Komm, Pieter«, sagte Joost Heertgens zu seinem Patensohn. »Wir müssen weiter.«
»Ich würde gern wissen, woran der Medicus sah, dass der Mann an Gift starb.«
»Das hat er gewiss aufgrund seiner Studien erkannt. Doctores wie dieser sind genau wie dein Vater gelehrte Männer, die an berühmten Universitäten studiert haben.«
»Ich würde gern wissen, woran er es sah.«
»Er sah es gewiss an dem, was der Tote ausgespien hat. Oder genauer: was ihm aus dem Mund fiel«, verbesserte Joost Heertgens sich. »Wahrscheinlich war der Fisch schlecht. Verdorbener Fisch ist giftig, das weiß jeder. Daran ist schon so manch einer gestorben.«
Nur widerwillig ließ sich der Junge vom Schauplatz des Geschehens fortziehen. »Der Medicus sagte aber, es müsse nicht am Fisch gelegen haben.«
»Der Mann ist tot, gleichviel aus welchen Gründen. Möge er in Frieden ruhen.«
»Ich würde gern wissen, woran er starb.«
»Du willst vieles wissen, doch nicht alles trägt zu deiner Bildung bei«, versetzte Joost, dem es immer schwerer fiel, Geduld zu bewahren. »Schließlich willst du ja kein Medicus werden, sondern Maler.« Erneut korrigierte Joost sich. »Dein Vater wollte es, und es obliegt mir als deinem Vormund, seinen letzten Willen zu vollziehen.« Danach verstummte er und gab sich sorgenvollen Gedanken hin. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sein Vetter nicht so früh das Zeitliche segnen müssen, zumal Maarten sich bester Gesundheit erfreut hatte und noch viele Jahre selbst für seinen Sohn hätte sorgen können. In den letzten Jahren hatte Joost ihn zwar nicht häufig gesehen, aber an ihrer freundschaftlichen Verbundenheit hatte das nichts geändert. Maartens Tod hatte Joost zutiefst getroffen und ein bedrückendes Gefühl eigener Vergänglichkeit in ihm geweckt.
Als Pate von Maartens einzigem Sohn nahm Joost seine Aufgabe ernst, und auch wenn er die damit verbundenen Beschwernisse und Umstände manchmal verfluchte, würde er getreulich alle nur erdenklichen Widrigkeiten auf sich nehmen, um Maartens letzten Willen zu erfüllen und Pieter bei dem gewünschten Lehrmeister unterzubringen.
Bis jetzt entwickelte sich alles hoffnungsvoll. Die im Vorfeld geführte Korrespondenz war aussichtsreich verlaufen. Im Falle etwaiger verbleibender Unklarheiten hatte Joost Heertgens eine Menge schlagkräftiger Argumente zur Verfügung. Routinemäßig tastete er nach der schweren Geldkatze unter seinem Wams. Pieters neuer Lehrherr würde keinen Grund zur Klage haben. Gleichwohl konnte ein Mindestmaß sinnvoller Instruktion nicht schaden.
»Hör mir zu, Pieter«, sagte Joost. »Wenn wir gleich im Haus des Malers ankommen, darfst du dort nur reden, wenn dir jemand eine Frage stellt.«
»Ich weiß. Das sagtest du bereits auf der Fahrt hierher.«
Joost erlaubte sich ein frustriertes Seufzen. »Ich vergesse ständig, dass du ein ungewöhnliches Gedächtnis hast und dir alles merkst. Aber manchmal … Nun, wie soll ich sagen … manchmal begreifst du nicht alles richtig. So wie vorhin bei dem Fischhändler. Deine Erklärung zum Begriff Exitus war sicher nicht das, was er hören wollte.«
»Er hat danach gefragt.« Es klang nicht aufsässig, sondern wie eine sachliche Feststellung, als sei es Joost selbst, der die Dinge verdrehte und nicht einsehen wollte, wie es sich in Wahrheit verhielt.
Joost gab es fürs Erste auf. Es war ein mühseliges Unterfangen, Pieter zurechtzuweisen. Blieb nur zu hoffen, dass er sich als Malerlehrling fügsamer verhielt. Und falls sich doch alles schwieriger anließ als erwartet – der Inhalt der Geldkatze würde es im Zweifel schon richten.
Sie spazierten an einer Gracht vorbei, die von vornehmen Häusern gesäumt war. Weit konnte es nicht mehr sein, ihr Ziel musste sich ganz in der Nähe befinden, zumindest hatten sie bereits das richtige Viertel erreicht. Joost war schon unzählige Male in Amsterdam gewesen, auch wenn er die letzten Jahre lieber in der beschaulichen Abgeschiedenheit seines ländlich gelegenen Anwesens verbracht hatte. Früher hatte er den Trubel und das bunte, abwechslungsreiche Leben in der Stadt als unterhaltsame Abwechslung geschätzt, doch die Jahre hatten in ihm das Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit verstärkt. Öfter als einmal im Quartal kam er nicht mehr nach Amsterdam, und selbst das war ihm manchmal noch zu viel. Sobald er den Jungen ordentlich untergebracht und damit Maartens letzten Wunsch erfüllt hatte, würde er sich wieder in die Idylle seines Heimatdorfs zurückziehen und all die Bücher lesen, die sich noch dort stapelten – etliche davon aus Maartens Nachlass. Eigentlich gehörten sie Pieter, da der Junge Maartens einziger Erbe war, doch er wollte sie nicht, da er sie allesamt bereits gelesen hatte.
Joost wandte sich an eine junge Frau, unter deren Aufsicht zwei Knechte Fässer zu einer Schenke rollten.
»Mevrouw, könnt Ihr mir sagen, wo ich die Nieuwe Doelenstraat finde? Sie müsste ganz in der Nähe sein.«
Die Frau lächelte, und für einen Moment kam es Joost Heertgens so vor, als sei die Sonne aufgegangen. Er wünschte sich selten, wieder jung zu sein. Dies war einer jener raren Momente.
»Gleich um die Ecke, und schon seid Ihr da.«
»Habt Dank, Mevrouw.«
Anschließend war das Haus von Rembrandt van Rijn schnell gefunden. Ein Schild an der Backsteinfassade, beschriftet mit dem Namen des Meisters, wies es als Kunsthandlung und Maler-Atelier aus.
Joost streckte die Hand nach dem Türklopfer aus, ließ sie dann aber wieder sinken und zog den Jungen zu sich heran. »Lass dich einmal ansehen, Pieter.« Er rückte ihm die Kappe zurecht, strich ein paar herausgeschlüpfte Locken glatt und zupfte s olange an dem wollenen Umhang herum, bis er in ordentlichen Falten herabfiel. »So, jetzt bist du präsentabel. Hm, du bist tatsächlich ein ansehnlicher Kerl, wenn man sich die Pickel und die Bartfusseln einmal wegdenkt. Du siehst deiner hübschen Mutter wirklich sehr ähnlich, Gott hab sie selig.«
Pieter ließ seine Bemühungen mit stoischer Miene über sich ergehen, aber Joost merkte, dass dem Jungen die Berührungen nicht sonderlich angenehm waren. Er klopfte Pieter ein wenig unbeholfen auf die Schulter und trat einen Schritt zurück. »Du wirst bald anfangen müssen, dir den Bart zu schaben. Oder hatte ich dir auch das bereits gesagt?«
»Nein.«
»Nun, dann weißt du es jetzt.«
»Bin ich nun ein Mann?«
»Wieso fragst du mich das?«
»Weil Vater einmal sagte, sobald ich ein Mann wäre, solle ich mir den Bart schaben.«
Diesmal kam Joosts Seufzer von Herzen. »Das kommt schon noch. Zuallererst bist du ab heute der Lehrling eines sehr berühmten Kunstmalers. Sofern sich alles so fügt, wie dein Vater es sich wünschte«, setzte er hinzu. Mit einem weiteren Seufzer betätigte er den Türklopfer.
Nach einer Weile wurde ihnen von einer Magd mittleren Alters geöffnet. Joost begrüßte sie freundlich und stellte sich vor.
»Mein Name ist Joost Heertgens, und das ist mein Mündel Pieter, der in diesem Hause Lehrling werden soll. Wir sind für heute angekündigt.«
Die Magd nickte nur mit verdrießlicher Miene und ließ sie vor der Tür stehen, während sie im hinteren Teil des Hauses verschwand, wo sie leise mit jemandem sprach. Kurz darauf erschien eine jüngere Frau mit einem hübschen, lebhaften Gesicht. Über ihrem Kleid trug sie einen volantbesetzten Hausmantel. Im Gegensatz zu der griesgrämigen Magd begrüßte sie die Besucher mit einem Lächeln.
»Mein Mann ist leider gerade außer Haus, aber er kommt in Kürze zurück. Ihr könnt gern solange mit mir in der Stube warten.«
Dankbar ließ Joost sich auf einem gepolsterten Stuhl vor dem Kamin nieder. Pieter musste mit einem Schemel in der Ecke vorliebnehmen, aber daran würde er sich gewöhnen müssen. Als Lehrjunge konnte er keinen Luxus erwarten.
Das Kaminfeuer verbreitete behagliche Wärme, und Joost streckte erleichtert die Beine von sich. Die letzten Wochen hatten ihn angestrengt. Er hatte zuerst von Zeeland nach Leiden reisen müssen, um Maartens Nachlass aufzulösen und den Jungen abzuholen, und dann von dort aus nach Amsterdam, und das alles innerhalb kurzer Zeit. Er spürte das nahende Alter. Umso wichtiger war es, gleich heute für klare Verhältnisse zu sorgen und den Jungen fest unterzubringen.
Die junge Hausfrau klingelte nach der Magd und befahl ihr, dem Besuch Wein zu servieren. Auch dafür war Joost dankbar, obwohl der Wein stark verdünnt und sauer war. Für richtig wichtige Gäste – also solche, die bereit waren, mehrere Hundert Gulden für ein Gemälde auszugeben – hätte sie vermutlich den besten Wein hervorholen lassen. Doch das störte Joost nicht. Er war nicht zum Trinken hier, sondern in Geschäften.
Die Gattin des Malers hatte es sich in einem Lehnstuhl bequem gemacht und beugte sich über eine Stickarbeit. Ab und zu blickte sie auf und stellte eine Frage, und Joost beeilte sich, sie schnellstmöglich zu beantworten, ehe Pieter es tun konnte.
»Ihr kommt aus Leiden, wie ich hörte?«
»Mein Mündel Pieter kommt von dort. Ich selbst lebe in Zeeland. Drei- bis viermal im Jahr komme ich nach Amsterdam, der Geschäfte wegen. Ich unterhalte hier ein Kontor, doch den täglichen Handel hat mein Verwalter unter sich. Ich schaue nur gelegentlich nach dem Rechten und kümmere mich um größere Aufträge.«
»Womit handelt Ihr, Mijnheer?«
»Mit vielem, aber hauptsächlich mit Effekten.« Als er den verständnislosen Blick der jungen Frau bemerkte, fügte er erklärend hinzu: »Dabei geht es um Anteile an Handelsgütern, meist Schiffsladungen. Genau genommen kaufe und verkaufe ich Waren, die mit den großen Frachtern nach Holland kommen.«
»Oh, Ihr seid ein Händler der Ostindien-Kompanie?« Das Interesse der jungen Frau an Joost stieg merklich. »Das hatte mein Mann gar nicht erwähnt. Er sprach nur davon, dass Ihr ihn um eine Ausbildung für Euren Patensohn ersucht habt.« Sie warf einen Blick auf den Jungen. »Du bist Pieter, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Pieter.
»In den Briefen stand, dass du bald achtzehn wirst. Die meisten Schüler meines Mannes sind zu Beginn ihrer Lehrzeit viel jünger.«
»Pieter war noch auf der Lateinschule«, warf Joost Heertgens ein.
»Ich weiß, davon habt Ihr meinem Mann geschrieben. Geht man dort nicht meist mit vierzehn oder fünfzehn ab?«
»Pieter hat ein bisschen länger gebraucht. Aber jetzt ist er bereit für den Ernst des Lebens.«
»Du willst also das Malerhandwerk erlernen, Pieter?«
»Ich weiß es nicht.«
Joost unterdrückte ein Stöhnen. »Natürlich will er es. Genauer: Es war der dringende Wunsch seines Vaters, der das ungeheure Talent seines Sohnes früh erkannt hat und unbedingt wollte, dass es bestmöglich gefördert werde. Pieter, zeig der Dame deine Skizzen.«
Die Gattin des Malers hob abwehrend die Hand. »Das ist Sache meines Mannes. Der versteht mehr davon.«
Beim Fortgang des Gesprächs stellte sich jedoch rasch heraus, dass sie von einer bestimmten anderen Sache mindestens genauso viel verstand wie ihr Mann.
»Wie ich hörte, hattet Ihr im Zuge der Korrespondenz mit meinem Mann bereits eine Einigung über das Lehrgeld für Euer Mündel erzielt.«
Joost nickte. »Hundert Gulden jährlich, bei freier Kost und Logis.«
»Eigentlich bieten wir unseren Lehrlingen keine Unterbringung an. Bis zu unserem Einzug hier wurden sie sogar in einer Werkstatt außerhalb des Hauses unterrichtet. Sie wohnen alle bei ihren Familien. Hat mein Mann Euch das nicht mitgeteilt?«
Joost ging davon aus, dass sie sehr genau wusste, was ihr Gatte ihm alles mitgeteilt hatte.
»Doch«, sagte er. »Meister Rembrandt schrieb mir davon, worauf ich zurückschrieb, dass man über ein angemessenes zusätzliches Kostgeld gewiss eine Einigung erzielen könne. Damit war Euer Gatte einverstanden. Das ist der letzte Stand der Dinge.«
Sie beugte sich vor. »Was wäre denn Eure Vorstellung von einem angemessenen zusätzlichen Kostgeld?«
»Achtzig Gulden per anno.«
»Hundertzwanzig«, gab sie ohne mit der Wimper zu zucken zurück.
Sie schien selbst zu bemerken, wie überzogen diese Forderung war, denn sie beeilte sich, eine Begründung zu erfinden. »Der Junge sieht aus wie ein starker Esser. Er ist groß und kräftig für seine siebzehn Jahre. Zudem muss man noch die Unterbringung berechnen – er bekäme ja auch ein Bett zum Schlafen gestellt.«
Joost tat so, als würde es ihn große Überwindung kosten, sich geschlagen zu geben. »Nun gut. Der letzte Wille meines Vetters bedeutet mir alles, und meine Verpflichtung als Vormund des armen Jungen ist mir heilig, auch wenn ich dafür Opfer bringen muss.« Als ein mit allen Wassern gewaschener Händler verstand er sich darauf, jenen Ton von Entsagung in seine Stimme zu legen, der keinen Zweifel daran ließ, wie bitter dieses Nachgeben für ihn war. Die Frau des Malers mochte geschäftstüchtig sein, aber sie war zu jung, um seine Durchtriebenheit zu durchschauen. Das schlechte Gewissen stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Es soll dem Jungen an nichts fehlen. Er darf sich immer satt essen und bekommt zu den Sonntagsmahlzeiten eine ordentliche Portion gutes Fleisch. Und er muss keine Hilfsdienste im Haushalt verrichten, das könnt Ihr in den Kontrakt schreiben. Eine eigene Kammer können wir ihm jedoch nicht bieten, er muss auf dem Dachboden nächtigen, wo auch ein Geselle meines Gatten schläft.« Hastig setzte sie hinzu: »Der einzige, der bei uns untergebracht ist. Laurens ist ein Verwandter meines Mannes, deshalb die Ausnahme.«
»Gewiss, Mevrouw.« Joost verzog keine Miene. »Damit Ihr meinen guten Willen erkennt, würde ich das Lehrgeld mitsamt dem Kostgeld gern gleich für drei Jahre im Voraus bezahlen.«
In ihren Augen stand ein erwartungsvolles Funkeln. »Ihr habt all dieses Geld bereits dabei?«
»Ich schätze klare Verhältnisse und sorge gern vor.« Mit treuherzigem Augenaufschlag legte er die Geldkatze auf das Tischchen, das zwischen seinem Stuhl und dem der Hausherrin stand. »Darin befinden sich ungefähr tausend Gulden. Warum nehmt Ihr Euch nicht einfach das Geld für drei Jahre heraus? Damit erspart Ihr einem alten Mann mit schlechten Augen die Mühe des Zählens.«
Ihre Miene zeigte genau, was sie dachte. Hätte sie weiter feilschen sollen? Wenn er tausend Gulden auf den Tisch legte, wäre vielleicht viel mehr für sie drin gewesen!
Freundlich bemerkte er: »Ich habe deshalb so viel Geld dabei, weil ich noch Schiffspapiere erwerben wollte. Diesen Kauf kann ich aber ohne Weiteres auf eine spätere Zeit verschieben, denn mein Patenkind ist mir wichtiger.«
Die Lüge kam ihm glatt über die Lippen, und die junge Frau glaubte sie nur zu gern. Zögernd griff sie nach dem schweren Lederbeutel, und das sachte Klimpern vieler Goldstücke erfüllte die Stube. Mit diesem Klang war die Sache besiegelt. Joost spürte die Macht des Augenblicks ebenso wie die Gattin des Malers, über die er im Vorfeld der Geschäftsanbahnung genauso gründlich Erkundigungen eingeholt hatte wie über ihren Mann. Bis vor Kurzem hatten die jungen Eheleute noch bei dem reichen Kunsthändler Hendrick van Uylenburgh gewohnt, einem älteren Vetter von Saskia. Für die Ausübung des Malerhandwerks und die Ausbildung seiner Lehrlinge hatte Rembrandt anfangs einen Speicher angemietet, doch inzwischen benutzte er dafür das obere Geschoss des neuen Hauses – das sparte Geld. Seit dem Umzug in die Nieuwe Doelenstraat rann Saskias Erbe den beiden allerdings zuweilen schneller durch die Finger, als Rembrandt malen konnte. Das Haus war nur gemietet, aber es war absehbar, dass das Ehepaar sich bald nach einem eigenen Domizil umtun würde, denn sie wollten höher hinaus. Rembrandt war ehrgeizig und nicht frei von Geltungsdrang. Dank seines Talents konnte er über seine Auftragslage nicht klagen, doch er neigte dazu, über seine Verhältnisse zu leben. Nicht auf die Art, die manche Männer seines Alters arm machte – er vergeudete sein Geld weder für Huren noch beim Glücksspiel –, doch kostspielig war sein Steckenpferd allemal. Er war ein begeisterter Sammler von Kunst und wertvollen Raritäten.
Unauffällig ließ Joost seinen Blick über die Einrichtung der Stube schweifen, während die Dame des Hauses mit konzentrierter Miene Gulden abzählte. Durch die Bleiglasfenster fiel ausreichend Tageslicht in den Raum. Auf einem Wandbord war feines Porzellan neben Silbergeschirr und gläsernen Trinkpokalen aufgereiht. Mehrere Gemälde des Meisters zierten die Wände, darunter ein Bildnis, auf dem die Gattin des Malers als Blumengöttin dargestellt war. Eine Wand wurde von einem breiten Pfostenbett eingenommen – die Schlafstätte der Eheleute und zugleich zur Schau gestelltes Statussymbol, ebenso wie der mit Schnitzereien verzierte Prunkschrank für die feine Wäsche. In der Mitte des Raums prangte ein kunstvoll gedrechselter Tisch, umgeben von einem halben Dutzend hochlehniger Stühle. Hier würde Pieter allerdings nicht seine Mahlzeiten einnehmen, sondern zusammen mit dem Gesinde in der Küche, wie es sich für einen Lehrjungen geziemte. Joost warf einen kurzen Blick auf den Jungen, der unruhig auf seinem Schemel hin und her rutschte.
Nur noch ein paar Minuten, beschwor Joost ihn mit flehendem Blick. Doch Pieter schien gegenüber seinen stummen Bitten taub zu sein.
»Ich will etwas fragen«, sagte er.
Saskia blickte irritiert von den Münzen auf. »Jetzt habe ich mich verzählt.«
»Fangt von vorn an und bildet Stapel zu je zehn Gulden«, riet Joost ihr.
Sie runzelte die Stirn, tat jedoch wie geheißen.
Joost versuchte, Pieter zu ignorieren, aber der ließ sich nicht beirren.
»Ich will eine Frage stellen.«
»Natürlich«, meinte Joost. »Oh, warte.« Er zog seine Tasche mit der Pfeife und dem Tabak hervor und warf sie zu Pieter hinüber, der sie behände auffing. »Stopf mir doch zuerst einmal ordentlich meine Pfeife. Ich habe dir ja gezeigt, wie man es macht.«
Mit kaum verhohlener Ungeduld kam Pieter dem Ansinnen nach. Anschließend ließ Joost sich von ihm mit einem Holzspan, den der Junge im Kamin ansteckte, Feuer geben, doch er hatte kaum den Pfeifentabak richtig zum Glühen gebracht, als Pieter auch schon mit seiner Frage herausplatzte.
»Kann ich auf den Lokus?«
*
Saskia klingelte nach der Magd, die Pieter den Weg zum Abtritt zeigen sollte. Diesmal erschien nicht die schlecht gelaunte Person, die ihnen die Tür geöffnet und den dünnen Wein gebracht hatte, sondern ein junges Mädchen von höchstens achtzehn Jahren, reizvoll anzuschauen mit ihrem lieblichen Gesicht und den deutlichen Rundungen unter der Schürze. Pieter schluckte sichtlich bei ihrem Anblick, und seine Augen wurden groß. Auf dem Weg zur Tür stolperte er, weil er auf das Hinterteil des Mädchens geblickt hatte statt auf seine Füße.
Der Junge ist wirklich bald ein Mann, dachte Joost mit einem Hauch von Wehmut. Er erinnerte sich noch sehr gut an die Zeit, als er selbst in Pieters Alter gewesen war. Mit siebzehn waren alle Jünglinge hilflose Opfer ihrer aufkeimenden Triebe, dem war auch durch Beten und Fasten nicht beizukommen.
Saskia war mit dem Zählen des Geldes fertig. »Ich habe sechshundertsechzig Gulden entnommen. Möchtet Ihr noch einmal selbst nachzählen, Mijnheer?«
Er hatte aus den Augenwinkeln sehr genau Anzahl und Höhe der von ihr gebildeten und zur Seite geschobenen Stapel im Blick gehabt. Doch das brauchte sie ja nicht zu wissen.
»Nicht doch, Mevrouw. Ich vertraue Euch und Eurem Wort, denn nie traf ich eine ehrbarere und im Geschäftsleben versiertere Dame als Euch!« Mit einem zuvorkommenden Lächeln schob er die übrigen Münzen zurück in den Lederbeutel und nahm ihn wieder an sich.
Saskia errötete vor Stolz und Freude, denn mit seiner Schmeichelei hatte er anscheinend einen Nerv getroffen. Sie verstaute die abgezweigte Summe sorgfältig in einem Rosenholzkästchen.
»Von Eurem ansprechenden Äußeren will ich besser gar nicht erst reden«, setzte Joost noch eins drauf. »Denn schließlich seid Ihr eine verheiratete Frau. Aber lasst mich Euch zumindest sagen, dass Ihr den Augen eines alten Mannes einen Anblick bietet, der das Herz erwärmt!« Bei diesen Worten zog er den Kontrakt aus seiner Tasche und breitete ihn auf dem Tischchen aus. »Hier ist der Lehrvertrag. Inhaltlich entspricht er den allgemein anerkannten Regularien der Malergilde. Fehlen nur noch unsere Zusatzvereinbarungen.«
Saskia holte Feder und Tinte, damit Joost den Vertrag um die besprochenen Punkte ergänzen konnte.
Nun bedurfte es nur noch der Unterschrift des Meisters, um den Handel perfekt zu machen. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass der Hausherr just in diesem Moment nach Hause kam, womit dem Abschluss nichts mehr im Wege stand.
Mit Wärme in der Stimme stellte Saskia ihrem Gatten den Besucher vor und erwähnte anschließend nicht nur die großzügige Regelung, die sie über das Kostgeld getroffen hatten, sondern hob auch hervor, wie zurückhaltend und wohlerzogen der neue Lehrling doch sei. In dem Punkt würde Pieter sie zweifellos bald eines Besseren belehren, aber nun steckte das Geld bereits in ihrem Kästchen.
Saskia reichte ihrem Gemahl die Tintenfeder, damit er den Lehrvertrag unterzeichnen konnte. Rembrandt tat es mit energischem Federstrich, ohne mehr als einen flüchtigen Blick darauf zu werfen, während Joost die verbleibende Zeit bis zu Pieters Rückkehr nutzte, um dem Maler Honig um den Bart zu schmieren. Das Gute daran war – er musste dabei nicht einmal übertreiben.
»Ihr ahnt nicht, was meinem verstorbenen Vetter dieser Tag bedeutet hätte! Er hielt Euch für den größten lebenden Maler unserer Zeit, und ich kann Euch versichern, dass er ein hochgebildeter und überaus kunstbeflissener Mann war. In seiner Jugend war er in Italien und schwärmte mir von den Gemälden und anderen Kunstwerken vor, die er dort betrachtet hatte. Große Namen von Malern und Bildhauern, die Euch sicher nicht fremd sind – Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizian, Caravaggio, Bellini, Giorgione …« Joost ließ seinen Blick in die Ferne schweifen, als könne er sämtliche Kunstwerke vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen sehen. »Euer Name fiel mit jenen Legenden in einem Atemzug. Es war sein größter Wunsch, Pieter zu Euch in die Lehre zu geben. Mit diesem Wunsch auf den Lippen tat er seinen letzten Atemzug, nachdem er mir alles Geld anvertraut hatte, das er sich eigens dafür vom Munde abgespart hatte.«
Letzteres war schamlos übertrieben, aber im Kern traf es Maartens letzten Willen, und der allein zählte schließlich. Und es erfüllte seinen Zweck, denn Rembrandt war Komplimenten dieser Art gegenüber keineswegs immun. Sein Gesicht erstrahlte vor Freude, und er warf sich ein wenig in die Brust, als wäre es durchaus folgerichtig, ihn in eine Reihe mit jenen Ruhmesgrößen zu stellen, die Joost ihm gerade aufgezählt hatte.
Tatsächlich hatte Maarten große Stücke auf Rembrandt van Rijns Kunst gehalten. Obwohl er den Maler nie persönlich getroffen hatte, war er von dessen Bildern, die er bei einem Besuch der Uylenburgh’schen Galerie einmal hatte besichtigen können, zutiefst beeindruckt gewesen. Die Entscheidung, Pieter den Beruf des Kunstmalers erlernen zu lassen, hatte er schon vorher getroffen, aber von diesem Moment an hatte für ihn außer Frage gestanden, dass Pieters Lehrherr niemand anderer sein dürfe als Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Bedauerlicherweise war er gestorben, bevor er alles Nötige veranlassen konnte, doch diese Aufgabe hatte Joost ihm ja nun abgenommen. Und zwar auf ganz hervorragende Weise, wie er nicht ohne Selbstzufriedenheit konstatierte. Maarten würde im Himmel seine helle Freude daran haben.
Als Pieter vom Abtritt zurückkam, war bereits alles geregelt, sodass es auch schon ans Abschiednehmen gehen konnte. Draußen vor der Tür nahm Joost den Jungen noch einmal beiseite. »Deinen Reisesack lasse ich dir gleich herbringen.« Dann erteilte er Pieter mit leiser Stimme letzte Instruktionen. »Es gibt einige goldene Verhaltensregeln, die du unbedingt verinnerlichen und anwenden musst. Erstens: Sprich nur, wenn du gefragt wirst, und antworte nur mit Ja oder Nein. Ist dies nicht möglich, beschränke deine Antworten auf höchstens zehn Worte. Zweitens: Stell keine Fragen. Zum Abtritt darfst du übrigens ungefragt gehen«, flocht Joost vorsorglich ein. »Drittens: Gib keine Widerworte, und gehorche den dir erteilten Anweisungen.«
Es blieb noch Zeit für die Aufzählung einiger untergeordneter Bestimmungen, etwa, kein Geld für Weiber zu verschleudern, nicht zu fluchen und nicht zu raufen und in geschlossenen Räumen nicht auf den Boden zu spucken, doch diesen Punkten maß Joost im Grunde keine besondere Bedeutung bei, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Pieter. Was solche Belange betraf, würde er sich bestimmt nicht unliebsam hervortun.
»Ach, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen«, sagte Joost zum Schluss. »Ab und zu wirst du etwas Geld brauchen, um dir irgendwelche Kleinigkeiten zu kaufen. Aus diesem Grund …« Er unterbrach sich und betrachtete seinen Patensohn, der von einem Fuß auf den anderen trat und kaum an sich halten konnte. »Was ist los mit dir, Junge?«
»Darf ich dich etwas fragen, Onkel Joost? Auch wenn es gegen die goldene Verhaltensregel Nummer zwei verstößt?«
Joost seufzte. »Stell die Frage.«
»Welche Kleinigkeiten soll ich mir kaufen?«
»Du sollst dir nichts kaufen. Ich erwähnte es nur für den Fall, dass du etwas benötigst.«
»Was denn?«
»Nun … beispielsweise ein neues Hemd oder sonstige Kleidung. Oder ein Rasiermesser, wenn du anfängst, dir den Bart zu schaben. Oder hast du schon eines?«
»Nein.«
»Na siehst du.«
»Wann soll ich mir das Rasiermesser kaufen?«
»Das kannst du selbst entscheiden.« Joost runzelte die Stirn, denn er hatte den untrüglichen Eindruck, dass er im Begriff war, etwas Wichtiges zu vergessen. Zu seiner Erleichterung fiel es ihm sofort wieder ein. »Was das Geld angeht – du kannst dir welches holen. Ich habe dir ja heute nach unserer Ankunft mein Kontor gezeigt. Dorthin kannst du gehen und dir von Mijnheer Mostaerd geben lassen, was immer du brauchst.« Er hatte seinen Verwalter instruiert, den Jungen großzügig zu alimentieren, denn Pieter sollte keinesfalls während seiner Lehrjahre darben müssen.
In einer für ihn selbst unerwarteten Aufwallung von Zuneigung tätschelte er dem Jungen die Wange und unterdrückte dabei den Anflug eines schlechten Gewissens, weil er seinen Patensohn hier ablieferte wie eine Ladung unbestellter Ware, die man nicht schnell genug loswerden konnte.
»Ich werde bald nach dir sehen, Pieter. Spätestens zu Weihnachten komme ich vorbei und überzeuge mich davon, dass du es gut getroffen hast mit deiner Lehrstelle.« Damit wandte er sich entschlossen zum Gehen. Bis Weihnachten waren es noch fast drei Monate. Wenn er hätte wetten müssen, ob der Junge es bis dahin schaffte, sich die Lehrstelle zu erhalten, hätte Joost keine nennenswerte Summe darauf setzen mögen. Andererseits – sechshundertsechzig Gulden waren ein schönes Stück Geld, auch für einen gut bezahlten Maler. Das galt vor allem, wenn es erst einmal ausgegeben war.
Auf dem Weg zu seinem Kontor gab Joost sich der stillen Hoffnung hin, dass Meister Rembrandt das Lehrgeld schnellstmöglich für verlockende Sammlungsstücke verprasste. Ob man da vielleicht ein wenig nachhelfen konnte?
*
Pieter verbrachte den ersten Monat seiner Lehrzeit ohne besondere Vorkommnisse. Meistens war er stumm wie ein Fisch, und wenn er doch einmal ein paar Worte von sich gab, musste man ihm schon eine Frage gestellt haben, wobei jedoch seine Antworten stets ausgesprochen einsilbig ausfielen. Bald hielten ihn alle im Hause van Rijn für einen Sonderling.
Gegen Ende des Monats Oktober 1636, rund vier Wochen nach Pieters Ankunft, traf – nebst einem Federbett für Pieter – ein Brief seines Vormunds ein, dem offenbar die Absicht zugrunde lag, Pieters Verhalten zu erklären. Der Junge sei, so schrieb Joost Heertgens, zuweilen ein Eigenbrötler, und sollte er vielleicht einmal einen renitenten oder besserwisserischen Eindruck machen, dürfe man ihm das nicht verargen, da er unter ungewöhnlichen Umständen aufgewachsen sei.
Über die genaue Art dieser Umstände ließ sich Pieters Vormund in dem Brief nicht aus, aber Meister Rembrandt und seine Gattin focht das nicht an. Sie vermochten den Sinn dieser vorweggenommenen Entschuldigung in Heertgens Schreiben nicht zu erkennen, denn sie hatten keinen Grund, sich über den Jungen zu beklagen. Wenn er ihnen überhaupt auffiel, dann nur durch seine ungewöhnliche Schweigsamkeit und bemerkenswerte Pünktlichkeit. Zu den Mahlzeiten erschien er immer auf die Minute genau mit dem Glockenschlag, und seit seiner Ankunft kam es nie mehr vor, dass jemand vergaß, im Haus die großen Sanduhren umzudrehen, die den Tag in Stunden teilten. Meist war er schon eine Minute vorher zur Stelle. Seine Arbeit erledigte er ebenso zuverlässig. In den ersten Tagen hatte Rembrandt ihm nichts weiter zu tun gegeben, als abends die Werkstatt im Obergeschoss des Hauses auszufegen, die Leinwände mit Tüchern abzuhängen und Pinsel und Paletten zu reinigen. All das hatte er nach eingehender Unterweisung durch Rembrandts ältesten Lehrling Cornelis zufriedenstellend erledigt.
Doch Rembrandt steckte bis über beide Ohren in Arbeit, und so war es ihm entgangen, dass der Schwerpunkt von Pieters Tätigkeit sich nach und nach in andere Bereiche des Hauses verlagert hatte. Die ältere Magd – ihr Name war Geertruyd – hatte rasch herausgefunden, dass Pieter sich auch für gröbere Arbeiten im Haushalt gut eignete, und da es in der Werkstatt des Meisters ohnehin tagsüber von Schülern nur so wimmelte, war der Junge ihrer Auffassung nach dort jederzeit entbehrlich. Dies galt umso mehr, als die jüngeren Lehrbuben, allesamt Knaben von zwölf, dreizehn Jahren, Pieter wegen seiner stillen Art oft hänselten, weshalb es aus Geertruyds Sicht nur folgerichtig war, den Jungen anderweitig zu beschäftigen.
Bald war er ausschließlich damit befasst, Hühner zu rupfen, Fische zu schuppen, Torfballen und Feuerholz in Küche, Waschküche und Stube zu schleppen und die Abfälle in den Fluss zu kippen. Gelegentlich musste er auch Kohlköpfe klein schneiden, Möhren schrappen, Bratenstücke parieren und den Boden scheuern. Eine Menge Zeit verbrachte er zudem damit, bei der Wäsche zu helfen.
Als Joost Heertgens Brief eintraf, machte sich Rembrandt zum ersten Mal seit Wochen bewusst, wie selten er Pieter in der Werkstatt zu Gesicht bekam. Am Nachmittag desselben Tages wandte er sich daher an seinen Gesellen Laurens, der sich mit Pieter die Dachkammer über der Werkstatt teilte und seine Frage am besten beantworten konnte.
»Wo treibt sich eigentlich Pieter den ganzen Tag immer herum? Ich sehe ihn kaum noch.«
Laurens verzog verächtlich das Gesicht. »Er hilft Geertruyd in der Küche oder Anneke bei der Wäsche.«
»Warum?«
Laurens, dem der unerwünschte Kammergenosse von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen war, nutzte gern die Gelegenheit, dem Jungen eins auszuwischen. »Weil er lieber Weiberarbeit macht, statt das Malen zu erlernen.«
»Wirklich?« Rembrandt runzelte die Stirn. »Hat er das gesagt?«
»Nein«, räumte Laurens ein. »Aber ich finde, es ist die einzige Erklärung.«
Rembrandt hielt mit seiner Skepsis nicht hinterm Berg. Dass einer seiner Lehrlinge lieber Frauenarbeit verrichtete, statt sich der Kunst zu widmen, erschien ihm schlechterdings grotesk. Dahinter musste mehr stecken. Er befahl Laurens, ihm Pieter zu rufen, weil er unter vier Augen mit dem Jungen reden wollte.
Pieter erschien umgehend in der Werkstatt. Er kam ganz offensichtlich aus der Küche, denn er hatte eine große Schürze umgebunden, die von Flecken übersät war und nach Bratenfett stank.
»Was hast du denn da um Himmels willen an?«, wollte Rembrandt von ihm wissen.
Der Junge schien im Kopf kurz etwas zu überschlagen, denn seine Lippen bewegten sich stumm. Doch dann kam seine Antwort flüssig und ohne zu stocken heraus. »Hose, Hemd, Weste, Strümpfe, Schuhe, Gürtel, Halstuch, Kappe, Schürze.«
»Willst du dich über mich lustig machen, Bursche?«
»Nein.«
»Warum zählst du dann alles auf, was du anhast?«
»Weil Ihr mich danach fragtet.«
Befremden erfasste Rembrandt, und er begriff, dass dem Brief von Pieters Vormund eine Bedeutung innewohnte, die ihm bisher entgangen war.
»Pieter, warum bist du so selten hier oben in der Werkstatt?«
Der Junge dachte kurz nach. »Weil ich Geertruyd und Anneke bei der Arbeit helfe.«
»Tust du diese Arbeit denn gern?«
»Nur, wenn Anneke dabei ist.«
Rembrandt gewann den Eindruck, der Sache allmählich näher zu kommen, denn Anneke war wirklich eine Augenweide, das mochte eine Erklärung dafür sein, dass Pieter sich im Haushalt betätigte. Doch das konnte unmöglich der alleinige Grund sein.
Gleichwohl fand er es zusehends mühselig, Pieter jede Auskunft einzeln aus der Nase ziehen zu müssen. Hätte Rembrandt nicht gewusst, dass Pieter die Lateinschule in Leiden besucht hatte (dieselbe Schule hatte Rembrandt in seiner Jugend auch absolviert), wäre wohl die Annahme berechtigt gewesen, dass es um die Geisteskräfte des Jungen traurig bestellt war. Er widerstand der Anwandlung, Pieters Mitteilungsfreude durch eine kräftige Ohrfeige anzuregen.
»Hilfst du lieber Anneke bei der Arbeit als mir?«
»Nein.«
»Warum tust du es dann?«
Wieder schien der Junge im Geiste etwas abzuzählen. »Weil Geertruyd es befiehlt und weil ich Anweisungen gehorchen muss.«
»Pieter, warum zögerst du vor manchen Antworten?«
»Weil ich die Wörter zähle.«
»Wessen Wörter?«
»Meine.«
Der Junge war zweifellos gestört, doch so schnell gab Rembrandt nicht auf.
»Wer hat dich geheißen, deine Wörter zu zählen? Und warum?«
Der Junge wand sich, von erkennbarer Unruhe erfüllt.
»Ich erwarte eine Erklärung«, insistierte Rembrandt.
Pieter starrte ihn hilflos an. Schließlich platzte er heraus: »Ich kann nicht antworten.«
»Warum nicht?«
»Es waren zwei Fragen auf einmal.«
»Beantworte zunächst die erste.«
Pieter war sichtlich erleichtert. »Mein Onkel Joost befahl mir das Zählen.«
»Warum tat er das?«
»Das weiß ich nicht.«
»Pieter, ich bin dein Lehrherr. Meine Befehle stehen über denen deines Paten. Du musst meinen Anweisungen folgen.«
»Ich weiß. Das ist die goldene Regel Nummer drei.«
»Wie bitte?«
»Die goldene Regel Nummer drei.«
»Zähl mir die goldenen Regeln auf«, verlangte Rembrandt. Er hatte das Gefühl, durch zähen Schlamm zu waten.
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Die Antwort hätte mehr als zehn Wörter.«
Rembrandt frohlockte innerlich. Damit war er endlich zum Kern des Problems vorgestoßen!
»Als Allererstes befehle ich dir, sofort mit diesem albernen Zählen aufzuhören. Wenn ich dich etwas frage, erwarte ich schlüssige, ausformulierte und kluge Antworten. Sie dürfen länger sein als zehn Wörter. Und jetzt zähl mir besagte Regeln auf.«
Pieter betete sie allesamt in Windeseile und ohne zu stocken herunter, die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus. Vor Rembrandts innerem Auge tauchte kurz das Bild eines unter Wasserfluten berstenden Deichs auf.
Mit grimmiger Anteilnahme versuchte er, den Sinn dieser Regeln zu erfassen, vor allem der goldenen. Welches Ziel hatte Pieters Patenonkel mit dieser himmelschreienden Unterdrückung verfolgt? Es war ihm ein Rätsel. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass der Junge ein armes, geknechtetes Wesen war, dem geholfen werden müsse.
»Pieter«, sagte er mit ernster Stimme. »Hiermit setze ich alle von deinem Paten aufgestellten Regeln außer Kraft. Für dich gilt ab sofort keine mehr davon.« Er besann sich. »Außer natürlich, dass du meine Anweisungen befolgen musst, denn ich bin ja dein Lehrherr. Ah, und die meiner Frau. Aber die anderen haben dir nichts mehr zu sagen.«
»Auch Laurens und Geertruyd nicht?«
»Vor allem Laurens und Geertruyd nicht. Alles Weitere wird sich schon fügen. Verhalte dich einfach wie ein anständiger Christenmensch, und befolge anstelle dieser seltsamen Regeln deines Paten nur getreulich die Zehn Gebote. Sei immer ehrlich, strebsam und gottesfürchtig, dann kann nicht viel schiefgehen. Hast du das verstanden?«
»Ja.«
»Gut. Ach, und ich erwarte ab sofort zu allen Arbeitszeiten deine regelmäßige Anwesenheit hier in der Werkstatt. Ich werde Geertruyd und Anneke klarmachen, dass sie dir keine Aufgaben im Haushalt mehr aufhalsen dürfen, denn dafür bist du nicht zuständig. Du willst doch ein guter Maler werden, oder nicht?«
»Mein Vater wollte es.«
»Du denn nicht?«
»Ich weiß nicht, was ich will.«
Rembrandt dachte über die Antwort nach, denn es waren ehrliche Worte, und solche verdienten immer Beachtung. Er erinnerte sich daran, dass Joost Heertgens das Talent des Jungen hervorgehoben hatte. Falls er nicht gelogen oder übertrieben hatte – inzwischen traute Rembrandt diesem Kaufmann jedwede Schlechtigkeit zu –, musste bei Pieter folglich ein Mindestmaß an künstlerischer Begabung vorhanden sein. Das lag schon deshalb nahe, weil sein Vater ihm den Beruf des Kunstmalers zugedacht hatte. Für künstlerisch Unbegabte gab es genügend andere sinnvolle und einträgliche Tätigkeiten.
Rembrandt beschloss, der Sache sofort auf den Grund zu gehen. Streng genommen hätte er sich schon längst darum kümmern müssen. Er schalt sich im Stillen für seine Nachlässigkeit, denn tatsächlich hatte er bisher kein einziges Mal die malerischen Anlagen des Jungen geprüft, hatte weder Skizzen noch sonstige Entwürfe in Augenschein genommen. Es musste welche geben, Saskia hatte ihm erzählt, dass Heertgens sie ihr hatte zeigen wollen.
»Pieter, hast du eine Mappe mit Zeichnungen mitgebracht, als du in unser Haus kamst?«
»Ja.«
»Kann ich sie einmal sehen?«
»Nein.«
Rembrandt stutzte. »Warum nicht?«
»Die Skizzen sind weg.«
Rembrandt wollte aufbrausen, zügelte sich dann aber. »Pieter, es wäre hilfreich, wenn du daran denkst, dass deine Antworten jetzt länger sein dürfen als zehn Wörter. Oder genauer: Sie dürfen es nicht nur, sondern sollen es sogar, wenn das dazu führt, einen Sachverhalt ohne ständiges Nachfragen ausreichend zu erhellen. Also erkläre und begründe mir doch bitte, wieso deine Skizzen weg sind.«
»Laurens hat sie allesamt zerrissen. Sie gefielen ihm nicht.«
»Aha.« Rembrandt machte aus seinem Zorn keinen Hehl. »Und zweifellos hat er dir befohlen, darüber Stillschweigen zu bewahren.«
»Ja.«
»Nun gut, Laurens wird in dieser Sache von mir noch näheren Bescheid erhalten. Einstweilen fertigst du einfach eine neue Skizze an. Zeichne etwas.« Rembrandt reichte dem Jungen einen Block und einen Kohlestift.
»Was soll ich zeichnen?«
»Nimm ein Sujet, das dich in der letzten Zeit beeindruckt hat. Am besten eine Szenerie mit Menschen.«
Pieter setzte sich auf einen Schemel vors Fenster, den Block auf den Knien, und fing an zu stricheln. Rembrandt sah ihm dabei zu, um einen Eindruck zu gewinnen, wie der Junge den Stift hielt, welchen Abstand er zum Papier einnahm, welche Bewegungen er ausführte. Pieter war Linkshänder. Das musste bei der Malerei kein Nachteil sein, im Gegenteil. Die meisten Linkshänder konnten beidhändig arbeiten, was die Belastung auf zwei Seiten verteilte. Wenn der linke Arm schmerzte, konnten sie mit der rechten Hand weitermachen, etwa mit den gröberen Arbeiten wie dem Ausfüllen des Hintergrundes. Rembrandt rief sich in Erinnerung, dass auch Rubens Linkshänder war, und dessen Werke gehörten zu den begehrtesten und teuersten der Welt.
Pieter war mit Feuereifer bei der Sache. Seine Zungenspitze hatte sich in den Mundwinkel gestohlen, seine Gesichtszüge waren beständig in Arbeit, als müssten sie ebenso zum Gelingen der Skizze beitragen wie seine Hände. Mal war seine Miene in Anspannung erstarrt, mal verzog sich sein Mund zu einem flüchtigen Lächeln. Die ganze Zeit über strahlten die Augen des Jungen, als hätte er die fertige Zeichnung schon vor sich und müsste sie nur noch Schicht um Schicht ans Licht befördern, damit sie für jedermann sichtbar wurde.
Während seiner Beobachtungen widerstand Rembrandt der Versuchung, dem Jungen über die Schulter zu blicken, denn er wollte auf das fertige Ergebnis warten, um einen vollständigen Gesamteindruck zu bekommen. Dass Pieter schon oft gezeichnet hatte und einen Stift führen konnte, stand außer Frage, denn er arbeitete schnell, konzentriert und zielstrebig und war in erstaunlich kurzer Zeit mit dem Entwurf fertig. Als er den Kohlestift sinken ließ, schien er aus tiefer Versunkenheit zu erwachen. Sein Gesicht war offen und verwundbar wie das eines Kindes, das nach einem ausgiebigen, glücklichen Spiel von der Mutter heimgerufen wird und gern noch eine Weile draußen geblieben wäre. In seinen Zügen zeigte sich ein Ausdruck leisen Widerstrebens, gemischt mit der Freude über die hinter ihm liegende schöne Zeit.
Rembrandt nahm ihm den Block weg und betrachtete das Skizzenblatt. Er nickte gedankenverloren, denn schon als er den Jungen bei der Arbeit betrachtet hatte, war eine Ahnung in ihm aufgestiegen, was dabei herauskommen würde: In seinen Händen hielt er das Werk eines Künstlers.
Ein Blick auf diese Zeichnung reichte, um die exorbitante Begabung des Jungen zu erkennen, seine sichere Hand für Details und Ausdruck, die einmalige Fähigkeit, Stimmungen einzufangen und die Bedeutung eines einzigen Augenblicks mit wenigen Linien und Schraffuren zu bewahren. Für Rembrandt war es ein bewegender Moment, denn mit einem Mal fühlte er sich zurückversetzt in das Jahr, als er selbst siebzehn gewesen war. Dieser stürmische Drang in seinem Herzen, das unbändige Verlangen nach mehr, wenn seine Hände ein leeres Blatt berührten und in seinem Kopf das fertige Bild Gestalt annahm, noch ehe Kreide oder Kohle es berührten.
Bei Pieter schien es sich ein wenig anders zu verhalten – er war über alle Maßen talentiert, wusste aber nicht zweifelsfrei, ob die Kunst wirklich seine Bestimmung war. Dieses Wissen brachten große Maler für gewöhnlich bereits zu Beginn ihrer Laufbahn mit. Auf der anderen Seite war da während des Zeichnens jener Ausdruck in Pieters Gesicht gewesen, diese beinahe besessene Ergriffenheit – womöglich stand Pieter sich einfach selbst im Weg, weil er aufgrund seiner Verschrobenheit nicht in der Lage war, seine Wünsche und Ziele wirklich zu erfassen. Seine Art zu denken unterschied sich von der anderer Menschen. Vielleicht musste er in dieser Werkstatt vor allem eines lernen: zu begreifen, was gut und richtig für ihn war. Dass die Kunst der leuchtende Leitstern eines ganzen langen Lebens sein konnte, wenn man sich ihr von der richtigen Warte aus näherte. Und für das Schaffen einer solchen Warte war der Lehrherr schließlich ebenso zuständig wie für das Vermitteln elementarer Grundkenntnisse oder ausgefeilter Techniken. Was wiederum zu der Einsicht führen musste, dass besagte richtige Warte nur dann tatsächlich eine solche war, wenn sie den Betrachter dazu verlockte, sie einzunehmen.
Ganz durchdrungen von dieser Erkenntnis blickte Rembrandt seinen Lehrjungen an. »Pieter, ich bin davon überzeugt, dass eine große Zukunft vor dir liegt. Du wirst viel bei mir lernen und dadurch im Leben weiterkommen.« Er betrachtete die Skizze des Jungen noch einmal genauer, wobei er diesmal weniger auf die gestalterische als auf die inhaltliche Komponente achtete. Die Zeichnung stellte eine lebhafte Szene da, vermutlich im Rahmen eines Markttreibens. Im Hintergrund war ein Verkaufsstand zu sehen, daneben die Umrisse einiger Fässer, zwar nur angedeutet, aber sogar in dieser auf das Wesentliche reduzierten Form bestechend realitätsnah. Eine Reihe von Zuschauern füllte einen weiteren Teil des Hintergrundes, ebenfalls nur sehr sparsam skizzierte Gestalten. Hier ein etwas genauer hervortretendes Gesicht, der Ausdruck schockiert, dort ein weiteres, noch deutlicher gezeichnet – in der Miene dieses Mannes (dem Aussehen nach schien es ein Markthändler zu sein) stand unverhohlener Zorn. Den Mittelpunkt der Zeichnung bildete jedoch eine liegende Gestalt, die den ganzen Vordergrund einnahm. Auch sie war nicht bis ins letzte Detail ausgeformt, aber Pieter hatte ersichtlich den Fokus der Skizze auf diesen hingestreckten Körper gelegt. Der schwarze Umhang, die Stiefel – es war gut zu erkennen, dass der Mann teure Kleidung trug. Die Geldbörse an seinem Gürtel war prall gefüllt. Desgleichen war nicht zu übersehen, dass es sich um einen Toten handelte. Die Augen waren in stumpf erstarrtem Blick geweitet, der Mund stand sperrangelweit offen, während etwas zwischen den Lippen hervorrutschte. Rembrandt flog ein Grausen an, als er dieses tote Gesicht näher in Augenschein nahm, denn mit einem Mal kam es ihm auf vage Art bekannt vor. Den Block in der Hand, eilte er in sein Atelier, wo er mit einem Ruck das Tuch von einer großformatigen Leinwand zog und das Bild mit Pieters Skizze verglich. Keine Frage, es war van Houten – Würdenträger, Ratsmitglied, begüterter Kaufmann. Ein Porträtauftrag, den Rembrandt mit Freuden angenommen hatte, denn die Bezahlung war fürstlich. Allerdings hatte er seit über einem Monat nicht mehr an dem Bild gemalt, obwohl es so gut wie fertig war. Er verhandelte noch mit van Houtens Frau über die Abnahme, denn der Kaufpreis war erst bei Übergabe fällig. Die Frau verweigerte jedoch die Bezahlung, denn ihr Mann war zwischenzeitlich verstorben. An schlechtem Fisch zugrunde gegangen, wie sie Rembrandt mit lapidaren Worten durch einen Boten übermittelt hatte. Ferner hatte sie ihm mitgeteilt, dass sie das Gedenken an ihren Gatten lieber auf andere Weise pflege, als sich das Bildnis eines Toten in die Stube zu hängen. Zudem beabsichtige sie, zu ihrem Bruder zu ziehen, und der habe seinen Schwager zeitlebens bis aufs Blut gehasst; niemals würde er sein Porträt in seinen vier Wänden dulden. Das entscheidende Argument hatte sie sich jedoch für den Schluss ihrer Botschaft aufgehoben – bereits zu Lebzeiten habe ihr Gemahl unter Zeugen davon gesprochen, dass das Bild nichts tauge und er daher von dem Kauf zurücktreten wolle.
Van Houten hatte sich tatsächlich derart geäußert, das war Rembrandt längst zugetragen worden, aber der Grund dafür bestand nicht etwa darin, dass ihm das Bild nicht gefallen hätte. Vielmehr hatte ihn die kostspielige Ausgabe gereut, das war inzwischen sonnenklar. Er hatte sich, nach allem, was man zuletzt so hörte, im Tulpenhandel verspekuliert, der in diesen Monaten so manchen plötzlich mit leeren Taschen dastehen ließ, während andere zu schwindelerregendem Reichtum gelangten. Ein Tulpist hatte ihm, so hieß es, für viel Geld minderwertige Zwiebeln untergeschoben und ihn darauf sitzen lassen.
Es schwante Rembrandt, dass er wegen des Bildes wohl würde prozessieren müssen, wenn er noch etwas von dem Geld sehen wollte. Er war ein streitbarer Zeitgenosse und scheute den Gang zum Gericht keineswegs, auch nicht, wenn seine Klage sich zwangsläufig gegen eine verarmte Witwe richten musste. Sollte bei ihr nicht mehr viel zu holen sein, würde es ihm zumindest etwas Genugtuung verschaffen, wenn sie deswegen ein paar Jahre im Spinhuis schmoren musste. Doch der mit einem solchen Schritt verbundene Ärger würde sich fraglos ungünstig auf seine Schaffensfreude auswirken. Allein die Notwendigkeit, das Bild noch vollenden zu müssen, um es – für den Fall seines gerichtlichen Obsiegens und ihrer Zahlungsfähigkeit – abholbereit zur Verfügung stellen zu können, empfand er als Zumutung. Bei dem bloßen Gedanken kochte wieder der Zorn in ihm hoch, und in einem Ausbruch von Unbeherrschtheit vergaß er sich sogar so weit, dass er die Skizze, die Pieter von dem Toten angefertigt hatte, in Fetzen riss. Gleich darauf gewahrte er erschrocken, was er angerichtet hatte. Zerknirscht wandte er sich zu Pieter um, der ihn stumm anstarrte.
Rembrandt räusperte sich. »Mein Ärger galt nicht deiner Zeichnung, sondern dem Manne darauf, van Houten. Sowie seiner Frau, die jetzt sein Porträt nicht mehr bezahlen will.« Er deutete auf das Ölbildnis. Dann blickte er auf die Papierfetzen zu seinen Füßen. »Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich in meinem Zorn dein Bild zerstört habe.« Er selbst, das musste er sich beschämt eingestehen, hätte als Lehrling nach so einem Vorfall wohl wochenlang in Mordfantasien geschwelgt. Oder vielleicht sogar gleich sein Bündel gepackt. Wäre Swanenburgh seinerzeit nur halb so reizbar gewesen wie er selbst es heute war, hätte er seine Lehre dort wohl niemals beendet.
»Hol dir ein großes Stück Fleisch in der Küche«, befahl Rembrandt dem Jungen, um sein schlechtes Gewissen zu besänftigen. Er wusste, das Geertruyd einen Braten zubereitet hatte (vermutlich sogar mit Pieters Hilfe), denn für den Abend erwarteten er und Saskia Gäste. »Danach hast du für den Rest des Tages frei. Lass dir von meiner Frau einen Stüver geben.«
»Was soll ich mit dem Stüver tun?«
»Das, was alle jungen Burschen mit einem Stüver tun würden. Geh damit in die nächstbeste Schenke und trink dir einen Schnaps.« Rembrandt besann sich. »Oder besser ein Bier.« Er fand, dass er mit dieser großzügigen Sonderzuwendung seiner Reue angemessen Ausdruck verliehen hatte. Auch Pieter schien dieser Ansicht zu sein, denn er drehte sich wortlos um und ging zur Treppe. Halbwegs zufrieden hängte Rembrandt das Tuch wieder über die Staffelei und wandte sich wichtigeren Dingen zu. Von dem plötzlichen Bedürfnis erfasst, seine Sammlung zu betrachten, ging er in das angrenzende Kabinett, wo er seine Raritäten und Kunstgegenstände aufbewahrte. In der Vorwoche hatte er zwei Radierungen eines italienischen Künstlers bei Uylenburgh gekauft, unwiderstehliche (und sehr teure) kleine Meisterwerke, an denen er sich nicht sattsehen konnte.
Erst, als er die Tür hinter sich zuzog, um sich ungestört der Freude an seinen Kunstschätzen hingeben zu können, fiel ihm ein, dass er Pieter nach den Umständen hätte fragen können, unter denen van Houten gestorben war. Offenbar war der Junge zufällig dabei gewesen, als es geschah.
Konnte verdorbener Fisch so schädlich sein, dass man davon an Ort und Stelle tot umfiel? Die Frage ließ Rembrandt keine Ruhe. Er ging zurück in den Nebenraum, wo er die Fetzen der Skizze einsammelte und sie auf dem Boden zu einem Ganzen zusammenfügte, um sie nochmals eingehend zu betrachten. Keine Frage, es handelte sich um einen Fischstand. Wenn man genau hinschaute, erkannte man in dem oberen der aufeinandergestapelten Fässer die Leiber von Fischen, vermutlich Makrelen. Der Bezug zu dem dicken Brocken, der dem Toten aus dem Mund rutschte, hätte nicht deutlicher sein können. Besaß dieser Brocken nicht sogar die Textur von Räucherfisch? Und was bedeutete die weißliche Substanz (eine so helle Färbung mittels Kohlestift darzustellen, zeugte von wahrer Könnerschaft!), die ebenfalls aus dem Mund des Toten auszutreten schien? Für Speichel war es zu viel, für Mageninhalt zu hell. Rembrandt dachte kurz darüber nach, fand es dann aber nicht weiter wichtig. Die eigentliche Frage, die ihn in diesem Zusammenhang beschäftigte, drehte sich um seine Aussicht auf Bezahlung. Es konnte nicht angehen, dass ein Auftraggeber ihm das Geld für ein Gemälde schuldig blieb, in welchem bereits derart viel Arbeit steckte. Saskia und er hatten sich gemeinsam darüber ereifert, als ihnen zu Ohren gekommen war, dass die Bestellung für hinfällig erklärt werden sollte. Die Entrüstung seiner Frau hatte der seinen in nichts nachgestanden, denn sie wusste ebenso gut wie er, wie viel von seiner Entlohnung abhing. Malen war ein täglicher Kampf, eine ständige Herausforderung, und vor allem war es auf geistige und körperliche Art aufreibend – jeder Gulden war sauer verdientes Geld. So gesehen hatte van Houten versucht, ihm die Existenzgrundlage zu rauben. Somit war der Tod nur die gerechte Strafe für sein ruchloses Verhalten.
Rembrandt stand vom Boden auf und stieß in erneutem Grimm die Fetzen der Skizze mit der Spitze seines Fußes auseinander, sodass sie in alle Richtungen davonstoben. Anschließend begab er sich wieder zu seiner Sammlung.
*
Die Schenke an der Ecke hieß Zur goldenen Tulpe. Am Tag seiner Ankunft war Pieter hier mit Onkel Joost vorbeigekommen, er erinnerte sich an die Frau, die ihnen so freundlich den Weg zu Rembrandts Haus erklärt hatte. Über der Tür hing ein Schild, auf dem eine gelbe Tulpe zu sehen war. Pieter betrachtete es eine Weile, bevor er im Gedränge eintreffender Gäste vorwärtsgeschoben wurde. Wie von allein landete er gemeinsam mit den lärmenden Männern an einem großen Tisch. Ehe er sich’s versah, saß er im Kreise einer ganzen Schar Pfeife paffender, schwadronierender Tulpenhändler, die lautstark bei der Bedienung Bier bestellten und sich über ihre Geschäfte und andere Befindlichkeiten austauschten. Dass es sich bei ihnen um Tulpenhändler handelte, erkannte Pieter an den Katalogen, die kreuz und quer über den Tisch geschoben und mit allerlei Preis- und Angebotslisten verglichen wurden. Er hatte dergleichen schon bei Onkel Joost gesehen, der auf der Reise nach Amsterdam solche Unterlagen studiert hatte.
Vor seinem Sitznachbarn lag eine Tabelle, in der die Namen von Tulpen und ihre aktuellen Marktwerte eingetragen waren. Daneben hatte der Mann den bunt bebilderten Katalog ausgeklappt. Auch Onkel Joost hatte Kataloge mit farbigen Abbildungen von Tulpen mit sich geführt, er hatte sie Pieter gezeigt und ihm erklärt, was es damit auf sich hatte. Seinen Erläuterungen zufolge handelte es sich bei Tulpen um die wertvollsten Pflanzen der Welt. Manche von ihnen waren so kostbar, dass sie in Gold aufgewogen wurden, und für einige der gesuchtesten Sorten reichte nicht einmal das. Die wertvollsten Exemplare waren so teuer, dass zwei oder drei von ihnen genug einbrachten, um ein großes Wohnhaus in der besten Gegend von Amsterdam zu erwerben.
Pieter wusste, dass er Tulpenzwiebeln von seinem Vater geerbt hatte, der ein begeisterter Blumenliebhaber gewesen war. Er hatte seinen Patenonkel gefragt, ob das Beet mit den Tulpen verkauft worden sei.
»Das Beet gehört dir noch, Pieter. Und vor allem das, was drinsteckt.« Onkel Joost hatte ihm ein Bündel Papiere gezeigt. »Hier haben wir verbriefte Rechte an einer Menge von kleinen braunen Setzlingen, die im Frühjahr Blüten hervorbringen. Wir müssen den rechten Zeitpunkt für den Verkauf abpassen, denn in Holland herrscht ein munterer Handel mit diesen Zwiebelchen. Je mehr damit gehandelt wird, desto teurer werden sie. Und je teurer sie werden, desto mehr Händler wollen damit handeln. Jeder Kaufmann, der etwas Geld übrig hat, investiert es derzeit in Tulpen, ohne seinen erworbenen Schatz jemals in der Hand zu halten oder ihn blühen zu sehen. Denn dazu muss man wissen, dass fast all diese Leute die Blume nicht um ihrer Schönheit willen kaufen wollen, sondern um sie möglichst rasch und möglichst gewinnbringend weiterzuveräußern und auf diese Weise reich zu werden. Reich werden will ein jeder gern, Pieter, das ist ein ehernes Gesetz unter den Menschen, auch wenn die Kirche uns zu Mäßigung und Bescheidenheit anhält. Und weil von den begehrtesten Tulpenzwiebeln nicht genug Exemplare für die sich ständig vergrößernde Händlerschar da sind, werden sie eben gestückelt. Nicht die Zwiebeln, sondern die Bezugsrechte daran. Man schreibt ihren Wert in Gewichtsanteilen auf Papier, mit dem man bequemer und schneller und öfter handeln kann als mit den Tulpen selbst. Der gesamte Tulpenhandel basiert auf der Hoffnung, dass die Preise der Zwiebeln immer und immer weiter steigen. Das, lieber Pieter, nennt man Spekulation.«
Pieter hatte lange über diese Erklärungen nachgedacht. Beim Anblick der vor ihm auf dem Tisch liegenden Aufstellungen erhielten die Gedanken, die er sich bereits im vorigen Monat während der Reise gemacht hatte, neue Nahrung, denn er hatte alle Zahlen von Onkel Joosts Listen noch genau im Kopf und konnte sie daher mit denen in den Tabellen dieser Händler vergleichen. Die Preise waren seither tatsächlich stark gestiegen. Für manche Sorten hatten sie sich vervielfacht.
Die Bedienung brachte große Humpen mit Bier, und die Männer riefen sich reihum Trinksprüche zu. Der Rauch aus ihren Tonpfeifen lag wie Nebel über dem Tisch. Pieter musste husten und sich die Augen reiben. Dabei fiel den Männern schließlich auf, dass er keiner der ihren war. Es stellte sich heraus, dass jeder der Händler irrtümlich davon ausgegangen war, dass er zu einem aus ihrer Runde gehörte, sei es als Gehilfe oder Verwandter, und als sich offenbarte, dass er lediglich zufällig an den Tisch geraten war, wurde er umgehend von der Bank gescheucht und aufgefordert, sich woanders hinzusetzen. Doch die Schenke war bis auf den letzten Platz besetzt, also blieb Pieter stehen. Er besaß immer noch seinen Stüver, den er sich von Mevrouw Saskia hatte geben lassen, denn er hatte bis jetzt kein Bier bestellt. Zu Hause trank er meist Milch oder Wasser vom Pumpbrunnen. Bier schmeckte ihm nicht, und auch Geruch und Farbe des Getränks sagten ihm nicht zu. Daher entschied er sich für den anderen Vorschlag seines Meisters – Schnaps. Pieter hatte bisher noch nie welchen getrunken, doch die klare Farbe und der Geruch gefielen ihm. Geertruyd trank in der Küche häufig Schnaps wegen ihrer schlimmen Schulter und zur Verbesserung ihrer schlechten Laune. Allerdings durfte es außer ihm keiner wissen. Sie hatte ihm befohlen, es niemandem zu sagen. Nach dem Trinken zerkaute sie stets Minzblätter aus dem Kräutergarten, um den Schnapsgeruch in ihrem Atem zu überdecken.
Pieter wandte sich an die Bedienung, die gerade mit einer Ladung von Bierkrügen nahte. Es war die Frau, die er auch am Tag seiner Ankunft vor der Schenke gesehen hatte. Mit beiden Armen hielt sie – Pieter erfasste die Anzahl mit einem Blick – acht große Krüge auf einmal an ihre Brust gedrückt, was ihm Bewunderung abnötigte. Ein Teil dieser Bewunderung lag allerdings auch darin begründet, dass das überschwappende Bier ihre Bluse durchfeuchtete, wodurch sich ihre Brüste unter dem Stoff deutlich abzeichneten. Der Anblick fesselte Pieter so sehr, dass er vergaß, den Schnaps zu bestellen.
Sie lud die Krüge am Tisch der Tulpenhändler ab und kam ohne ihre Last zurück, was ihm Gelegenheit verschaffte, auch den Rest von ihr genauer in Augenschein zu nehmen. Sie war nicht sonderlich groß. Ihr Körper war in der Taille schmal, aber an Hüften, Gesäß und Brust gerundet. Wenn man sich die Kleidung wegdachte, sah sie gewiss genauso aus wie die Frau auf dem Bild unter Laurens’ Bett. Ihr Haar war hell und rieselte in Löckchen unter der weißen Haube hervor. Ihr Gewand war locker geschnürt, und ihre Pantinen waren an den Spitzen leicht nach oben gebogen. Ihre Wangen waren gerötet, und ihre Augen sehr groß und blau.
»Was hältst du hier Maulaffen feil, Junge?«, blaffte sie ihn an. »Hast du nichts anderes zu tun, als mich anzuglotzen?«