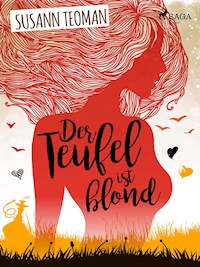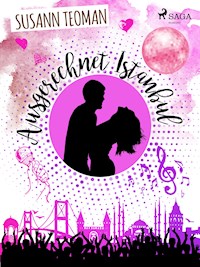Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein quirliger Roman über die Liebe und die damit einhergehenden Nebenwirkungen!Melda kann es kaum fassen! Sie lebt als junge Türkin in Deutschland, aber sie hätte nicht damit gerechnet, dass ihre Eltern ihr einfach einen Heiratskandidaten präsentieren würden. Und dieser Kandidat ist dann auch noch todlangweilig. Außerdem hat sie doch schon länger ein Auge auf den attraktiven Jan geworfen. Sie sieht keine andere Möglichkeit, als ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Eltern eine Lektion zu erteilen. Immerhin hat ihre beste Freundin Pelin von ihrer Oma Voodoo gelernt. Doch plötzlich droht alles aufzufliegen...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susann Teoman
Türkischer Mokka mit Schuss
Saga
Türkischer Mokka mit SchussCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 2008, 2019 Susann Teoman und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726255454
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1. Rock ’n’ Roll!
Ich bereue nichts, überhaupt nichts, niemals!
Außer heute.
Ich stecke ganz schön in der Klemme. Und es ist kein Ausweg in Sicht.
Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mir wünsche, dass die gesamten vergangenen drei Monate wieder rückgängig gemacht werden könnten.
Ich wende meine zu stark geschminkten Augen flehend himmelwärts. Nichts passiert. Keine Fanfaren kündigen die Ankunft eines Engels an, und auch der Himmel, beziehungsweise die weißgetünchte Decke über mir, öffnet sich nicht.
Was kann der liebe Gott denn dafür, dass ich so bescheuert bin? Ich an seiner Stelle würde mir eine Tüte Popcorn greifen und amüsiert abwarten, was heute sonst noch alles geschieht.
Wie bin ich hier nur gelandet? Im Nebenzimmer eines Standesamtes und in einer unheimlichen Wolke aus weißem Tüll nebst passendem Brautstrauß aus goldenen Plastikrosen und einem Gesicht, das so stark angemalt ist, dass ich aussehe wie der Sänger von »The Cure«?
Ich bin eine Braut! Schlimmer noch, ich bin eine türkische Braut! HILFE!
Um meine Taille spannt sich eine zwei Meter lange leuchtendrote Schleife. Das ist bei uns Türken so Sitte, musste ich mich heute früh belehren lassen. Jede Jungfrau trägt so ein Monster um die Taille, das symbolisiert meine »Unschuld«. Was der Bräutigam wohl davon halten wird, wenn er bemerkt, dass ich nicht unschuldig bin? Dass ich sogar alles andere als unschuldig bin?
Ich stehe auf und wandere zum vergoldeten Spiegel. Meine Herrschaften, ich sehe wirklich enorm geschmacklos aus! Meine Haare sind mit einem Glanzpartikelspray so hoch toupiert, dass ich wie ein Popstar der Achtziger wirke. Auf diesem kunstvollen Turm aus Haar und Chemie befindet sich ein steifer Tüllschleier, den ich nach dieser Hochzeit problemlos als Gardine für ein sechs Meter breites Fenster verwenden könnte.
Das Kleid ist der Oberkracher, eine Kreation aus acht Lagen weißem Tüll, mit einem Reifrock darunter, der so breit ist, dass ich durch keine Tür passe. Die oberste Tülllage ist mit einer halben Tonne Strasssteinchen beklebt, und auf meinem Po prangt eine riesige weiße Tüllschleife, die zu den kleinen Schleifchen am unteren Rockrand passt. Ich sehe verdammt scheußlich aus! So scheußlich wie noch nie. Ich kann mich nicht beherrschen und fange an zu weinen.
Das hätte alles ganz anders laufen sollen! Ich hatte das alles so schön geplant.
Nicht diese Hochzeit, nein, ich meine doch meine echte Hochzeit.
Die, bei der ich Jan heiraten wollte. Meinen schönen, blonden Jan.
Heute hingegen werde ich Ali heiraten, einen türkischen Ingenieur. Und ich kann nicht einmal so etwas zu meiner Verteidigung vorbringen wie: »Man hat mich zu dieser Ehe gezwungen!«
Ich habe mir den Typen ja schließlich ausgesucht, obwohl ich doch Jan liebe.
Ich hätte mir zu meiner Hochzeit ein schlichtes, cremefarbenes Seidenkleid gewünscht und ein Sträußchen aus gelben Orchideen und weißen Röschen. Und vielleicht einen Hauch Rouge und etwas Lippenstift. Und natürlich Jan an meiner Seite, vorzugsweise mit Frack und Zylinder.
Und nun stehe ich hier und sehe aus wie mein eigener schlimmster Albtraum. Und heirate einen Typen, den ich ebenso wenig kenne wie er mich und den ich nicht die Spur liebe. Daran bin ich selber schuld, auch wenn ich doch noch auf ein Wunder hoffe.
Ich bin schuld oder, genauer gesagt, Pelins Voodoo-Zauber und meine geheime Identität.
Mein verruchtes Doppelleben ist so sehr ein Teil von mir selbst geworden, dass ich mir eine andere Art zu leben gar nicht mehr vorstellen kann. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich angefangen habe, zwei Leben zu führen.
Halt – doch, das ist, glaube ich, auf einer Klassenfahrt in die Bretagne passiert. Damals war ich noch die wohlerzogene Tochter oder gab mir zumindest alle Mühe, dem Idealbild meiner Eltern von einer perfekten türkischen Tochter aus gutem Hause zu entsprechen.
Mit achtzehn hatte ich mich unsterblich in Adonis Atanasius verknallt. Adonis oder Adi, wie ihn alle nannten, machte seinem Namen alle Ehre. Adi war ein griechischer Gott, wie er im Buche stand: groß, breitschultrig, mit schwarzen Locken und Glutaugen, einem kantigen Kinn, und das Tollste war: Er rasierte sich schon!! Gooott, war das vielleicht männlich!! Ich glaube, in Adi war die gesamte weibliche Jahrgangsstufe hoffnungslos verliebt. War ja auch kein Wunder, denn die meisten anderen Jungs steckten noch bis zum Hals in der Pubertät, Eiterpickel, Zahnspangen, schlaksige Körper und ständig kicksende Stimmen inklusive. Mal ehrlich, Jungs im Stimmbruch hören sich an wie eine Tonstörung, man hat unweigerlich das Bedürfnis, sich die nächste Fernbedienung zu schnappen und auf »lautlos« zu stellen. Adi dagegen hatte eine Stimme wie nachtschwarzer Samt. Man wollte sich in seine Stimme hineinfallen lassen und sich mit ihrem warmen Timbre zudecken. Ich war zwar bis über beide Ohren in Adi verschossen, hätte das aber im Leben nicht zugegeben. Was das angeht, bin ich doch sehr türkisch veranlagt. Ich bevorzuge es, wenn die Männer mir hinterherlaufen und nicht umgekehrt.
Nicht, dass das bis dahin je passiert wäre, denn ich war nie auffallend hübsch, meine Beine sind kurz und ein wenig stämmig. Ich denke, das hat Gott mit Absicht gemacht, denn hätte ich lange, schlanke Beine wie die deutschen Frauen, würde ich nur kurze Röcke tragen und einen Familienkrieg auslösen. Dafür habe ich eine schlanke Taille, die mein ganzer Stolz ist. Mein Busen ist bedauerlicherweise nicht weiter nennenswert, da kaum vorhanden. Gäbe es das, dann wäre meine Körbchengröße sicherlich fünfundsiebzig minus A anstelle von fünfundsiebzig A, und mit meinen langen nussbraunen Haaren, die ich damals gerne offen getragen habe, versuchte ich, meine mangelnde Oberweite zu kaschieren. Meine Arme waren für eine Frau schon immer viel zu muskulös. Leider steht kein Kerl auf eine Frau, die mehr Liegestützen machen kann als er. So dachte ich bis dahin jedenfalls.
Deshalb war ich total perplex, als Adi eines Tages in der Zehn-Uhr-Pause auf dem Schulhof zu mir kam und begann, sich mit mir zu unterhalten. Obwohl ich ja ansonsten nicht auf den Mund gefallen bin, war ich so baff, dass ich seine freundliche Frage, wie denn meine Mathearbeit gelaufen sei, mit einem heftigen Schluckauf beantwortete. Denn immer, wenn ich entsetzlich nervös bin, bekomme ich einen sehr lauten, lang anhaltenden Schluckauf.
Ich fragte mich, ob irgendjemand eine geschmacklose Wette mit ihm abgeschlossen haben könnte oder ob ich träumte. Zugleich wünschte ich mir sehnlichst, dass er hier bei mir blieb und immer weiter sprach, obwohl ich vor lauter Aufregung das Gefühl hatte, nichts verstehen zu können. Adi hatte mich eine Weile verblüfft gemustert, sicher hat er sich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hatte, dann hatte er gelacht.
»Melda, ich finde, du bist erfrischend anders als die anderen Mädchen.«
Als wüsste er, was mir eben durch den Kopf gegangen war, fragte er mich: »Was hast du nach der Schule vor?« Seine schwarzen Augen glänzten, während sich sein pechschwarzer Blick auf meinen heftete. In diesem Moment wusste ich, dass Adi der Mann sein würde, mit dem ich das erste Mal Sex haben würde, türkische Tochter hin oder her.
Adi und ich gingen also fast täglich unter den neidischen Blicken meiner Klassenkameradinnen nach der Schule zusammen irgendwohin, zum Lernen in die Bibliothek, wo wir hinter dicken Wälzern heimliche Küsse austauschten, ins Café zum Eisessen, wo er mein Knie streichelte und mir das Eis von den Lippen saugte, oder zum Knutschen ins Kino. Meinen Eltern erzählte ich, ich sei nun Mitglied im Schachclub, im Bücherclub und in der Redaktion der Schülerzeitung und müsste deshalb auch nach dem Unterricht dableiben, um alles zu schaffen, oder ich teilte ihnen mit, ich würde mit Pelin, meiner besten Freundin, in der Bibliothek lernen. Pelin deckt mein Doppelleben übrigens bis heute. Früh übt sich eben!
Meine Eltern, die sich sehr über meinen neu erwachten Arbeitseifer freuten, hatten nie irgendwelche Einwände.
Hätten sie gewusst, dass ich mit einem Griechen, dem erklärten Todfeind der Türken, knutschend und heftig fummelnd in der letzten Reihe im Kino gesessen hatte, dann wäre mein Leben bestimmt anders verlaufen, da bin ich mir sicher. Aber was keiner weiß, macht keinen heiß, nicht wahr?
Adonis sah nicht nur aus wie ein griechischer Gott, er konnte auch so küssen. Wenn er seine Lippen auf meine presste, wurden meine Beine zu Pudding, die Welt um mich herum drehte sich, und ich fürchtete, mein Herz könnte vor lauter Aufregung aus meinem Mund geradewegs in seinen hüpfen. Adi war schlichtweg perfekt. Meine Mathenoten verbesserten sich rapide, weil er sich nun neben mich setzte und mich abschreiben ließ.
Als dann unsere Klassenfahrt in die Bretagne anstand, waren wir natürlich unheimlich aufgeregt. Ohne darüber gesprochen zu haben, wussten wir, dass diese Klassenfahrt unsere große Chance sein würde, eine bedeutende sexuelle Erfahrung zu machen. Aber wir hatten uns das Ganze sehr viel leichter vorgestellt. Entweder tauchten unsere Klassenkameraden just in dem Moment auf, in dem wir dachten, dies sei der richtige Zeitpunkt, um uns näherzukommen, oder ich bekam einen heftigen Schluckauf. Doch so schnell gibt ein Grieche nicht auf und ich sowieso nicht! Wir ließen keinen unbeobachteten Moment verstreichen, den wir nicht mit heißen Küssen und vielversprechendem Körperkontakt ausfüllten. Die Luft um uns herum knisterte vor Spannung. Ein Blick von ihm reichte aus, mich schwach zu machen.
In unserer letzten Nacht hatte Adi schließlich eine Decke, Cidre und Plastikbecher besorgt. Damit wollten wir hinaus an den Strand gehen, um einen romantischen Abend zu verbringen. Er hatte den idealen Ort am Tag zuvor ausgekundschaftet. Wir stellten also unsere Armbanduhren auf Mitternacht und schlichen uns aus unseren Schlafsälen hinaus an den Strand, wo wir Hand in Hand im seichten Wasser entlangspazierten. Der Vollmond spiegelte sich beruhigend auf den mitternachtsblauen Wellen wider, die aussahen, als wären sie schwarz lackiert. Es war warm, und eine leichte Brise wehte uns um die Nase.
Adi bespritzte mich neckisch mit Meerwasser, und ich kreischte leise auf, holte mit meinem Fuß aus und spritzte ihn ebenfalls nass, dann lief ich davon, und unter meinen Füßen sprengte das Wasser auf und zerstob im Mondlicht wie Diamantenstaub, während mein Adonis mir hinterhersetzte und mich lachend herumwirbelte.
An den Rest des Weges kann ich mich kaum erinnern, weil wir so intensiv geknutscht haben, dass ich mich halb von Adi bis an diese besondere Stelle am Strand mitschleifen ließ. Als wir endlich angekommen waren, breitete er die Decke sorgfältig aus, und wir stießen mit lauwarmem Cidre an. Dann küsste er mich, und ich küsste ihn, und er knöpfte mein Kleid auf, während ich ihm sein Shirt vom Körper zog, und wir begaben uns langsam in die Waagerechte. Gerade als ich bis auf meinen Slip vollkommen nackt war, merkte ich, dass es um mich herum irgendwie nass wurde. Vielleicht lagen wir zu dicht am Wasser, aber was machte das schon. Es war heiß, und ein wenig Wasser würde uns sicher angenehm erfrischen.
Außerdem würde ich mich nun nicht schon wieder um meine Chance bringen lassen, eine Nacht mit meinem persönlichen Adonis zu verbringen. So knutschten wir weiter und weiter, bis mein Kopf plötzlich ganz im Wasser versank. Adi lag halb auf mir und war derart in Fahrt, dass er erst bemerkte, dass ich gerade ertrank, als er von meinem Busen abließ und an meinem Ohrläppchen knabbern wollte.
»Mein Gott, die Flut!«, rief er erschrocken und richtete sich kerzengerade auf.
»Flut? Welche Flut?«, prustete ich und hickste. Das verdammte Salzwasser brannte in meinen Augen, und meine Haare waren voller Sand.
»Wir müssen hier schnell weg!«, rief er und zog mich hoch. Wir rannten zurück zur Jugendherberge.
»Soʼn Mist!«, fluchte er, als wir patschnass dort ankamen.
Ich nickte zustimmend und hickste erneut.
Plötzlich leuchteten seine Augen auf, und er sagte: »Was wäre, wenn ich dir sagen würde, ich habe noch eine Idee?«
Ich war mir gar nicht so sicher, ob ich noch in der richtigen Stimmung war, aber irgendwie war ich auch wütend auf die Flut und den verdammten Schluckauf und dachte: Jetzt oder nie!
»Los, erzähl mir von deiner Idee!«
Adi grinste und ging auf den BMW Z3 zu, der in der Auffahrt stand. »Der Wagen gehört zur Jugendherberge, einem der Betreuer«, erklärte er. »Zufällig weiß ich, dass der Besitzer die Schlüssel immer hier aufbewahrt.« Er öffnete die unverschlossene Fahrertür und zog den Schlüssel unter dem Sitz hervor.
»Und?«, fragte ich.
»Na ja, ganz in der Nähe befindet sich ein Wäldchen. Ich habe mich gerade gefragt, ob du wohl Lust auf eine kleine Spritztour hast?« Er sah mir tief in die Augen, und seine Zähne leuchteten im Mondlicht weiß auf. Wer kann dazu schon nein sagen? Trotzdem hatte ich Bedenken.
»Mit einem gestohlenen Wagen? Ich weiß nicht, Adi.«
»Komm schon, wer sollte uns schon erwischen, um diese Uhrzeit ist doch nichts mehr los.«
Ich zögerte, doch als Adi mich erneut küsste, lächelte ich. »Okay.«
Und so fuhren wir kurze Zeit später in einem gestohlenen BMW Z3 auf einen Wald zu, der in der Dunkelheit der Nacht alles andere als romantisch aussah.
Tapfer ließ ich mir nichts anmerken und so befanden wir uns schon bald auf einem kleinen, stockfinsteren Schlammpfad, die Scheinwerfer unseres Autos waren die einzige Lichtquelle. Schließlich entschied Adi, dass wir nun weit genug entfernt seien, und stellte den Motor ab. Mit einem. Mal war es stockfinster. Ich begann heftig mit den Zähnen zu klappern, weil ich nass bis auf die Knochen war und die Hosen gestrichen voll hatte, weil mir plötzlich das »Blair Witch Project« einfiel.
Was, wenn mir nun irgendwer meine Gedärme herausriss oder Adi plötzlich aus dem Auto zog und ihm die Kehle durchschnitt? Und ich könnte nicht einmal um Hilfe schreien, weil ich keine Silbe Französisch sprechen konnte. Mein Gott, das alles nur, weil ich endlich Sex haben wollte!
Doch mein persönlicher Adonis lächelte mir beruhigend zu und strich mir liebevoll eine nasse Strähne aus dem Gesicht, bevor er meine blau angelaufenen Lippen mit seinem heißen Mund versiegelte. Es ging mir schlagartig besser.
Nach kurzer Zeit waren wir schon so weit, dass wir gerne übereinander hergefallen wären, wenn da nicht die Schaltung des Z3 uns im Weg gewesen wäre. Das Interieur des Wagens war derart eng, dass der arme Adi sich kaum bewegen konnte, trotzdem schafften wir es, einander umständlich von unserer nassen Kleidung zu befreien. Ich hatte einen Moment später gar nichts mehr an, genauso wie er.
Er machte einen tollpatschigen Versuch, über die Schaltung hinweg auf meinen Sitz zu gelangen, aber seine Beine waren zu lang. Er hielt einen Moment inne, überlegte kurz und richtete sich auf. Dann stieg er aus, und bevor ich erstaunt nach Luft schnappen konnte, sah ich einen ziemlich weißen Hintern um den Z3 zu meiner Seite des Wagens herumlaufen (der Rest seines Körpers war so braun, dass er mit der Dunkelheit des Waldes verschmolz). Wäre ich nicht unheimlich aufgeregt gewesen, hätte ich mich sicher totgelacht.
So aber steigerte sich meine Erregung, als Adi die Tür öffnete. Ich stieg aus, Adi setzte sich auf meinen Platz und ich mich auf seinen Schoß.
»Hi«, flüsterte er rau.
»Hallo«, begrüßte ich ihn etwas scheu. Ich erinnere mich noch genau, wie ungewohnt, aber überraschend warm sich seine nackte Haut auf meiner angefühlt hatte.
Und auch wenn der Wagen unheimlich eng und unkomfortabel war, schaffte es mein persönlicher Adonis dennoch, mir jede Scheu zu nehmen, so dass ich diese Fahrt nach Frankreich mein Leben lang sicher nie vergessen werde. In dieser Nacht verlor ich meine Unschuld und das sogar mehrmals.
Es wurde erst dann alles etwas heikel, als der Förster gegen die beschlagenen Autoscheiben klopfte und uns auf Französisch nach unseren Ausweisen fragte.
Wahrscheinlich wären Adi und ich noch lange ein Paar geblieben, doch unglücklicherweise erfuhren seine griechischorthodoxen Eltern von seiner Liaison mit einer Türkin, ergriffen drastische Maßnahmen und zogen einfach fort. Von Adonis habe ich danach nie wieder etwas gehört. So ist das eben. Aber hätte ich damals nicht angefangen, meine Mutter und meinen Vater zu belügen, hätte ich mich selbst um meinen Adonis gebracht, und das war eine Erfahrung, die es eindeutig wert war, alles zu riskieren.
Es ist übrigens überaus anstrengend, zwei Kulturen angehören zu wollen, davon kann ich ein Liedchen singen. Adi ist nicht der Einzige, der Eltern hat, die, sagen wir: »heimatorientiert« denken und handeln. Ich weiß das, denn immerhin bin ich auf diese Weise erzogen worden.
Meine Eltern sind Einwanderer aus der Türkei. In den Sechzigern zogen sie mitsamt ihren Familien nach Deutschland. Weiß der Teufel, was sie geritten hat, das zu tun. Mein Leben wäre weitaus weniger kompliziert verlaufen, wenn sie geblieben wären, wo sie waren!
Aber ich will nicht unfair sein. Sie konnten das ja nicht wirklich frei entscheiden. Mama war vierzehn und Papa war siebzehn, als ihre Familien sie mit nach Deutschland mitgenommen haben. Die beiden mussten Deutsch lernen in einer Zeit, in der es kein Geld für Kurse gab. Doch immerhin besaß schon jede Familie einen Fernseher, und so lernten sie Deutsch aus Filmen. Deshalb spricht Papa noch heute Deutsch wie John Wayne.
Sie kamen beide auf dieselbe Schule, und nachdem sie ihren Abschluss in der Tasche hatten, beschlossen sie, zu heiraten. Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher, ob es nun eine dieser arrangierten Ehen war und sie sich hinterher verliebten oder ob sie sich zuerst verliebt hatten und die Ehe im Nachhinein arrangiert wurde. Ist ja auch einerlei. Jedenfalls sind sie ein glückliches Paar, und ich bin ihr einziges Kind.
Wenn ich mich so umsehe, kann ich von Glück sagen, dass Mama und Papa moderne Menschen sind, die sich um Integration bemühen. Ich trage kein Kopftuch, genauso wenig wie Mama, und mein Papa ist glatt rasiert und trägt Mama auf Händen. Er kann spülen und Wäsche waschen, nur das Kochen ist Mamas Sache, weil alles, was er kocht, einfach nicht schmeckt. Wir sind eine normale, moderne, türkische Familie.
Trotzdem ist es nicht so leicht, seine kulturellen Fesseln abzuwerfen.
Meine Eltern wollten immer, dass ich es einmal besser habe als sie, also haben sie während meiner ersten drei Lebensjahre nur türkisch mit mir gesprochen, damit ich meine Wurzeln nie vergesse. Im Kindergarten konnte ich deshalb natürlich kein Wort Deutsch. Ich habe mich lange Zeit gewundert, was die vielen ausländischen Kinder hier machten, bis ich merkte, dass meine beste Freundin Pelin und ich hier die Fremden waren und nicht die anderen Kinder. Wie erklärte man, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, als Dreijährige einer ebenfalls dreijährigen blonden Zicke, dass nicht ich ihr die Kaugummis in die Haare geklebt hatte, sondern der freche Junge mit den Sommersprossen?
Zum Ramadanfest habe ich den Älteren aus meiner Familie die Hände geküsst und dafür Süßes oder Geld bekommen, und weil Mama und Papa sich auch den deutschen Sitten anpassen wollten, haben wir jedes Jahr zu Weihnachten lauthals »Stille Nacht, Heilige Nacht« gesungen und unter einem Tannenbaum aus pfefferminzgrünem Plastik Geschenke ausgepackt. Das war für mich vollkommen normal.
Mama und Papa dachten, dass ich so alles lernte, was für mein späteres Leben wichtig ist. Leider scheiden sich da schon unsere Geister.
Ich versuche ja mein Menschenmögliches, ihnen eine gute Tochter zu sein. Ich habe einen Beruf und wohne noch immer bei meinen Eltern, wie es sich für ein wohlerzogenes unverheiratetes türkisches Mädchen gehört, obwohl ich schon sechsundzwanzig bin.
Mehr müssen Mama und Papa nicht über mich wissen. Alles andere würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder einen Kreislaufkollaps verursachen.
Ich lerne türkische Gerichte zu kochen und halte mit unseren ebenfalls türkischen Nachbarn höflichen Smalltalk. Wenn türkische Männer mich anstarren, senke ich den Blick, wie es sich für eine anständige unverheiratete junge Frau gehört.
Bisher bin ich damit eigentlich ganz gut gefahren.
Das alles erklärt nun aber noch lange nicht, warum ich mich hier auf einer unfreiwilligen Hochzeit befinde. Es begann alles an dem Tag, den Pelin und ich so lange gefürchtet hatten.
»Frau Moran, Frau Balabak, morgen ist es so weit: Ich trete den Rückzug an!«, verkündete unser Chef eines Tages strahlend.
Ich nickte ihm freundlich zu, und Pelin sagte bedauernd: »Wir werden Sie wirklich sehr vermissen, Herr Hase, Sie und ›Hobbit‹ natürlich auch.«
Was den Hasen so besonders sympathisch machte, war die Tatsache, dass er ein Pechvogel war.
Hase hatte einen Hund, nun ja, eigentlich war der Hund ja mehr ein mittelgroßes Pony oder ein kleines Rind, das kommt wohl ganz auf den Betrachter an. Sein Fell war kurz und grau gescheckt und sein Bellen tief und durchdringend. Hobbits Kopf war beinahe doppelt so groß wie meiner, und seine Augen hatten die Größe von Zwei-Euro-Stücken. Seine Tatzen hätten genauso gut einem Grizzly gehören können, und seine ständig feuchte Zunge leckte freundlich über jedes Gesicht in Reichweite. Hobbit war ein Rüde, und leider war er auch nicht kastriert.
Pelin und mich störte diese unwesentliche Tatsache eigentlich nicht, denn Hobbit war lammfromm und meistens mehr kuscheliger Bettvorleger als aggressiver Kampfhund.
Der Hase ließ ihn frei zwischen seinem und unserem Büro hin und her pendeln, und wir vier waren bis dato ein gutes Team, solange Hobbit friedlich war. Das war leider nicht immer der Fall.
Eines Tages knurrte und kläffte Hobbit unruhig. Langsam waren Pelin und ich wirklich genervt. Aber was konnten wir beide schon gegen ein Kalb ausrichten?
Gerade als wir überlegten, Hobbit in Hases Büro zu sperren, klopfte es kurz, und noch bevor einer von uns Einspruch erheben konnte, öffnete sich die Tür, und der Vorstandsvorsitzende unserer Bank, Herr Müller, trat lächelnd ein.
Leider kam es vor, dass Hobbit geil wurde, und dann sollte man ihm, wenn man ein Mann war, besser aus dem Weg gehen. Tja, Pelin und ich haben das auch nie so recht verstanden, aber Hobbit schien eben mehr auf Kerle zu stehen.
Als er den vor Schrecken paralysierten Vorstandsvorsitzenden in seinem vornehmen, schwarzen Anzug mit dem blütenweißen Hemd und der flotten roten Krawatte sah, hielt er in seinem Kläffen inne. Ich denke heute, es war Liebe auf den ersten Blick. Als Herr Müller Hobbit sah, schmolz sein Lächeln wie Eiscreme im Hochsommer in rekordverdächtigem Tempo dahin.
»N...nehmen Sie den Hund bb...bbitte weg ... Ich hhhhabbbe panische Angst vvvor Hunddden«, stotterte er.
Doch Hobbit, so nett er ansonsten war, konnte leider erstaunlich stur sein, wenn er sein Herz vergab. Mit einem Satz sprang er Herrn Müller an und legte seine enormen Pfoten auf dessen Schultern. Wie Hobbit da so auf zwei Beinen stand, wirkte er unheimlich imposant, sicher war er so über einen Meter neunzig groß, auf jeden Fall einen Kopf größer als der Vorstandsvorsitzende.
»Nnn...nehmt den ... H...Hund ... dda wwwweg.« Herr Müller war paralysiert vor Angst.
Pelin und ich eilten ihm zu Hilfe, doch sobald wir Hobbit anfassten, fletschte er seine Wolfszähne und knurrte uns furchterregend an. Nicht, dass Pelin und ich feige wären, aber wir fürchteten um die Gesundheit unseres Vorstandsvorsitzenden.
»Äh ... vielleicht ist es besser, Sie warten, bis er von allein runterkommt«, schlug ich vor.
»N...nnehmt ihn ddda wwweg.« Herr Müller war furchtbar blass. Hobbit hielt seinen neuen Freund fest umklammert. Ich konnte deutlich sehen, wie Hobbits Atem die Nackenhaare unseres Vorstandes hochpustete.
»Ich hole Herrn Hase, er wird Ihnen sicher helfen können«, versuchte Pelin ihn zu beruhigen und lief den Korridor zu dem Kollegen herunter, mit dem der Hase im Termin war.
Herr Müller wimmerte mitleiderregend, wagte aber nicht, sich zu rühren, da jede seiner Bewegungen von Hobbit mit einem unzufriedenen »Grrrrr...!« quittiert wurde.
»Sie sollten sich momentan besser nicht bewegen«, riet ich mitfühlend.
Als ob das nicht reichen würde, begann Hobbit nun, seine Umarmung zu intensivieren und ... äh ... man könnte sagen, Hobbit begann, sich merkwürdig hopsend auf und ab zu bewegen.
Nervös stürmte der Hase in diesem Moment ins Büro. Beim Anblick unseres obersten Chefs, wie er da von seinem Hund vergewaltigt wurde, wurde er beinahe so rot wie ein guter Bordeaux.
»Hobbit! Aus!«, schrie er, packte den Hund bei seinem Halsband und riss ihn herunter.
Herr Müller war noch immer leichenblass, obwohl er sichtlich erleichtert schien. Er wischte sich den Angstschweiß von der Stirn, atmete tief durch und sagte: »Herr Hase, wir müssen uns unterhalten.«
Mit diesen ernsten Worten verschwand Herr Müller in Hases Büro, ohne Pelin und mich zu beachten, während unser Chef uns einen mitleidheischenden Blick zuwarf, sich umdrehte und den Rückzug in sein Büro antrat. Kurze Zeit später gab Hase bekannt, dass er in den Ruhestand ging.
»Was werden Sie denn mit all Ihrer Freizeit anstellen? Werden Sie uns vermissen?«, erkundigte ich mich besorgt.
»Ich werde sicher oft an Sie zwei denken, weil Sie immer so lustig sind und mich hier sehr verwöhnt haben, aber die Arbeit vermissen?« Er schüttelte seinen weißbehaarten Kopf.
»Meine Frau und ich werden von Februar bis Oktober in der Türkei bleiben, uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und leckeren Kebab essen, während Sie hier über den Papieren brüten«, erklärte er vergnügt, während er seine Habseligkeiten in einen Karton packte und Pelin und ich ihm dabei halfen.
»Wer wird denn Ihr Nachfolger?« Ich war maßlos neugierig. Immerhin hatten wir doch wohl ein Recht zu erfahren, wen uns die Geschäftsleitung nun vor die Nase setzen würde, nicht wahr?
»Ein Dr. Pfennig. Leider weiß ich nur, dass er in Münster studiert und seinen Doktor in Bankwirtschaft an der Uni in Harvard erworben hat«, teilte Herr Hase uns bereitwillig mit.
Ich pfiff anerkennend durch die Zähne. »Wow! Harvard! Nicht schlecht!«
»Ach was, bestimmt ist er ein spießiger, alter Sesselfurzer, der sich bei jedem winzigen Privatgespräch sofort an die Geschäftsleitung wendet, um sich zu beschweren«, wisperte Pelin mir zu, und ich verzog mein Gesicht. Das lag absolut im Rahmen des Möglichen. Wir hatten so manche Kollegen, die mit Chefs zusammenarbeiten mussten, die sich aufführten, als seien sie der Papst persönlich.
Wenn man beispielsweise Herrn Saft, dem Kreditdirektor, in einer Spielwarenabteilung im Kaufhaus begegnen würde, würde man ihn freundlich an seine Schulter tippen und fragen: »Na, mein Junge, welches Spielzeug soll ich dir denn vom Regal holen?«
Herr Saft sieht nämlich nur so lange seriös aus, wie er hinter seinem überdimensionalen Schreibtisch hockt. Wenn man es aber wagt, seinen Blick zu senken, während man eingeschüchtert vor ihm steht, sieht man, dass seine kurzen Beine in der Luft baumeln, und man munkelt, dass er eine Leiter braucht, um auf seinen Bürostuhl zu klettern. Wie so oft bei kleinen Männern verspürt auch er ständig das Bedürfnis, herumzuschreien und sich aufzuplustern. Deshalb sieht er auch aus wie ein faltiger Gnom, hat dafür aber die Stimme von Joe Cocker.
Und weil er sich ständig wichtig machen muss, pfeift er seine Sekretärin bei jeder sich bietenden Gelegenheit an. Nicht auszudenken, wenn man so einen Typen als Chef bekäme!
»Was ist eigentlich patlican kebab?«
Solche Fragen würden Pelin und mir sicher besonders fehlen. Der Hase war ein netter Mann in den besten Jahren und hat uns mit Fragen über türkisches Essen, türkische Sitten und die türkische Sprache immer gerne gelöchert, und da Pelin und ich uns in dieser Hinsicht als kompetent betrachteten, haben wir ihm stets alles ausführlich erklärt.
»Patlican kebab sind runde Frikadellen, die abwechselnd mit Auberginen, Peperoni, Zwiebeln und Tomaten aufgespießt und dann auf offenem Feuer gegrillt werden. Diesen langen Spieß richtet man dann auf lavasch an, das ist ein hauchdünnes, frisch gebackenes Fladenbrot. Man isst immer ein Stück von dem Gemüse und dem Fleisch, eingewickelt in ein Stück vom Fladenbrot. Es schmeckt unheimlich gut!«, antwortete Pelin geduldig, tippte vielsagend auf ihre Armbanduhr und zwinkerte mir verschwörerisch zu.
»Oh, Herr Hase, ich muss gehen, es tut mir leid, aber ich habe heute noch einen Arzttermin. Wir sehen uns ja morgen bei Ihrem Ausstand.« Hektisch begann ich, meinen Computer herunterzufahren und meine Schubladen abzuschließen.
»Jaja, keine Sorge, Frau Moran, Frau Balabak und ich kommen schon allein zurecht, nicht wahr?« Pelin erwiderte sein Lächeln, während ich einen gehetzten Blick auf meine Armbanduhr warf.
»Pelin, wenn meine Eltern anrufen ...«
»Keine Sorge, Melda, ich kümmere mich schon um sie. Und jetzt raus mit dir, du musst dich noch fertig machen!«
Ich warf ihr einen dankbaren Blick zu. Was gibt es Schöneres, als die beste Freundin und verlässlichste Komplizin als Kollegin zu haben?
So schnell es mein puderrosafarbenes Etuikleid zuließ, rannte ich die schwarzen Marmortreppen der Bank hinunter, in der ich seit meiner Ausbildung arbeite.
Ich lief hastig aus dem imposanten Gebäude hinaus und suchte den nächsten McDonaldʼs auf, wo ich mich in einer schmuddeligen Klokabine auszog und die Klamotten meines geheimen Lebens überstreifte.
Wenn ich morgens unser Heim verließ, war ich Melda Moran, die vernünftige Sekretärin in einer großen Bank in Köln. Ich arbeitete sorgfältig und gewissenhaft, und ich liebte meinen Job, weil ich gerne Kontakt zu Menschen habe und mein Chef ein Schatz war. Aber dreimal wöchentlich sehnte ich meinen Feierabend herbei.
Denn erst, wenn ich meine Bürokluft auszog und in meine durchlöcherten Jeans schlüpfen konnte, wenn ich meine Augen mit einem dicken Kajalstift schwarz bemalte, so dass sie blau aufleuchteten, und wenn meine langen, braunen Haare offen und glatt über meinen Rücken flossen, erst, wenn ich mich an mein Schlagzeug setzte und auf das Zeichen unseres Leadsängers Bono wartete, um endlich voll draufloszuhämmern, erst dann hatte ich das Gefühl, wirklich lebendig und ich selbst zu sein, denn dann war ich Roxy, die Schlagzeugerin.
Für alle normalen Menschen hört sich das bestimmt komisch an. Meine Eltern wussten, dass ich in einer Bank arbeitete, aber nicht, dass ich Drummerin in einer Rockband war. Meine Kollegen wussten, dass ich Türkin war und deshalb manche Dinge anders betrachtete als sie, aber auch sie wussten nichts von meinem Nachtleben.
Meine Band wusste, dass ich Türkin war und mich samstagnachts oft heimlich aus dem Haus schleichen musste, damit meine Eltern nichts mitbekamen. Sie wussten nichts davon, dass ich Bankerin war. Banker und Steuerberater sind Spießer, das war klar für sie. Und wo ich doch ohnehin schon so viele Geheimnisse habe, macht das eine mehr doch auch nichts aus, nicht wahr? Leider verdiente man als Schlagzeugerin nicht halb so gut wie in der Bank, wo nur Pelin alles über mich wusste und mir stets den Rücken frei hielt.
Pelin ist so etwas wie meine Schwester und heißt mit vollem Namen Pelin Balabak.
Unsere Mütter waren schon beste Freundinnen, als sie aus der Türkei fort- und hierhergezogen sind, also wuchsen wir zwei Einzelkinder beinahe wie Geschwister auf. Unsere Väter arbeiteten beide im Eisenwerk und waren von morgens bis abends nicht zu Hause, das Regiment führten deshalb eher die Frauen. Das hieß, dass Pelins Mutter, Tante Aylin, auf mich aufpasste, wenn Mama im Zeitungskiosk um die Ecke arbeitete, und Mama passte auf Pelin auf, wenn Tante Aylin arbeiten ging.
Ich zog mir ein schwarzes Tanktop über, legte zwei silberne Nietengürtel an und befestigte meine Nasenringe. Dann bemalte ich meine Lippen und betrachtete mich kritisch im Spiegel. Sehr gut! Von einer Tippse hatte ich nun rein gar nichts mehr an mir. Unwahrscheinlich, dass Kollegen aus der Bank erschienen oder jemand aus unserer Nachbarschaft kam und mir zuhörte, aber wenn doch, würde ich bestimmt nicht erkannt werden.
Endlich packte ich mein Kleid in einen alten Armeerucksack, zog meine schwarzen Springerstiefel an und lief ins »Garage«, so hieß der Club, in dem meine Band, »Dungeon«, auftrat. Ich war heute Abend leider viel zu spät dran und musste mich durch eine lange Schlange an der Kasse nach vorn drängen, um überhaupt hineinzukommen.
»He, pass doch auf!«, rief ein großer Blonder verärgert, als ich ihm versehentlich auf den Fuß stieg.
»Oh, tut mir leid, habe ich dein Porzellanfüßchen beschmutzt?«, erkundigte ich mich und schenkte ihm ein Lächeln.
»Ganz schön große Klappe!«, murmelte er verärgert.
»Mach mal nicht soʼn Wind, Blondie!«
Der blonde Kerl musterte mich kühl, während ich mich weiter vordrängte. Unser Bassist, Dean, hielt dort vorn schon Ausschau nach mir. Ich hüpfte wild auf und ab und rief: »Deaaaan! Hieeer bin ich! Deeeaahhhan!!«
Da hatte er mich schon gesehen, fischte mich mit seinen langen Armen kurzerhand aus der Menschenmenge heraus und half mir auf die Bühne, wo die anderen Bandmitglieder mich erleichtert begrüßten.
»Roxy, Babe, wo hast du denn nur gesteckt? Wir haben uns schon Sorgen gemacht!« Bono klopfte mir erleichtert auf die Schulter, und Pit, der E-Gitarrist, lächelte.
Für die Jungs war ich Roxy, die Schlagzeugerin mit Power, und das reichte ihnen. Mehr wollten sie nicht wissen und mehr würden sie nicht erfahren.
»Wollen wir loslegen?«, fragte Dean, der sich als Letzter auf die Bühne schwang und lässig einen Soundcheck durchführte, als wäre die Bar nicht brechend voll, sondern menschenleer.
Ich sah mich um und bemerkte, dass mein Schlagzeug gefährlich nahe am vorderen Rand der Bühne stand.
»Warum steht mein Schlagzeug so weit vorn?«
»Roxy, wir haben jetzt keine Zeit mehr, etwas daran zu ändern. Mach einfach das Beste daraus, okay?«
Ich nickte verärgert. »Ich werde schon nicht herunterfallen, keine Sorge!«
»One, two, one two three four ...!«, brüllte Bono laut, und die Menschenmenge unter uns wurde merklich leiser. Ich haute auf meine Trommeln, was das Zeug hielt, und schon röhrte Bonos rauchige Stimme durch den Raum, dicht gefolgt von einem erstklassigen Gitarrensolo von Pit. Die Menge jubelte und pfiff begeistert, viele schüttelten den Kopf wild zum Takt unserer Musik. Wie immer, wenn ich die Bühne betrat, war ich voll in meinem Element. Eine Stunde lang unterhielten wir unser Publikum und hatten dabei eine Menge Spaß.
Dann geschah das Unvermeidliche.
Jemand stieß heftig an den unteren Teil der ohnehin schon wackeligen Bühne. Mein Schlagzeug schwankte bedenklich, fast so, als würde es sich überlegen, ob es nun hinunterfallen sollte oder nicht. Ich machte einen kleinen Hechtsprung zum gefährlichen Rand der Bühne hin, um meine Instrumente zu retten, und es klappte auch, sie blieben, wo sie waren.
Dafür fiel ich eineinhalb Meter tief von der Bühne auf ein Meer voll namenloser Gesichter, und mein Kreischen verlor sich im Jaulen von Pits E-Gitarre.
Überraschenderweise landete ich ungewohnt weich.
»Pass doch auf!«, brüllte mir jemand von unten zu. Ich rappelte mich auf, um demjenigen, den ich gerade unter mir begraben hatte, aufzuhelfen.
Ein langer, kräftiger Oberkörper richtete sich unmittelbar vor meiner Nase auf, und jemand schüttelte seinen weizenblonden Schopf.
»Kennen wir uns?«, fragte ich ein wenig irritiert.
Er seufzte verärgert. »Porzellanzeh?«, half er mir gutmütig weiter.
Oh nein, der Blonde vom Eingang! Das konnte ja wohl nicht wahr sein! Konnte ich in ein und derselben Nacht demselben Mann auf den Fuß getreten und ihn dann auch noch platt gewalzt haben?
Bono hielt suchend nach mir Ausschau, und als ich ihm den Daumen hochhielt, signalisierte er mir ein Time-out. Pause.
Ich drehte mich zu meinem Opfer um.
»Hör mal, das tut mir leid, äh, auch das mit deinem Zeh, meine ich«, entschuldigte ich mich lahm.
Er grinste. »Schon gut.«
»Kann ich dich denn auf ein Bier einladen, um deine Schmerzen ein wenig zu lindern?«
Er legte seinen Kopf ein wenig schief und betrachtete mich kurz. »Okay, warum nicht? Ich habe wohl nicht mehr allzu viel zu verlieren, oder?«
Ich zuckte die Schultern und wandte mich zum Gehen, als ein stechender Schmerz in meinem Fuß mir fast die Sinne raubte und ich aufschrie und gegen ihn fiel.
»Du bist ja ganz schön anhänglich, was?«, erkundigte er sich belustigt.
Ich verzog schmerzhaft mein Gesicht und zeigte auf mein Bein.
»Hast du dich etwa verletzt?«
Es tat so weh, dass ich die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht loszuschreien. Schweiß trat mir auf die Stirn.
»Augenblick.« Der Blonde drehte sich um und ging zu Bono an die Bühne, er zeigte wild gestikulierend auf mich und Bono nickte verständig. Sie tauschten ein paar Worte aus, und Bono erklärte Dean und Pit etwas.
»Was hast du mit ihm besprochen?«, erkundigte ich mich.
»Ich habe ihm gesagt, dass ich dich ins Krankenhaus fahre. So, wir gehen«, erklärte er ruhig.
»Was fällt dir ein? Es geht mir gu... auu verdammt ...«
»Ja, klar, es geht dir toll. Dann mach mal die paar Schritte bis zum Ausgang allein. Bin ja mal gespannt, wie weit du kommst«, spottete er boshaft.