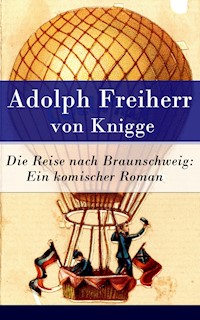Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Viele denken bei Knigge an kleinliche Benimmregeln, welche Gabel man für welche Speisen nutzt oder ob zuerst die Dame begrüßt wird und erst dann der höhergestellte Herr? Mit solchen Nebensächlichkeiten und Moden hat das Buch von Knigge nichts zu tun. Es ist mehr zu verstehen als ein psychologisches Benimmwerk und als Buch voller zeitloser Lebensweisheiten. Wir lernen über den Umgang mit Familie, Freunden, Bekanntschaften, dem anderen Geschlecht und - bemerkenswert! - mit uns selbst. "Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten, und also der Umgang mit unsrer eigenen Person gewiß weder der unnützeste noch uninteressanteste." [Kapitel "Über den Umgang mit sich selbst"] Der Titel ist Programm; Knigge konzentriert sich auf den Umgang mit Menschen. Eine Lebensphilosophie zum Gebrauch für die unmittelbare gesellschaftliche Praxis, ganz in der der Tradition der Aufklärung stehend. Knigges Sammeln von Erfahrungen und Beobachtungen lassen die Texte nicht als moraline Regeln, sondern als Vorschläge verkleidet daherkommen. Das Buch ist mehr ein früher Lebensratgeber als Benimmführer. In der 3. Auflage von 1790 hat es seine endgültige Form bekommen. Die lebendige und lebensnahe Sprache machen das Alter der Schriften schnell vergessen. Menschen sind Menschen geblieben, die Themen sind brandaktuell und werden es immer bleiben. "Allein in den jetzigen Zeiten, wo der Luxus so übertrieben wird; wo die Bedürfnisse, auch des mäßigsten Mannes, der in der Welt leben und eine Familie unterhalten muß, so groß sind; wo der Preis der nötigen Lebensmittel täglich steigt; wo die Macht des Geldes soviel entscheidet; wo der Reiche ein so beträchtliches Übergewicht über den Armen hat; endlich, wo von der einen Seite Betrug und Falschheit und von der andern Mißtrauen und Mangel an brüderlichen Gesinnungen in allen Ständen sich ausbreiten ..." [Kapitel: "Über den Umgang mit Leuten von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmung des Geistes und Herzens"] Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adolph Freiherr von Knigge
Über den Umgang mit Menschen
Adolph Freiherr von Knigge
Über den Umgang mit Menschen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-13-5
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Über den Umgang mit Menschen
Vorrede zu dieser dritten Auflage
Vorrede zu den ersten beiden Auflagen
Erster Teil
Einleitung
1.
2.
3.
4.
Erstes Kapitel
Allgemeine Bemerkungen und Vorschriften über den Umgang mit Menschen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Zweites Kapitel
Über den Umgang mit sich selbst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Drittes Kapitel
Über den Umgang mit Leuten von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmung des Geistes und Herzens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Zweiter Teil
Einleitung
Erstes Kapitel
Von dem Umgange unter Menschen von verschiedenem Alter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zweites Kapitel
Von dem Umgange unter Eltern, Kindern und Blutsfreunden
1.
2.
3.
4.
Drittes Kapitel
Von dem Umgange unter Eheleuten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Viertes Kapitel
Über den Umgang mit und unter Verliebten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fünftes Kapitel
Über den Umgang mit Frauenzimmern
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Sechstes Kapitel
Über den Umgang unter Freunden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Siebentes Kapitel
Über die Verhältnisse zwischen Herrn und Diener
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Achtes Kapitel
Betragen gegen Hauswirte, Nachbarn und solche, die mit uns in demselben Hause wohnen
1.
2.
3.
4.
5.
Neuntes Kapitel
Über das Verhältnis zwischen Wirt und Gast
1.
2.
3.
4.
Zehntes Kapitel
Über die Verhältnisse unter Wohltätern und denen, welche Wohltaten empfangen, wie auch unter Lehrern und Schülern, Gläubigern und Schuldnern
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elftes Kapitel
Über das Betragen gegen Leute in allerlei besondern Verhältnissen und Lagen
1.
2.
3.
4.
Zwölftes Kapitel
Über das Betragen bei verschiedenen Vorfällen im menschlichen Leben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dritter Teil
Einleitung
Erstes Kapitel
Über den Umgang mit den Großen der Erde, Fürsten, Vornehmen und Reichen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Zweites Kapitel
Über den Umgang mit Geringern
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Drittes Kapitel
Über den Umgang mit Hofleuten und ihresgleichen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Viertes Kapitel
Über den Umgang mit Geistlichen
1.
2.
3.
Fünftes Kapitel
Über den Umgang mit Gelehrten und Künstlern
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sechstes Kapitel
Über den Umgang mit Leuten von allerlei Ständen im bürgerlichen Leben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Siebentes Kapitel
Über den Umgang mit Leuten von allerlei Lebensart und Gewerbe
1.
2.
3.
4.
Achtes Kapitel
Über geheime Verbindungen und den Umgang mit den Mitgliedern derselben
1.
2.
3.
Neuntes Kapitel
Über die Art, mit Tieren umzugehn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zehntes Kapitel
Über das Verhältnis zwischen Schriftsteller und Leser
1.
2.
3.
4.
Elftes Kapitel
Schluß
1.
2.
3.
4.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Das Buch
Über den Umgang mit Menschen
Viele denken bei Knigge an kleinliche Benimmregeln, welche Gabel man für welche Speisen nutzt oder ob zuerst die Dame begrüßt wird und erst dann der höhergestellte Herr?
Mit solchen Nebensächlichkeiten und Moden hat das Buch von Knigge nichts zu tun.
Es ist mehr zu verstehen als ein psychologisches Benimmwerk und als Buch voller zeitloser Lebensweisheiten. Wir lernen über den Umgang mit Familie, Freunden, Bekanntschaften, dem anderen Geschlecht und -- bemerkenswert! -- mit uns selbst.
»Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten, und also der Umgang mit unsrer eigenen Person gewiß weder der unnützeste noch uninteressanteste.« [Kapitel »Über den Umgang mit sich selbst«]
Der Titel ist Programm; Knigge konzentriert sich auf den Umgang mit Menschen. Eine Lebensphilosophie zum Gebrauch für die unmittelbare gesellschaftliche Praxis, ganz in der der Tradition der Aufklärung stehend. Knigges Sammeln von Erfahrungen und Beobachtungen lassen die Texte nicht als moraline Regeln, sondern als Vorschläge verkleidet daherkommen.
Das Buch ist mehr ein früher Lebensratgeber als Benimmführer. In der 3. Auflage von 1790 hat es seine endgültige Form bekommen.
Die lebendige und lebensnahe Sprache machen das Alter der Schriften schnell vergessen. Menschen sind Menschen geblieben, die Themen sind brandaktuell und werden es immer bleiben.
»Allein in den jetzigen Zeiten, wo der Luxus so übertrieben wird; wo die Bedürfnisse, auch des mäßigsten Mannes, der in der Welt leben und eine Familie unterhalten muß, so groß sind; wo der Preis der nötigen Lebensmittel täglich steigt; wo die Macht des Geldes soviel entscheidet; wo der Reiche ein so beträchtliches Übergewicht über den Armen hat; endlich, wo von der einen Seite Betrug und Falschheit und von der andern Mißtrauen und Mangel an brüderlichen Gesinnungen in allen Ständen sich ausbreiten ...« [Kapitel: »Über den Umgang mit Leuten von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmung des Geistes und Herzens«]
Das Werke wurde vielfach nachgedruckt und übersetzt. Hier liegt es in der letzten, vom Autor überarbeiten und kommentierten Fassung vor.
Besonders interessant ist das fünftes Kapitel: »Über den Umgang mit Frauenzimmern«.
Vorrede zu dieser dritten Auflage
Die gütige, nachsichtsvolle Aufnahme, deren das Publikum in und außer Deutschland dies Buch würdigt, übertrifft sehr meine Erwartung. Der schnelle Absatz der ersten beiden Auflagen; die vorteilhaften Urteile einsichtsvoller Kunstrichter; die Auszüge, welche der Herr Prediger Fest und andre daraus gemacht haben, und endlich die Übersetzungen desselben -- das alles fordert mich auf, keine Mühe zu sparen, nach und nach das Fehlerhafte darin auszumerzen, und durch nötige Zusätze sowie durch Verbesserung der Schreibart meinem Werke mehr Vollkommenheit zu verschaffen.
Aufmerksame Leser werden finden, welche große Veränderungen, sowohl was die Anordnung, als was den Inhalt selbst betrifft, ich bei dieser dritten Auflage, wenn man sie gegen die ersten beiden hält, vorgenommen habe. Ich bin dabei neben meiner eigenen Überzeugung der Zurechtweisung würdiger Männer gefolgt. Unter diese zähle ich, wie billig, mit Dankbarkeit auch den Herrn Rezensenten im siebendundachtzigsten Bande der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, dessen milde, aber verständige und ernsthafte Winke ich größtenteils zu meinem Vorteile genützt habe.
Über unweisen, nicht reiflich durchgedachten Tadel hingegen habe ich mich hinausgesetzt. Ohne der verachtenswerten Beschuldigung des salzburgischen Herrn Kritikers Erwähnung zu tun, will ich nur des Vorwurfs der den deutschen Schriftstellern so eignen, zu großen Vollständigkeit gedenken, womit der undeutsche Herr Rezensent in der Allgemeinen Literatur-Zeitung mich beehrt. Ich werde mich bestreben, dieses Vorwurfs in vollem Maß würdig zu werden. Hat mein Buch einigen Wert, so bestimmt gewiß eben diese möglichste Vollständigkeit einen großen Teil desselben, und jedermann wird zum Wohltäter an mir werden, der mir jetzt anzeigt, über welche Verhältnisse und Lagen im menschlichen Leben ich noch Bemerkungen und Vorschriften zu liefern versäumt habe.
*
Man hat gegen den Titel dieses Werks die Erinnerung gemacht: daß er nur Regeln des Umgangs ankündigte, da hingegen das Buch selbst fast über alle Teile der Sittenlehre sich ausdehnte. Billige Richter haben indessen eingesehen, wie schwer dies zu vermeiden war. Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können. -- Das heißt: ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muß dabei zum Grunde liegen. Sollte man an meinem Buche das tadeln dürfen, daß es mehr leistet, als der Titel verspricht, so könnte man dem Übel auf einmal abhelfen, wenn man diesem Werke etwa die Überschrift gäbe: »Vorschriften, wie der Mensch sich zu verhalten hat, um in dieser Welt und in Gesellschaft mit andern Menschen glücklich und vergnügt zu leben und seine Nebenmenschen glücklich und froh zu machen.« Allein dieser Titel kommt mir ebenso geschwätzig als prahlerisch vor. Man verzeihe mir’s also, daß ich es damit beim alten gelassen habe!
Andre haben hier Vorschriften für junge Leute vermißt, die als Studenten, Offiziere usf. in die Welt treten. -- Vorschriften, wie diese sich gegen andre junge Leute gleichen Standes zu betragen hätten. Der Herr Rezensent in den Würzburger gelehrten Anzeigen hat dagegen sehr vernünftig angemerkt, daß, wenn ich so hätte in das Detail gehn wollen, ich vielleicht in zehn Bänden meinen Gegenstand nicht würde erschöpft haben, und daß ich mich sehr vielfach hätte wiederholen müssen. Ich füge noch hinzu, daß unter jungen Leuten, die noch keinen festen Charakter haben, die Mannigfaltigkeit der Sonderbarkeiten, welche sie in ihrer Art sich zu betragen zeigen, zwar unendlich groß, aber auch zugleich so unwichtig scheint, daß ein Jüngling, dem es ernst ist, sich für die Welt zu bilden, auf diese weiter keine Rücksicht zu nehmen braucht, wenn er sich, im Umgange mit Menschen von gleichem Alter, so vorsichtig, ordentlich und redlich beträgt, als die Vorschriften dazu in diesem Buche, sowohl im allgemeinen, als nach den verschiedenen Stimmungen und Verhältnissen unter allen Gattungen von Menschen, angegeben werden.
Hannover, im Januar 1790.
Vorrede zu den ersten beiden Auflagen
Der Gegenstand dieses Buchs kommt mir groß und wichtig vor, und irre ich nicht, so ist der Gedanke, in einem eignen Werke Vorschriften für den Umgang mit allen Klassen von Menschen zu geben, noch neu.1 Eben dieser Umstand aber und daß mir in Deutschland, soviel ich weiß, niemand vorgearbeitet hat, muß einen Teil der Unvollkommenheiten meiner Arbeit entschuldigen. Es ist ein weites Feld vollständig und gründlich zu bearbeiten, vielleicht für einen Menschen und gewiß für meine Kräfte zu groß. Kann aber das in magnis voluisse aliquid Verdienst geben, so darf ich einigen Anspruch auf den Dank des Publikums machen, um so mehr, wenn etwa meine Arbeit bei einem größern Menschenkenner und feinern Philosophen einst die Lust erwecken sollte, etwas Vollkommneres hierüber zu liefern.
Vielleicht wird man mir Weitschweifigkeit vorwerfen und mich beschuldigen, ich hätte Räsonements eingemischt, die nicht eigentlich zu den Regeln über den Umgang mit Menschen gehören; allein es ist hier schwer, die wahre Grenzlinie zu finden. Wenn ich zum Beispiel lehren will, wie vertraute Freunde im Umgange miteinander sich betragen sollen, so scheint es mir sehr passend, erst etwas über die Wahl eines Freundes und über die Grenzen freundschaftlicher Vertraulichkeit zu sagen, und wenn ich über das Betragen im geselligen Leben in manchen Klassen von Menschen rede und zeige, wie man ihrer Schwächen schonen soll, so stehen philosophische Bemerkungen über diese Schwächen selbst und über deren Quellen nicht am unrechten Ort.
Übrigens habe ich dies Buch nicht flüchtig hingeschrieben, wie wohl andre meiner Schriften, sondern lange an den Materialien dazu gesammelt. -- Es enthält Resultate aus meinem ziemlich unruhigen Leben unter Menschen mancher Art. Bei dem veränderlichen und leichtfertigen Geschmacke des deutschen Publikums und der übertriebenen Nachsicht, mit welcher dasselbe unbedeutende Romane, leere Journale, platte Schauspiele und nichtswürdige Anekdotensammlungen aufnimmt, möchte es zwar kaum einer Entschuldigung bedürfen, wenn man diesen größern Teil des Publikums nicht so sehr respektierte, daß man streng gewissenhaft in Wahl und Ausfeilung der Produkte wäre, welche man in die gelehrte Welt schickt. Schriftstellerei ist in jetzigen Zeiten nicht viel mehr als Gespräch mit der Lesewelt; in freundschaftlichen Unterredungen wiegt man aber nicht jedes Wort ab. Der müßige Haufen will ohne Unterlaß etwas Neues hören; ernsthafte, wichtige Werke werden von den Buchhändlern nicht halb so gern in Verlag genommen und vom Publikum nicht halb so eifrig gelesen als jene Modeware; wenn man sich nun herabläßt, die Wahrheiten, die man zu sagen hat, wenigstens in ein solches Gewand zu hüllen, wie es der große Haufen gern sieht, so läuft wohl freilich je zuweilen ein unnützes Wort mit unter, und das ist vielleicht auch mein Fall gewesen. Doch will ich offenherzig genug sein, noch etwas zur Entschuldigung meiner bisherigen Vielschreiberei anzuführen.
Niemand kann lebhafter als ich selbst fühlen, welcher Ausfeilung meine zuerst herausgegebenen Schriften noch bedurft hätten, um irgendeinen Grad von Vollkommenheit zu erreichen. Indessen wurden sie und werden noch immer häufiger gelesen und öfter aufgelegt, als sie es verdienen. Der Verleger bat um mehr Ware von der Art, machte mir vorteilhafte Bedingungen, und ich wies den Erwerb nicht von mir. Ich schäme mich dieses Geständnisses nicht: Wer nur irgend weiß, auf welche Weise mein Vermögen eine lange Reihe von Jahren hindurch, sehr ohne meine Schuld, ist verwaltet worden, der wird mir das gern verzeihn, und wer mit meiner häuslichen Lebensart bekannt ist, muß mir das Zeugnis geben, daß ich das Gewonnene auf keine unedle Art verwendet habe.
Nicht immer habe ich mich vor meinen Schriften genannt; zuweilen hat man mich als Verfasser von Büchern angegeben, die ich nicht einmal gelesen hatte. Das hat mich bis jetzt wenig bekümmert; anders aber handelt der Mann, der in fremden Provinzen lebt, ohne an den Staat geknüpft zu sein, dem es desfalls weniger ängstlich um seinen bürgerlichen und gelehrten Ruf zu tun ist, und anders der, welcher in seinem Vaterlande wohnt, und dem die Achtung, auch des Geringsten unter seinen Mitbürgern, nicht gleichgültig sein darf. Nach achtzehnjähriger Abwesenheit befinde ich mich nun wieder in dem letztern Falle. Ich würde fürchten, man möchte das Unkraut, das ich hergäbe, dem vaterländischen Boden zur Last legen, auf welchem es gewachsen wäre, wenn ich fortführe, so schnell zu arbeiten; ich würde fürchten, mein liebes Vaterland zu beschimpfen, in welchem gottlob der Haufen elender Scribler noch nicht so groß ist als in den mehrsten andern Provinzen Deutschlands. Was ich also hier liefre und etwa ferner liefern werde (wenn ich je noch außer diesem Werke etwas schreiben sollte), muß wenigstens keine lose Ware sein, und nicht leicht werde ich wieder etwas drucken lassen, ohne meinen Namen davorzusetzen.
Es hat nicht Unzufriedenheit mit meinem Herrn Verleger in Frankfurt am Main, sondern andre Rücksichten haben mich bewogen, dies Buch einer hiesigen Buchhandlung in Verlag zu geben; vielmehr muß ich dem Herrn Andreä das Zeugnis geben, daß er sich jederzeit sehr billig, redlich und freundschaftlich gegen mich betragen hat.
Einige meiner Schriften sind in Wien und Leipzig nachgedruckt worden; sollte einer von der berüchtigten Zunft etwa auch auf dies Büchelchen eine korsarische Unternehmung von der Art wagen wollen, so dient demselben zur Nachricht, daß alle Vorkehrungen getroffen sind, den Schaden eines solchen Diebstahls auf den Räuber selbst fallen zu machen.
Hannover im Jänner 1788.
Ein gewisser Herr Kunstrichter hat die Entdeckung gemacht, und diese, in seiner Beurteilung der ersten Ausgabe meines Buchs, dem Publikum mitgeteilt, nämlich die Entdeckung: daß ich sehr irrte, wenn ich glaubte, der Gedanke, Vorschriften für den Umgang mit Menschen zu geben, sei neu; man finde vielmehr dergleichen in manchen andern Büchern. Der gute Mann hat in der Tat recht; selbst in Gesenii Haustafel trifft man solche Vorschriften an. Nur meine ich, der Gedanke, solche Vorschriften, und die nicht sämtlich von ganz gemeiner Art sind, für alle Verhältnisse zu sammeln, das wäre doch wohl nicht eben abgenutzt. Es würde mir indessen angenehm sein, wenn gedachter Herr Kunstrichter mir ein Werk von dieser Art namhaft machen und mir zugleich Gelegenheit geben wollte, die in meiner Schrift im allgemeinen gerügte Sprachunrichtigkeit durch Studium seiner mir unbekannten Schriften zu verbessern. <<<
Erster Teil
Einleitung
1.
Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln müssen.
Wir sehen die feinsten theoretischen Menschenkenner das Opfer des gröbsten Betrugs werden.
Wir sehen die erfahrensten, geschicktesten Männer bei alltäglichen Vorfällen unzweckmäßige Mittel wählen, sehen, daß es ihnen mißlingt, auf andre zu wirken, daß sie, mit allem Übergewichte der Vernunft, dennoch oft von fremden Torheiten, Grillen und von dem Eigensinne der Schwächeren abhängen, daß sie von schiefen Köpfen, die nicht wert sind, ihre Schuhriemen aufzulösen, sich müssen regieren und mißhandeln lassen, daß hingegen Schwächlinge und Unmündige an Geist Dinge durchsetzen, die der Weise kaum zu wünschen wagen darf.
Wir sehen manchen Redlichen fast allgemein verkannt.
Wir sehen die witzigsten, hellsten Köpfe in Gesellschaften, wo aller Augen auf sie gerichtet waren und jedermann begierig auf jedes Wort lauerte, das aus ihrem Munde kommen würde, eine nicht vorteilhafte Rolle spielen, sehen, wie sie verstummen oder lauter gemeine Dinge sagen, indes ein andrer äußerst leerer Mensch seine dreiundzwanzig Begriffe, die er hie und da aufgeschnappt hat, so durcheinander zu werfen und aufzustutzen versteht, daß er Aufmerksamkeit erregt und selbst bei Männern von Kenntnissen für etwas gilt.
Wir sehen, daß die glänzendsten Schönheiten nicht allenthalben gefallen, indes Personen, mit weniger äußern Annehmlichkeiten ausgerüstet, allgemein interessieren. --
Alle diese Bemerkungen scheinen uns zu sagen, daß die gelehrtesten Männer, wenn nicht zuweilen die untüchtigsten zu allen Weltgeschäften, doch wenigstens unglücklich genug sind, durch den Mangel einer gewissen Gewandtheit zurückgesetzt zu bleiben, und daß die Geistreichsten, von der Natur mit allen innern und äußern Vorzügen beschenkt, oft am wenigsten zu gefallen, zu glänzen verstehen.
Ich rede aber hier nicht von der freiwilligen Verzichtleistung des Weisen auf die Bewunderung des vornehmen und geringen Pöbels. Daß der Mann von bessrer Art da in sich selbst verschlossen schweigt, wo er nicht verstanden wird; daß der Witzige, Geistvolle in einem Zirkel schaler Köpfe sich nicht so weit herabläßt, den Spaßmacher zu spielen; daß der Mann von einer gewissen Würde im Charakter zu viel Stolz hat, sein ganzes Wesen nach jeder ihm unbedeutenden Gesellschaft umzuformen, die Stimmung anzunehmen, wozu die jungen Laffen seiner Vaterstadt den Ton mit von Reisen gebracht haben, oder den grade die Laune einer herrschenden Kokette zum Konversations-, Kammer- und Chorton erhebt; daß es den Jüngling besser kleidet, bescheiden, schüchtern und still, als, nach Art der mehrsten unsrer heutigen jungen Leute, vorlaut, selbstgenügsam und plauderhaft zu sein; daß der edle Mann, je klüger er ist, um desto bescheidener, um desto mißtrauischer gegen seine eigenen Kenntnisse, um desto weniger zudringlich sein wird; oder daß, je mehr innerer, wahrer Verdienste sich jemand bewußt ist, er um desto weniger Kunst anwenden wird, seine vorteilhaften Seiten hervorzukehren, so wie die wahrhafte Schönheit alle kleinen anlockenden, unwürdigen Buhlkünste, wodurch man sich bemerkbar zu machen sucht, verachtet, -- das alles ist wohl sehr natürlich! -- Davon rede ich also nicht.1
Auch nicht von der beleidigten Eitelkeit eines Mannes voll Forderungen, der unaufhörlich eingeräuchert, geschmeichelt und vorgezogen zu werden verlangt und, wo das nicht geschieht, eine traurige Figur macht; nicht von dem gekränkten Hochmute eines abgeschmackten Pedanten, der das Maul hängen läßt, wenn er das Unglück hat, nicht aller Orten für ein großes Licht der Erden bekannt und als ein solches behandelt zu sein, wenn nicht jeder mit seinem Lämpchen herzuläuft, um es an diesem großen Lichte der Aufklärung anzuzünden. Wenn ein steifer Professor, der gewöhnt ist, von seinem bestaubten Dreifuße herunter, sein Kompendium in der Hand, einem Haufen gaffender, unbärtiger Musensöhne stundenlang hohe Weisheit vorzupredigen und dann zu sehn, wie sogar seine platten, in jedem halben Jahre wiederholten Späße sorgfältig nachgeschrieben werden; wie jeder Student so ehrerbietig den Hut vor ihm abzieht, und mancher, der nachher seinem Vaterlande Gesetze gibt, ihm des Sonntags im Staatskleide die Aufwartung macht; wenn ein solcher einmal die Residenz oder irgendeine andre Stadt besucht, und das Unglück nun will, daß man ihn dort kaum dem Namen nach kennt, daß er in einer feinen Gesellschaft von zwanzig Personen gänzlich übersehn oder von irgendeinem Fremden für den Kammerdiener im Hause gehalten und Er genannt wird, er dann ergrimmt und ein verdrossenes Gesicht zeigt; oder wenn ein Stubengelehrter, der ganz fremd in der Welt, ohne Erziehung und ohne Menschenkenntnis ist, sich einmal aus dem Haufen seiner Bücher hervorarbeitet, und er dann äußerst verlegen mit seiner Figur, buntscheckig und altväterisch gekleidet, in seinem vor dreißig Jahren nach der neuesten Mode verfertigten Bräutigamsrocke dasitzt und an nichts von allem, was gesprochen wird, Anteil nehmen, keinen Faden finden kann, um mit anzuknüpfen, so gehört das alles nicht hierher.
Ebensowenig rede ich von dem groben Zyniker, der nach seinem Hottentottensysteme alle Regeln verachtet, welche Konvenienz und gegenseitige Gefälligkeit den Menschen im bürgerlichen Leben vorgeschrieben haben, noch von dem Kraftgenie, das sich über Sitte, Anstand und Vernunft hinauszusetzen einen besondern Freibrief zu haben glaubt.
Und wenn ich sage, daß oft auch die weisesten und klügsten Menschen in aller Welt, im Umgange und in Erlangung äußerer Achtung, bürgerlicher und andrer Vorteile ihres Zwecks verfehlen, ihr Glück nicht machen, so bringe ich hier weder in Anschlag, daß ein widriges Geschick zuweilen den Besten verfolgt, noch daß eine unglückliche leidenschaftliche oder ungesellige Gemütsart bei manchem die vorzüglichsten, edelsten Eigenschaften verdunkelt.
Nein! meine Bemerkung trifft Personen, die wahrlich allen guten Willen und treue Rechtschaffenheit mit mannigfaltigen, recht vorzüglichen Eigenschaften und dem eifrigen Bestreben, in der Welt fortzukommen, eigenes und fremdes Glück zu bauen, verbinden, und die dennoch mit diesem allen verkannt, übersehn werden, zu gar nichts gelangen. Woher kommt das? Was ist es, das diesen fehlt und andre haben, die, bei dem Mangel wahrer Vorzüge, alle Stufen menschlicher, irdischer Glückseligkeit ersteigen? -- Was die Franzosen den esprit de conduite nennen, das fehlt jenen: die Kunst des Umgangs mit Menschen -- eine Kunst, die oft der schwache Kopf, ohne darauf zu studieren, viel besser erlauert als der verständige, weise, witzreiche; die Kunst, sich bemerkbar, geltend, geachtet zu machen, ohne beneidet zu werden; sich nach den Temperamenten, Einsichten und Neigungen der Menschen zu richten, ohne falsch zu sein; sich ungezwungen in den Ton jeder Gesellschaft stimmen zu können, ohne weder Eigentümlichkeit des Charakters zu verlieren, noch sich zu niedriger Schmeichelei herabzulassen. Der, welchen nicht die Natur schon mit dieser glücklichen Anlage hat geboren werden lassen, erwerbe sich Studium der Menschen, eine gewisse Geschmeidigkeit, Geselligkeit, Nachgiebigkeit, Duldung, zu rechter Zeit Verleugnung, Gewalt über heftige Leidenschaften, Wachsamkeit auf sich selber und Heiterkeit des immer gleich gestimmten Gemüts; und er wird sich jene Kunst zu eigen machen; doch hüte man sich, dieselbe zu verwechseln mit der schändlichen, niedrigen Gefälligkeit des verworfenen Sklaven, der sich von jedem mißbrauchen läßt, sich jedem preisgibt; um eine Mahlzeit zu gewinnen, dem Schurken huldigt, und um eine Bedienung zu erhalten, zum Unrechte schweigt, zum Betruge die Hände bietet und die Dummheit vergöttert!
Indem ich aber von jenem esprit de conduite rede, der uns leiten muß, bei unserm Umgange mit Menschen aller Gattung, so will ich nicht etwa ein Komplimentierbuch schreiben, sondern einige Resultate aus den Erfahrungen ziehn, die ich gesammelt habe, während einer nicht kurzen Reihe von Jahren, in welchen ich mich unter Menschen aller Arten und Stände umhertreiben lassen und oft in der Stille beobachtet habe. -- Kein vollständiges System, aber Bruchstücke, vielleicht nicht zu verwerfende Materialien, Stoff zu weiterm Nachdenken.
Vermutlich war es diese Stelle in meinem Buche, welche einen Herrn quidam bewog, in seiner Rezension der ersten Auflage, zu sagen: »ich hätte mir Schilderungen erlaubt, die manchen Leser beleidigen würden.« Das ist möglich! Ein Buch voll Sittengemälde kann nicht so trocken geschrieben sein als ein Kompendium. Dies beleidigt freilich nicht leicht jemand anders als etwa den echten Geschmack, die gesunde Vernunft und den Systemgeist irgendeines Pedanten. Wer hingegen die Sitten der Menschen schildert, der kommt nicht so wohlfeil davon. Er kann nicht füglich ihre Torheiten verschweigen; fühlt nun ein Narr, dem eine dieser Torheiten anklebt, sich dadurch getroffen, dann geht der Lärm los. So könnte es zum Beispiel geschehn, daß, wenn ich von den Lächerlichkeiten eines Professors geredet hätte, der außer seiner Studierstube, oder wenigstens außer seiner akademischen Sphäre, in welcher er sich für ein großes Weltlicht halten läßt und Orakel predigt, eine elende Figur spielte, daß, sage ich, ein solcher Professor, der das lese, darüber sehr entrüstet und wohl gar gereizt würde, deswegen eine hämische Rezension meines Buchs drucken zu lassen; allein das benähme denn doch wohl diesem Buche nichts von seinem Werte. Eine äußerst boshafte Stelle in vorerwähnter Rezension aber, und die ich nicht so kaltblütig übersehn kann, ist die, wo der große Gelehrte mir Schuld gibt: »ich hätte Vorschriften gegeben, welche die strenge Sittlichkeit nicht gutheißen könne.« Ich fordre ihn auf, mir, nicht nur in diesem meinem neuen, sondern in irgendeinem Buche, daß ich je geschrieben habe, eine Stelle anzuführen, die eine solche mich vor dem Publico verleumdende Anklage begründen könnte. <<<
2.
In keinem Lande in Europa ist es vielleicht so schwer, im Umgange mit Menschen aus allen Klassen, Gegenden und Ständen allgemeinen Beifall einzuernten, in jedem dieser Zirkel wie zu Hause zu sein, ohne Zwang, ohne Falschheit, ohne sich verdächtig zu machen und ohne selbst dabei zu leiden, auf den Fürsten wie auf den Edelmann und Bürger, auf den Kaufmann wie auf den Geistlichen nach Gefallen zu wirken, als in unserm deutschen Vaterlande; denn nirgends vielleicht herrscht zu gleicher Zeit eine so große Mannigfaltigkeit des Konversationstons, der Erziehungsart, der Religions- und andrer Meinungen, eine so große Verschiedenheit der Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der einzelnen Volksklassen in den einzelnen Provinzen beschäftigen. Dies rührt her von der Mannigfaltigkeit des Interesses der deutschen Staaten gegeneinander und gegen auswärtige, von dem Unterschiede der Verbindungen mit diesem oder jenem auswärtigen Volke und von dem sehr merklichen Abstande der Klassen in Deutschland voneinander, zwischen denen verjährtes Vorurteil, Erziehung und zum Teil auch Staatsverfassung eine viel bestimmtere Grenzlinie gezogen haben als in andern Ländern. Wo hat mehr als in Deutschland die Idee von sechzehn Ahnen des Adels wesentlichen moralischen und politischen Einfluß auf Denkungsart und Bildung? Wo greift weniger allgemein als bei uns die Kaufmannschaft in die übrigen Klassen ein? (Soll ich die Reichsstädte ausnehmen?) Wo macht mehr als hier das Korps der Hofleute eine ganz eigene Gattung aus, in welche hinein, so wie zu der Person der mehrsten Fürsten, nur Leute von gewisser Geburt und gewissem Range sich hinzudrängen können? Wo durchkreuzen sich mehr Arten von Interesse? -- Und das alles wird nicht durch gewisse, dem ganzen Volke merkbare allgemeine Nationalbedürfnisse, Volksangelegenheiten, Vaterlandsnutzen konzentriert, wie in England, wo Aufrechterhaltung der Konstitution, Freiheit und Glück der Nation, Flor des Vaterlandes, der Punkt ist, in welchem sich das Streben, Dichten und Trachten so mancher originellen Charaktere vereinigt, noch wie in fast allen übrigen europäischen Ländern, die entweder unter einem einzigen Oberhaupte stehen oder durch ein einziges, allen Gliedern wichtiges Interesse beherrscht werden, wie die Schweiz, oder in welchen eine allein herrschende Religion oder ein tyrannisches Klima, über Denkungsart, Ton und Stimmung allgemein überwiegende Gewalt hat.
Daß im ganzen unsre deutsche Verfassung, so zusammengesetzt sie auch ist, sehr große, wesentliche Vorzüge gewährt, das leidet keinen Zweifel; allein es ist nicht weniger gewiß, daß dieselbe den mächtigsten Einfluß auf die Verschiedenheit der Stimmung in den einzelnen Provinzen und Staaten und unter den mancherlei voneinander abgesonderten Ständen hat. Eben daher kommt es, daß unsre Schauspieler, Schauspieldichter und Romanschreiber ein viel schwereres Studium haben, wenn sie alle diese Nuancen kennen, bearbeiten und dennoch einen Anstrich von originellem Nationalcharakter wollen durchschimmern lassen; viel schwerer als in Frankreich, wo die Sitten der verschiedenen Stände und einzelnen Provinzen nicht so sehr gegeneinander abstechen. Eben daher kommt es, daß man über wenige unsrer literarischen Produkte ein allgemein einstimmig beifälliges Volksurteil hört, daß überhaupt so wenig unsrer Werke als Nationalmonumente auf die Nachwelt übergehn, und eben daher endlich kommt es, daß es so schwer ist, mit Menschen aus allen Ständen und Gegenden in Deutschland umzugehn und bei allen gleichwohl gelitten zu sein, auf alle gleich vorteilhaft zu wirken.
Der treuherzige, naive, zuweilen ein wenig bäuerische, materielle Bayer ist äußerst verlegen, wenn er auf alle verbindlichen, artigen Dinge antworten soll, die ihm der feine Sachse in einem Atem entgegenschickt; dem schwerfälligen Westfälinger ist alles hebräisch, was ihm der Österreicher in seiner ihm gänzlich fremden Mundart vorpoltert; die zuvorkommende Höflichkeit und Geschmeidigkeit des durch französische Nachbarschaft polierten Rheinländers würde man in manchen Städten von Niedersachsen für Zudringlichkeit, für Niederträchtigkeit halten! Man glaubt da, ein Mann, der so äußerst untertänig und nachgiebig ist, müsse gefährliche und niedrige Absichten haben oder müsse falsch oder sehr arm und hilfsbedürftig sein, und oft ist dort ein wenig zu weit getriebene äußere Höflichkeit hinlänglich, den Mann, der sich am Rheine dadurch allgemeine Liebe erwerben würde, an der Leine verächtlich zu machen. Dagegen wird aber auch der nicht kältere, nur weniger leichtsinnige, weniger zuversichtliche, nicht so im Gedränge von Fremden, noch auf Reisen an Leib und Seele abgeschliffene, geglättete, sondern ernsthaftere Niedersachse, der bei der ersten Bekanntschaft nicht sehr zuvorkommend, sondern wohl gar ein wenig verlegen ist, an einem Hofe im Reiche vielleicht für einen schüchternen Menschen ohne Lebensart, ohne Welt angesehn werden.
Sich nun also nach Ort, Zeit und Umständen umzuformen und von verjährten Gewohnheiten sich loszumachen, das erfordert Studium und Kunst.
In Gegenden, aus welchen weder Unzufriedenheit mit dem Vaterlande, noch Müßiggang, noch Verderbnis der Sitten, noch unbestimmte, rastlose Tätigkeit, noch Anekdotenjagd, noch vorwitzige Neugier die Menschen scharenweise emigrieren macht und jeden Pinsel zum Reisen und Wandern treibt, sind die Einwohner mit dem, was es daheim gibt, so herzlich wohl zufrieden, daß sie nichts Größeres kennen, nichts Größeres kennen mögen, als was sie in ihrem Vaterlande von Jugend auf betrachtet, schon als Knaben bewundert oder von ihren Verwandten und Freunden haben stiften, bauen, anlegen gesehn. Ihnen sind die kleinen jährlichen oder andern Feste immer neu, immer gleich glänzend und merkwürdig. -- Glückliche Unwissenheit! nicht zu vertauschen mit dem Ekel, welcher den Mann anwandelt, der in seinem Leben so gar viel allerorten erlebt, erfahren, gesehn, bauen und zerstören gesehn hat und zuletzt an nichts mehr Freude finden, nichts mehr bewundern kann, alles mit Tadel und Langerweile anblickt! Ich reiste vor einigen Jahren im rauhesten Wetter in notwendigen Geschäften vierzig Meilen weit von … nach …. Es fügte sich, daß in letztrer Stadt am Tage meiner Ankunft ein General mit den dabei allerorten mehr oder weniger üblichen Feierlichkeiten sollte begraben werden. Die ganze Stadt, die dergleichen selten gesehn, war vom frühen Morgen an in Bewegung; alles sprach von dem Begräbnisse des Generals. Ein Offizier von meiner alten Bekanntschaft begegnete mir im Gasthofe: »Ei! wo kommen Sie her?« rief er; ich sagte es ihm. Der gute Mann vergaß in dem Augenblicke, daß … vierzig Meilen weit läge und daß eine solche Feierlichkeit mir wohl schwerlich in so schlechtem Wetter eine so weite Reise wert sein könnte: »Oh!« sagte er, »Sie kommen gewiß, um unsern General begraben zu sehn; ja! es wird sich schön ausnehmen.« -- Nun! zu so etwas kann ich kaum lächeln; möchten alle Menschen das am schönsten finden, was sie haben! Doch gestehe ich auch, daß dies oft zu Intoleranz führt; daß die Anhänglichkeit an einheimische Sitten zuweilen ungerecht, ungeschliffen gegen Menschen macht, die sich durch kleine Verschiedenheiten, wäre es auch nur in Anstand, Kleidung, Ton, Mundart oder Gebärden, unschuldigerweise auszeichnen.
In Reichsstädten ist diese Anhänglichkeit an väterliche Sitten, Kleidertrachten u. dgl. sehr auffallend und hat nicht selten Einfluß auf Regierungsverfassung, Religionsverträglichkeit und andre wichtige Dinge. So legen z. B. alle calvinistischen Kaufleute in … ihre Gärten nach holländischem Geschmacke an; nun hörte ich einstens einen solchen von einem andern Negotianten dieses Bekenntnisses, der aber in seinem Garten einige der reformierten Gemeinde auffallende Veränderungen vorgenommen hatte, sagen: Der Mann habe in seinem Garten allerlei lutherische Streiche gemacht. -- Daß ich mich nicht von meinem Zwecke entferne! Ich meine, die Verschiedenheit der Sitten und der Stimmung in den deutschen Staaten macht es sehr schwer, außer seiner vaterländischen Gegend, in fremden Provinzen, in Gesellschaften zu gefallen, Freundschaften zu stiften, Geschmack am Umgang zu finden, andre für sich einzunehmen und auf andre zu wirken.
Aber diese Schwierigkeiten werden in Deutschland noch größer unter Personen von verschiedenen Ständen und Erziehungen. Wer wird nicht schon mehrmals in seinem Leben die Erfahrung gemacht haben, in welche Verlegenheit man kommen kann, und wie groß die Langeweile ist, die uns befällt oder die wir andern verursachen, wenn wir in eine Gesellschaft geraten, deren Ton uns gänzlich fremd ist, wo alle auch noch so warmen Gespräche an unserm Herzen vorbeigleiten, wo die Form der ganzen Unterhaltung, alle Gebräuche und äußern Manieren der Anwesenden weit außer unserm Systeme liegen, nicht zu unsern Gewohnheiten passen, wo die Minuten uns Tage scheinen, wo Zwang und Verwünschung unsrer peinlichen Lage auf unsrer Stirne gemalt stehen.
Man sehe nur einen ehrlichen Landedelmann aus treuer Lehnspflicht einmal nach langen Jahren wieder an dem Hofe seines Landesherrn erscheinen! Er hat sich schon frühmorgens aufs beste ausgeschmückt und sich die sonst gewöhnte liebe Pfeife Tabak versagt, um nicht nach Rauch zu riechen. Auf den Gassen der Stadt war es noch öde und still, als er schon in seinem Wirtshause umherwandelte und alles in Bewegung setzte, um ihm beizustehn bei dem beschwerlichen Geschäfte, sich hofmäßig auszuschmücken. Jetzt ist er endlich fertig; sein gekräuseltes und gepudertes Haar, das außerdem selten ohne Nachtmütze auftritt, hat er der freien Luft preisgegeben, und leidet er nun höllische Kopfschmerzen; die seidenen Strümpfe ersetzen bei weitem nicht, was die heute zurückgelegten Stiefel ihm sonst gewähren; ihn friert gewaltig an den ihm nackend scheinenden Beinen. Der besetzte Rock ist in den Schultern nicht so bequem als sein treuer, alter, warmer Überrock; der Degen gerät jeden Augenblick zwischen die Beine; er weiß nicht, was er mit dem kleinen Hütchen in der Hand anfangen soll; das Stehn wird ihm unerträglich sauer. -- In dieser grausamen Verfassung erscheint er im Vorzimmer. Um ihn her wimmelt ein Haufen Hofschranzen herum, die, obgleich sie wahrlich sämtlich vielleicht nicht so viel wert als dieser ehrliche, nützliche Mann und im Grunde ihrer Herzen nicht weniger als er von Langerweile geplagt sind, dennoch mit Naserümpfen und Verachtung hier, wo sie in ihrem Elemente zu sein scheinen, ihn ansehen. Er fühlt jeden Spott, übersieht sie und muß sich dennoch von ihnen demütigen lassen. Sie nähern sich ihm, tun mit zerstreuter, wichtiger Miene einige Fragen an ihn, Fragen, an denen das Herz keinen Anteil nimmt und worauf sie auch die Antworten nicht abwarten. Er glaubt einen unter ihnen zu entdecken, der ihm teilnehmender scheint als die übrigen; mit diesem fängt er ein Gespräch von Dingen an, die ihm, vielleicht auch dem Vaterlande, wichtig sind: von seiner häuslichen Lage, von dem Wohlstande der Provinz, in welcher er lebt; er redet mit Wärme; Redlichkeit atmet alles, was er sagt -- aber bald sieht er, wie sehr er sich in seiner Hoffnung getäuscht hat; das Männchen hört ihm mit halbem Ohre zu, erwidert irgendein paar unbedeutende Silben zur Antwort und läßt dann den braven Hausvater da stehn. Nun nähert er sich einem Zirkel von Leuten, die mit Interesse und Lebhaftigkeit zu reden scheinen; an diesem Gespräche wünscht er teilzunehmen; aber alles, was er hört, Gegenstand, Sprache, Ausdruck, Wendung, alles ist ihm fremd. In halb deutschen, halb französischen Worten wird hier eine Sache abgehandelt, auf welche er nie seine Aufmerksamkeit geschärft, von welcher er nie geglaubt hat, daß es möglich wäre, deutsche Männer könnten sich damit beschäftigen. Seine Verlegenheit, seine Ungeduld steigt mit jedem Augenblicke, bis er endlich das verwünschte Schloß weit hinter sich sieht.
Und nun, den Fall umgekehrt, lasse man einen sonst edlen Hofmann einmal hinaus auf das Land in die Gesellschaft biedrer Beamter und Provinzial-Edelleute geraten! Hier herrschen ungezwungene Fröhlichkeit, Offenherzigkeit, Freiheit; man redet von dem, was am nächsten den Landmann interessiert; man wiegt die Worte nicht ab; der Scherz ist naiv, gewürzt, aber nicht zugespitzt, nicht gekünstelt. Unser Hofmann versucht es, sich in diese Manier hineinzuarbeiten; er mischt sich in die Gespräche; aber der Ausdruck der Offenheit und Treuherzigkeit fehlt; was bei jenen naiv war, wird bei ihm beleidigend. Er fühlt dies und will die Leute in seinen Ton stimmen; in der Stadt gilt er für einen angenehmen Gesellschafter; er spannt alle Segel auf, um auch hier zu glänzen; allein die kleinen Anekdoten, die feinen Züge, worauf er anspielt, sind hier gänzlich unbekannt, gehen verloren. Man findet ihn medisant, empfindet ihn als Lästerer, Verleumder, da in der Stadt niemand ihn einer Verleumdung beschuldigt; seine Komplimente, die er wahrlich gut meint, hält man für Falschheit; die Süßigkeiten, die er den Frauenzimmern sagt und die nur höflich und verbindlich sein sollen, betrachtet man als Spott. -- So groß ist die Verschiedenheit des Tons unter zweierlei Klassen von Menschen! --
Ein Professor, der in der literarischen Welt eine nicht gemeine Rolle spielt, meint in seiner gelehrten Einfalt, die Universität, auf welcher er lebt, sei der Mittelpunkt aller Wichtigkeit, und das Fach, in welchem er sich Kenntnisse erworben, die einzige dem Menschen nützliche, wahrer Anstrengung allein werte Wissenschaft. Er nennt jeden, der sich darauf nicht gelegt hat, verächtlicherweise einen Belletristen; einer Dame, die bei ihrer Durchreise den berühmten Mann kennenzulernen wünscht und ihn desfalls besucht, schenkt er seine neue, in lateinischer Sprache geschriebene Dissertation, wovon sie nicht ein Wort versteht; er unterhält die Gesellschaft, welche sich darauf gefreut hatte, ihn recht zu genießen, bei der Abendtafel mit Zergliederung des neuen akademischen Kreditedikts, oder, wenn der Wein dem guten Manne jovialische Laune gibt, mit Erzählung lustiger Schwänke aus seinen Studentenjahren.
Einst speisete ich mit dem Benediktiner-Prälaten aus I… bei Hofe in H…; man hatte dem dicken hochwürdigen Herrn den Ehrenplatz neben Ihrer Hoheit der Fürstin gegeben; vor ihm lag ein großer Ragoutlöffel zum Vorlegen; er glaubte aber, dieser größere Löffel sei, ihm zur besondern Ehre, zu seinem Gebrauche dahingelegt, und um zu zeigen, daß er wohl wisse, was die Höflichkeit erfordert, bat er die Prinzessin ehrerbietig, sie möchte doch statt seiner sich des Löffels bedienen, der freilich viel zu groß war, um in ihr kleines Mäulchen zu passen.
In welcher Verlegenheit ist zuweilen ein Mann, der nicht viel Journale und neurere Modeschriften liest, wenn er in eine Gesellschaft von schöngeisterischen Herrn und Damen gerät!
Gleichsam wie verraten und verkauft scheint ein sogenannter Profaner, wenn er sich unter einem Haufen Mitglieder einer geheimen Verbindung befindet.
Freilich kann nichts ungesitteter, den wahren Begriffen einer feinen Lebensart mehr entgegen sein, als wenn eine Anzahl Menschen, die sich auf diese Art untereinander verstehen, einem Fremden, der gutmütig unter sie tritt, um an den Freuden der Geselligkeit teilzunehmen, durch ununterbrochene Lenkung des Gesprächs auf Gegenstände, wovon dieser gar nichts versteht, jeden Genuß der Unterredung rauben. Auf diese Art habe ich zuweilen in meiner ersten Jugend in Familienzirkeln, wo die Unterhaltung beständig mit Anspielungen auf mir gänzlich unbekannte Anekdoten durchflochten und durch gewisse mir fremde Redensarten und Bonmots, womit ich gar keinen Begriff verbinden konnte, gewürzt war, tötende Langeweile gehabt. Man sollte wohl mehr Rücksicht nehmen; allein selten sind ganze Gesellschaften so billig, sich nach einzelnen zu richten; auch läßt sich das nicht immer mit Recht fordern; folglich ist es wichtig für jeden, der in der Welt mit Menschen leben will, die Kunst zu studieren, sich nach Sitten, Ton und Stimmung andrer zu fügen.
3.
Über diese Kunst will ich etwas sagen. -- Aber habe ich denn auch wohl Beruf, ein Buch über den esprit de conduite zu schreiben, ich, der ich in meinem Leben vielleicht sehr wenig von diesem Geiste gezeigt habe? Ziemt es mir, Menschenkenntnis auszukramen, da ich so oft ein Opfer der unvorsichtigsten, einem Neulinge kaum zu verzeihenden Hingebung gewesen bin? Wird man die Kunst des Umgangs von einem Manne lernen wollen, der beinahe von allem menschlichen Umgange abgesondert lebt? -- Lasset doch sehn, meine Freunde! was sich darauf antworten läßt! Habe ich widrige Erfahrungen gemacht, die mich von meiner eigenen Ungeschicklichkeit überzeugt haben -- desto besser! Wer kann so gut vor der Gefahr warnen, als der, welcher darin gesteckt hat? Haben Temperament und Weichlichkeit (oder darf ich es nicht Fühlbarkeit eines so gern sich anschließenden Herzens nennen?), haben Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft, nach Gelegenheit, andern zu dienen und sympathische Empfindungen zu erregen, mich oft unvorsichtig handeln gemacht, oft die kalkulierende Vernunft weit zurückgelassen; so war es wahrlich nicht Blödsinnigkeit, Kurzsichtigkeit, Unbekanntschaft mit Menschen, was mich irreleitete, sondern Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden, Verlangen, tätig zu sein, zum Guten zu wirken. Übrigens werden vielleicht wenig Menschen in einem so kurzen Zeitraume in so manche sonderbare Verhältnisse und Verbindungen mit andern Menschen aller Art geraten, als ich seit ungefähr zwanzig Jahren; und da hat man denn schon Gelegenheit, wenn man nicht ganz von der Natur und Erziehung verwahrlost ist, Bemerkungen zu machen, und vor Gefahren zu warnen, die man selbst nicht hat vermeiden können. Daß ich aber jetzt einsam und abgezogen lebe, geschieht weder aus Menschenhaß noch Blödigkeit; ich habe sehr wichtige Gründe dazu; allein diese hier weitläufig zu entwickeln, das hieße zu viel von mir selbst reden, da ich ohnehin noch, zum Schlusse dieser Einleitung, etwas über meine eigenen Erfahrungen werde sagen müssen, bevor ich zum Zwecke komme. -- Also nur noch dieses:
4.
Ich trat als ein sehr junger Mensch, beinahe noch als ein Kind, schon in die große Welt und auf den Schauplatz des Hofes. Mein Temperament war lebhaft, unruhig, bewegsam, mein Blut warm; die Keime zu mancher heftigen Leidenschaft lagen in mir verborgen; ich war in der ersten Erziehung ein wenig verzärtelt und durch große Aufmerksamkeit, deren man meine kleine Person früh gewürdigt hatte, gewöhnt worden, sehr viel Rücksichten von andern Leuten zu fordern. In einem freien Vaterlande aufgewachsen, wo Schmeichelei, Verstellung und ein gewisses kriechendes Wesen nicht sehr zu Hause sind, hatte man mich freilich auch nicht zu jener Geschmeidigkeit vorbereitet, deren ich bedurfte, um, unter mir ganz fremden Leuten, in despotischen Staaten große Fortschritte zu machen; auch ist der theoretische Unterricht in wahrer Weltklugheit bei der Jugend teils selten mit Erfolge, teils nicht immer ohne Gefahr zu erteilen; eigene Erfahrung muß da in der Folge das Beste tun. Diese Lektionen, wenn man das Glück hat, wohlfeil daran zu kommen, sind von der heilsamsten Wirkung und prägen sich tief ein. Noch erinnere ich mich einer kleinen Szene von der Art, die mich auf eine Zeitlang vorsichtig machte: Ich saß in C… in der italienischen Oper, in der herrschaftlichen Loge; ich war früher als der Hof gekommen, weil ich mittags nicht auf dem Schlosse, sondern in der Stadt zu Gaste gespeist hatte; noch waren wenig Menschen da; in der ganzen Reihe des ersten Rangs saß nur der einzige Landkommandeur, Graf J…, ein würdiger Greis. Er hatte, wie es scheint, auch darauf gerechnet, daß es schon später wäre, als es wirklich war; weil er nun Langeweile hatte und mich gleichfalls einsam da sitzen sah, so trat er zu mir herein und fing eine Unterredung mit mir an. Er schien sehr zufrieden mit dem, was ich ihm über verschiedene Gegenstände, von denen ich einige Kenntnis besaß, sagte; der Greis wurde immer freundlicher und herablassender, und dies kitzelte mich so sehr, daß ich darauf allerlei Seitensprünge in meinem Gespräche machte und zuletzt ein wenig medisant wurde. Endlich entwischte mir eine mir gegenwärtig nicht mehr erinnerliche grobe Unvorsichtigkeit im Reden; der Graf sah mir ernsthaft in das Gesicht, und ohne weiter ein Wort zu verlieren, ließ er mich stehn und ging zurück in seine Loge. Ich fühlte die ganze Stärke dieses Verweises, aber die Arzenei half nicht lange. Meine Lebhaftigkeit verleitete mich zu großen Inkonsequenzen; ich übereilte alles, tat immer zu viel oder zu wenig, kam stets zu früh oder zu spät, weil ich immer entweder eine Torheit beging oder eine andere gutzumachen hatte. Daher kamen unendliche Widersprüche in meinen Handlungen, und ich verfehlte fast bei allen Gelegenheiten des Zwecks, weil ich keinen einfachen Plan verfolgte. Zuerst war ich zu sorglos, zu offen, gab mich zu unvorsichtig hin und schadete mir dadurch; alsdann nahm ich mir vor, ein feiner Hofmann zu werden; mein Betragen wurde gekünstelt, und nun trauten mir die Bessern nicht; ich war zu geschmeidig und verlor dadurch äußere Achtung und innere Würde, Selbständigkeit und Ansehn. Erbittert gegen mich und andre riß ich mich dann los und wurde bizarr. Dies erregte Aufsehn; die Menschen suchten mich auf, wie sie alles Sonderbare aufsuchen. Dadurch aber erwachte mein Trieb zur Geselligkeit wieder; ich näherte mich aufs neue, lenkte wieder ein, und nun verschwand der Nimbus, den nur meine Abgezogenheit von der Welt um mich her gezogen hatte. In einer andere Periode spottete ich der Torheiten, zuweilen nicht ohne Witz; man fürchtete mich, aber man liebte mich nicht; dies schmerzte mich; um das wieder gutzumachen, zeigte ich mich von der unschädlichen Seite, entfaltete mein liebevolles, wohlwollendes Herz, unfähig zu schaden und zu verfolgen -- und die Wirkung davon war, daß jedermann, der noch einen Rest von Groll auf mich oder irgendeinen lustigen Einfall von mir auf seine Rechnung geschrieben hatte, mir jetzt auf der Nase spielte, sobald er sah, daß ich nur mit Rapieren und nicht mit Schwertern focht, daß meine Waffen nicht zum Morde geschliffen waren. Oder wenn meine satirische Laune durch den Beifall lustiger Gesellschafter aufgeweckt wurde, hechelte ich große und kleine Toren durch; die Spaßvögel lachten dann; aber die Weisern schüttelten die Köpfe und wurden kalt gegen mich. Um zu zeigen, wie wenig bösartig meine Laune wäre, hörte ich auf zu medisieren und entschuldigte alle Fehler, und nun hielten einige mich für einen Pinsel, andre für einen Heuchler. Wählte ich mir meinen Umgang unter den ausgesuchtesten, aufgeklärtesten Männern, so erwartete ich vergebens Schutz von dem am Ruder stehenden Dummkopf; gab ich mich elenden Leuten preis, so wurde ich mit diesen in eine Klasse gesetzt. Menschen ohne Erziehung, von niederm Stande mißbrauchten mich, wenn ich mich ihnen zu sehr näherte; mit Vornehmern verdarb ich es, sobald sie meine Eitelkeit beleidigten. Bald ließ ich zu viel Übergewicht den Dummen fühlen und wurde verfolgt; bald war ich zu bescheiden und wurde übersehn. Bald richtete ich mich nach den Sitten der Leute, nach dem Ton aller unbedeutenden Gesellschaften, in welche ich lief, verlor goldene Zeit, Achtung der Weisen und Zufriedenheit mit mir selber; dann wurde ich zu einfach und spielte eine schiefe Rolle, da, wo ich hätte glänzen können und sollen, durch Mangel an Zuversicht zu mir selber. Zu einer Zeit ging ich zu selten aus; man hielt mich für stolz oder menschenscheu; zu einer andern zeigte ich mich überall und wurde ein Alltagsgesicht. In den ersten Jünglingsjahren gab ich mich unbedachtsam jedem ausschließlich, einzeln und ganz hin, der sich meinen Freund nannte und mir einige Zuneigung bewies, wurde oft schändlich betrogen und in den süßesten Erwartungen getäuscht; nachher war ich jedermanns Freund, bereit jedem zu dienen, und dann schloß sich niemand mit ganzer Seele an mich, weil niemand mit dem kleinen, in so viel Partikeln geteilten Stückchen Herzen vorliebnehmen wollte. Wenn ich zu viel erwartete, wurde ich getäuscht; wenn ich ohne allen Glauben an Treue und Redlichkeit unter den Menschen umherrannte, hatte ich gar keinen Genuß, nahm an gar nichts teil. Nie aber verbarg ich meine schwachen Seiten so sorgfältig, als ich hätte tun sollen. -- Und so vergingen dann die Jahre, in welchen ich hätte mein Glück machen können, wie man das gewöhnlich nennt. Jetzt, da ich die Menschen besser kenne, da Erfahrung mir die Augen geöffnet, mich vorsichtig gemacht und vielleicht die Kunst gelehrt hat, auf andre zu wirken, jetzt ist es zu spät für mich, diese Wissenschaft in Anwendung zu bringen. Mein Rücken krümmt sich mit Mühe zu Reverenzen; ich habe nicht viel unnütze Zeit mehr zu verschwenden, die ich preisgeben könnte; das Wenige, was ich noch in dem Reste meines Lebens auf solchen Wegen erlangen könnte, lohnt die Mühe und Anstrengung nicht, die mich das kosten würde, und es ziemt dem Mann, dessen Grundsätze Alter und Erfahrung befestigt haben, ebensowenig, jetzt erst anzufangen, den Geschmeidigen wie den Stutzer zu spielen. -- Es ist zu spät, sage ich, mit der Ausübung anzuheben, aber nicht zu spät, Jünglingen zu zeigen, welchen Weg sie wandeln müssen -- und so lasset uns denn den Versuch machen und der Sache näherrücken!
Erstes Kapitel
Allgemeine Bemerkungen und Vorschriften über den Umgang mit Menschen
1.
Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich selbst macht. Das ist ein goldener Spruch, ein reiches Thema zu einem Folianten über den esprit de conduite und über die Mittel, in der Welt seinen Zweck zu erlangen; ein Satz, dessen Wahrheit auf die Erfahrung aller Zeitalter gestützt ist. Diese Erfahrung lehrt den Abenteurer und Großsprecher, sich bei dem Haufen für einen Mann von Wichtigkeit auszugeben, von seinen Verbindungen mit Fürsten und Staatsmännern, mit Männern, welche nicht einmal von seiner Existenz wissen, in einem Tone zu reden, der ihm, wo nichts mehr, doch wenigstens manche freie Mahlzeit und den Zutritt in den ersten Häusern erwirbt. Ich habe einen Menschen gekannt, der auf diese Art von seiner Vertraulichkeit mit dem Kaiser Joseph und dem Fürsten Kaunitz redete, obgleich ich ganz gewiß wußte, daß diese ihn kaum dem Namen nach, und zwar als einen unruhigen Kopf und Pasquillanten kannten. Indessen hatte er hierdurch, da niemand genauer nachfragte, sich auf eine kurze Zeit in ein solches Ansehn gesetzt, daß Leute, die bei des Kaisers Majestät etwas zu suchen hatten, sich an ihn wendeten. Dann schrieb er auf so unverschämte Art an irgendeinen Großen in Wien und sprach in diesem Briefe von seinen übrigen vornehmen Freunden daselbst, daß er zwar nicht Erlangung seines Zwecks, aber doch manche höfliche Antwort erschlich, mit welcher er dann weiter wucherte.
Diese Erfahrung macht den frechen Halbgelehrten so dreist, über Dinge zu entscheiden, wovon er nicht früher als eine Stunde vorher das erste Wort gelesen oder gehört hat, aber so zu entscheiden, daß selbst der anwesende bescheidene Literator es nicht wagt, zu widersprechen, noch Fragen zu tun, die des Schwätzers Fahrzeug aufs Trockene werfen könnten.
Diese Erfahrung ist es, durch welche der empordringende Dummkopf sich zu den ersten Stellen im Staat hinaufarbeitet, die verdienstvollsten Männer zu Boden tritt und niemand findet, der ihn in seine Schranken zurückwiese.
Sie ist es, durch welche sich die unbrauchbarsten, schiefsten Genies, Menschen ohne Talent und Kenntnisse, Plusmacher und Windbeutel bei den Großen der Erde unentbehrlich zu machen verstehen.
Sie ist es, die größtenteils den Ruf von Gelehrten, Musikern und Malern bestimmt.
Auf diese Erfahrung gestützt, fordert der fremde Künstler für ein Stück hundert Louisdor, das der einheimische, zehnfach besser gearbeitet, um fünfzig Taler verkaufen würde; allein man reißt sich um des Ausländers Werke; er kann nicht so viel fertig machen, als von ihm gefordert wird, und am Ende läßt er bei dem Einheimischen arbeiten und verkauft das für ultramontanische Ware.
Auf diese Erfahrung gestützt, erschleicht sich der Schriftsteller eine vorteilhafte Rezension, wenn er in der Vorrede zu dem zweiten Teile seines langweiligen Buchs mit der schamlosesten Frechheit von dem Beifalle redet, womit Kenner und Gelehrte, deren Freundschaft er sich rühmt, den ersten Teil beehrt haben.
Diese Erfahrung gibt dem vornehmen Bankerottierer, der Geld borgen will und nie wieder bezahlen kann, den Mut, das Anlehn in solchen Ausdrücken zu fordern, daß der reiche Wucherer es für Ehre hält, sich von ihm betrügen zu lassen.
Fast alle Arten von Bitten um Schutz und Beförderung, die in diesem Tone vorgetragen werden, finden Eingang und werden nicht abgeschlagen, dahingegen Verachtung, Zurücksetzung und nicht erfüllte billige Wünsche fast immer der Preis des bescheidenen, furchtsamen Klienten sind.
Diese Erfahrung lehrt den Diener, sich bei seinem Herrn, und den, welcher Wohltaten empfangen, sich bei dem Wohltäter so wichtig zu machen, daß der, so die Verbindlichkeit auflegt, es für ein großes Glück rechnet, einem solchen Manne anzugehören. -- Kurz! der Satz: daß jedermann nicht mehr und nicht weniger gelte, als wozu er sich selbst macht, ist die große Panacee für Aventuriers, Prahler, Windbeutel und seichte Köpfe, um fortzukommen auf diesem Erdballe -- ich gebe also keinen Kirschkern für dieses Universalmittel. -- Doch still! sollte denn jener Satz uns gar nichts wert sein? Ja, meine Freunde! Er kann uns lehren, nie ohne Not und Beruf unsre ökonomischen, physikalischen, moralischen und intellektuellen Schwächen aufzudecken. Ohne also sich zur Prahlerei und zu niederträchtigen Lügen herabzulassen, soll man doch nicht die Gelegenheit verabsäumen, sich von seinen vorteilhaften Seiten zu zeigen.
Dies muß aber nicht auf eine grobe, gar zu merkliche, eitle und auffallende Weise geschehn, denn sonst verlieren wir viel mehr dadurch; sondern man muß die Menschen nur mutmaßen, sie von selbst darauf kommen lassen, daß doch wohl etwas mehr hinter uns stecke, als bei dem ersten Anblicke hervorschimmert. Hängt man ein gar zu glänzendes Schild aus, so erweckt man dadurch die genauere Aufmerksamkeit; andre spüren den kleinen Fehlern nach, von denen kein Erdensohn frei ist, und so ist es auf einmal um unsern Glanz geschehn. Zeige Dich also mit einem gewissen bescheidenen Bewußtsein innerer Würde, und vor allen Dingen mit dem auf Deiner Stirne strahlenden Bewußtsein der Wahrheit und Redlichkeit! Zeige Vernunft und Kenntnisse, wo Du Veranlassung dazu hast! Nicht so viel, um Neid zu erregen und Forderungen anzukündigen, nicht so wenig, um übersehn und überschrien zu werden! Mache Dich rar, ohne daß man Dich weder für einen Sonderling, noch für scheu, noch für hochmütig halte!
2.
Strebe nach Vollkommenheit, aber nicht nach dem Scheine der Vollkommenheit und Unfehlbarkeit! Die Menschen beurteilen und richten Dich nach dem Maßstabe Deiner Prätensionen, und sie sind noch billig, wenn sie nur das tun, wenn sie Dir nicht Prätensionen aufbürden. Dann heißt es, wenn Du auch nur des kleinsten Fehlers Dich schuldig machst: »Einem solchen Manne ist das gar nicht zu verzeihn«; und da die Schwachen sich ohnehin ein Fest daraus machen, an einem Menschen, der sich verdunkelt, Mängel zu entdecken, so wird Dir ein einziger Fehltritt höher angerechnet als andern ein ganzes Register von Bosheiten und Pinseleien.
3.
Sei aber nicht gar zu sehr ein Sklave der Meinungen andrer von Dir! Sei selbständig! Was kümmert Dich am Ende das Urteil der ganzen Welt, wenn Du tust, was du sollst? Und was ist Deine ganze Garderobe von äußern Tugenden wert, wenn Du diesen Flitterputz nur über ein schwaches, niedriges Herz hängst, um in Gesellschaften Staat damit zu machen?
4.
Enthülle nie auf unedle Art die Schwächen Deiner Nebenmenschen, um Dich zu erheben! Ziehe nicht ihre Fehler und Verirrungen an das Tageslicht, um auf ihre Unkosten zu schimmern!
5.
Schreibe nicht auf Deine Rechnung das, wovon andern das Verdienst gebührt! Wenn man Dir, aus Achtung gegen einen edlen Mann, dem Du angehörst, Vorzug oder Höflichkeit beweist, so brüste Dich damit nicht, sondern sei bescheiden genug zu fühlen, daß dies alles vielleicht wegfallen würde, wenn Du einzeln aufträtest! Suche aber selbst zu verdienen, daß man Dich um Deinetwillen ehre! Sei lieber das kleinste Lämpchen, das einen dunklen Winkel mit eigenem Lichte erleuchtet als ein großer Mond einer fremden Sonne oder gar Trabant eines Planeten!
6.
Fehlt Dir etwas, hast Du Kummer, Unglück, leidest Du Mangel, reichen Vernunft, Grundsätze und guter Wille nicht zu, so klage Dein Leid, Deine Schwäche niemand als dem, der helfen kann, selbst Deinem treuen Weibe nicht! Wenige helfen tragen; fast alle erschweren die Bürde; ja! sehr viele treten einen Schritt zurück, sobald sie sehen, daß Dich das Glück nicht anlächelt. Sobald sie aber gar wahrnehmen, daß Du ganz ohne Hilfsquellen bist, daß Du keinen geheimen Schutz hast, niemand, der sich Deiner annimmt -- o! so rechne auf keinen mehr! Wer hat den Mut, einzig und fest als die Stütze des von aller Welt Verlassenen öffentlich aufzutreten? Wer hat den Mut, zu sagen: »Ich kenne den Mann; er ist mein Freund; er ist mehr wert als ihr alle, die ihr ihn schmähet«? Und fändest Du ja einen solchen, so würde es doch nur etwa ein andrer armer Teufel sein, der selbst in elenden Umständen, aus Verzweiflung sein Schicksal an das Deinige knüpfen wollte, dessen Schutz Dir mehr schädlich als nützlich wäre.
7.
Rühme aber auch nicht zu laut Deine glückliche Lage! Krame nicht zu glänzend Deine Pracht, Deinen Reichtum, Deine Talente aus! Die Menschen vertragen selten ein solches Übergewicht ohne Murren und Neid. Lege daher auch andern keine zu große Verbindlichkeit auf! Tue nicht zu viel für Deine Mitmenschen! Sie fliehen den überschwenglichen Wohltäter, wie man einen Gläubiger flieht, den man nie bezahlen kann. Also hüte Dich, zu groß zu werden in Deiner Brüder Augen, auch fordert jeder zu viel von Dir, und eine einzige abgeschlagene Wohltat macht tausend wirklich erzeigte in einem Augenblick vergessen.
8.
Vor allen Dingen wache über Dich, daß Du nie die innere Zuversicht zu Dir selber, das Vertrauen auf Gott, auf gute Menschen und auf das Schicksal verlierst! Sobald Dein Nebenmann auf Deiner Stirne Mißmut und Verzweiflung liest -- so ist alles aus. Sehr oft aber ist man im Unglücke ungerecht gegen die Menschen. Jede kleine böse Laune, jede kleine Miene von Kälte deutet man auf sich; man meint, jeder sehe es uns an, daß wir leiden, und weiche vor der Bitte zurück, die wir ihm tun könnten.
9.
Gegenwart des Geistes ist ein seltenes Geschenk des Himmels und macht, daß wir im Umgange in sehr vorteilhaftem Lichte erscheinen. Dieser Vorzug nun läßt sich freilich nicht durch Kunst erlangen; allein man kann an sich arbeiten, daß, wenn er uns fehlt, wir wenigstens nicht durch Übereilung uns und andre in Verlegenheit setzen. Sehr lebhafte Temperamente haben hierauf vorzüglich zu achten. Ich rate daher, wenn eine unerwartete Frage, ein ungewöhnlicher Gegenstand oder irgend etwas anders uns überrascht, nur eine Minute still zu schweigen und der Überlegung Zeit zu lassen, uns zu der Partei vorzubereiten, die wir nehmen sollen. So wie ein einziges rasches, unvorsichtiges Wort oder ein in der Verwirrung unternommener Schritt zu späte Reue und unglückliche Folgen wirken können, so kann ein schnell auf der Stelle gefaßter und ausgeführter rascher Entschluß in entscheidenden Augenblicken, in welchen man so leicht den Kopf verliert, Glück, Rettung, Trost bringen.
10.
So wenig als möglich lasset uns von andern Wohltaten fordern und annehmen! Man trifft gar selten Leute an, die nicht früh oder spät für kleine Dienste große Rücksichten forderten, und das hebt dann das Gleichgewicht im Umgange auf, raubt Freiheit, hindert uneingeschränkte Wahl, und wenn auch unter zehnmal nicht einmal der Fall einträte, daß dies uns in Verlegenheit setzte oder Verdruß zuzöge, so ist es doch weislich gehandelt, dies mögliche Einmal zu vermeiden und lieber immer zu geben, jedem zu dienen als von andern Dienste oder sonst etwas anzunehmen. Auch gibt es wenig Menschen, die mit guter Art Wohltaten erzeigen. Versuchet es, meine Freunde! wie viele unter Euren Bekannten nicht auf einmal, mitten in der fröhlichsten, höflichsten Gemütsstimmung, ihr Gesicht in feierliche Falten ziehen, wenn Ihr Eure Anrede mit den Worten anhebet: »Ich muß eine große Bitte an Sie wagen; ich bin in einer erschrecklichen Verlegenheit.«
Um nun fremden Beistandes entbehren zu können, dazu ist das beste Mittel, wenig Bedürfnisse zu haben, mäßig zu sein und bescheidene Wünsche zu nähren; wer aber von unzähligen Leidenschaften in rastlosem Taumel umhergetrieben wird, bald Ehrenstellen, bald Wucher, bald Erwerb, bald wollüstigen Genuß verlangt; wer von dem Luxus des Zeitalters angesteckt, alles begehrt, was seine Augen sehen, wen vorwitzige Neugier und ein unruhiger Geist treiben, sich in jeden unnützen Handel zu mischen, der wird freilich nie der Hilfe und Unterstützung fremder Leute zur Befriedigung seiner zahllosen Wünsche sich entäußern können.
11.
Keine Regel ist so allgemein, keine so heilig zu halten, keine führt so sicher dahin, uns dauerhafte Achtung und Freundschaft zu erwerben, als die: unverbrüchlich, auch in den geringsten Kleinigkeiten, Wort zu halten, seiner Zusage treu, und stets wahrhaftig zu sein in seinen Reden. Nie kann man Recht und erlaubte Ursache haben, das Gegenteil von dem zu sagen, was man denkt, wenngleich man Befugnis und Gründe haben kann, nicht alles zu offenbaren, was in uns vorgeht. Es gibt keine Notlügen; noch nie ist eine Unwahrheit gesprochen worden, die nicht früh oder spät nachteilige Folgen für jedermann gehabt hätte; der Mann aber, der dafür bekannt ist, streng Wort zu halten und sich keine Unwahrheit zu gestatten, gewinnt gewiß Zutrauen, guten Ruf und Hochachtung.