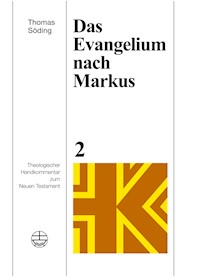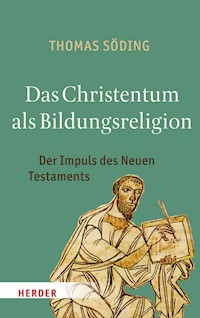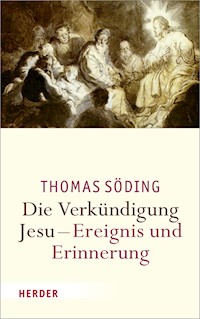Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kirche fordert immer wieder die Menschen zur Umkehr auf – mit hohem moralischen Anspruch. Das gehört zu ihrem Auftrag. Aber was ist mit ihr selbst? Eine Kirchenreform "an Haupt- und Gliedern" tut not. Aber woher kommen die Impulse und Kriterien? Hier spielt das Neue Testament eine Schlüsselrolle. Es ist mitten im Aufbruch der Kirche entstanden. Es ist durch die Botschaft Jesu inspiriert. Es sammelt die prägenden Erfahrungen der ersten Gemeinden. Welche Mission die Kirche hat, welchen Gefahren sie ausgesetzt ist, welche Rollen Männer und Frauen gespielt haben, wie die Sakramente gefeiert worden sind und welches Ethos der Solidarität sich herausgebildet hat - in diesem Buch wird nicht nur beschrieben, was gewesen ist, sondern auch kritisch diskutiert, worin seine aktuelle Bedeutung liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Söding
Umkehr der Kirche
Wegweiser im Neuen Testament
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-80134-1
ISBN (Buch) 978-3-451-30915-1
Inhalt
Vorwort
Orientierung am Neuen Testament
I. Der Auftrag der Kirche
1. Mit einer Guten Nachricht
2. Unterwegs
3. Zur Einheit und zur Vielfalt
II. Das Leben der Kirche
1. Missionarisch
2. Kooperativ
3. Konstruktiv
III. Die Reform der Kirche
1. Back to the roots
2. Katholisch werden
3. In der Welt, nicht von der Welt
IV. Frauen für die Kirche
1. Frauen wie Lydia
2. Diesseits und jenseits des Schweigens
3. In alter und neuer Stärke
V. Dienste und Ämter in der Kirche
1. In der Kraft des Geistes
2. Auf die Kirche achten
3. In Rom und aller Welt
VI. Eucharistie
1. Das kostbare Mahl
2. An der Quelle des Lebens
3. Für alle
VII. Spiritualität
1. Aufbrechen & Innehalten
2. Beten & mehr
3. Hören & Sprechen
VIII. Solidarität
1. Brot für die Welt
2. Schutz für die Kleinen – Gedanken zum Missbrauchsskandal
3. Einsatz für das Leben
Nachweis der Erstveröffentlichungen
Bibelstellenregister
Vorwort
Die katholische Kirche muss sich reformieren. Wer zweifelt daran? Zu groß sind die weltweiten Probleme, den Glauben neu zu entdecken und in alter Frische weiterzugeben. Zu einfach sind die Antworten, die die Quelle der Schwierigkeiten »draußen« suchen, in der bösen Welt, und die Lösungen »drinnen«, am heimischen Herd.
Aber wie soll die Kirche sich reformieren? Und wohin?
Wer Orientierung sucht, kommt am Neuen Testament nicht vorbei. Aber wer das Neue Testament liest, um Anstöße zu finden, kann nicht in den vorgegebenen Strukturen bleiben, die in einem Reformprozess zu optimieren wären. Die Frage wird grundsätzlicher. Erstens hat es eine ideale Kirche nie gegeben, auch am Anfang nicht. Zweitens ist in 2000 Jahren so viel Wasser den Jordan hinuntergeflossen, dass unmöglich aus einer Rückkehr zu dem, was am Anfang einmal war, Zukunft zu gewinnen wäre.
Das Neue Testament selbst blickt nach vorn: auf das Reich Gottes hin, das nahekommt. Dies ist die entscheidende Blickrichtung für die Kirche aller Zeiten, auch heute. Das Schlüsselwort des Neuen Testaments, das verstehen lässt, was »Reform« heißen kann, ist »Umkehr«. Das Wort hat Jesus nicht erfunden, sondern in der prophetischen Theologie Israels gefunden. Zuletzt hat es Johannes der Täufer geprägt, von dem Jesus sich im Jordan hat taufen lassen. »Umkehr« meint eine Kehrtwende des Lebens: weg von der Fixierung auf die Vergangenheit, hin zur Orientierung an der Zukunft; weg von der Fixierung auf das Böse, hin zur Orientierung am Guten; weg von der Fixierung aufs Gehabte, hin zur Orientierung am Verheißenen. Bei den Propheten, bei Johannes und bei Jesus ist Umkehr mit dem Bekenntnis der Sünden verbunden und der Erfahrung der Vergebung, mit Reue und Zuversicht, Buße und Aufbruch zu einem neuen Leben.
»Umkehr« hat den Vorteil, dass Gott ins Spiel kommt und dass nicht nur Institutionen vor Augen stehen, sondern Menschen. Umkehr ist eine Sache des ganzen Herzens und der ganzen Seele, des vollen Verstandes und der vollen Kraft. Umkehr ist immer eine persönliche Entscheidung und eine persönliche Konsequenz; aber Umkehr ist auch die Bewegung einer ganzen Gemeinschaft, die ihre Sünden loswerden will – um sich von der Gerechtigkeit Gottes erfüllen zu lassen: »Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden«.
Wer so betet, mit den Worten Jesu, weiß, dass Umkehr nicht mit der Bekehrung abgetan ist, sondern eine permanente Dimension persönlichen und kirchlichen Glaubenslebens ist. Die Umkehr, die im Neuen Testament gefordert wird, setzt die entscheidenden Wegmarken für die Kirchenreform.
Das Buch soll einige Impulse aufgreifen. Es geht auf neutestamentliche Studien zurück, die als exegetische Beiträge zur aktuellen Reformdebatte betrachtet werden können. Für dieses Buch wurden sie durchgesehen, aktualisiert und neu zusammengestellt.
Bochum, 10. Januar 2014
Thomas Söding
Orientierung am Neuen Testament
Die Krise der Kirche in Deutschland und Europa ist unübersehbar. Die Zeit, da man »Hymnen an die Kirche« (Gertrud von le Fort)1 gesungen hat, ist vorbei. Nach wie vor gibt es »Kirchenträume« (Norbert Lohfink)2: heute vor allem die Vision einer Gemeinschaft, die sich auf dem Wege weiß; bei einigen die Sehnsucht nach einem Freundeskreis, der Geborgenheit und Sicherheit im Glauben verleiht; bei wenigen die Utopie einer Kontrastgesellschaft, in der die Menschen anders leben, anders denken, anders arbeiten, anders beten als in der Umwelt. Doch für allzu viele sind diese Träume nur Schäume.
Die Situation scheint paradox: Zum ersten Mal in der Konzilsgeschichte hat das Zweite Vatikanum die Kirche zum großen Thema gemacht; zwei seiner Schlüsseldokumente, Lumen gentium (»Licht der Völker«) und Gaudium et spes (»Freude und Hoffnung«), sind von den aufgeschlossenen Zeitgenossen als wegweisende Reflexionen begrüßt worden, weil sie trotz aller Kompromisse, die eingegangen werden mussten, dem Prinzip des aggiornamento (Verheutigung) ebenso verpflichtet gewesen seien wie der Treue zum Ursprung. Allerdings ist die Wirkung kein durchschlagender Erfolg gewesen.
In den Kirchen der südlichen Hemisphäre und des ehemaligen Ostblocks haben sich Entwicklungen abgespielt, die einerseits die Identität der Kirchen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt, andererseits aber die moralische Autorität der Ortskirchen vergrößert haben. Es gibt wachsende Gemeinden, besonders in Afrika und Asien, mit neuen Formen des Gottesdienstes, der Spiritualität und der Ethik, die für die gesamte Kirche eine große Bereicherung sind, besonders wegen der Glaubensfreude, die sie ausstrahlen. Allerdings gibt es auch ein massives Erstarken der Freikirchen, die vielen Katholikinnen und Katholiken freier, offener, intensiver erscheinen als die Kirche, in der sie getauft worden sind.
Im Westen ist die Ära nach dem Konzil nicht nur eine Zeit massiver Kirchenkritik wegen ausgebliebener oder halbherziger Reformen, sondern auch eine Zeit großer Frustrationen über fehlende Resonanz in der Gesellschaft und starker Unsicherheiten hinsichtlich der neuen Rolle, die der Kirche als ganzer, aber auch den verschiedenen Gliedern innerhalb der Kirche, insbesondere den Klerikern und den Laien, nicht zuletzt den Frauen zufallen soll. Die Phänomene deuten nicht nur auf eine Krise der pastoralen Strategien und institutionellen Strukturen, sondern der kirchlichen Identität in einer demokratischen und pluralistischen Wohlstandsgesellschaft hin. Diese Identitätskrise resultiert einerseits daraus, dass die ekklesiologischen Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils erst in Ansätzen aufgenommen, realisiert und weitergedacht worden sind; andererseits resultiert sie daraus, dass in den Jahrzehnten nach dem Konzil eine Vielzahl neuer, ebenso rasanter wie tiefgreifender gesellschaftlicher Entwicklungen eingetreten ist, auf die neue Antworten gesucht werden müssen.
Die Geschichte der europäischen Neuzeit ist auch die Geschichte der Säkularisierung Europas. Weite Bereiche des Lebens, nicht nur die Wissenschaft und die Technik, auch der Staat und die Ökonomie, die Kultur und die Gesellschaft, selbst die ganz persönlichen Wertvorstellungen und Überzeugungen, nicht zuletzt die Sexualmoral und das Familienbild, werden immer weniger von religiösen Traditionen und Positionen beeinflusst, auch bei denen, die sich voll und ganz zur Kirche rechnen. Soziologen sprechen von einer fortschreitenden Segmentierung der Gesellschaft; die Religion ist nur einer von vielen Lebensbezirken, ohne große Ausstrahlung auf die anderen Bereiche und ohne große Einflüsse von ihnen. Die Konsequenzen sind unvermeidlich: Der Einfluss der Kirchen auf das öffentliche Leben ist gesunken. Die Identifikation mit der Kirche wird immer weniger selbstverständlich. Das elementare Glaubenswissen schwindet. Die Zahl der Kirchenaustritte schwillt wellenförmig an. Volkskirchliches Leben löst sich immer weiter auf. Die Zahl der Konfessionslosen steigt, zumal im Osten und Norden, zunehmend auch im Westen und im Süden. Die Symbiose von abendländisch-europäischer Kultur und christlicher Kirchlichkeit ist dahin. Wenn man nicht auf die offiziellen Mitgliedszahlen schaut, sondern auf die aktive Teilnahme am Gemeindeleben, bilden die Christen beider großen Konfessionen in weiten Teilen Deutschlands und Europas nur mehr eine Minderheit. Dass dies die Kirchen in eine schwere Identitätskrise stürzt, ist unvermeidbar.
Freilich zeigt sich in letzter Zeit auch, dass die Säkularisierungsschübe im Wirbel postmoderner Lebenskonzepte durchaus mit einer neuen Religionsfreudigkeit einhergehen können. Buchhandlungen machen beste Umsätze mit esoterischer Literatur. Firmen verordnen ihren Managern Kurse für positives Denken und transzendentale Meditation. Fernsehsendungen, die Lebenshilfe mit allerlei religiösen Betrachtungen verbinden, erzielen beachtliche Einschaltquoten. Das Interesse für fernöstliche, indianische und afrikanische Religionen ist nicht gering, wenn es auch nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erfasst.
Das Phänomen ist ambivalent. Einerseits scheint es zu bestätigen, dass Religiosität eine Konstante menschlicher Existenz ist, auch in der Moderne. Andererseits signalisiert es eine tiefe Unsicherheit in den transzendentalen Suchbewegungen vieler heutiger Menschen. Wie Johann Baptist Metz analysiert hat, lassen sie sich auf eine eher vage, konsumorientierte, gewiss pluralistische, in jedem Fall synkretistische Religiosität ein, die mit einem eigentümlichen Ausweichen vor der Frage nach einem persönlichen Gott einhergeht.3 Er spricht von einer Gotteskrise; eher sollte man von einer Glaubenskrise sprechen. Die Religiosität der Menschen gerät in der Sog einer breiten geistigen Strömung, die in den letzten Jahren gerade in Deutschland zu einem tiefgreifenden Wandel des Lebensklimas geführt hat: Aus einer Konflikt- und Risikogesellschaft ist eine Erlebnisgesellschaft geworden.4 Zur Steigerung des eigenen Lebensgefühls ist – neben vielem anderen – auch das Religiöse durchaus willkommen; es wird freilich funktionalisiert: als Mittel zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Selbsttranszendenz.
Ist diese Analyse nur in Ansätzen richtig, nimmt es nicht Wunder, dass die Kirchen von neuen Formen der Religiosität wenig profitieren können. Mit verbindlichen Entscheidungen, mit langfristigen Festlegungen, mit klaren Bekenntnissen, mit harten Forderungen verträgt sich dieser Trend nicht. Mehr noch: Die neue religiöse Welle verändert das Denken und Glauben der Kirchenmitglieder selbst. Die Lust an der Vielfalt, am Experiment, am Neuen und Unbekannten ist groß: Man nimmt sich die Freiheit, anders als die Kirchenleitungen zu denken; man sieht keine Probleme darin, das Glaubensbekenntnis für sich persönlich nur in Teilen als verbindlich zu erachten; man lässt sich im Gottesbild, in der Frömmigkeit, in der privaten Theologie ganz unbefangen von buddhistischen, hinduistischen, animistischen Traditionen inspirieren; die Differenzen zu anderen Religionen werden relativiert, von den Unterschieden zwischen den christlichen Konfessionen ganz zu schweigen.
Diese breite Bewegung ist unter vielerlei Rücksichten zweifellos positiv zu beurteilen: der Trend weg von Fixierungen auf kirchliche Autoritäten, weg von Selbstimmunisierungen vor fremden Einflüssen, hin zur Anerkennung des hohen Wertes anderer Religionen, hin zur Akzeptanz und Praktizierung eines legitimen, weil vom Evangelium selbst begründeten Pluralismus in Theologie und Kirche. Aber die Grenze zwischen Pluralismus und »Vielmeinerei« (Johann Wolfgang Goethe) ist fließend. Interessenvielfalt kann auch Oberflächlichkeit, Toleranz auch Profillosigkeit, Offenheit auch Denkschwäche kaschieren. Eine Unterscheidung der Geister tut not; sie vorzunehmen und für den Aufbau der Ekklesia zu nutzen, ist schwer. Die gesamtgesellschaftlichen Trends zur Privatisierung des Glaubens, zur Funktionalisierung der Religion und zum harmlosen Synkretismus sind so stark, dass sie durch einzelne Initiativen noch so engagierter Gemeinden, noch so begabter Lehrerinnen und Lehrer, noch so aufgeschlossener Pfarrer nicht gestoppt werden können. Sie verlangen nach einer neuen Ortsbestimmung der Kirchen, nach einer selbstkritischen Situationsanalyse, in der sie ihre Berufung neu zu entdecken hätten.
Die Kritik an den bestehenden Verhältnissen und die Suche nach Alternativen bleiben allerdings immer wieder an volkskirchlichen Modellen orientiert, die eine irgendwie geartete Symbiose von kirchlichem und gesellschaftlichem Leben voraussetzen.5 Das ist zum Scheitern verurteilt. Auch die klassische Pfarreistruktur löst sich langsam auf, mögen auch die Gemeinden besser sein als ihr Ruf. Die Suche nach Alternativen ist notwendig.
In dieser Situation nach den Kirchenbildern des Neuen Testaments zu fragen, kann nicht Ausdruck eines biblischen Romantizismus sein. Eine heile Anfangszeit der Kirche hat es nie gegeben. Die These, die Geschichte der Kirche sei eine einzige Geschichte des Abfalls von den Idealen Jesu, ist, so kritisch und aufgeklärt sie sich geben mag, selbst der ideologische Ausdruck eines unkritischen und unaufgeklärten Bewusstseins. Die sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Lebensbedingungen haben sich seit der urkirchlichen Zeit derart immens verändert, dass eine Rückkehr zu neutestamentlichen Kirchenstrukturen ins Abseits führen müsste.
Dennoch ist die Frage nach den neutestamentlichen Gemeindeformen von größter Aktualität. Jede Reform der Kirche, die wirklich zu neuen Ufern geführt hat, ist entscheidend durch die Rückbesinnung auf den Anfang bestimmt gewesen. Die Treue zum Ursprung ist eine wesentliche Voraussetzung ekklesialer Identität. Der Grund liegt nicht allein in einem formal bleibenden Schrift- oder Traditionsprinzip; der Grund liegt vielmehr in der »Dynamik des Anfangs« (Anton Vögtle)6: in der großen, in der unvergleichlichen spirituellen, kerygmatischen und ethischen Kraft, von der die ersten Jahrzehnte nach Ostern geprägt gewesen sind. Sich zu vergegenwärtigen, in welchem Umfeld, aus welchen Antrieben, unter welchen Schwierigkeiten, mit welchen Hoffnungen, auf welchem Grund die ersten christlichen Gemeinden entstanden sind, ist deshalb eine unentbehrliche Hilfe für die Suche nach neuen, glaubwürdigen Formen des Kircheseins hier und heute.
Freilich kann das theologische Potential, das die neutestamentlichen Schriften für die Identitätsbildung der Kirche heute bereitstellen, nur dann erschlossen werden, wenn in der Schriftauslegung neue Fragen und alte Fragen neu gestellt werden. Das Thema, das traditionell die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Amtstheologie. Die ökumenische, kirchenrechtliche und pastoraltheologische Brisanz der Fragestellung ist offenkundig; in der Einsicht z. B., welche Rolle Frauen in den urchristlichen Gemeinden spielen konnten und dann bald wieder nicht mehr, liegt einiger Zündstoff. Deshalb muss dieses Thema exegetisch immer wieder neu aufgearbeitet werden. Doch wäre es problematisch, die Hauptaufgabe einer neutestamentlichen Ekklesiologie in der Untersuchung von Diensten und Ämtern, Strukturen und Institutionen der ersten Gemeinden zu sehen. Fundamentaler als die Frage nach Ämtern setzt die Frage nach urchristlichen Lebensformen und Gemeindemodellen an: Was hat Menschen in neutestamentlicher Zeit dazu bewegt, Christen zu werden? Was hat sie motiviert, Christen zu bleiben? Wie haben sie ihr Christsein zu leben versucht? Wie hat das Alltags- und das Sonntagsleben einer urchristlichen Gemeinde ausgesehen? Welchen Herausforderungen mussten sich die ersten Christen stellen? Welchen Zwängen sahen sie sich ausgesetzt? Welche Alternativen gab es? In welchem Umfeld haben sich die ersten christlichen Gemeinden entwickelt?
Richtet sich die Aufmerksamkeit auf diese Fragen, erweist sich in neuer Weise die grundlegende Bedeutung des Neuen Testaments: erstens weil es keine starke, mächtige, etablierte, selbstsichere, sondern eine kleine, schwache, angefochtene, diskreditierte, aber eben dynamische und faszinierende Kirche zeigt; zweitens weil es in einer pluralistischen Welt der Religionen christliche Identität weder durch Verschmelzung noch durch Rigorismus zu gewinnen sucht, sondern (jedenfalls in seinen großen Schriften) angstfrei und sensibel, durch Dialog und Kritik, im Respekt vor den spirituellen und ethischen Werten griechischer Religionen, in tiefer Zustimmung zur Bibel Israels, voll Vertrauen in die unvergleichliche Kraft des Evangeliums (Röm 1,16f.).
I. Der Auftrag der Kirche
Die Kirche ist mit einer guten Nachricht unterwegs zur Einheit und zur Vielfalt des Glaubens ganz verschiedener Menschen, die allesamt »auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes« getauft sind (Mt 28,19) – oder doch eingeladen sind, sich taufen zu lassen, wo auch immer und wie auch immer sie leben. Die Gute Nachricht ist das Evangelium Jesu Christi: wie unendlich nahe Gott den Menschen kommt und die Menschen Gott kommen, so dass sie auch sich selbst und ihre Nächsten, sogar ihre Feinde anders sehen können, nämlich wie Gott sie sieht. Die Einheit ist die gemeinsame Konzentration auf Gott, wie ihn Jesus Christus in der Kraft des Geistes gezeigt hat (und zeigt), und die daraus folgende Pflege eines Miteinanders, das im Kern nicht auf Interessen, sondern auf Berufungen beruht. Die Vielfalt ist die Weite der Glaubenserfahrungen und die Tiefe der persönlichen Glaubenseindrücke.
1. Mit einer Guten Nachricht
Im Philipperbrief 7 schreibt Paulus als Überschrift einer ganzen Reihe von Mahnungen und Aufmunterungen (Phil 1,27):
Es kommt nur auf eines an:Führt euer Gemeindeleben so, wie es dem Evangelium Christi entspricht.
Der Satz ist markant, aber problematisch. Kommt es tatsächlich nur darauf an, dass die Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht? Kommt nicht vielmehr alles darauf an, dass sie die drängenden Aufgaben und Probleme in unserer Gesellschaft wahrnimmt und – soweit es in ihrer Kraft steht – zu lösen versucht? Eine schnelle Antwort könnte sich allzu leicht als vorschnell erweisen. Aufgeworfen ist ein Grundproblem, mit dem sich die Kirche in ihrer Gesamtheit und in den einzelnen Gemeinden immer wieder aufs Neue auseinanderzusetzen hat: das Problem, welche Bedeutung das Evangelium für die Gemeinde und für die Kirche haben kann und haben muss und welche Perspektiven sich für ihre Lebensformen und Aufgaben ergeben, wenn sie ganz vom Evangelium her zu leben versucht.
Um dieses Problem in seiner ganzen Schärfe zu sehen, aber auch um Ansätze und Perspektiven für Lösungen zu erkennen, ist es unumgänglich zu fragen, wie das Verhältnis von Evangelium und Gemeinde im Neuen Testament selbst gesehen wird. Der Blick ist auf solche Aussagen, Vorstellungen und Konzeptionen zum Thema »Evangelium und Gemeinde« zu lenken, denen innerhalb des Neuen Testaments selbst eine Schlüsselfunktion zukommt. Ein erster Schwerpunkt liegt deshalb auf der Frage, inwieweit die Verkündigung Jesu von Nazareth selbst Gemeinde zu bilden versucht hat; ein zweiter Schwerpunkt ist die Frage, welche Schwierigkeiten und Perspektiven sich für die Evangeliumsverkündigung aufgrund von Tod und Auferweckung Jesu ergeben haben; einen dritten Schwerpunkt bildet die Frage, wie Paulus, derjenige, der der universalen Evangeliumsverkündigung entscheidend zum Durchbruch verholfen hat, das Verhältnis von Evangelium und Gemeinde sieht.
a) Der jesuanische Ansatz
Zum Abschluss seines Evangelienprologs versucht der Evangelist Markus mit wenigen Worten den Kern der Botschaft Jesu freizulegen.8 In Mk 1,14f. heißt es:
Nachdem aber Johannes ausgeliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium Gottes:»Erfüllt ist die Zeitund nahegekommen ist die Gottesherrschaft.Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!«
So klar die heutige Bibelwissenschaft sieht, dass diese Verse aus der Feder des Evangelisten selbst stammen (der freilich Traditionselemente aufgegriffen hat), so klar darf doch auch gesagt werden, dass es Markus gelungen ist, entscheidende Aspekte dessen deutlich werden zu lassen, was als Grundanliegen Jesu von Nazareth heute erkennbar ist. Dazu gehört nicht zuletzt, dass Jesus selbst als Verkünder des »Evangeliums Gottes« gesehen wird.
Diese Aussage von Mk 1,14 trifft sich mit der einer alten Tradition, die auf die »Logienquelle« zurückgeht (Mt 11,2–6 par. Lk 7,18f.22f.): Auf die Frage des Täufers, ob er es sei, der kommen soll, oder ob sie auf einen anderen warten müssten, antwortet Jesus, auf Stellen im Jesajabuch anspielend (Jes 26,19; 29,18; 35,5f.):
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt,
um all dies – wiederum in Anspielung auf eine Jesajastelle (61,1) – in dem Wort zusammenzufassen:
Und den Armen wird das Evangelium verkündet.
Das Evangelium, das Jesus verkündet, ist nach Mk 1,15 die »Frohe Botschaft«, dass Gott seine Herrschaft nahekommen lässt, eine Frohe Botschaft für alle Menschen, insbesondere aber für die Armen. Denn Jesus verkündet in seinem Evangelium Gott als denjenigen, der den Antritt seiner Herrschaft, die für die Menschen – durch das Gericht hindurch – Heil, Leben und Rettung schlechthin bedeutet, nicht bis in eine ferne Zukunft vertagt, sondern nahebringt. Von dieser andrängenden Nähe der zukünftigen Gottesherrschaft ist bereits die Gegenwart durch und durch bestimmt. Sie ist deshalb eine Zeit, in der einerseits das Heilshandeln Gottes in ganz neuer Intensität erfahrbar wird, in der aber andererseits auch der Anspruch Gottes, der aus seinem eschatologischen Heilshandeln entspringt, die Menschen in neuer Intensität trifft.
Von beidem, zuerst vom Zuspruch, dann aber auch vom Anspruch Gottes, hat jede Evangeliumsverkündigung zu reden – und hat Jesus als der erste, als der von Gott selbst gesandte Bote der Gottesherrschaft in seiner Evangeliumspredigt durchweg geredet. Wie die Antwort auf die Täuferfrage aus der Erinnerung festgehalten hat, gehört zu Jesu Verkündigung zunächst, dass er den Menschen, die ihm begegnen, insbesondere aber den Armen, konkrete Erfahrungen heilsamer Nähe der Gottesherrschaft vermittelt: indem er sie von Krankheit und Besessenheit befreit; indem er sie von den Rändern der politischen und religiösen Gesellschaft an einen gemeinsamen Tisch holt; und indem er sie vom Joch einer Gesetzesauslegung befreit, die den Zugang zum Reich Gottes versperrt.
Zur Evangeliumsverkündigung Jesu gehört es aber auch, dass er den Anspruch weitergibt, den Gott erhebt, wenn er seine Herrschaft nahekommen lässt. In Mk 1,14f. stehen dafür die Stichwörter »Umkehr« und »Glaube«: Jesus fordert die Hörer seiner Botschaft zu einer radikalen Neuorientierung ihres gesamten Lebens mit all seinen Wünschen und Hoffnungen, Erfolgen und Misserfolgen, Erfahrungen, Ängsten und Erwartungen auf: zu einer Wendung um 180 Grad weg von der Fixierung auf sich selbst, hin zu einer Orientierung an Gott, die von rückhaltlosem Vertrauen getragen ist, zu einem geklärten Bekenntnis führt und tiefgreifende Folgen für das zwischenmenschliche Verhalten hat. Im Zusammenhang damit fordert Jesus aber auch eine Solidarisierung mit seiner eigenen Person und seiner Botschaft. So geht es aus dem alten Wort Lk 12,8f. hervor:
Amen, ich sage euch,wer sich zu mir vor den Menschen bekennt,zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden.
Mit diesem Ruf zur Umkehr, zum Glauben und zur Solidarisierung mit ihm, dem prophetischen Boten der Gottesherrschaft, hat Jesus ganz Israel angesprochen, um es in der Nähe der Gottesherrschaft zu sammeln und als Gemeinde Gottes neu zu formen. Jesu Evangeliumsverkündigung zielt also von Anfang an auf die Bildung einer Gemeinschaft des Glaubens hin, und zwar auf eine (innerhalb Israels) offene Gemeinschaft. Jesu Ziel war es nicht, einen heiligen Rest auszusondern; Jesus wusste sich vielmehr dazu gesandt, allen Menschen in Israel, nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen (Lk 8,2), nicht nur den Gesunden, sondern auch den Kranken (Lk 11,20), nicht nur den Gelehrten, sondern auch den Unmündigen (Lk 10,21), nicht nur den Etablierten, sondern auch und gerade den Marginalisierten, den Armen (Lk 6,20f. par. Mt 5,3–12), das Evangelium von Gottes nahekommender Herrschaft zu verkünden, um sie für die Sache Gottes zu gewinnen. Auch Heiden – von denen in Galiläa und Judäa viele lebten – hat Jesus nicht zurückgestoßen, sondern angenommen.
Dem Ziel der Sammlung ganz Israels und seiner Öffnung für die Heiden dient es auch, wenn Jesus einzelne Menschen in seine Nachfolge ruft. Die Jünger, die Jesus sich erwählt hat, müssen aus ihren bisherigen Leben ausbrechen (Mk 1,16–20; 10,28–31; Mt 8,21), um die Unsicherheit und Unstetigkeit des Wanderlebens Jesu teilen zu können, der selbst »keinen Fleck Erde hat, um dort sein Haupt niederzulegen« (Lk 9,58), und dadurch frei zu werden, an Jesu Sendung teilzunehmen und – in der Vollmacht Jesu (Mk 6,7) – gleichfalls das Evangelium von Gottes Reich zu verkünden (Lk 10,9 par. Mt 10,7).
Im Überblick betrachtet, zeichnen sich vier Wesensmomente der Evangeliumsverkündigung Jesu ab:
Erstens: Jesus selbst sieht seine entscheidende Aufgabe darin, das Evangelium Gottes zu verkünden.
Zweitens: Als Evangelium verkündet er, dass Gottes Herrschaft heilbringend nahegekommen ist.
Drittens: Diese Evangeliumsverkündigung zielt auf die Sammlung ganz Israels als Gemeinde, die sich neu auf den Willen Gottes verpflichtet.
Viertens: Diesem Ziel dient es, wenn Jesus einzelne Menschen in seine Nachfolge ruft, damit sie mit ihm – aus seiner Vollmacht heraus – das Evangelium von Gottes Reich verkünden.
b) Der österliche Motivationsschub
Mit seiner Verurteilung und Hinrichtung am Kreuz war (oder schien) Jesu Evangeliumsverkündigung gescheitert: Jesus hat mit seinem Glaubens- und Umkehrruf nur wenige erreicht; ein Großteil hat sich seiner Botschaft verschlossen; mit maßgeblichen Kreisen des Judentums geriet Jesus aufgrund seiner Evangeliumsverkündigung, die ihn zugleich für die ungeteilte Geltung des Anspruchs Gottes und für die rückhaltlose Öffnung der Heilsgemeinde auch für die Sünder und Unreinen eintreten ließ, zunehmend in Konflikte, die seine Hinrichtung durch die Römer mit verursacht haben werden; von den Jüngern schließlich berichtet das älteste Evangelium, dass sie dem Druck des Leidens nicht standzuhalten vermochten und alle geflohen sind (Mk 14,50).
Umso erstaunlicher ist es, dass nach dieser Katastrophe des Todes Jesu die Verkündigung des Evangeliums nicht aufhört, sondern in ihrer ganzen Dynamik erst beginnt: Die Grenzen der Israelmission werden im Ausgriff auf die Völker gesprengt; zuerst in Jerusalem, vielleicht in Galiläa, sehr schnell aber auch in Syrien und Kleinasien bilden sich Gemeinden von nachösterlichen Jüngern, die den Namen Jesu anrufen und bald auch »Christen« genannt werden (Apg 11,26).9
Die Initialzündung, die diesen Prozess ausgelöst hat, war – nach der übereinstimmenden Auskunft des gesamten Neuen Testaments – die Erfahrung der Auferweckung Jesu von den Toten. Wie auch immer im Einzelnen den Erstzeugen der Auferweckung, die aus dem Kreis der vorösterlichen Jünger Jesu stammten, diese Erfahrung zuteilgeworden ist (die neutestamentlichen Texte bleiben in dieser Hinsicht mit Recht sehr zurückhaltend): Entscheidend war die Erfahrung, dass Gott seinen Knecht Jesus, den getöteten Boten der Gottesherrschaft, von den Toten auferweckt (1 Kor 15,3–5) und zu seiner Rechten erhöht hat (Phil 2,6–11). Zu dieser grundlegenden Auferweckungserfahrung gehört aber auch, dass Jesus von Nazareth – und niemand anders – sich als Auferstandener den Jüngern zu erkennen gibt, um sie wiederum zu sammeln und erneut in die Nachfolge zu rufen mit dem Ziel, dass sie seine Evangeliumsverkündigung fortsetzen. Der Evangelist Matthäus stellt dies in den Mittelpunkt seiner Auferstehungsbotschaft. Der auferstandene Jesus tritt in die Mitte der (übriggebliebenen) elf Jünger und sagt ihnen, die zweifeln (Mt 28,18ff.):
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.Geht darum hin und macht alle Völker zu Jüngern,indem ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes tauftund sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe.Und siehe: ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Wodurch ist nach diesem Manifest die nachösterliche Evangeliumsverkündigung gekennzeichnet?
Erstens: Die nachösterlichen Verkündiger werden vom Auferstandenen selbst gesendet. Er ist der eigentliche Initiator der nachösterlichen Evangeliumsverkündigung.
Zweitens: Diese Verkündigung ist von der Zusage des Auferstandenen getragen, alle Tage »mit« den Jüngern zu sein; sie darf und soll sich mithin auf die Verheißung gründen, dass der Auferstandene mit aller ihm von Gott verliehenen Vollmacht in der Mitte der Jünger als ihr Beistand wirkt.
Drittens: Die nachösterliche Evangeliumsverkündigung steht in Kontinuität zur vorösterlichen, weil der auferstandene Jesus in der Mitte seiner Jünger bleibt. Die Jünger haben nichts anderes zu lehren, als das, was Jesus selbst ihnen gesagt hat – was das Bemühen um ein zeitgemäßes Sprechen nicht ausschließt, sondern voraussetzt. Das deutlichste Neuheitselement ist die – trinitarisch angelegte – Taufe, die (so lässt sich theologietechnisch sagen) sakramental die Zugehörigkeit zu Jesus und zum Gottesvolk bewirkt.
Viertens: Die nachösterliche Evangeliumsverkündigung ist von ihrem Wesen her universal, weil Tod und Auferweckung Jesu die Universalität der Heilsintentionen Gottes unwiderruflich aufgedeckt haben.
Fünftens: Den nachösterlichen Jüngern, die das Evangelium verkünden sollen, wird vom Auferstandenen die Aufgabe und die Vollmacht gegeben zu taufen und zu lehren. Diese Vollmacht ist an die Aufgabe gebunden; sie ist eine Vollmacht, die um des Dienstes am Evangelium willen entstanden ist und sich deshalb ganz in den Dienst des Evangeliums stellen muss.
Sechstens: Das Ziel der nachösterlichen Evangeliumsverkündigung liegt darin, alle Völker zu Jüngern zu machen. Das ist weit mehr, als sie zu belehren; es heißt, die Hörer des Wortes an die Person Jesu zu binden, ihnen seinen helfenden Beistand erfahrbar zu machen, sie zum Tun des Willens Gottes einzuladen (wie er am nachdrücklichsten in der Bergpredigt formuliert wird) und sie dadurch zur Mitarbeit am Werk der Evangeliumsverkündigung zu befähigen, zu der (nicht nur) nach matthäischer Sicht alle nachösterlichen Jünger berufen und befähigt sind, d. h. alle Glieder der entstehenden Gemeinde, unbeschadet ihres je verschiedenen Charismas.
c) Die paulinische Konsequenz
Der erste, der die Konsequenzen aus der Auferweckung des Gekreuzigten für Aufgabe, Perspektive und Form der nachösterlichen Evangeliumsverkündigung in aller Klarheit gesehen und verfolgt hat, war Paulus.10 Er war zwar nicht der erste » Missionar«, der Heiden bekehrt hat (vgl. Apg 8,4–25; 10f.), aber er war der erste, der die Aufgabe universaler Evangeliumsverkündigung zur Mitte seiner apostolischen Existenz gemacht hat. Dafür war seine persönliche Ostererfahrung entscheidend: seine Begegnung mit dem Auferweckten, von der er im Galaterbrief (Gal 1,15f.) schreibt, dass er sie zugleich als Berufung zur Heidenmission erfahren habe:
Gott aber, der mich von meiner Mutter Schoß erwähltund durch seine Gnade berufen hat,gefiel es, seinen Sohn in mir zu offenbaren,damit ich ihn den Heiden als Evangelium verkünde.
Das Programm der universalen Evangeliumsverkündigung, also auch der damals keineswegs unumstrittenen Heidenmission, das aus dieser Berufung folgt, hat Paulus am intensivsten in dem Brief reflektiert, der zu seinem »Testament« geworden ist, dem Römerbrief. Im ersten Satz dieses Briefes stellt Paulus sich der ihm unbekannten Gemeinde (von Gal 1,15f. her verständlich) als »berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes« (Röm 1,1) vor. Wie sehr diese »Aussonderung« für ihn Berufung zur universalen Heidenmission meint, geht aus dem Rahmen des Römerbriefs besonders deutlich hervor. Paulus sucht das Gespräch mit der Hauptstadtgemeinde (Röm 1,11f.), weil er von Rom aus eine neue Phase seiner Evangeliumsverkündigung einleiten will: Nachdem er seine Mission im Osten des römischen Imperiums im Wesentlichen für abgeschlossen hält, will er sein Arbeitsfeld in den Westen, bis hin nach Spanien, verlagern (Röm 15,23f.). Der Vorbereitung dieses Planes, der Einstimmung der Gemeinde auf seine Absichten, aber auch der theologischen Reflexion dieses universal auszubreitenden Evangeliums dient der Brief an die Römer.
Inwiefern aber drängt das Evangelium zur universalen Verkündigung und damit zur Bildung von Gemeinden in der ganzen damaligen Welt? Eine Antwort ergibt sich aus der »Definition« des Evangeliums, mit der Paulus die Einleitung seines Briefes beschließt und dessen Thema vorstellt (Röm 1,16f.):
Ich schäme mich nämlich des Evangeliums nicht:Es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt,den Juden zuerst, aber auch den Griechen;denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbartaus Glauben zum Glauben,wie geschrieben steht (Hab 2,4):»Der aus Glauben Gerechte wird leben.«
Das Evangelium ist danach weder eine Summe von Glaubenssätzen noch gar ein Buch über das Wirken Jesu; Evangelium ist vielmehr die Macht des zur Rettung aller Menschen entschlossenen Gottes, die er am intensivsten in der Auferweckung des für alle Menschen gestorbenen Gottessohnes Jesus erwiesen hat. Von dieser Macht Gottes sieht Paulus sich selbst in seiner ganzen Existenz ergriffen. In Röm 15,16, dort, wo er auf seine weiteren Missionspläne zu sprechen kommt, versteht er sich als Diener Jesu Christi, der
das Evangelium priesterlich vermittelt;denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden, die Gott gefällt,geheiligt im Heiligen Geist.
Wenn Paulus hier von einer Opfergabe spricht, zu der die Heidenvölker selbst werden sollen, so steht dahinter nicht die Vorstellung, dass Gott durch Selbstdemütigung, Zerstörung der eigenen Persönlichkeit oder blinde Unterwerfung in seinem Zorn beschwichtigt werden sollte. Gott ist vielmehr – dies ist ja das Evangelium – im Voraus und geradezu gegen die Sünde, gegen die Abgewandtheit der Menschen von Gott zu deren Rettung entschlossen. Wohl aber steht hinter dem Bild von der Opfergabe die Vorstellung, dass Gott sich ein Volk aus den Völkern sucht, das ganz ihm zu eigen ist. Die Aufgabe des Apostels ist die eines Priesters, der das Evangelium vermittelt, indem er durch seine Verkündigung Gemeinden bildet, in denen diese Übereignung des einzelnen und der Gemeinschaft an Gott vollzogen wird.
Welcher Anspruch ergibt sich daraus für die Gemeinden selbst? Das Entscheidende drückt Paulus im Römerbrief wiederum in der kultischen Terminologie der Opfersprache aus. In Röm 12,1, wo Paulus die praktischen Schlussfolgerungen aus seiner theologischen Reflexion des in Röm 1,16f. vorgestellten Evangeliums zieht, heißt es als Überschrift über die gesamte Paränese:
Ich ermahne euch also, Brüder, durch das Erbarmen Gottes,euch selbst als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen!
Der Tenor der Forderungen, die Paulus als Sprachrohr Gottes stellt, lautet: Daraus, dass Gott zur Rettung aller Menschen, die Sünder sind, entschlossen ist, entspringt ein Anspruch Gottes, der den ganzen Menschen in all seinen Lebensvollzügen fordert und dem der vom Wort des Evangeliums getroffene Mensch nur dann gerecht werden kann, wenn er sich selbst innerhalb der Gemeinschaft, in der er lebt, Gott ganz übereignet als dankbarer Ausdruck seiner Angewiesenheit auf Gott. Paulus fordert die Christen und die Gemeinde damit auf, sich in ihrer ganzen Existenz allein auf das Evangelium zu gründen.
Dies hat konkrete Folgen. In der Gemeinde von Rom gibt es Konflikte zwischen »Starken« und »Schwachen«. Die »Schwachen« halten bestimmte Speisevorschriften und Riten ein; sie essen kein Fleisch (Röm 14,2), verzichten auf Alkohol (Röm 14,21) und beobachten bestimmte Feste und Fasttage. Sie verurteilen die »Starken« (Röm 14,3.4.10.13), die sich um diese Vorschriften nicht kümmern und ihrerseits die »Schwachen« verachten (Röm 14,3). Paulus versucht, die Gemeinde zu einer Lösung dieses Konfliktes zu bewegen, aber nicht dadurch, dass er einer der beiden Parteien Recht gibt (auch wenn er selbst sich eher der Gruppe der »Starken« zurechnen würde), sondern dadurch, dass er beide Gruppen und die Gemeinde insgesamt auf das Evangelium verpflichtet. Den anderen zu verurteilen, aber auch, ihn zu verachten und ihm gar durch das eigene Handeln »Anstoß zu geben«, d. h. ihn zum Abfall vom Glauben zu führen, ist für Paulus deshalb ausgeschlossen, weil Christus für alle gestorben ist und auferweckt wurde, »um Herr zu sein über Tote und Lebende« (Röm 14,9).
Die Art und Weise, wie Paulus in diesem Konfliktfall argumentiert, ist von grundsätzlicher Bedeutung für das Selbstverständnis christlicher Gemeinde; denn diese Argumentation führt an einem Beispiel modellartig vor, dass eine Gemeinde nur dann und nur in dem Maße ihrer Bestimmung und Berufung gerecht werden kann, wie sie ganz vom Evangelium her lebt. Ihre vom Christusgeschehen her vorgegebene Bestimmung und Berufung ist es nach Paulus, »ein Leib in Christus« zu sein (Röm 12,3–8; vgl. 1 Kor 12,12–27). Dies – so zeigt es die Einbettung des Gedankens in die Paränese – kann nicht nur ein abstrakter theologischer Gedanke bleiben, sondern muss die Gemeindemitglieder zu einem Handeln inspirieren, das tatsächlich zur Einheit und Gemeinschaft führt.
Das einheitsstiftende Prinzip ist für Paulus die Liebe, in der Gottes Liebe weitergegeben wird (Röm 5,5). Die Einheit und Gemeinschaft, die dadurch zustandekommt, ist ein lebendiges, den anderen in seiner Andersartigkeit annehmendes Miteinander und damit das Gegenteil von Gleichschaltung. Eine solche Gemeinde ist fähig, auch nach außen zu wirken und anderen das Evangelium zu verkünden. Auch im Römerbrief finden sich Ansätze dafür, dass die auf dem Evangelium gründende Liebe der Gemeindemitglieder untereinander nicht auf die Gemeinde begrenzt werden kann. Die paulinische Ethik der Agape erinnert im Römerbrief am stärksten an die Bergpredigt: Der Apostel fordert die Gemeinde zur Gastfreundschaft auf und dazu, ihre Verfolger zu segnen, (soweit es möglich sei) Frieden mit allen Menschen zu halten und dem Feind zu essen und zu trinken zu geben, wenn er Hunger und Durst hat (Röm 12,13–20). Auch dies kann als eine Form der Evangeliumsverkündigung verstanden werden, zu der die Gemeinde aufgerufen ist, weil das Evangelium die Macht der Liebe Gottes ist, der zur Rettung der Welt entschlossen ist.
Wird das Evangelium derart fundamental verstanden, so, wie es letztlich von Jesus selbst her vorgegeben ist, dann muss tatsächlich Geltung beanspruchen, was Paulus im Philipperbrief schreibt: Alles kommt darauf an, dass jede Gemeinde und die Kirche insgesamt ihr Leben so führt, wie es dem Evangelium Gottes entspricht. Denn nur in dem Maße, wie sie sich auf das Evangelium Gottes gründet, kann sie die ihr aufgetragene Aufgabe erfüllen und zur Zeugin der heilshaften Nähe Gottes in dieser Welt werden.
2. Unterwegs
Der Hebräerbrief 11 ist wegen seiner Sprache, seiner Thematik und seines Denkstils nicht nur eine der schwierigsten und anspruchsvollsten, sondern auch eine der unbekanntesten und unzugänglichsten Schriften des Neuen Testaments. Wie aktuell und relevant er aber ist, zeigt sich sofort, wenn man die geschichtliche Situation betrachtet, in der er entstanden ist, und die pastoraltheologische Strategie bedenkt, die der Verfasser mit seinem Schreiben verfolgt. Er schickt die Gläubigen auf Wanderschaft. Christsein ist ein Weg. Die Kirche ist on tour.
Der Hebräerbrief ist an eine Gemeinde gerichtet, die sich in einer kritischen Lage befindet. Es geht nicht um prinzipielle Kontroversen mit Vertretern christlicher Tora-Observanz wie im Galaterbrief; es geht nicht um die kritische Auseinandersetzung mit überschäumendem Enthusiasmus wie im Ersten Korintherbrief; es geht nicht um die theologische Zurechtweisung sektiererischer Skrupulosität wie im Kolosserbrief; es geht auch nicht um die Lösung bedrohlicher Konflikte mit Häretikern wie im Ersten Johannesbrief. Die Probleme scheinen auf den ersten Blick viel banaler, sie haben es aber in sich, und sie liegen viel näher bei den Glaubensproblemen der Gegenwart.
a) Die Mühen der Ebene
Der Hebräerbrief wendet sich an Christen der zweiten oder dritten Generation (2,3), denen der Elan der Anfangszeit abhandengekommen ist (vgl. 10,32–35). Der Autor hat wohl eine bestimmte Gemeinde und in dieser Gemeinde besonders eine bestimmte Gruppe von Christen vor Augen; aber er weiß, dass die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat, nicht nur die Probleme dieser Gemeinde und dieser Gruppe sind, sondern die der ganzen Generation. Der Hebräerbrief sieht die Kirche als »wanderndes Gottesvolk«12: als Gemeinschaft, die auf dem Weg ist. Die theologische Tragweite dieser Metapher hat das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Traktat über die Kirche neu entdeckt und ihre kirchenpolitische Relevanz in ersten Ansätzen skizziert (Lumen gentium Kap. 2).
Der Brief sieht allerdings auch, dass den Christen der Weg lang wird (vgl. 10,36; 12,1f.): Die Knie werden weich, die Arme werden schlaff (12,2); die Beine beginnen zu stolpern (vgl. 12,13); die Orientierung fällt zusehends schwerer (vgl. 2,1; 3,10); einige Weggefährten drohen zurückzubleiben (4,1), andere sich zu verirren (2,1; 3,10); ein Ende des Weges scheint nicht absehbar zu sein. Die Folgen sind Lustlosigkeit und Trägheit (6,1), Ungeduld (10,36) und Ängstlichkeit (vgl. 10,39), übrigens auch nachlassender Gottesdienstbesuch (10,25).
Die gegenwärtige Schwäche ist der Gemeinde keineswegs von Haus aus eigen. Sie hat schon einigen Stürmen getrotzt; sie könnte bereits auf eine stolze Vergangenheit zurückblicken. Sie hat nicht nur das Klima des Unverständnisses, der Ausgrenzung, der Diskriminierung, der Verleumdung und Verachtung ertragen, das in der Anfangszeit allenthalben den christlichen Gemeinden (wie anderen Außenseitern) entgegengeschlagen ist (10,33). Sie hat auch regelrechte Verfolgungen erlitten (10,32ff.; 12,4–13; 13,3.23). Zwar ist ihr die Herausforderung des Martyriums erspart geblieben; sie hat noch nicht »bis aufs Blut widerstanden« (12,4; vgl. 13,22). Aber einige Christen aus der Gemeinde sind aufgrund ihres Glaubens inhaftiert worden (13,3; vgl. 10,34; 13,23); einigen ist, gleichfalls aufgrund ihres Glaubens, das Vermögen konfisziert worden (10,32ff.). All das hat die Gemeinde mutig, solidarisch, geduldig und zuversichtlich durchgestanden (vgl. 10,32–36). Doch scheint dies für die Bewältigung der neuen Herausforderung kaum eine Hilfe zu sein.
Das Problem, das es jetzt zu lösen gilt, ist anderer Art: Es ist nicht der Druck von außen, dem man standhalten, oder die Gefahr einer Glaubensspaltung, die man abwehren müsste; es ist auch kaum (wie die ältere Forschung gemeint hat) die Tendenz zu einer Rejudaisierung, die der Verfasser bekämpfen will (vgl. 13,9ff.). Es sind schlicht und einfach die Mühen der Ebene, die Probleme bereiten. Es ist nicht einmal so sehr die Enttäuschung über das Ausbleiben der Parusie. Der Stachel sitzt tiefer: Der christliche Glaube wird alltäglich; spektakuläre Missionserfolge bleiben aus; das große Thema, das alle mitreißen könnte, fehlt; das eschatologische Heil, von dem das Evangelium spricht, ist nicht unmittelbar zu erfahren; vor allem aber fällt es der Gemeinde zunehmend schwer, sich auf das Hören des Evangeliums zu konzentrieren und das Überzeugende, Aufbauende, Wegweisende, Ermunternde, Tröstende, Anspornende der christliche Botschaft zu erkennen (5,11ff.). Ihre Schwerhörigkeit (5,11) ist die Ursache ihrer Lustlosigkeit, ihrer Irritationen über den Weg des Christseins und ihres mangelnden Engagements in der Gemeinde.
b) Die Suche nach einem neuen Anfang
Der Autor des Briefes weiß, dass er die Krise der Gemeinde nicht lösen kann, wenn er an den Symptomen herumdoktert; er muss das Problem an der Wurzel packen. Deshalb geht er zu den Wurzeln des christlichen Glaubens zurück. Er gibt keine Durchhalteparolen aus; er verbreitet keinen Zweckoptimismus; er rät nicht, die langsamen Wanderer eben abzuhängen und die unsicheren Kantonisten nur laufen zu lassen (4,1). Er nimmt die Gemeinde als ganze ins Gebet und mutet ihr zu, neu über die Grundlagen ihres Glaubens nachzudenken (5,11–6,3). Ganz Theologe, ist er der festen Überzeugung, dass die beste Motivation für engagiertes Christsein das gläubige Verstehen des Evangeliums ist, die reflektierte Bejahung seines Zuspruchs und Anspruchs, die intellektuelle und spirituelle Aneignung seines theologischen Gehalts.
Der »Grundkurs des Glaubens«, den der Verfasser mit seinem Schreiben konzipiert, ist weder ein Lehrbuch der Dogmatik noch ein erster Universalkatechismus, sondern eine Einführung ins Christentum: in seine Prinzipien und seine Praxis des Glaubens. Der Verfasser unternimmt den groß angelegten Versuch, das Heilsgeschehen des Todes Jesu in der Sprache des israelitischen Kultes neu zu interpretieren. Er beschreibt den Weg, den der Hohepriester Jesus zurücklegt, um den Menschen einen Zugang zu Gott zu eröffnen; dabei skizziert er auch die Richtung des Weges, den Christen auf ihrer irdischen Pilgerschaft zurücklegen müssen, um an das Ziel ihres Lebens zu gelangen: mit Christus in die himmlische Ruhe eines ewigen Sabbats eingehen zu können (4,1–11).
Wie aber finden die Christen auf den rechten Weg? Und wie werden sie es schaffen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen?
(1) Hinschauen zu Jesus – Hinhören auf Gottes Wort
Das Erste und Wichtigste ist: auf Jesus zu schauen (2,9; 3,1; 12,2; vgl. 7,4; 8,5; 9,28; 12,14) und die Ohren für das Wort Gottes aufzusperren, das durch Jesus gesagt wird (2,1; 12,19.25f.; vgl. 3,7.15f.; 4,2.7). So notwendig Geduld und Ausdauer, Leidensfähigkeit und Zuversicht, Solidarität und Rechtgläubigkeit sind, um den Weg des Lebens zu gehen: Entscheidend ist es, zum Hörer jenes Wortes zu werden, »das Gott viele Male und auf vielerlei Weise einst zu den Vätern durch die Propheten gesprochen hat, in dieser Endzeit aber zu uns durch den Sohn« (1,1f.). Das aufmerksame Hören setzt freilich den Aufbau einer personalen Beziehung zu Jesus Christus voraus. Diese Beziehung kann aber nur dann entstehen, wenn die Christen Jesus so sehen lernen, wie er wirklich ist; nur dann können sie ihn als den bejahen, der er nach Gottes Willen für sie sein will.
Am genauen Hinschauen zu Jesus und am genauen Hinhören auf das Wort, das Gott durch ihn spricht, hängt die Identität des Glaubens. Freilich ist ein scharfes Auge ebenso wenig selbstverständlich wie ein sensibles Ohr. Das richtige Hören und Sehen muss erst gelernt werden. Wer den Hebräerbrief studiert, macht Exerzitien im Sehen und Hören. Ziel ist die präzise Wahrnehmung des christologischen Heilsgeschehens. Es ist eine Wahr-nehmung im genauen Sinn des Wortes: nicht nur das Erkennen dessen, was mit Jesus wirklich geschehen ist und wer Jesus in Wahrheit ist, sondern auch die Bejahung, das Für-Wahr-Nehmen dessen, was er nach Gottes Willen für die Menschen sein soll.
Was vor Augen tritt, wenn man ganz genau hinschaut, ist zunächst ernüchternd, vor allem aber realistisch: Es ist das Todesleiden Jesu (2,9), es ist die Schmach und Schande seines Kreuzestodes (12,2; vgl. 11,26; 13,13). Wer genauer hinschaut, sieht freilich gerade im Leiden auch die Treue Jesu zu seiner Sendung (3,1f.), sein glaubendes Vertrauen auf Gott (12,2) und seine Solidarität mit den Sündern (12,3); wer das Geschick Jesu, vor allem sein Sterben, im Lichte des Glaubens betrachtet, wird sehen, dass er gerade um dieses seines Leidens willen »mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt« ist (2,9); und am Ende der Geschichte wird er den wiederkommenden Jesus Christus sehen, wie er erscheint, um die zu retten, die auf ihn warten (9,28; 12,14).
Ähnlich facettenreich wie das Sehen ist das Hören. Wer seine Ohren für die Stimme öffnet, die Gott »heute«, in der eschatologischen Gegenwart Jesu Christi, erhebt (3,7–19; 4,7), vernimmt scharfe Worte der Kritik, die alle Illusionen zerstören, die Menschen über sich selbst, über Gott und die Welt haben (4,12). Es sind die Worte des Richters, der von den Menschen Rechenschaft über ihr Leben verlangt (4,12f.). Wer aber vor dieser Stimme sein Herz nicht verschließt (3,7–19), kann durch die Worte des Gerichts hindurch den Klang des Evangeliums vernehmen (4,2; vgl. 4,8): die große Verheißung endgültiger Gemeinschaft mit Gott (4,6–11); und er wird Geschmack finden an jenem »guten Wort« (6,5), das Gott spricht, indem er durch Jesus die Sünden vergibt (1,3).
(2) Wahrnehmung der Wirklichkeit
Die Leser des Hebräerbriefes gehen in eine Schule des Sehens und des Hörens. Die erste Lektion, die sie lernen müssen: die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, und die Realitäten anzuerkennen. Im Falle Jesu heißt das: So verlockend es sein mag, sich ein Christusbild auf Goldgrund auszumalen, das die ganze Herrlichkeit des Gottessohnes unmittelbar widerzuspiegeln scheint, so notwendig ist es, die Augen vor den bruta facta des Lebens Jesu nicht zu verschließen: vor seiner Anfechtung (2,18) und Anfeindung (12,3), vor seiner Angst und seinen Tränen (5,7), vor seiner Erniedrigung (2,9) und seiner Schmach (11,26; 13,13), vor seinem Leiden (2,9f.18) und seinem Tod am Kreuz (12,2). Andernfalls wird der Glaube zur Ideologie, bestenfalls zur Gnosis. Der Auctor ad Hebraeos betont diesen Punkt nicht so sehr, weil es ihm um den Zusammenhang zwischen Religion und Ethik geht: Wer das Leiden Jesu nicht wahrhaben will, kann auch sein Mit-Leid mit den Menschen nicht sehen, sein Verständnis für die Irrenden, seine Solidarität mit den Schwachen, seine Barmherzigkeit mit den Sündern (4,14–5,4). Gerade das ist aber allen, die den Brief lesen, äußerst wichtig: Wenn sie sehen, dass Jesus mit ihrer Schwachheit mitfühlen kann, weil er in seinem menschlichen Dasein selbst in Versuchung geführt worden ist (4,15), können sie glauben, dass sie auf ihrem langen und beschwerlichen Weg nicht alleingelassen sind, sondern in Jesus Christus einen verständnisvollen (5,2) und mitfühlenden (4,15) Weggefährten haben, der ihnen treu zur Seite steht (12,3).
Freilich setzt dies voraus, dass der Blick nicht an der Oberfläche haften bleibt, sondern in die Tiefe dringt. So wichtig der Realitätssinn des Glaubens ist, so notwendig ist es, die geschichtlichen Ereignisse bis auf den Grund zu durchschauen. Wer seine Augen dafür schärft, kann sehen, dass in der Erniedrigung Jesu der rettende Gott am Werk ist. Deshalb wird er zugleich sehen, dass der Tod Jesu nicht das Ende ist, sondern ein ganz neuer Anfang: der Anfang des ewigen Lebens Jesu zur Rechten Gottes, da er wie in seinem irdischen Leben für die sündigen Menschen eintritt (7,25), und der Anfang eines neuen, eines zweiten, besseren Bundes, den Gott den Menschen gnädig gewährt, damit allen, die glauben, das Erbe ewigen Lebens zuteilwird.
Ähnlich steht es mit dem Hören. Zwar mag für viele Menschen der Gedanke verführerisch klingen, dass über ihre Schuld geschwiegen und über ihre Fehler der Mantel des Vergessens gebreitet wird. Dennoch kann ihre wahre Hoffnung nur darin bestehen, dass ihr Versagen ungeschminkt zur Sprache kommt; sonst würde es nur verdrängt und könnte nicht vergeben werden. Das Wort Gottes, das Jesus mitteilt, redet in schonungsloser Offenheit von der Wirklichkeit menschlichen Lebens mitsamt seiner Schwäche und Begrenztheit (4,12f.), um dann vom Heilswillen Gottes zu handeln, der durch den Hohenpriester Jesus die Schuld der Menschen tilgt. Diese Dialektik von Gericht und Heil stellt der Autor in den Mittelpunkt seiner Theologie des Wortes Gottes: nicht weil er auf die Zerknirschung des Sünders setzte, auch nicht weil er einem naiven Heilsoptimismus begegnen müsste, der Gottes Gnade billig macht und sich allzu schnell angesichts der schlechten Verfassung der Gemeinde tröstet, sondern weil er der Wahrheit die Ehre geben muss und den Christen den Ernst ihrer Lage verdeutlichen will, gleichzeitig aber die Macht und den Willen Gottes, den Glaubenden noch in ihrer gegenwärtigen Misere die schöpferische Kraft seines Wortes spürbar werden zu lassen (4,12).
(3) Sehen des Unsichtbaren – Hören des Unerhörten
Das aufmerksame Hinschauen zu Jesus, dem das genaue Hören auf Gottes Wort entspricht (2,1; 4,3; vgl. 5,9), führt zur Konzentration auf das Wesentliche: auf das, was dem Leben Richtung und Ziel gibt. Das Eigentliche aber, davon ist der Verfasser des Hebräerbriefes überzeugt, ist unsichtbar. Es ist unsichtbar, weil es erst in der transzendenten Zukunft zum Vorschein kommen wird (11,1.7); und es ist unsichtbar, weil es zu Gott gehört. Gott aber ist unsichtbar (11,27), weil er der »ganz Andere« ist, der sich menschlichem Sinnen und Trachten entzieht. Diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes müssen die Christen in der Welt sehen lernen. Darin kann ihnen Mose ein Vorbild sein. Von ihm sagt der Hebräerbrief, an seinen Auftritt vor dem Pharao denkend, dass er vor seinem inneren Auge den »Unsichtbaren« gesehen habe, also Gott in seiner Unsichtbarkeit, und deshalb standgehalten habe (11,27). Der Blick für Gott verleiht Mose den Mut, der Wut des Pharao zu trotzen und das Volk Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten in die Freiheit zu führen. Der Blick der Christen darf nicht über die Realitäten hinweghuschen. Er kann sich jedoch durch sie hindurch auf das richten, was zwar dem äußeren Auge verborgen bleibt, was aber die eigentliche Wirklichkeit ist: Gottes Heilsplan.
Wiederum ganz ähnlich beim Hören: Das Wort, das Gott »jetzt« durch seinen Sohn spricht, ist nicht irgendein Wort unter vielen; es ist nicht schon häufig formuliert worden, es wird durch Jesus Christus zum ersten und zum letzten Mal gesagt, ein für alle Mal (7,27; 9,12.26ff.; 10,10). In diesem Sinne ist das Wort unerhört. Es erklingt nicht mehr in der Vielzahl und Vielfalt prophetischer Stimmen aus der Geschichte Israels, sondern in jener end-gültigen Klarheit und Eindeutigkeit, die durch die Identität und Integrität des menschgewordenen Gottessohnes (2,14) gestiftet wird (1,1f.). Dieses Wort muss gehört werden, und es muss so gehört werden, wie Gott es zum Heil der Menschen gesprochen hat.
Deshalb ist das Hören, zu dem der Hebräerbrief anleiten will, ein Aufhorchen, das zum Gehorchen (5,9; 11,8), ein Verstehen, das zum Einverständnis wird (12,25f.). Es kommt darauf an, dass die Hörer das Wort Gottes so in sich aufnehmen, dass sie es aus ganzem Herzen bejahen und zur bewegenden Kraft ihres Lebens werden lassen (4,2).
c) Vertrauen auf Gott
Alle, die zu Jesus hinschauen und auf seine Stimme hören, können die Treue Gottes und die Größe seiner Verheißung erkennen (4,1; 6,13–20; 10,23). Gott ist zuverlässig; er steht zu seinem Wort; man kann sich auf ihn verlassen (11,11). Was er einmal versprochen hat, wird er auch vollbringen; was er geschworen hat, wird ihn nicht reuen (3,18; 4,3–11; 6,13–20; 7,20f.).
Das Problem ist freilich, dass dieser Heilswille Gottes keineswegs ohne Weiteres plausibel ist und dass ihm die gegenwärtige Lebenserfahrung der Gemeinde, an die der Hebräerbrief adressiert ist, sogar zu widersprechen scheint. Das Vertrauen auf die Nähe Gottes ist den Christen fraglich geworden. Es gibt nur einen, der dieses Vertrauen begründen kann: Jesus. Er, der sich selbst erniedrigt hat und der zur Rechten Gottes erhöht worden ist, bürgt dafür, dass Gott sein Vorhaben wahr macht, den Menschen ihre Schuld zu vergeben und sie durch den Tod hindurch in ein neues Leben zu retten. Deshalb müssen die Christen ihren Blick so fest auf Jesus richten, deshalb so genau auf das hören, was Gott durch ihn sagt. Was ihnen an Jesus aufgehen kann, ist das Vertrauen auf Gott, anders gesagt: der Glaube. Am Glauben aber hängt die ganze Hoffnung der Christen.
(1) Glauben im Zeichen der Hoffnung
Der Hebräerbrief redet anders vom Glauben als die anderen Autoren des Neuen Testaments. Zwar weiß er um die Notwendigkeit des rechten Bekenntnisses (4,14; 10,23). Er weiß auch um das Wagnis der Umkehr und den Mut zur Bekehrung (6,1ff.). Aber das steht für ihn nicht im Mittelpunkt der Glaubensthematik – weil hier nicht das Problem liegt, das die Gemeinde zu bewältigen hat. Seine eigene Auffassung von dem, was den Glauben ausmacht, bringt der Autor in 11,1 auf eine kurze Formel. Sie ist freilich heiß umstritten, weil sie vor erhebliche exegetische Probleme stellt. Am besten scheint die Übersetzung:
Glaube heißt, unter dem zu stehen, worauf zu hoffen ist,der Wirklichkeit überführt zu sein, die man nicht sieht.
Was ist gemeint? Das Erste: Der Glaube lebt von der Hoffnung. Sie allein verleiht ihm die nötige Standfestigkeit im Leben. Wer glaubt, setzt auf die transzendente Zukunft, weil er darauf vertraut, dass sich in ihr Gottes Verheißung erfüllen wird, obwohl in der Gegenwart nicht sehr viel dafür spricht. Das Zweite: Der Glaube ist nicht nur eine Reaktion von Menschen; er ist zuerst eine Aktion Gottes. Gott allein bewirkt den Glauben (vgl. 13,9). Wer glaubt, wird von Gott selbst mit der Wirklichkeit des eschatologischen Heilsgeschehens konfrontiert: Er wird sowohl seiner eigenen Schwäche und Bedürftigkeit gewiss als auch der Gnade, die ihm wider alle Erwartung und gegen allen Augenschein geschenkt ist (2,9; 4,16; 10,29; 12,15).
Beide Momente erläutert der Autor anhand einer langen Reihe von Glaubensbeispielen aus der Geschichte Israels (11,4–40). Ob Abel, ob Henoch, ob Noah, ob Abraham und Sara, Isaak und Jakob, Josef und Mose, ob Rahab und die Richter, ob die makkabäischen Märtyrer: Eine ganze »Wolke von Zeugen« (12,1) steht für die Einsicht in die Vergänglichkeit des irdischen Lebens und das Vertrauen auf die Unverbrüchlichkeit der Heilsverheißung Gottes (11,13–16). Mit diesen »Alten« (11,2) sind die Christen zu einer Pilgerschar verbunden – weil Gott »sie nicht ohne uns zur Vollendung führen wollte« (11,40).