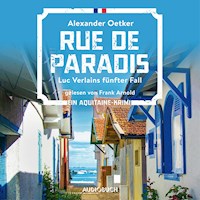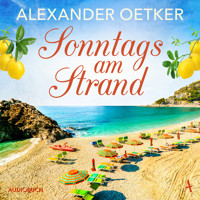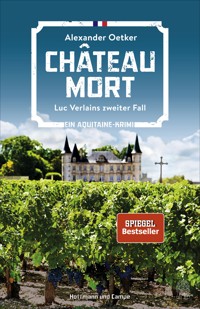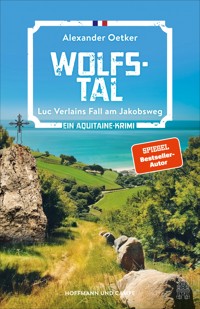10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wird aus der Liebe, wenn die Welt aus den Fugen gerät? Brüssel 2015. François steht im Auge des Taifuns. Als Reporter berichtet er täglich über das Chaos auf unserem Kontinent. Finanzkrise in Griechenland, Flüchtlingsströme quer durch Europa, Terror in Paris. Doch dann begegnet er Agápi, einer aufstrebenden griechischen Beamtin, und plötzlich stellt sich die große Frage: Wie können wir noch lieben in einer Welt, die sich immer schneller dreht? Aus François' Suche nach einer Antwort wird eine Reise zu sich selbst – die in einen ungeheuren Verrat mündet. Der große Gesellschaftsroman des Spiegel-Bestsellerautors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alexander Oetker
Und dann noch die Liebe
Roman
Hoffmann und Campe
»A gentleman will walk
but never run.«
Sting
Später
Ich sehe ihr nach. Langsam und gemächlich geht sie die Dorfstraße entlang, als habe sie alle Zeit der Welt. Vielleicht stimmt das sogar. Es sind nur 150, vielleicht 200 Meter, keine lange Strecke. Doch sie ist 91. Und sie geht so selbstverständlich und den Menschen hinter ihren Fenstern zugewandt, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Ob dieser Gang gebückt ist, spielt keine Rolle, auch nicht, dass sie manchmal kurz innehalten muss. Sie kann jetzt diese Straße entlanglaufen. Sie ist hier. Nach all dem, was sie mir erzählt hat, ist das alles andere als selbstverständlich.
An der Hoftür dreht sie sich noch einmal zu mir um. Ein zurückhaltendes Lächeln, ein Winken, dann verschwindet sie im Garten. Gleich wird sie das Kaffeewasser aufsetzen und den Kuchen aus der Tüte vom Supermarkt ziehen.
Ich habe gesagt, dass ich noch eine Weile hier sitzen will. Es ist ein warmer Tag. Der Verkehr rauscht auf der Bundesstraße vorbei gen Berlin, ich aber sitze im Schatten unter dem Blätterwerk der ausladenden Linde im Sommerwind.
Wir haben wieder so viel gesprochen. Seitdem sie zum ersten Mal von all dem begonnen hat, reden wir viel mehr miteinander. Ich erzähle ihr meine Chosen, die mir spätestens dann bescheuert vorkommen, wenn sie von früher erzählt. Wir sind uns so nah, heute.
Angefangen hat das alles vor ein paar Ewigkeiten, am Ende eines Jahres, das irgendwie alles verändert hat: Deutschland, Europa, mich.
Wenn ich heute auf dieses Jahr zurückblicke, dann kommt es mir vor, als wäre ich eine unbestimmte Zeit lang atemlos durch die Gegend gerannt. Und nicht nur ich – die ganze Welt. Zumindest der Teil der Welt, den ich überblicken kann. Dass dieser Teil nicht sehr groß ist, brauch’ ich wohl nicht zu sagen, auch wenn mir das damals noch nicht richtig klar war.
Es ist wie immer: In dem Moment, in dem etwas Großes passiert, spürst du nicht, dass du dir diesen Moment einprägen solltest. Weil du damit beschäftigt bist, deine eigenen kleinen Probleme zu lösen. Erst hinterher erkennst du, dass diese Begebenheit wirklich historisch war. Wobei dieses Wort so grandios und übermächtig klingt – dabei kann auch eine ganz kleingeistige, miese Nummer historisch sein.
Jetzt, in der großen Retrospektive, wo alle über 2015 reden, Schicksalsjahr, sie sagen es immer wieder, versuchst du, die Elemente dieser Zeit irgendwie zusammenzupuzzeln. Natürlich gelingt das nicht. Weil du das Gefühl von damals nicht mehr herbeizaubern kannst. Diese Atemlosigkeit, dieses Gebanntbeobachten. Du weißt, dass es da war, aber wie es dich in dem Moment angefasst hat, das weißt du nicht mehr.
Es sind nur noch Fragmente, die herausstechen, Leuchttürme vielleicht, in deren Licht dieses Jahr dann entweder besonders grausam oder besonders strahlend dasteht – und die eigene Rolle naturgemäß brutal überzeichnet wird.
Ganz so, als hätte ich die Grenzen geöffnet, die Menschen aus dem Wasser gezogen, die Frau in mein Bett geholt, das marode Land gerettet.
Und nun? Was mache ich mit dieser Erkenntnis, dass man hinterher glaubt, es sei so besonders gewesen, nur weil man selbst dabei war? Heute, wo die Welt wieder unnormal ist, wenn auch aus anderen Gründen. Wieder ist nichts mehr so, wie es vorher war. Weil es schon vorher verrückt war, wir haben es nur nicht gemerkt. Und das Beste: Auch jetzt machen wir einfach genauso weiter wie vorher.
Ich bin verheiratet. Ich bin Workaholic. Jeden Abend presse ich den ganzen Wahnsinn des Tages in anderthalb Minuten und erzähle meinen Zuschauern davon, als sei dieser Bericht die allumfassende Wahrheit.
Ob mich das erfüllt? Ob ich mir selbst glaube? Hey, ich bin Journalist. An dem einen Tag sind wir die vierte Säule der Demokratie. Und am nächsten Tag treiben wir schon wieder eine neue Kuh durchs Dorf, bis sie entweder zur Kuhkönigin wird – oder vom Laster überfahren.
Irgendwann in diesem Schicksalsjahr fangen die Menschen in meinem Land an, uns nicht mehr zu glauben. Nicht alle Menschen. Nur diejenigen, die schon immer Schwierigkeiten mit ihrem Leben hatten. Oder die, die soziale Medien für ihren Freundeskreis halten. Oder die, die generell so ihre liebe Mühe mit der Demokratie haben.
Natürlich sind wir auch selbst daran schuld. Weil wir Fehler machen, weil wir Menschen sind. Kleine Fehler, die all die Kritiker mit dem Finger auf alle zeigen lassen: Seht ihr? Nichts kann man denen glauben.
Und dann gibt es noch ein paar Gesinnungskollegen, die meinen, sie könnten sich doch mit einer Sache gemein machen, die sie für gut halten. Die auf einmal die Seite gewechselt haben – nicht mehr berichten, sondern richten. Sich Bundesverdienstkreuze anstecken lassen von denen, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Aus ihrer Blase auf die ganze Welt schließen, ohne mal wirklich nachgeschaut zu haben, wie das Leben denn ist, im Arbeitsamt in Saarlouis oder Nantes.
Irgendwann in diesem bestimmten Jahr also werden sie anfangen, uns als Lügenpresse zu bezeichnen. Werden sagen, die Kanzlerin oder der Präsident rufen uns morgens an und sagen, was wir berichten sollen. Und dann werden immer mehr Fehler auf unserer Seite für immer größeren Vertrauensverlust sorgen. Alle werden in Panik geraten, weil die Abozahlen einbrechen und die Quoten.
Und dann – und ich weiß das, weil ich es erlebt habe –, viele Jahre später, wird das alles nichts bedeuten. Weil es einfach weitergeht. Weil die, die uns Lügner genannt haben, tot sind oder arm oder bedeutungslos, so bedeutungslos wie vorher. Und weil die Menschen einfach eine Lust haben an Nachrichten, die sie wie Unterhaltung konsumieren können.
Und so werden wir eben Unterhalter sein, Entertainer im großen Spiel, nicht zu unterscheiden von denen am Rednerpult im Bundestag oder in der Assemblée Nationale, die auch nur ins Fernsehen kommen, wenn sie mal einen besonders geilen Witz reißen oder Pippi Langstrumpf singen.
Heute also ist alles wieder normal. So wie vorher. Nur noch ein bisschen nebensächlicher. Weil wir wissen, dass die Umbrüche so groß sein können, wie es vorher keiner für möglich hielt: dass da eine Pandemie kommt, und auf einmal hält die Welt einfach an – und dreht sich dennoch gefühlt noch schneller weiter als vorher. Dass ein Kind mit Größenwahn Präsident ist und alle auf einmal ganz unironisch »Mr. President« sagen, und es passiert dennoch gar nichts Schlimmes, so im Sinne von Atomknopf oder so – und dann wird er abgewählt, und es hat alles nichts bedeutet. Während auf der anderen Seite Dinge, die damals erst ins Bewusstsein gerückt sind, heute einfach noch immer da sind. Wie dieses Lager in Moria auf der griechischen Insel, von dem vorher niemand je gehört hatte – und von dem nach 2015 jeder sprach, weil sie dort die Menschen hielten wie Vieh. Oder anders gesagt: Sie tun das bis heute, nur ist das Lager wieder aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden, es taucht nur noch ab und zu in den Schlagzeilen auf, wenn sich mal wieder ein Flüchtlingskind mit Reinigungsmitteln vergiftet hat, um dem Leid ein Ende zu setzen. Moria ist wie eine alte Operationsnarbe, die nur noch schmerzt, wenn das Wetter schlecht wird.
Wenn ich mit meiner Oma spreche, die 70 Jahre vor unserem Schicksalsjahr ihr ganz eigenes Schicksalsjahr hatte, so wie ganz Europa damals, ein viel tragischeres, schrecklicheres, tödlicheres, aber auch befreiendes, weil die Herrschaft des Schreckens endete, dann weiß ich auf einmal, wie unbedeutend das alles ist. Aber hey, es ist meine Zeit, mein Leben.
Ich stehe von der harten Holzbank auf, die sie gegenüber der kleinen Kirche aufgestellt haben, betrachte das Kreuz am Erker, dann gehe ich die Hauptstraße entlang, grüße die alte Frau, die aus dem Fenster schaut. Wir kennen uns seit Jahrzehnten. So ist das hier. Ich schwitze, weil es immer heißer wird, das Pflaster brennt schon, ein Tag im August, wie ich ihn in Kindertagen immer geliebt habe, weil die Schatten immer länger werden und alles dennoch kein Ende zu nehmen scheint.
Ob ich spüren würde, wenn ein neues Jahr kommt, das wieder zu einer Zäsur wird? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Veränderung, der Umbruch, nie mit einem Knall beginnt. Sondern mit einer leisen Stimmung, die um dich herumschleicht, bis du sie nicht mehr ignorieren kannst. Dann ist es aber meistens schon zu spät.
Bruxelles, Rue de la Loi
2015
Terrorwarnstufe 3.
Das heißt, dass ich hier draußen beim Mann von Securitas meinen Presseausweis zeigen muss. Der funkt dann nach drinnen. Und dann müssen wir beide warten, auf jemanden, der mich abholt, jemanden vom Presseteam, der zu Fuß hinauskommt. Persönlich. Das macht der Pressesprecher an ruhigen Tagen zwanzigmal. Wenn aber Sitzungswoche ist wie heute, dann kann es auch zweihundertfünfzigmal am Tag sein.
Der Rat hat mal wieder seine Sicherheitsvorkehrungen überprüft – und das ist das Ergebnis: Ich bin das Sicherheitsrisiko. Und mit mir etwa 249 andere Kollegen. Nur sind die alle schon drinnen. So stehen wir also hier draußen, der Sicherheitsmann in seinem schwarzen Anzug und ich. Neben den zwei belgischen Soldaten, die diese merkwürdig blassgrüne Tarnkleidung tragen, die stets so verwaschen aussieht, dass man sie nicht recht ernst nehmen kann. In den Händen halten sie ihre riesigen schwarzen Maschinenpistolen, die aussehen wie Maschinengewehre.
Ich habe gelernt, dass ich bei Liveschalten auf dem Sender nie Maschinengewehre sagen kann, ohne dass ein Zuschauer anruft und schreit: »Hat denn der Mann nicht gedient? Das sind Maschinenpistolen.«
Die Menschen haben gerade sehr viel Zeit zum Telefonieren, scheint es.
Wir ungedienten Reporter sind also dazu übergegangen zu erzählen, hier stünden überall Soldaten mit Maschinenpistolen herum.
Diese riesigen schwarzen Dinger jedenfalls baumeln um die Hälse der beiden Soldaten, der eine blond und leicht zerzaust, der andere ein Schwarzer, die Haare kurzgeschoren, beide kaum älter als 20. Sie gucken ganz ernst, das soll abgeklärt wirken, sieht bei ihnen aber nur angestrengt aus, weil sie dabei so jung und unbeholfen wirken, dass ich fragen will, ob ich ihnen beim Tragen helfen kann. Sie müssen hier so viel verteidigen: Brüssel, Belgien, die EU. Und, weil es so schön klingt: auch die Freiheit der zivilisierten Welt. Was, wenn die Innenminister es sagen, ja immer heißt: die westliche Welt. Klare Abgrenzung. So ist die Verkaufe. Und diese zivilisierte Welt, die muss aufstehen gegen den Terror und die Barbaren. Sie erklären uns auch immer, wie wir Europäer gegen die Barbaren aufstehen müssen. Dass wir weiter unbeirrt auf Weihnachtsmärkte gehen müssen, auf Oktoberfeste, in Cafés, auf Einkaufsstraßen. Sonst hätten die Terroristen ja gewonnen.
Selbst wenn wir gar keine Lust auf Weihnachtsmarkt haben, selbst wenn es kalt ist, friert und zieht – wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Draußen auf der Straße. Nebenbei können wir ja auch gleich noch was einkaufen, damit die Krise schnell vorbei ist.
So stehen wir also da, auf der Rue de la Loi, und wer uns sieht, der findet bestimmt, dass wir ein merkwürdiges Quartett abgeben: die Soldaten, der Securitas-Mann, der sichtbar aus dem Maghreb stammt, und der junge Journalist, der ich bin. In ausgebeulten Jeans, abgeschabten Adidas-Turnschuhen, dazu aber das gute weiße Hemd und eine Krawatte. Die minzfarbene heute. Und das Sakko, ein gutes Teil, Hugo Boss. Es stammt aus dem Fundus des Senders.
Oben hui, unten pfui also. Es gilt eben nur, was auf dem Schirm zu sehen ist, und unterhalb des Sakkos bin ich nie zu sehen, für die Fernsehzuschauer jedenfalls. Den Kollegen ist es eh egal, Zeitungskollegen sind zumeist so nachlässig angezogen, als würden sie bloß Wert darauf legen, dass die Geschichte gut ist, so wie Russell Crowe in diesem Film, in dem er einen unbestechlichen Reporter spielt.
Mein Sakko bekommt erste Tropfen ab. Natürlich nieselt es. Es nieselt oft in Belgien. Steter Nieselregen mit kleinen Tempowechseln ist für Belgien so charakteristisch wie der leicht grau verhangene Himmel für Paris oder der krass blaue Himmel für mein Berlin im Mai.
Die Rue de la Loi rauscht auf der Höhe des Europäischen Rates aus dem Tunnel unterm Jubelpark. Das ist keine Straße mehr, es ist eine Autobahn, sechs Spuren in Richtung Innenstadt, dichtgepackt mit Autos, morgens im Stillstand, jetzt am Mittag immerhin in zähem Fluss. Gegenüber steht die Kommission, diese gläserne Niere von einem Gebäude. Nebenan bauen sie auf einem riesigen Areal am neuen Europäischen Rat, es wird ein Konstrukt aus Holz und Glas. Der Sitzungssaal wird einen ganz bunten Teppich bekommen, so habe ich es auf den Plänen gesehen, das wird herrlich: graue Herren vor pink-türkisfarbener Auslegeware, mein Kameramann wird es lieben.
Immer wieder gehen Männer und Frauen am Securitas-Mann vorbei und zeigen ihren Badge. Laissez-passer steht darauf und ihr Name, ihre Abteilung, dazu ihr Foto. Auch sie sind Journalisten, festakkreditierte Journalisten mit Wohnsitz in Brüssel, die dürfen einfach so durch. Die dürfen ohnehin viel. Sie dürfen sogar gratis Zug fahren in ganz Belgien, das ist was. Mir wäre zwar nicht eingefallen, wo ich in Belgien hätte hinfahren wollen, aber die Möglichkeit hat doch was, oder?
Auch die Angestellten des Rates rasen vorbei. Und die Angestellten der Kantine des Rates. Ich aber muss hier warten, auf den Mann aus der Pressestelle. Der Weg ist weit. Das ist der Preis für den Kampf gegen den Terror im EU-Viertel. Zumindest drinnen hinter diesen Mauern.
Die Menschen draußen auf der Straße, der Blumenhändler, die wild diskutierenden Taxifahrer, die schwarze Putzfrau mit ihrem Eimer unterm Arm, sie dagegen sehen ganz schön ungeschützt aus, wie sie durch das riesige leere Quartier eilen, dieses Raumschiff, das hier eines Tages gelandet ist, am Rande von Brüssel, zwischen Flughafen und Königspalast.
Und da sind die Menschen unter uns, in der U-Bahn, die gerade aus dem Bahnhof Schuman abfährt in Richtung Maelbeek, sie sind auch ungeschützt. Was das bedeuten kann, ahnen sie in diesen Tagen noch nicht. Die Anschläge vom März liegen noch vor uns.
Endlich öffnet sich die elektrische Schiebetür und spuckt Davide aus, den kleinen alten Italiener mit dem schütteren Haupthaar, den ich so gerne mag. Er ist also dran heute, die beinahe 500 Meter Fußweg zu bewältigen, und weil Sitzungswoche ist, eben eher zweihundertfünfzig- als zwanzigmal. Ich lache ihn an, er lacht zurück.
»Ciao, come va?«
»Bene«, antwortet er. »Ça va être une longue journée«, fügt er auf Französisch hinzu, er spricht, wie alle, die seit gefühlten 100 Jahren in Brüssel wohnen, alle Sprachen, die es gibt. Er zieht das Gesicht in Falten.
Eine lange Sitzung. Wenn Davide das schon am Beginn eines Tages ankündigt, dann wird es nicht nur eine lange, sondern eine schier endlose Sitzung, die bis morgen früh dauert.
»Na, aber mit deinem Transferdienst heute wird es dir wenigstens nicht langweilig.«
Er grinst, rollt mit den Augen.
Nun machen wir den restlichen Weg zusammen. Die Soldaten und der Securitas-Mann treten auf die Seite, die elektrische Schiebetür surrt, und dann höre ich schon das Piepen der Metalldetektoren und der Röntgenmaschinen. Sicherheitsschleuse. Davide schlüpft durch die Tür, er muss diese Prozedur nicht mitmachen.
»Bonjour«, begrüße ich die beiden Sicherheitsmänner an der Schleuse und lasse mich durchleuchten. Nach weiteren zwei Minuten – mein Schlüsselbund steckte doch noch in der Jeans – betrete ich die große Halle mit dem gläsernen Dach, ein leeres Ungetüm, das wie das Innere dieses Raumschiffs aussieht, das Europa ist.
Roter Stein, der aussieht wie blutender Marmor, braune, riesige Fliesen auf dem Boden und Balkone rund um die Halle, noch sind sie leer, noch stehen da keine Reporter, keine Kameras, sind da keine Lichter. Nur die Eurovision hat für die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon ihre Schaltposition aufgebaut.
Wir laufen in Richtung Haupttür. Darüber die Fahnen aller europäischen Mitgliedsstaaten und das spezielle Logo des Staates, der in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Derzeit ist das Lettland, ein recht einfallsloses Logo aus zusammengesetzten Buchstaben. Zypern hatte mal eine stilisierte Kogge aufgebaut, und irgendein Land hatte den Boden beklebt mit illustrierten Füßen, auf die man die eigenen setzen konnte und dann wie auf dem Schulhof hin- und herspringen. Das war lustig, es hatte nur nichts mit dem Land zu tun, für das das Logo stand, weswegen ich vergessen habe, welches es war.
Wieder surrt eine Tür, diesmal eine Drehtür, wir treten hindurch, dann winkt mir Davide zu, ruft »Ciao, caro«, bis später, ein kurzer Abschied, man grinst sich wissend an, wir werden einander noch oft sehen an diesem Tag. Oft und lange. Bis morgen früh wahrscheinlich. So ist das, wenn sich die EU-Finanzminister treffen. Es geht um Griechenland. Wieder einmal. Wie seit mittlerweile so vielen Jahren.
Im Atrium ein Glaskasten. So unwirklich, dieser Glanz des Goldes. So ungewöhnlich wie die Umgebung. Ich stehe vorm Friedensnobelpreis. Genauer: der Medaille des Nobelpreiskomitees für die Europäische Union. Der Rat hat sie hier in den Flur stellen lassen, in diesen zugigen Durchgang, in einen Glaskasten, der, so scheint es, als einziges Objekt im ganzen Gebäude regelmäßig geputzt wird. Daneben stehen der Geldautomat und der Infopoint.
Da liegt sie nun auf einem roten Kissen, diese goldene Münze, umgeben von Sicherheitsglas. Der weltwichtigste Preis für Frieden und Verständigung. Der eine Anerkennung sein soll, aber irgendwie immer mehr zur Bürde wird. So wie bei Obama. Der konnte nach dem Preis auch nichts mehr richtig machen. Bisschen Krieg hier, mal schnell Bin Laden umlegen. Und Guantánamo ist immer noch da.
Ja, Europa ist der Garant für Frieden auf dem Kontinent. Nun schon so viele Jahre. Doch mittlerweile ist es eine Union, in der sich viele alte Männer und wenige junge Frauen die Köpfe einschlagen, heute Abend wird es wieder so sein, auf dieser Sitzung, der Anlass ist die Frage, ob ein Land seinen Rentnern nochmals die Notrente kürzen kann. Eine Union, die es vermeidet, den Schwachen Kohle zu leihen, weil die Reichen, die ständig von den Schwachen profitieren, die Kohle nicht rausrücken wollen. Eine Union, die dafür den Banken Milliardenbürgschaften gibt, weil die ja systemrelevant sind. Eine Union, die ein Gesetz verabschiedet, das alle Flüchtlinge da lassen will, wo sie anlanden, in zweien der ärmsten Länder der EU. Eine Union, die sich gegen Terror schützt, indem ein Italiener einen Deutsch-Franzosen zu Fuß abholt, um ihn ins Ratsgebäude zu lassen.
Das ist mein Alltag. Das ist Bruxelles.
Eurogroup
2015
Im Pressezentrum herrscht gähnende Leere. Die Bar ist noch geschlossen, sie wird erst um sechzehn Uhr wieder aufmachen. Café d’Autriche heißt sie, was genau genommen eine Unverschämtheit ist. Hier sieht es eben nicht aus wie im Wiener Kaffeehaus, sondern wie in einer bulgarischen Kantine. Obwohl ich damit auch in Sofia niemandem zu nahetreten will. Weiße Pappwände vor schmutzigen Fenstern, die hinausführen auf die Rue Froissart. Dazu dieser hölzerne Tresen, garniert mit Pappbechern, schmutzigen Tassen und Sandwiches in Plastikfolien.
»Kannste eijnen mit todslagen«, sagt mein belgischer Kameramann immer im schönsten flämisch-deutschen Singsang über diese Baguettekracher mit Analogkäse und Alibisalat.
Hinterm Tresen wischt ein Mann mit weißer Haube die Kaffeemaschine sauber. Sie wird heute Nacht trotz des profanen Geschmacks der braunen Brühe, die sie ausspuckt, wieder das meistgenutzte Gerät sein. An den Arbeitsplätzen um die Ecke sitzen schon einige Printkollegen, starren unverwandt auf ihre Laptops und tippen die ersten Vorausschauen zur Zukunft Griechenlands. Ich frage mich immer, woher diese Leute zu dieser frühen Stunde ihre Informationen haben. Ich bin schon froh, am Morgen nicht den Thalys von Paris verpasst zu haben.
Ich nicke einigen Kollegen zu, die ich vom Sehen kenne, dort hinten sitzt der spanische Block. Das sind bekanntermaßen die lautesten Kollegen hier, ich versuche also, mich weit entfernt von ihnen zu platzieren. Vielleicht reden Spanier gar nicht sonderlich laut, die Sprache ist nur sehr kehlig.
Ich stelle meine Tasche ab, öffne den Laptop und lasse alles auf dem kleinen Schreibtisch in der Ecke stehen, in der ich immer sitze. Sorgen, egal welche, sind hier unbegründet. In dieser europäischen Blase geschieht nix: kein Diebstahl, kein Terror, keine Durchbrüche bei Verhandlungen.
Wieder an der Bar vorbei, gehe ich die zwei Treppen hinunter, vorbei an den nationalen Briefingräumen, wo nachher der litauische Finanzminister den zwei Journalisten der litauischen Zeitung erklären wird, warum die Griechen nicht weiter sparen wollen, dass sie es aber ganz dringend tun müssen. Daneben der Briefingraum von Estland. Die reichen Länder haben ihre großen Räume im Untergeschoss des Rates.
Da werde ich nachher meinen Finanzministern lauschen, dem deutschen und dem französischen. Nach der Sitzung. Das heißt: morgen früh.
Unten angekommen, in diesen Katakomben mit Allzweckteppich und willkürlich ausgesuchten Fotos von alten Staats- und Regierungschefs – von Mitterand über Schröder bis Tusk hängen sie alle hier –, sind es noch zwei Türen. Dann steht da die Kamerameute, die sich schon aufgebaut hat für die Vorfahrt der Finanzminister.
Ich finde meinen Kameramann Roland und den Tonassistenten, wie heißt er noch gleich? Wim? Tom? Ich komme immer mit den flämischen Namen durcheinander. Wir begrüßen einander mit einer flachen Umarmung, die beiden haben einen guten Platz im Pulk der Medienvertreter, schön mittig, es ist die Position, die sie am Mittag eingenommen haben und die sie nicht verlieren dürfen, sie brauchen schließlich einen guten Blick aufs Geschehen. Neben ihnen stehen die Kameras der deutschen Kollegen, ARD, ZDF, RTL, auf der anderen Seite der ORF.
Nun heißt es: warten. Mein Buch liegt oben im Rucksack. Das Rauchen habe ich vor zwei Wochen drangegeben. Und die Café-Bar ist noch geschlossen. Wahnsinnsaussichten.
Ich nehme mein iPhone. Twitter habe ich vorhin im Taxi stur durchgesehen, mitten in einer Tirade des Fahrers über die Unverfrorenheit der Smart-Fahrerin neben ihm, die er selbst gerade fast auf den Seitenstreifen gedrängt hatte. Die zwei Minuten hatten gereicht, um meinen Account aufs gründlichste zu prüfen. Mit dem Hashtag #Greece kamen einige Tweets zur aktuellen Finanzlage. Vorwürfe von konservativen Parlamentariern an Griechenland. Noch mehr Vorwürfe von linken Abgeordneten an die konservativen Parlamentarier wegen ihrer Erpressung der armen Griechen. Die Tweets waren so austausch- wie wiederholbar. Ich wusste ganz genau, wer was schrieb und wie lange sich die Entrüstung darüber halten würde. Meist ebbte die Aufregung in Stundenfrist wieder ab. Nur Holocaustvergleiche hielten sich länger.
Blieben nur noch Facebook und Tinder. Tinder ist schwierig hier im Pulk. Niemand will dabei erwischt werden, wie er Frauenfotos auf seinem Handy hin- und herwischt, während all die anderen Kollegen Google zur Finanztransaktionssteuer befragen. Blieb Facebook.
Da klingelte es glücklicherweise.
»Salut, hier ist Paris, du bist in Brüssel?«
Der Chef vom Dienst meines Senders am anderen Ende weiß das ganz genau, er hat es auf der Dispo der Planung gesehen und hätte andernfalls gar nicht angerufen. Doch durch unsinniges Nachfragen kriegt man seinen Tag auch rum.
»Ja, bei der Eurogruppe.«
»Gut. Du, sag mal, was wirst du uns denn sagen können? Werden die Griechen endlich liefern?«
»Die Minister kommen gleich hier an, dann schauen wir mal. Viel kann man vorher nie sagen.«
Das galt immer. Was sollte man denn nachher erzählen, wenn die Sitzung gerade begonnen hatte? Gespanntes Schweigen am anderen Ende. Genau für zwei Sekunden. Dann das, was immer passierte.
»Dann machen wir auf jeden Fall eine 18-Uhr-Schalte, eine 19-Uhr-Schalte und dann noch mal um 22 und um 23 Uhr, dann wissen wir bestimmt mehr. Wird’s denn lange dauern?«
Ich weiß, dass es lange dauern wird, was ich nicht weiß, ist, ob ich Lust habe, diese Nervensäge mit meinem Wissen zu konfrontieren.
»Mal sehen. Schalten hab ich notiert. Bis nachher.«
Ich lege auf und knurre. Dort vorne stehen die österreichische Kollegin und ihr ungarischer Liebhaber und rauchen. Jeder weiß hier viel von jedem. Es ist ein kleiner Kosmos. Mir fehlen meine Zigaretten. In Brüssel ist Abstinenz immer doppelt so schwer. Weil sinnarme Dinge wie Rauchen sinnlosen Dingen wie Eurogruppensitzungen zumindest ein bisschen Sinn geben.
Eine schwarze Limousine mit belgischem Diplomatenkennzeichen rumpelt über das metallische Sicherheitsgitter, ein Audi A8. Die hintere Tür öffnet sich und der EU-Währungskommissar steigt aus. Sofort brüllen die Kollegen los, »Monsieur!«, »Sir!«, und so weiter.
Der Mann stammt aus meiner zweiten Heimat, und ich kenne ihn leidlich, stehe aber ganz gut, deshalb bitte ich ihn ein wenig leiser als die anderen und auf Französisch um ein kurzes Statement. Natürlich bleibt er stehen, dieser Mann bleibt immer stehen. Er kommt immer als Erster und will stets ins Fernsehen. Stirnglatze, tiefe Augenringe, unsteter Blick. Der nun in unsere Kamera fällt.
»Es werden lange und harte Verhandlungen. Aber ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden. Die Zeit ist reif für eine Lösung, und beide Seiten haben das erkannt. Der richtige Weg für Griechenland ist ein gemeinsamer Weg mit Europa, und wir werden eine Lösung finden.«
Optimistisch. Der Mann ist immer optimistisch. Dreimal das Wort Lösung. Dabei will man ihm so gerne zurufen: »Du bist zuversichtlich? Dann sag das mal deinem Gesicht!«
Ich danke ihm, und er geht ab, um vor der Kamera der Briten im Gebäude das Gleiche noch mal auf Englisch zu wiederholen. »I am very optimistic that we can find a solution today.« Sein Optimismus wird sich in den Nachrichtenmeldungen der nächsten Minuten gerade so lange halten, bis der deutsche Finanzminister auftaucht und sagt, dass er gar nicht mal so optimistisch ist. Es ist wie ein großes Theaterstück, in dem das Skript streng eingehalten wird, die Rollen klar verteilt sind und die Tragödie immer erst dann beginnt, wenn der Vorhang fällt.
Ich gehe ein bisschen aus dem Pulk heraus in Richtung Raucherecke und öffne Tinder. Die App fährt hoch, schon erscheint das erste Gesicht. Eines, das mir herrlich unbekannt vorkommt. Ich lächle. Darauf hab ich mich schon den ganzen Flug über gefreut. In Berlin und Paris, da ploppen auf Tinder immer dieselben Frauen auf, weil ich den Suchumkreis so eng eingestellt habe – ich scheue lange Anfahrtswege. Hier in Brüssel bin ich aber nur einmal im Monat, und hier gibt es eine hohe Fluktuation an Praktikantinnen und Volontärinnen und Referentinnen aus allen Ländern, und alle sind so einsam, wie ich es bin.
Eine blonde Frau lächelt mich auf dem Bildschirm an, sie sieht gut aus, ihr Gesicht ist schön, sie hat Sommersprossen, rote Wangen, ich denke, sie ist Holländerin, irgendetwas stört mich, ich kann nicht ausmachen, was es ist, ich zögere, dann wische ich nach links. Die Nächste ist eine Brünette, das Foto sieht sehr gestellt aus, sie hat ein Glas Champagner in der Hand, dahinter ein Sonnenuntergang, irgendwie versinkt alles im Dunkel, dennoch wische ich nach rechts. Es sieht nach Südfrankreich aus, meine Sehnsucht springt an. Einen Versuch ist es wert. Dabei sieht sie aus, als würde sie sich sicher nicht melden. Die folgenden Fotos sind ein europäisches Potpourri. Eine Spanierin auf einem Pferd. Wusch, nach links. Eine blonde Frau, sicher eine Schwedin oder eine Dänin? Sie trägt einen Bikini und steht bis zum Nabel im Meer. Wusch, nach rechts. Eine große Schwarze, die Haare kurzgeschoren, niemals matcht sie mit mir, aber sie macht mich an. Wusch, nach rechts. Dann ein Gesicht, das mir einfährt. Eine Frau, die ich nicht einschätzen kann. Ist sie 25? 21? 31? Eine Portugiesin? Eine Spanierin? Dunkle Locken, lange Haare, tiefbraune Augen, kein Lächeln, nur ein interessierter Blick, als suche sie etwas in der Kamera. Nur sie ist auf dem Foto zu sehen, kein Sonnenuntergang, kein Champagnerglas, kein Pferd. Nur sie. Wusch. Nach rechts.
In diesem Moment hält der deutsche Finanzminister mit seiner riesigen grauen S-Klasse vor den Kameras. Ein kurzer Moment, denn er braucht die Zeit, von Bodyguards abgeschirmt aus seinem Auto zu steigen. Dann rollt er an uns vorbei ins Gebäude, um sein Statement abzugeben. Ich renne hinterher. Drinnen sind Kamerateams des deutschen Fernsehens aufgebaut, um den Minister interviewen zu können. Ich komme gerade rechtzeitig, um den alten Herrn noch sagen zu hören:
»… Griechenland doch nichts geliefert. Wenn ich mit meinen Kollegen hier spreche, dann wissen wir alle nicht, was Griechenland eigentlich will. Wollen sie drinbleiben? Wollen sie raus? Wir wissen es nicht. Ich bin jedenfalls nicht sehr optimistisch, aber nun müssen wir abwarten.«
Es hagelt Nachfragen. Er wischt sie weg, indem er sein typisches Haifischgrinsen aufsetzt und einfach abfährt, in Richtung Sitzungssaal.
»Nun müssen wir erst mal reden, nachher sehen wir uns wieder«, sagt er, während er uns schon den Rücken zuwendet. Wow, was für eine Überraschung. Zwei Fronten bei den Finanzministern. Genau wie bei der letzten Sitzung. Und der davor. Ein Riss geht durch den Kontinent. Nord und Süd. Reich und Arm. Geber und Nehmer. Das wird wahnsinnig aufregend, darüber zu berichten. Die Zuschauer daheim in Calais, Nizza oder Clermont-Ferrand werden nach der 18-Uhr-Schalte so klug sein wie vorher. Und ihnen wird die griechische Tragödie noch mehr zum Hals raushängen, weil sich nichts bewegt, weil alle nur streiten.
Wer fehlt noch? Ach ja, der Grieche.
Bevor ich Tinder wieder öffnen kann, hält draußen der schwarze VW-Bus, der die griechische Delegation ausspuckt. Als Zeichen der Sparsamkeit wahrscheinlich, alle anderen Länder kommen schließlich im Mercedes oder BMW. Heute ist der erste Auftritt des neuen griechischen Finanzministers. Sein Vorgänger kam immer ohne Krawatte, er hat eine scharfe Ehefrau und fährt daheim in Athen Motorrad, früher auch ohne Helm. Das mochten die anderen Finanzminister gar nicht: Mit so einem Rüpel wollten sie nicht verhandeln, und dann hielt er ihnen auch noch Vorträge über finanztheoretische Zusammenhänge. Also haben sie ihm das Leben so lange schwergemacht, bis der Mann sein Amt entnervt aufgab. Demokratie in Zeiten der Krise. Brüssel entscheidet, wer wo Minister sein darf und wer nicht.
Nun also steigt der neue Finanzminister aus, auch er trägt keine Krawatte, aber einen grauen Wollpullover unter einem schlichten Sakko. Er sieht nett aus und ungefährlich, biegsam eher, wie ein freundlicher Großvater. Mit dem können die anderen bestimmt gut verhandeln. Der kleine Mann mit den dunklen Haaren stellt sich vor die Kameras.
»Guten Tag, meine Damen und Herren«, beginnt er in holprigem, aber verständlichem Englisch. »Wir haben eine sehr schwierige Situation. Die Spareinschnitte, die wir bereits unter meinem Vorgänger durchgeführt haben, bringen unser Land mit jedem Tag näher an den Rand einer Katastrophe. Dennoch wollen wir mit der EU und den Gläubigern zusammenarbeiten. Wir sind bereit …«
Ich schweife ab, meine Augen wandern umher, als würden sie von etwas angezogen. Oder von jemandem. Sie bleiben an einem anderen Augenpaar hängen. Neben dem Finanzminister, seinem Leibwächter und dem alten Pressesprecher steht eine Frau. Es ist die Frau von eben. Die Frau von Tinder. Die Frau mit den irrsinnig dunklen Augen. Sie schaut unverwandt nach vorn auf die Wand aus Kameras. Ich beobachte ihren leicht gespannten Blick, ihre sanften Züge, sehe, wie sie mit ihrem rechten aufgestellten Fuß leicht wippt. Die Bewegung ihrer Hüfte und ihres Beines. Ich hebe den Blick, unsere Augen treffen sich. Mist, verdammter! Sie hat bemerkt, dass ich sie beobachte. Ich zucke zusammen. Sie schaut mich an, guckt fragend und lächelt ganz kurz, vielleicht den Bruchteil einer Sekunde. Habe ich zu doll gestarrt, dass sie so direkt reagiert? Ich lächle zurück, der Moment entgleitet mir, ich kann sogar spüren, wie er mir entgleitet, weil ich weiß, dass ich keine Zeit habe, gleich ist sie weg, und so zwinkere ich einmal mit dem rechten Auge. Und will mich sofort ohrfeigen. So ein Mist. Zwinkern. Was für eine bescheuerte Idee. Was ist nur in mich gefahren?
Und dann ist der Moment vorbei. Der Minister kommt zum Schluss.
»… bin ich voller Hoffnung. Vielen Dank. Efaristo.«
Er geht ab, sie dreht sich weg und folgt ihm. Eine Griechin. Mein Zutrauen in meine Tinder-Schätzfähigkeiten schwindet.
Ich schaue auf die Uhr. Mist. Doppelmist. Ich spurte los, nehme zwei Stufen auf einmal und renne nun Richtung Balkon.
17:54