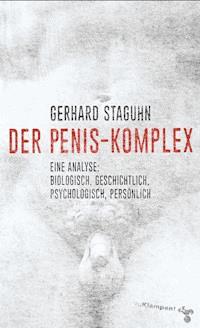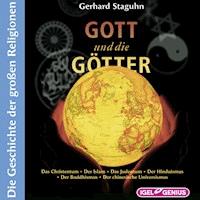Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Woher kommt die große Bedeutung, die wir dem Haar beimessen? Warum werden Achselhaare abrasiert, Kopfhaare dagegen gehegt und gepflegt? Warum stehen lange Kopfhaare bei Frauen für Weiblichkeit, Schambehaarung ist jedoch ein Tabu? Gibt es etwas, das gleichzeitig so erotisch und so abstoßend ist wie das menschliche Haar? Sehen wir Haare heute anders als früher? Was ist das Rapunzel-Syndrom? Und was können uns der »blonde Engel« und die »graue Maus« über Klischees erzählen? Das menschliche Haar kann faszinieren und bannen, ob einzeln, als Bart oder Schopf. Symbolisch verweisen Haare auf das Besitzen oder den Verlust von Macht und Stärke. Im Mythos spielen sie ebenso eine Rolle wie in der Religion, zu allen Zeiten besaß das Haar Strahl- und Aussagekraft, und nicht erst seit Freud steht es für den Spiegel der Seele und ist Objekt von Fetischismus. Gerhard Staguhn analysiert diese ambivalente Beziehung des Menschen zu seinem Haar aus biologischer, kultureller und psychoanalytischer Perspektive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Staguhn
Und ewig lockt das Haar
Was es bedeutet, wie es wächstund warum es uns so anzieht
Dieses Werk wurde vermittelt durch
Schoneburg. Literaturagentur und Autorenberatung, Berlin.
© 2019 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe · zuklampen.de
Satz: Germano Wallmann · Gronau · geisterwort.de
Umschlaggestaltung: © Stefan Hilden · München · hildendesign.de
Bildmotiv: © HildenDesign unter Verwendung eines Motivs von shutterstock.com
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
ISBN 978-3-86674-733-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
1.Kapitel: Die Biologie des Haars
Der Mensch und sein Restfell
Die Biologie des Haars
Unser haariges Erbe
Die Farbe des Haars
Das Haar als Kraftsymbol
2.Kapitel: Haar-Mythen
Die Ambivalenz des Frauenhaars
Göttliches Männerhaar
Märchenhaftes Frauenhaar
Simson, der tragische Haar-Held
3.Kapitel: Die Religion und das Haar
Die haarigen Männer des Alten Testaments
Die Heilige mit dem Fell: Maria Magdalena
Das Frauenhaar als religiöses Skandalon
Das spezielle Problem des Islam mit dem Haar der Frau
Die Verschleierung der Geschlechterspannung
Das »Goldene Zeitalter« des Islam
4.Kapitel: Eine kurze Geschichte der Frisur
Die Frisur in den frühen Hochkulturen
Die Frisur bei den alten Griechen, Römern und Germanen
Die Frisuren des Mittelalters und der Renaissance
Die Barockfrisuren
Frisuren der Bürgerlichkeit
Handwerker des Haars
5.Kapitel: Das Haar in der Kunst
Das Haar im Werk Gustave Courbets
Die haarige Wahrheit desUrsprungs der Welt
Das Haar in der Dichtkunst
6.Kapitel: Psychologie und Eros des Haars
Graue Maus und blonder Engel
Das Haar als Spiegel der Seele
Der männliche Haarfetischist
Der Eros von Samt und Seide, von Pelz und Leder
Haarliebe
Verzeichnis der verwendeten Bücher
Über den Autor
Weitere Bücher
Einleitung
Ein einzelnes Haar ist fast nichts: ein fadenförmiges Horngebilde. Es ist Teil unseres Körpers, ohne diesem gänzlich verhaftet zu sein. Beizeiten löst es sich einfach von ihm ab und liegt, mehr oder weniger störend, irgendwo herum. Als winziger, luftiger Körperteil strebt es wachsend von uns fort und setzt sich dadurch in einen direkten Bezug zur uns umgebenden Welt; es korrespondiert mit ihr. Darin ist es unseren Händen wesensverwandt.
Hier denkt man unwillkürlich an die symbolische Darstellung des altägyptischen Sonnengottes Aton in Gestalt einer goldenen Sonnenscheibe, deren Haarstrahlen mit kleinen Händen versehen sind. Auch unser Haar – als Abkömmling unserer Haut – besitzt unsichtbare Hände von feinstofflicher Qualität. Man kann ohne Übertreibung von einem Tastsinn des Haars sprechen. Das Haar ist ein Sinnesorgan. Davon rührt die elektrisierende Intimität, wenn wir, mit Absicht oder ungewollt, das Haar eines fremden Menschen berühren. Solche Berührungen sind von starker sinnlicher, um nicht zu sagen: erotischer Qualität. Selbst wenn es nur der Wind ist, der sich im Haar verfängt und mit ihm spielt, liegt sofort ein zarter Eroszauber in der Luft.
Sieht man hingegen ein einzelnes Haar irgendwo herumliegen, weckt es augenblicklich einen starken Widerwillen. Dieser kann sich bis zum Ekel steigern, zumal wenn wir wissen, dass es sich um das Haar eines Fremden handelt. Von Eros keine Spur. Vielmehr evoziert es eine Art von negativer Intimität, von der man nicht behelligt werden möchte. Ein fremdes Haar stört nicht nur in der Suppe, es stört überall. Ganz besonders stört es im Bett und im Badezimmer – in dem Maße, wie es sich dabei um sehr intime Orte handelt. Jeder kennt den Anflug von Ekel beim Anblick eines borstigen, obszön sich kräuselnden Schamhaars, das ein vorheriger Gast in der Hotelzimmerdusche hinterlassen hat als abstoßendes Überbleibsel seiner nackten Körperlichkeit. Dann sind wir geneigt, auf der Stelle das Hotel zu wechseln.
Aber wieso ekeln wir uns vor solitären Haaren? Zögerlich stellt sich bei dieser Frage der Gedanke ein, dass uns das einzelne, vom Körper abgelöste Haar unbewusst an den Tod gemahnt. Vielleicht liegt es daran, dass von den Toten – neben den Knochen – am längsten deren Haar überdauert. Und auch die Ähnlichkeit eines Haars mit einem Stück Faden – dem abgetrennten Lebensfaden – lässt eine Beziehung zum Tod nicht völlig abwegig erscheinen. So hat auch der Faden der Spinne, ja der Spinnfaden schlechthin, einen starken mythischen Bezug zu unserer begrenzten Lebensfrist. Die Moirai, die Schicksalsgöttinnen des griechischen Mythos, drei an der Zahl, werden uns als mächtige Spinnerinnen vorgestellt. Aus dem verhauchten Silbervlies des Mondlichts spinnen sie den unsichtbaren Lebensfaden eines jeden Neugeborenen. Die Moirai allein bestimmen seine Länge. Auch die obersten Götter vermögen daran nichts mehr zu ändern.
Abgelöste Haare gehören, den Moirai-Fäden der Spinne gleich, in die Sphäre des Todes. Die zarten, im Spätherbst überall herumfliegenden Spinnweben, nicht umsonst auch »Marienhaar« genannt, künden vom nahenden Winter und sind deshalb geeignet, uns melancholisch zu stimmen. »Der Menschen Leben ist wie Spinnenweben«, wusste schon der katholische Prediger Abraham a Sancta Clara (1644–1709). Man könnte auch sagen: Der Menschen Leben ist wie Haar. Und der Menschen Leben ist wie Gras. Haar und Gras sind einander wesensverwandt.
Doch der Vergänglichkeitsaspekt des einzelnen Haars ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt – wer wollte das leugnen! – auch noch des Haares pralle Lebensseite. Sie steht für die Sinnlichkeit und Fülle des Daseins. Doch dabei geht es nicht mehr ums einzelne Haar, sondern um die glänzende Haarpracht, die einen Menschenkopf im Idealfall schmückt. Glänzen muss dieses Haar, denn Glanz und Fülle verheißen Gesundheit und Vitalität. Dieses göttliche Geschenk, das die Natur vor allem den Frauen gewährt – freilich nicht allen –, verweist auf die Liebesgöttin selbst. Aphrodite/Venus vermag man sich kaum anders als mit goldglänzendem, wallendem, fast bis zum Boden reichendem Blondhaar vorzustellen. Schönes Frauenhaar verkörpert die weibliche Erosmacht schlechthin. Jede Frau, die solches Haar ihr Eigen nennt, weiß um diese Macht und setzt sie – bewusst oder unbewusst – im koketten Werbungsspiel ein.
Und so erweist sich das Haar schon bei einer ersten flüchtigen Reflexion als ein ambivalentes Ding. Es besitzt Faszinations- und Bannkraft sowohl im anziehenden als auch im abstoßenden Sinn. Es spannt sich von den Abgründen des Hässlichen bis zu den höchsten Sphären des Schönen und Erhabenen. Oder konkret: vom ekligen Haarbüschel im Abflusssieb der Dusche bis in die Unendlichkeit des nächtlichen Firmaments. Dort findet man während der Frühlingsmonate, hoch an den südlichen Himmel gesetzt, ein unscheinbares, aber gerade deshalb so reizendes Sternbild mit Namen »Haar der Berenike«. Es wird aus nur drei schwach leuchtenden Sternen gebildet, die zwischen den markanten Sternbildern »Löwe« und »Bootes« gelegen sind. Berenike, so erzählt die Legende, war die Gemahlin des ägyptischen Pharaos Ptolemäus III. Das Königspaar lebte in der Zeit der Diadochenreiche zur Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Als der Pharao in den Dritten Syrischen Krieg zog, versprach Berenike, sie werde ihr unvergleichlich schönes Haar der Liebesgöttin opfern, sollte ihr Gatte siegreich aus dem Krieg zurückkehren. Er kehrte zurück. Also schnitt sie sich, wie versprochen, das Haar ab und brachte es im Tempel der Aphrodite zum Opfer dar. Am nächsten Tag war es von dort verschwunden. Der Hofastronom wusste seiner Profession gemäß, wo er nach ihm zu suchen hatte: Er fand, seiner blühenden Fantasie gehorchend, den königlichen Haarschopf im Gewirr der Sterne. Die Liebesgöttin hatte ihn, von seinem göttlichen Liebreiz beeindruckt, als Sternbild verewigt. Der Preis für diese Art von Unsterblichkeit war für Berenike freilich gering: Geschnittenes Haar wächst wieder nach – pro Tag um einen halben Millimeter.
Erstes Kapitel
Die Biologie des Haars
In seiner körperlichen Erscheinung unterscheidet sich der Mensch von den anderen Primaten, denen er zoologisch zugeordnet wird, vor allem durch den aufrechten Gang und eine nur noch in Resten vorhandene Körperbehaarung. Der Mensch ist das einzige unter den Herrentieren, dem das Fell bis auf bescheidene Reste abhandengekommen ist. Dieser Verlust ist letztlich seiner Intelligenz und der damit verbundenen Lebensweise geschuldet. Im menschlichen Zivilisationsprozess der vergangenen etwa 100.000 Jahre hat sich der moderne Mensch (Homo sapiens) als Kulturwesen von den Tieren abgehoben und über sie erhoben.
Streng genommen ist das soeben Gesagte nicht ganz richtig: Homo sapiens hatte nie ein Fell, und somit kann es ihm auch nicht abhandengekommen sein. Die Frühformen der Gattung Homo, etwa Homo habilis (»geschickter Mensch«), die vor etwa 2,5 Millionen Jahren in Ostafrika gelebt haben und die ersten Werkzeugbastler gewesen sein sollen, waren vermutlich noch stark behaart. Doch ein zusammenhängendes Fell, wie es der Frühmensch Australopithecus vor drei bis vier Millionen Jahren noch besaß, hatten vermutlich auch sie nicht mehr. Daraus sollte man allerdings nicht den falschen Schluss ziehen, dass der Mensch vom Affen abstammt, wie es das griechische Wort pithecus (=Affe) nahezulegen scheint. Vielmehr ist es so, dass Mensch und Affe einen gemeinsamen Vorfahren haben. Dieser lebte vermutlich vor sechs bis sieben Millionen Jahren in Afrika und dürfte sich in Aussehen und Verhalten nicht nur vom Menschen, sondern ebenso von unserem nächsten Verwandten, dem heutigen Schimpansen, stark unterschieden haben.
Nun ist das Fell, das der Mensch entbehrt, gewiss nicht das wichtigste physiognomische Merkmal, das ihn von den Menschenaffen unterscheidet. Viel wichtiger sind die Unterschiede im Körperbau. Diese haben den aufrechten Gang des Menschen als buchstäblich herausragende Besonderheit dieses »Säugetiers« erst ermöglicht. Dabei wissen wir gar nicht, was den aufrechten Gang beim Frühmenschen überhaupt bewirkt hat. Es wird wohl ein komplexes Wechselspiel aus Ursachen und Wirkungen während langer Zeiträume gewesen sein, basierend auf der Leistung eines besonders großen Gehirns.
Aber wieso haben die Homo-Arten in ihrer Millionen Jahre währenden Evolution, bei der am Ende nur Homo sapiens übrig geblieben ist, ihr Fellkleid verloren? Die Erforscher der menschlichen Evolution vermuten, dass unsere menschenaffenähnlichen Vorfahren ihr Haarkleid nach und nach eingebüßt haben, als sie die offenen Savannenlandschaften Ostafrikas, die als die »Wiege der Menschheit« gelten, zu besiedeln begannen. Oder anders ausgedrückt: Die Möglichkeit einer aufrecht gehenden Gattung Homo bot sich in der Evolution erst von dem Moment an, da der Uraffe, warum auch immer, die schattigen Bäume verlassen hatte und in die offene Savanne vorgedrungen war – ein Prozess, der sich über Millionen von Jahren hingezogen hat. In der baumarmen Savanne aber drohte wegen der großen Hitze die Gefahr eines Hitzschlags. Das »affige« Fell war nicht nur nutzlos, sondern zu einem Hindernis geworden. Ohne Fell konnte der frühmenschliche Organismus seine Körpertemperatur viel besser regulieren. In der weiteren Entwicklung zum Homo sapiens hatte die Zahl der Schweißdrüsen bei immer dünner werdendem Haarkleid allmählich zugenommen. Denn Schweiß kann auf der Körperoberfläche umso schneller verdunsten – und dabei seine kühlende Wirkung entfalten –, je geringer die Körperbehaarung ist. Im Idealfall fehlt sie ganz.
Doch im Zuge der letzten Eiszeit, die vor etwa 100.000 Jahren auf unserem Planeten eingesetzt hatte, wurden wärmende Felle für Homo sapiens zum überlebenswichtigen Gut. Und so schuf er sich die Urform der Bekleidung, indem er das Naheliegende tat: Er nahm sich von den Tieren das Fell, das ihm die Evolution aus guten Gründen vorenthalten hatte. Davon erzählt auf poetische Art auch der biblische Mythos: Gott selbst übergibt den ersten Menschen Felle als Kleidung – eine Art Mitleidsgeschenk für das aus dem wohltemperierten Garten Eden vertriebene Menschenpaar. In ihm waren Adam und Eva nackt herumgelaufen. Lapidar heißt es: »Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und kleidete sie.« (Genesis, Kapitel 3, Vers 21)
Abgesehen von Kopf- und Schambehaarung ist unsere Körperoberfläche gewöhnlich nur von einem zarten Flaum bedeckt, zusammen mit einer mehr oder weniger starken Behaarung an Armen und Beinen. Nur einige männliche Exemplare der Gattung zeigen auf der Brust und im Bereich der Schultern und des Rückens noch beachtliche Reste eines frühmenschlichen Fells. Die größte zusammenhängende Fläche von Restfell trägt der Mensch gewöhnlich auf dem Kopf. Die Kopfbehaarung macht durchschnittlich etwa ein Viertel unserer gesamten Körperbehaarung aus. Als eine Art schützende Wetterhaube ist sie uns erhalten geblieben. Bei den Männern kommt noch der Bartwuchs hinzu, der allerdings keine Schutzfunktion hat.
Nacktheit, so vermuten die Forscher, hat für den Menschen neben dem Kühleffekt durch die Schweißabsonderung noch einen weiteren Vorteil: Sie erleichtert die Abwehr von Parasiten. In einem Fell können sich Läuse oder Flöhe sehr gut verstecken. Damit erhöht sich das Risiko, mit übertragbaren Krankheiten infiziert zu werden. Die winzigen Plagegeister aus dem Fell zu entfernen, ist zudem ein mühsames und zeitraubendes Geschäft. Allerdings kann der weitgehend haarlose Mensch in seinem Restfell immer noch von allen möglichen Parasiten befallen werden, etwa in Gestalt von Kopf- oder Filzläusen. Und in die nackte Haut bohren sich Krätzmilben oder Zecken.
Die Frage, wann der Frühmensch sein Fell verloren hat, wird von Paläoanthropologen unterschiedlich beantwortet. Die Vorfahren von Homo sapiens, so vermuten die einen, seien bereits vor 1,2 Millionen Jahren weitgehend nackt gewesen. Andere Forscher vertreten die Ansicht, dass der vollständige Fellverlust erst vor etwa 500.000 Jahren eingetreten sei – zu einer Zeit also, da der Mensch gelernt hatte, durch Feuerstellen und Höhlenbehausungen auch in kalten Nächten für angenehme Temperaturen zu sorgen. An Kleidung aber dachte Homo sapiens da noch lange nicht. Erst vor etwa 70.000 Jahren – im Zuge des sich verstärkenden eiszeitlichen Klimas – fing er an, sich vollständig in Tierfelle zu hüllen, zumal in den eurasischen Siedlungsgebieten, in die er aus Afrika, den Weg über Kleinasien nehmend, eingewandert war. Woher man das weiß? Nun, man weiß es aus den genetischen Daten der Kleiderlaus. Weil dieses Tierchen ohne den Menschen, genauer: ohne den bekleideten Menschen, nicht existieren kann, muss es sich aus der ursprünglichen Kopflaus entwickelt haben. Von der Kopflaus konnte sich eine Kleiderlaus logischerweise erst dann abspalten, als der Mensch begann, Fellkleidung zu tragen. Durch Vergleich der Unterschiede im Erbgut von Kopf-, Kleider- und Schimpansenlaus vermochten die Forscher den Zeitpunkt der Artentrennung ziemlich genau zu bestimmen: vor, wie gesagt, 70.000 Jahren.
Der Mensch und sein Restfell
Das Fell ist die ursprüngliche Erscheinungsform der Körperbehaarung. Dabei beschränken sich die unterschiedlichen Fellarten, die die Natur im Laufe der Evolution hervorgebracht hat, auf die Vertreter der Landsäugetiere – und damit auf die am höchsten entwickelte Klasse der Wirbeltiere. Einzig die reinen Meeresbewohner unter den Säugern, also Wale und Delfine, besitzen nicht die Spur einer Körperbehaarung. Bei einem ausschließlichen Leben im Wasser wäre sie als Wärmeisolation auch vollkommen nutzlos. Allerdings leben in den heißen Regionen der Erde auch Arten von Landsäugetieren, die kein Fell besitzen: etwa Elefanten, Nashörner oder Flusspferde. Das heißt jedoch nicht, dass sich auf den Körpern dieser Tiere überhaupt keine Haare befinden. Beim Elefanten zum Beispiel sind immerhin die Neugeborenen mit einem spärlichen braunen Haarkleid bedeckt, das aber mit der Zeit verschwindet. Die erwachsenen Tiere haben Haare nur noch am Schwanz in Form einer Quaste, ebenso an den Augen in Gestalt langer, derber Wimpern. Bei den Nashörnern verhält es sich ähnlich.
Während der letzten Eiszeit gab es mit dem Mammut und dem Wollnashorn Vertreter dieser Familien, die mit einem langen und dichten Fell den rauen klimatischen Verhältnissen in ihren nördlichen Lebensräumen widerstehen konnten. Sie sind jedoch zum Ende der vorerst letzten Eiszeit, also vor etwa 10.000 Jahren, ausgestorben. Vollkommen nackt sind unter den heute lebenden Säugetierarten nur die Nacktmulle, die zweifellos zu den seltsamsten Vertretern dieser Tierklasse zählen. Doch selbst diese völlig nackt erscheinenden, unterirdisch lebenden und fast blinden Tiere besitzen eine extrem feine, mit bloßem Auge kaum sichtbare Behaarung.
Ohne Haare, so scheint es, geht es bei den an Land lebenden Säugetieren nicht. Zahllos sind die Säugetierarten mit herrlichen, bizarr gemusterten Fellen in den typischen Farben Braun, Gelb und Schwarz mit all ihren Nuancen, Schattierungen und Mustern. Allein, wie der Gesamteindruck einer Fellzeichnung aus unzähligen Einzelhaaren zustande kommt, macht einen staunen. Die Fellzeichnung ist dabei mehr als nur ein launiges Spiel der Natur mit Farben und Konturen. Sie dient vor allem der Tarnung in der Landschaft, also dem Schutz vor Feinden beziehungsweise der Täuschung von Beutetieren.
So ein Fell ist zweifellos eine schöne Sache. Besonders Tiere mit seidigem Haarkleid wecken sofort unsere Sympathie, vorausgesetzt wir zählen nicht zu den bedauernswerten Menschen, die unter einer Haarallergie leiden. Es gibt kaum einen angenehmeren taktilen Reiz als das Streicheln einer Katze. Beim wesentlich gröberen Fell eines Hundes ist der Streichelgenuss längst nicht so intensiv. Und wenn man mit seiner Hand über das raue Fell eines Pferds oder eines Rindviehs streicht, genießt man in der Berührung vor allem den Kontakt mit einem kraftvollen Körper und weniger den taktilen Reiz. Es sind die fast schon erotisch zu nennenden stofflichen Qualitäten des Seidigen, Samtenen und Flauschigen, die bei Berührung eines Katzen- oder Kaninchenfells unseren Tastsinn betören.
Und dennoch: Uns selber wünschen wir kein Fell, und am wenigsten wünschten wir es uns im Gesicht. Ein Fell, so die Vermutung, würde uns in hohem Maße unserer Individualität und Persönlichkeit berauben. Denn wir sind vor allem unser Gesicht. Mit Fell sähen wir einander zum Verwechseln ähnlich, wie wir ja auch finden, dass sich Schimpansen, unsere nächsten biologischen Verwandten, kaum voneinander unterscheiden. Das ist freilich ein Trugschluss, der allein einem oberflächlichen und ungeübten Blick geschuldet ist. Wenn man bedenkt, dass die Schimpansenforscherin Jane Goodall schon nach kurzer Zeit jedes Individuum in einer Schimpansengruppe zu bestimmen vermochte, dann vermag Entpersönlichung als Argument gegen ein menschliches Fellgesicht kaum noch zu überzeugen.
Und doch: Fell und hohe Intelligenz passen irgendwie nicht zusammen. Diesem »irgendwie« scheinen zum Beispiel auch die Sciencefiction-Filme Genüge zu tun: In ihnen gibt es so gut wie keine intelligenten außerirdischen Lebewesen, die mit einem Fell ausgestattet sind. Lieber lässt man sie in Reptilien- oder Molluskengestalt auf der Leinwand erscheinen. Einzige berühmte Ausnahme, die freilich diese Regel nur bestätigt, ist der wortkarge, etwas Furcht einflößende, aber gutmütige Zottelriese Chewbacca, der Wookiee vom Planeten Kashyyyk in der Filmsaga »Krieg der Sterne« (»Star Wars«).
Der Mensch genießt das allein seiner Intelligenz geschuldete Privileg, bei Bedarf sein schützendes »Fell« in Gestalt der Kleidung ablegen zu können. Bedauerlicherweise tritt dabei nicht immer die nackte göttliche Schönheit zutage, die die Bibel zwangsläufig einfordert, wenn sie eine Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott zugrunde legt. Die Unbehaartheit wird – zusammen mit dem aufrechten Gang – zum äußeren Zeichen der menschlichen Gottesähnlichkeit erhoben, bei gleichzeitiger Abgrenzung vom behaarten Säugetier und dessen Gang auf vier Beinen. Wer weiß, ob Gott nicht besser daran getan hätte, wenn er Adam und Eva nach deren Sündenfall keine Tierfelle übergeben, sondern ein Menschenfell hätte wachsen lassen – zur Strafe für den Apfel-Frevel unterm Baum der Erkenntnis. Aber was heißt schon Strafe! Es gibt Schlimmeres, als rundum in ein seidiges, angenehm duftendes, vielleicht sogar hübsch gezeichnetes Fell gehüllt zu sein.
Dennoch gibt es kaum Gründe, dem Fell unserer menschenaffenähnlichen Vorfahren nachzutrauern. Gerade im Spannungsfeld von Kleidung und Nacktheit entfaltet sich etwas, das das Menschsein, neben anderem, vom Tiersein ganz erheblich unterscheidet: der Eros. Das immer gleiche Fell böte dem Eros nur sehr begrenzte Entfaltungsmöglichkeiten. Eros lebt nun mal vom Wechselspiel aus Verhüllung und Enthüllung unserer nackten Haut. Mit Fell fiele dem Menschen das Verführen um einiges schwerer.
Ein Fell ist eine sehr dicht behaarte Hautoberfläche. Entsprechend meinte das deutsche Wort »Fell« ursprünglich auch nichts anderes als »Haut« – und zwar von Mensch und Tier gleichermaßen! Beim englischen Wort »fell« ist das noch heute so. »Fell« ist verwandt mit dem lateinischen »pellis« (Pelz, Fell, Haut), das auch im deutschen Wort »Pelle« anklingt und phonetisch die Nähe zu »Pelz« bezeugt. Im Griechischen heißt es »pélla«. Erst im Neuhochdeutschen wurde das Wort »Fell« auf die Bedeutung »behaarte Tierhaut« eingeschränkt. Die alte, allgemeiner gefasste Bedeutung von »Fell« hat sich in Resten bis heute erhalten, etwa in Redewendungen wie »Mich juckt das Fell« oder »Ein dickes Fell haben«. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Herkunft des Menschen von haarigen Vorfahren immer gespürt wurde, lange bevor sie sich wissenschaftlich begründen ließ. So beginnen zum Beispiel die Märchen der Inuit mit der stereotypen Wendung: »Es geschah zu der Zeit, als man bald Mensch, bald Tier war.« Von Anbeginn war dem Menschen klar, dass er in vieler Hinsicht, und nicht allein aufgrund seiner Sterblichkeit, den Tieren viel näher steht als den Göttern oder dem Einen Gott.
Die Biologie des Haars
Fell und Haut sind eins. Die Redewendung »Mit Haut und Haar« bemüht man, wenn man einen anderen zum Fressen gern hat. Das Haar gehört zur Haut, aber nur zum Teil. Denn es hat ein Doppelwesen: lebendig und tot zugleich zu sein. So kann man es zwar schmerzlos abschneiden, aber nicht schmerzlos ausreißen. Das Haar wächst als fadenförmiges Gebilde aus der Haut, ohne wirklich ein Teil von ihr zu sein. Es wurzelt nur darin. Man kann es mitsamt der Wurzel ausreißen wie einen Grashalm, den man aus der Erde zieht. Beizeiten fällt es einfach aus, nicht anders als ein vom Zweig sich lösendes Blatt. Das Haar, so scheint es, hat eine verborgene Pflanzenseele. Allein der Begriff Haarwurzel weist schon darauf hin. Doch eigentlich wäre es zutreffender, von einer Haarzwiebel zu sprechen. Denn nicht anders als eine Tulpen- oder Amarylliszwiebel, die Jahr für Jahr eine neue Blüte hervorbringt, bildet auch die Haarzwiebel – nach Ruhephasen mit festgelegtem Zeitintervall – stets ein neues Haar, nachdem das alte ausgefallen ist. Das geht so lange, bis die Lebenskraft der Haarzwiebeln irgendwann erlischt mit der Folge, dass unsere Kopfbehaarung ihre Fülle verliert und sich kahle Stellen zeigen bis hin zur Glatze.
Auch bei Pflanzen – das übersieht man leicht – gibt es Haare, Trichome genannt, die teils einzellig (Wurzelhaare), teils mehrzellig (Gliederhaare) in Erscheinung treten. Der samtige Glanz vieler Laub- und Blütenblätter wird durch feine Papillenhärchen verursacht, die von Oberhautzellen ausgestülpt werden und das Blatt vor Benetzung schützen. Haarige Endwurzeln saugen das Wasser aus dem Boden, Drüsenhaare scheiden Sekrete aus, Wollhaare schützen vor allzu großer Hitze, Kletterhaare sorgen für genügend Haftfähigkeit eines Klettersprosses, Flughaare verringern die Fallgeschwindigkeit von Früchten und Samen, starre Borsten- und Brennhaare bewahren vor Tierfraß, Fühlhaare vermitteln Berührungsreize, auf die die Pflanze zu ihrem Schutz reagieren kann.
Die Behaarung bei Säugetieren ist allerdings keine direkte Fortentwicklung von Pflanzenhaaren, sondern stellt eine Weiterentwicklung der Schuppen bei Fischen und Reptilien dar. Mehr Ähnlichkeit haben Haare freilich mit Federn, mit denen höchstwahrscheinlich schon die Körper der urzeitlichen Saurier bedeckt waren, die evolutionsgeschichtlich zwischen den Reptilien und den Vögeln zu verorten sind. Besonders die sogenannten Fadenfedern mit ihrem sehr dünnen Schaft und einer verkümmerten oder fehlenden Fahne sind Haaren verblüffend ähnlich. Gerade bei Jungvögeln hat man den Eindruck, sie seien in einen dicken Pelz aus Flaum- oder Wollhaar gehüllt. Federn wie Haare sind gleichermaßen aus Keratin bestehende Horngebilde der Oberhaut.
Die harte Struktur des aus der Haut ragenden Haarschafts entspringt einer grubenförmigen Einsenkung der Oberhaut. Sie wird dort unter dem Einfluss bestimmter Zellen des Bindegewebes produziert. In dieser Einsenkung der Oberhaut steckt die Haarwurzel, die sich an ihrem Ende zu einer Art Haarzwiebel verdickt, die wiederum aus teilungsfähigen Haarzellen besteht. Die Haarzwiebel wird aus der darunter liegenden Lederhaut über eine zapfenförmige, mit einem Blutgefäßnetz ausgestattete Papille mit den nötigen Aufbaustoffen versorgt. Der gesamte, in der Lederhaut sitzende Komplex wird auch als Haarmatrix bezeichnet. Aus ihr wächst und in ihr regeneriert sich das Haar. Bei Zerstörung der Haarmatrix fällt das Haar aus. Eine weitere Haarneubildung ist dann nicht mehr möglich.
Auf ihrem Weg nach oben sterben die sich beständig bildenden und das Haarwachstum bewirkenden Haarzellen ab und verhornen. Deshalb tut Haarschneiden – nicht anders als Nägelschneiden – nicht weh. Doch der aus der Haut ragende Teil ist mehr als nur ein einfacher Hornfaden; er besitzt eine innere Struktur aus sogenanntem Haarmark, das sich aus unvollständig verhornten Haarzellen zusammensetzt.
In den Zellen der äußeren, vollständig verhornten Haarrinde sind Farbstoffe eingelagert, die für die individuelle Haarfarbe verantwortlich sind. Die in der Lederhaut sitzende Haarwurzel ist außen vom sogenannten Haarbalg, auch Haarfollikel genannt, umgeben, der aus einer Schicht verdickter Zellen besteht. Das Haar sitzt zumeist schräg im Haarbalg, kann sich jedoch unter dem Einfluss des sympathischen (= nicht willentlichen) Nervensystems durch Zusammenziehung eines winzigen glatten Muskels, des sogenannten Haarbalgmuskels, aufrichten. Das geschieht zum Beispiel, wenn wir frösteln und dabei eine Gänsehaut bekommen. Hätten wir noch ein Fell, würde sich durch dieses Aufrichten der Einzelhaare die Wärmefunktion desselben erhöhen, weil zwischen den aufgerichteten Fellhaaren reichlich Raum für isolierende Luft entstünde. Bei Felltieren hat das Sträuben der Haare bei Bedrohung den Zweck, das Individuum größer erscheinen zu lassen als es tatsächlich ist und dadurch einen Konkurrenten oder Feind abzuschrecken. Davon rührt beim Menschen die Gänsehaut in Schreckenssituationen. Zwischen dem Haarbalgmuskel und dem Haar liegen Talgdrüsen, die in den Haarbalg münden und mit einem öligen Sekret das Haar geschmeidig halten. Bei zu trockenem Haar liegt eine Unterfunktion dieser Drüsen vor, bei fettigem Haar eine Überfunktion.
Alles Leben verläuft zyklisch. Die physikalisch begründeten kosmischen Grundzyklen der wiederkehrenden Jahreszeiten und des Tag-Nacht-Wechsels gehen in den Bios ein, indem er sich an diese anpasst. Gerade am Haar offenbart sich das Zyklische des Lebens auf beeindruckende Weise. Ein menschliches Kopfhaar wächst pro Tag um etwa einen halben Millimeter, aber es wächst nicht endlos vor sich hin, sondern hat, wie alles Biologische, eine begrenzte Lebensfrist. Ist sein Wachstum beendet, wobei es beim Menschen große individuelle Unterschiede bei der maximal zu erreichenden Haarlänge gibt, so löst sich das Haar unter Verdickung seines unteren Endes von der Papille ab. Nach einer gewissen Ruhezeit bringt diese ein neues Haar hervor, das im selben Kanal aus der Kopfhaut zu wachsen beginnt. Dabei schiebt es das alte Haar nach oben, bis dieses ausfällt. So verliert der Mensch etwa hundert Kopfhaare pro Tag, ohne dass sich dadurch sein Haar mit der Zeit lichten würde. Denn jedes ausfallende Haar bezeugt ja nur den Wachstumsbeginn eines neuen Haars. Unser Kopfhaar lichtet sich erst, wenn Haarpapillen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Produktion unwiederbringlich einstellen.
Jedes einzelne »Haarprogramm« ist somit auf ein »Gesamthaarprogramm« abgestimmt, um im Normalfall eine gleichbleibende Haarfülle zu gewährleisten. Das zyklische Haarwachstum beruht also auf einer Art von programmiertem Zelltod zahlreicher Haarwurzelzellen, wissenschaftlich Apoptose genannt (von griechisch ptosis: Wegfall). Beim Kopfhaar ist es dabei so, dass sich stets etwa 85 Prozent der Haare in der Wachstumsphase und etwa 15 Prozent in der Ruhephase befinden. Bei der Beinbehaarung ist es hingegen fast umgekehrt: Nur etwa 20 Prozent der Haare befinden sich dort in der Wachstumsphase und etwa 80 Prozent in der Ruhephase. Aus diesem Grund hat der Mensch in der Regel mehr Haare auf dem Kopf als an den Beinen.
Insgesamt hat der Mensch zwischen 300.000 und 500.000 Haare auf seinem Körper, wovon etwa 25 Prozent auf die Kopfbehaarung entfallen. Von den 80.000 bis 150.000 Kopfhaaren eines erwachsenen Menschen befinden sich also 80 bis 90 Prozent in der Wachstumsphase. Die durchschnittliche Anzahl der Kopfhaare variiert zwischen den verschiedenen Haarfarbtypen erstaunlich stark. So haben Blonde etwa 150.000 Haare auf dem Kopf, Schwarzhaarige etwa 110.000, Braunhaarige etwa 100.000 und Rothaarige nur etwa 80.000. Rotes Haar ist dafür aber besonders kräftig.
Nach dieser kurzen Betrachtung des Haars unter biologischen Gesichtspunkten dürfte jedem klar sein, dass dieses auf den ersten Blick so simpel erscheinende Horngebilde einen komplexen Mikrokosmos repräsentiert, in welchem sich die grundlegenden Zyklen des Lebens exemplarisch wiederfinden. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die biochemischen Gesetze des Haarzyklus noch immer nicht bis ins Letzte erforscht sind. Der ganze Haarkomplex funktioniert nur, weil hoch spezialisierte Zellen des Bindegewebes, Fibroblasten genannt, die Fähigkeit besitzen, mit benachbarten Zellverbänden Signale auf der Grundlage von genetisch kodierten Proteinen (Eiweißmolekülen) auszutauschen. Dabei ist der Haarzyklus nur ein winziger integrierter Teil des Gesamtbiorhythmus eines Organismus, der selbst wieder von großen planetarisch-kosmischen Rhythmen beeinflusst wird.
Unser haariges Erbe
Verborgen im menschlichen Erbgut schlummert das Fell unserer frühmenschlichen Vorfahren. Die evolutionsgeschichtliche Bedeutung der Körperbehaarung beim Säugetier Mensch erkennt man schon daran, dass bereits sehr früh in der Entwicklung eines menschlichen Embryos, nämlich in der zehnten Schwangerschaftswoche, das Haar in Erscheinung tritt, nicht anders als bei anderen Säugetierembryonen auch. Zu diesem Zeitpunkt entstehen die ersten Haarkeime im Bereich der Augenbrauen, der Oberlippe und des Kinns. Aus jedem solchen Haarkeim wird später eine Haarmatrix hervorgehen. Die Bedeutung des Haars hat sich evolutionsgeschichtlich bei den Homo-Arten über Jahrmillionen – bis hin zum Homo sapiens – nach und nach abgeschwächt, ist aber im genetischen Programm des modernen Menschen immer noch präsent und könnte vermutlich bei Bedarf reaktiviert werden.
Während der Entwicklung des menschlichen Embryos wird gewissermaßen das ganze genetische Haarprogramm für Säugetiere abgerufen. So erscheint bereits in der neunzehnten Schwangerschaftswoche das sogenannte Lanugohaar: eine flaumige Körperbehaarung, die sich bis zum achten Monat der Schwangerschaft zu einem regelrechten »Fötusfell« verdichtet, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Säugetierfell hat. Dieses Menschenfell wird im Laufe des achten Schwangerschaftsmonats abgestoßen. Ihm folgt eine feinere zweite Behaarung nach. Mit ihr kommt der Mensch zur Welt; doch spätestens bis zum dritten Lebensmonat des Neugeborenen wird auch sie wieder abgelegt. Erst von da an setzt das oben beschriebene asynchronzyklische Haarwachstum ein. Hingegen lief das Wachstum der embryonalen Lanugobehaarung noch synchron ab: Alle Haare erschienen gleichzeitig und verschwanden auch gleichzeitig wieder. Der Übergang von einem synchronen zu einem asynchronen (zyklischen) Haarwuchs vollzieht sich um den dritten Lebensmonat und zeitigt die typische Säuglingsglatze am Hinterkopf. Sie bleibt so lange bestehen, bis die an der Stirn beginnende und zum Hinterkopf fortschreitende Haarwachstumswelle den Nacken des Säuglings erreicht hat. Das ist etwa bis zum Ende des ersten Lebensjahres der Fall.
Wir haben also vom Beginn bis zum Ende unseres Lebens nicht immer die gleiche Art von Körperbehaarung. Ihr Charakter verändert sich kontinuierlich – nicht anders, so möchte man sagen,