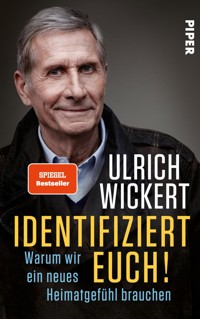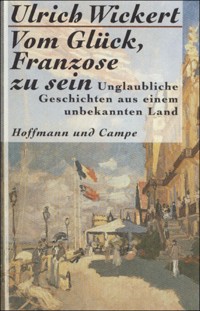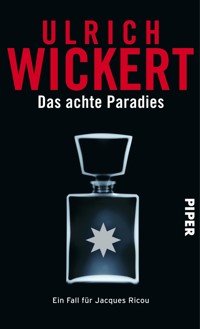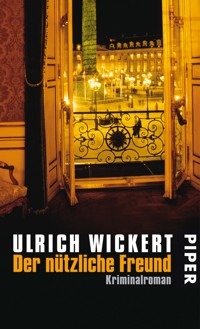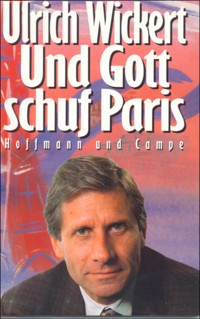
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der exzellente Paris-Kenner macht den Leser mit der Stadt und ihrem Leben außerhalb der ausgetretenen Touristenpfade bekannt. Gleichzeitig schreibt er über die Franzosen. In der ihm eigenen ironischen Art beleuchtet er ihre Fehler und Vorzüge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ulrich Wickert
Und Gott schuf Paris
Hoffmann und Campe Verlag
Für Sylvie
Vorwort
Le malaise« heißt die Krankheit, an der die Franzosen in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts leiden. »Le malaise« ist ein Zustand des Unwohlseins, dessen Herkunft sie nicht zu beschreiben wissen, und er befällt die Franzosen so, wie Angst die Deutschen übermannt, und auch sie wissen nicht, was ihnen eigentlich angst macht. »Le malaise« geht so weit, daß Raymond Soubie im Titel seines Buchs über das französische Unwohlsein die Frage stellt: »Dieu est-il toujours français? – Ist Gott noch Franzose?«[1] Und er schreibt, das Unwohlsein sei ausgelöst worden, weil Frankreich mit seinem Jahrhundert endlich eins geworden sei und sich getrennt habe von der Idee der »französischen Außergewöhnlichkeit«. Die Franzosen haben längst von der Vorstellung der »Grande Nation« Abschied genommen. Und spätestens seitdem die winzige französische Truppe sich im Golfkrieg dem übermächtigen amerikanischen Kommando unterordnen mußte, sind sie bescheidener geworden. Aber auch wenn es seine Sonderrolle nicht mehr aufrechterhalten kann, so ändert das nichts am Anspruch Frankreichs. Es sucht sich Partner, um als »primus inter pares« seiner insgeheim doch noch als besonders erachteten Stellung Bedeutung zu verleihen.
Engster Partner Frankreichs ist Deutschland, ein Land, an dem es sich schon immer gerieben hat, das ihm aber seit langem als Spieglein für die Frage dient, welches denn das schönere Land sei. »La France va-t-elle s’effacer? – Wird Frankreich sich auflösen?«[2] war bereits 1910 die beängstigende Frage eines französischen Aufsatzes, der mit dem Zitat eines Deutschen eingeleitet wurde: »Der Augenblick ist nicht mehr weit, wo fünf Söhne der armen Teutonen ohne Müh mit dem reichen Abkömmling der gallischen Familie fertig werden.« Deutschland werde sich innerhalb von hundert Jahren um sechzig Prozent vermehren, während die Franzosen nur um zehn Prozent zunähmen, klagte Torquet in seinem Artikel.
Frankreich vergleicht sich heute in politischen und wirtschaftlichen Belangen immer mehr mit Deutschland und sucht im Maßnehmen seine Identität. Nur in einer Hinsicht fühlt es sich unvergleichlich – wenn es um die Kultur geht. Allein deshalb, weil Deutschland über keine Metropole wie Paris verfügt, von der aus der französische Einfluß auf die Zivilisation immer noch in die ganze Welt getragen wird.
»Paris ist eine Göttin«, schrieb Walter Benjamin, und man fragt sich, weshalb das Göttliche immer wieder herhalten muß, um das Leben in Frankreich oder die Fassaden von Paris zu deuten. Es hat wohl damit zu tun, daß sich hinter den von den Franzosen – im Leben wie in der Stadt – errichteten Fassaden für den Fremden verborgene Dinge abspielen. Diese Geheimnisse lassen sich nur schwer entschlüsseln, und solange sie verborgen bleiben, lassen sie in seiner Vorstellung eine Traumwelt entstehen. Die Fassaden mögen Wunschträume vorgaukeln, doch dahinter verstecken sich auch Alpträume, denn da geht es häufig so brutal zu – zum Beispiel bei den Initiationsriten in französischen Eliteschulen, während des Bizutage –, wie es den auf ihre Zivilisation so stolzen Franzosen[3] niemand zutrauen würde.
Kein Politiker hat Frankreich in diesem Jahrhundert so geprägt wie Charles de Gaulle, der das Land vor einem politischen Chaos rettete, in das es nach dem Zweiten Weltkrieg und den verlorenen Kolonialkämpfen in Indochina und Algerien zu versinken drohte. Er hat den Grundstein für das Frankreich des 21. Jahrhunderts gelegt, indem er der Republik eine Präsidialverfassung gab und damit die Suche nach einer passenden politischen Ordnung beendete, auf der sich Frankreich seit Napoleon III. befand. Allerdings fördert die Ideologie der Fünften Republik das nationalstaatliche Denken – und das in einer Zeit, die ein europäisches Jahrhundert einläutet.
Nachdem Frankreich sich nun gefestigt zeigt, ist es Ziel der Staatsherren, ihr Land für das nächste Jahrhundert vorzubereiten. Und auch da stellt sich jeder Franzose eine Frage, die kaum einem Deutschen in den Sinn käme, nämlich die nach der kulturellen Identität. Denn nur wenn die gefunden ist, kann Frankreich wieder an sich arbeiten, um der Welt ein Modell der geistigen Aufklärung zu sein. Tatsächlich wird Kultur längst von Regierungen geplant; wir leben nun einmal in einer absurden Zeit, in der Dichter und Denker von Politikern aus den Salons verdrängt worden sind. Weshalb Eugène Ionesco kurzerhand für sich fordert, zum König von Frankreich ernannt zu werden. Doch der Geist läßt sich nicht herbeirufen – wie mit Aladins Wunderlampe. Daher kann ein Kulturminister, und sei er auch noch so mächtig und mit einem noch so reichen Budget ausgestattet wie der einstige »Minister für Intelligenz«, Jack Lang, nur das Äußere beeinflussen, Fassaden putzen oder neue errichten lassen. Und wie selbstverständlich beanspruchen französische Politiker königliche Privilegien für eine ihrer eigenen Bedeutung angemessene Fassade. Aber davon läßt sich das Volk sein Leben nicht verdrießen. Diese neidlose Gelassenheit rührt wohl daher, daß Gott Paris erschuf.
Mai 1993 Ulrich Wickert
Paris
Fassade für verinnerlichte Selbstdarstellung
Metropolis
Paris stellt die französische Geschichte dar, vereint in sich europäische Literatur und prägt den Stil des Abendlandes. So ist Paris Maßstab für das Denken und Darstellen, für verinnerlichte Kultur und veräußerlichte Ästhetik geworden. Dies alles lebt in dieser Stadt und zeugt, sich ergänzend, Menschen, die ihr Streben darauf richten, des Maßes höchste Marke zu erreichen. Selten, aber immer wieder, gelingt dies – in Glücksmomenten – außergewöhnlichen Repräsentanten ihres Faches. So zum Beispiel dem im März 1993 neu ernannten Premierminister.
Monsieur Édouard Balladur rief seine Sekretärin, schloß die Tür hinter ihr ab, lehnte sich zurück, dachte nach und fing nach einer kurzen Pause an zu reden, einfach zu reden, Satz für Satz; und erst nach Stunden ließ er die Mitarbeiterin wieder frei – nachdem er ihr seine Regierungserklärung in den Block diktiert hatte: aus dem Kopf, Seite um Seite. Keine Referentenentwürfe, keine Notizen lagen ihm vor, auf keine Hilfsmittel konzentrierte er sich; nein, er verließ sich nur auf seine Gedanken. So erhielt er, als er am 8. April 1993 seine Regierungserklärung vor der Nationalversammlung abgab, breiten Beifall, und das nicht nur im Halbrund des Palais Bourbon, sondern auch draußen in der Öffentlichkeit. Solch grandiose Darstellung – solcher Stil! – beeindruckt jeden bis hin zum einfachen Volk, das seinerzeit auch begeistert war, als Valéry Giscard d’Estaing als Finanzminister vor die Abgeordneten getreten war und ohne Manuskript eine Haushaltsrede mit Hunderten von verschiedenen Zahlen gehalten hatte – und alle Zahlen stimmten! Nur einmal die Symbiose von verinnerlichter Kultur mit veräußerlichter Ästhetik zum höchsten Stil entwickelt zu haben belohnt diese Persönlichkeiten mit einem echten Glücksgefühl, und so lassen sie sich gelegentlich zu Handlungen verleiten, die sie zur Karikatur verformen.
Hatte Édouard Balladur in seiner Antrittsrede den zerrütteten Zustand der Staatsfinanzen beklagt, so wollte er mit gutem Beispiel vorangehen und beschloß, sich zu einer Fraktionssitzung in der Nationalversammlung zu Fuß zu begeben. Sein Amtssitz, das Hôtel de Matignon, liegt in der Rue de Varenne, zehn Fußminuten vom Place du Palais Bourbon entfernt. So machte er sich »auf die Socken«, wie die französische Presse hämisch bemerkte, denn seine Socken läßt er sich für 120 Franc von der Gemahlin des französischen Botschafters beim Heiligen Stuhl in Rom bei Gammarelli kaufen, wo die Kardinäle sich einkleiden. Die Socken des Herrn Balladur sind handgemacht und haben die samtene Farbe, wie sie Prälaten zusteht. Zwölf Minuten marschierte Balladur die Rue de Varenne hinunter, bog in die Rue de Bourbon ein und betrat schließlich den Hof der Nationalversammlung. Doch von wegen sparen! Ihm folgten in ihren Wagen die Sicherheitsbeamten, die Mitarbeiter, und auch sein eigener Dienstwagen rollte im Schrittempo neben dem Premierminister her. »Der Wagen ist sein Büro«, erklärte ein Mitarbeiter, »kaum ist er hundert Meter gelaufen, muß er telephonieren.«
Gespart wurde dennoch weiterhin: Den Mitarbeitern im Amtssitz des Premiers wurde der kostenlose Kaffee-Service gestrichen, der fortan nur noch Kabinettsmitgliedern zusteht. Die Kabinettsmitglieder aber, die Balladur bei der ersten gemeinsamen Sitzung zum Mahl einlud, erhielten nur einen Hauptgang samt Dessert. Zwar entspricht solche Sparsamkeit seinem Wesen sonst nicht, aber im Moment war sie dem Image zuträglich. Im allgemeinen packt den Premierminister keineswegs die Wut über einen vergeudeten Groschen, wenn es darum geht, die Darstellung seiner Würde mit äußerlicher Ästhetik erkennbar zu machen. Die Fassade soll so prunkvoll sein, wie es der Bedeutung des als Denker anerkannten Politikers entspricht.
Als Balladur von 1986 bis 1988 Finanzminister war, bewirtete er am 8. Juli 1987 einige Journalisten so, als säßen sie am Hofe Ludwigs XIV. in Versailles zu Tische: Auf eine Languste folgte Knochenschinken, dann ein Turbot (Butt) soufflé, ein Chaudfroid de volaille, ein Baron d’agneau, Kalbszunge, ein Filet de bœuf, verschiedene Salate und eine Auswahl von Nachtischen. Gereicht wurden dazu ein Sancerre 1985 und ein Château Trimoulet 1979. So gut werden die Vertreter der schreibenden Zunft nie mehr gegessen haben.
Aber seiner Küche hatte Édouard Balladur ja schon bei Amtsantritt eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, denn er ließ sich dort nicht nur die offiziellen Gastmahle zubereiten, sondern auch das private Sonntagsessen mit der Familie. Im Februar 1987 versetzte er den Koch, den er bei der Amtsübernahme ein Jahr zuvor vorgefunden hatte, in die Küche des ihm unterstellten Ministers für Außenhandel, Michel Noir. Auf Anraten der Wirtschaftskapitäne Jimmy Goldsmith und Ambroise Roux heuerte er sich dann einen vorzüglichen Maître de cuisine aus der Privatwirtschaft an, und damit dieser in Ruhe arbeiten konnte, auch noch einen für den Haushalt zuständigen Intendanten. Porzellan wurde bestellt, kostbares natürlich, und mit den Initialen EB versehen. Da der Koch mit dem Zustand der Küche unzufrieden war, wurde das alte Gerät herausgerissen und durch teuerstes neues ersetzt, obwohl allen bewußt war, daß ein Jahr später der Umzug in ein neues Ministerium stattfinden würde.
Eigentlich hätte Édouard Balladur schon zu seinem Amtsantritt in das neue Gebäude im östlichen Stadtteil von Paris, in Bercy, einziehen sollen, doch die abweisende, moderne Fassade widersprach seinem Stilgefühl. Er wollte in den Mauern residieren, die Napoleon III. hatte errichten lassen, im Nordflügel des Louvre, wo Generationen von Finanzministern ein und aus gegangen sind. Kurz bevor Balladur 1986 ernannt wurde, waren die Räume des Finanzministers im Louvre auf Anordnung von François Mitterrand geräumt und zum Umbau freigegeben worden, denn auf seinen Wunsch hin sollte der Louvre das größte Museum der Welt werden, und dazu benötigte man diese Säle. Zehn Millionen Mark hatte der Abriß dieses Trakts gekostet, aber der Finanzminister wich nicht und ließ die Salons wieder herrichten – für zwanzig Millionen Mark. Kaum zwei Jahre hielt er sich im Amt, und dann begann der Umbau des Museums wirklich. Dreißig Millionen Mark hatte der Wunsch des Ministers also gekostet, hinter der ihm angemessenen Fassade zu residieren![4]
Die Rangfolge wird in Frankreich äußerst wichtig genommen. Bei jeder Regierungsbildung legt daher der Präsident oder der Premierminister den protokollarischen Platz eines jeden Regierungsmitglieds fest. 1986 ernannte Premierminister Jacques Chirac seinen engen Berater Édouard Balladur zum Ministre d’État im Rang eines ersten Ministers nach dem Regierungschef. Diese Position veranlaßte Balladur, eine entsprechende Karosse für sich zu fordern. Im Oktober 1986 beantragte er bei der staatlichen Automobilfirma Renault eine Sonderanfertigung des Modells R 25, eine Langfassung, die damals aber nicht mehr gebaut wurde. Auf Druck des Politikers fand sich schließlich im Ausland ein solcher Wagen, der nach Paris gebracht wurde und ihn von nun an aus der Masse der einfachen Minister hervorhob. Seinen Chauffeur tauschte Balladur allerdings bald aus, weil er, statt Tag und Nacht für Dienst- und Privatfahrten im Einsatz zu sein, an die Arbeitszeitordnung erinnert hatte. Den Rest dürfte ihm aber gegeben haben, daß er einem der halbwüchsigen Söhne von Balladur nicht die Wagentür aufgerissen hatte, als er ihn zu einem Privatvergnügen fahren sollte. Auch der neu eingestellte Koch und der Intendant suchten bald das Weite, weil der Herr ihnen keinen freien Tag zugestehen wollte.
Aber das sind natürlich Petitessen, wenn es darum geht, ein bestimmtes Erscheinungsbild zu vermitteln. Die Fassade ist wichtig! In Frankreich blendet sie das Volk so, daß es vor lauter Bewunderung seiner Elite Privilegien gönnt, die zu einem adäquaten Lebensstil gehören. Von 1968 bis 1980 war Édouard Balladur Präsident der Montblanc-Tunnelgesellschaft, die sich zu vierundfünfzig Prozent im Staatsbesitz befindet. Acht Jahre nachdem er das Unternehmen verlassen hatte und zwei Jahre nachdem er zum Finanzminister und damit Kontrollorgan über die Gesellschaft ernannt worden war, enthüllte die satirische Zeitschrift »Le canard enchainé« im Winter 1988, daß Balladur auf Kosten dieses Unternehmens in Chamonix über eine zweihundert Quadratmeter große Ferienwohnung verfügte, über eine zweite Wohnung für die Kinder und eine dritte für die Domestiken. Alle Spesen bis hin zur Radio- und Fernsehgebühr sowie den von Balladur erbetenen Renovierungen trug die Tunnelgesellschaft. Die Zeitungsveröffentlichung hatte für den Minister keinerlei Folgen, doch einige Monate später gab er die Wohnungen auf.
Sparen war ihm weniger wichtig, wenn es um die Darstellung seiner Position ging. Ihm, dem ersten unter den Ministern, waren nicht weniger als vier Staatsminister zugeordnet. Um die Würde des großen Denkers zu unterstreichen, mußten im Finanzministerium zusätzliche Hausdiener abgestellt werden, die ausschließlich dazu da waren, nicht nur in der Woche, sondern auch an Wochenenden, in vollem Ornat mit goldener Kette um Hals und Brust, vor dem Minister einherzuschreiten, ihm die Tür zu öffnen – und hinter ihm wieder zu schließen.
Auch bei der Arbeit zeigte sich Balladur als penibler Vorgesetzter. Als Alain Juppé, zuständig für Haushaltsfragen, dem Ministre d’État Balladur Photokopien von Berichten seiner Beamten schickte, tobte der Chef und verlangte die Originale. Juppé ließ daraufhin die Berichte seiner Beamten in zweifacher Originalform herstellen. Doch als Balladur dahinterkam, tobte er wieder. Nur er dürfe das Original erhalten, Juppé müsse sich mit einer Photokopie bescheiden.
Die einzige Bestrafung dieser Art Sinn für Fassade sind Spitznamen für Balladur. »Der kleine Ludwig XIV.«, »Sa Suffisance – Seine Selbstgefälligkeit« und »der Vizekönig« heißt er im Volksmund schon lange. Aber der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Daß sein Name auf -dur endet, was hart bedeutet, obwohl er im Gesicht doch eher schwabbelig wirkt, hat die Pariser dazu veranlaßt, ihm statt dessen die Endung -mou, weich, zu verpassen: Ballamou. Und weil es an Sultane erinnert, wird er auch Ballamouchi I. genannt. Nach seinem Amtsantritt als Premierminister im März 1993 avancierte er für »Le canard enchaîné« gar zu »SCS – Sa Courtoise Suffisance Ballamouchi I. – Seine Höfliche Selbstgefälligkeit Ballamouchi I.«. Und Ballamouchi I. wird an ihm schon wegen seiner Herkunft haftenbleiben.
In dem levantinischen Ort Smyrna, den die Türken heute Izmir nennen, kam Édouard Balladur 1929 zur Welt, doch nur deswegen als französischer Staatsbürger, weil der Familienälteste, Ernest Charles Balladur, drei Jahre zuvor für seinen ganzen Clan die Naturalisierung beim französischen Konsul in Smyrna beantragt hatte. Nach Smyrna waren die Balladurs 1737 gekommen. Unter der Führung von dominikanischen Patres waren sie in einer Gruppe von religiös verfolgten Christen aus der Gegend von Nachitschewan (damals persisches Gebiet, heute eine aserische Enklave zwischen Armenien, dem Iran und der Türkei) geflohen. 1789 erhielten die Balladurs durch einen Erlaß von Sultan Selim III. die Erlaubnis, Handel zu treiben, ohne Steuern zu zahlen, da sie »französische Subjekte« seien. Zwar widersprach ihre Herkunft dieser Zuordnung, doch in jenen Zeiten war nicht das Land, aus dem die Balladurs stammten, entscheidend für die nationale Identität, sondern die Religionszugehörigkeit. So mischten sich die Balladurs unter die levantinischen Familien provenzalischer Herkunft, und es verwunderte niemanden, als Édouards Vater, Direktor der Osmanischen Bank in Izmir, 1935 mit seiner Familie nach Frankreich übersiedelte, denn mit dem Ende des Osmanischen Reiches verfiel der kosmopolitische Lebensstil von Smyrna, weshalb viele großbürgerliche Familien nach Europa auswanderten.[5]
Édouards Entwicklung zu »SCS Ballamouchi I.« entspricht dem Klischee der Biographie eines Mitglieds der französischen Elite. Zu Hause siezt er seine Eltern und lernt, sich nie zu beklagen oder über sich selbst zu sprechen; und die von den streng katholischen Eltern übernommenen Lebensprinzipien wird er auch an seine Kinder weiterreichen. »Im Familienkreis sprechen wir nie über uns«, berichtet sein Sohn Henri ohne irgendwelches Bedauern.
Édouard jedenfalls absolviert die ENA, die er als Fünftbester seines Jahrgangs verläßt, und tritt in den Staatsrat ein. Mit fünfunddreißig wird er in das Büro des Premierministers Georges Pompidou geholt, der sich zu seinem Ziehvater entwickelt und ihn später zum Generalsekretär des Élysée ernennt – eine der wichtigsten Positionen des Landes. Mit der gleichen Hingabe, mit der Balladur für Pompidou arbeitet, wendet er sich nach Pompidous Tod Jacques Chirac zu, der ihn zu seinem engsten Berater macht und bewußt in der Politik an die Stelle des Premierministers plaziert, weil der loyale Balladur ihm – Jacques Chirac – kein Konkurrent im Kampf um die Präsidentschaft sein wird, aber als gute Fassade im politischen Leben dient, denn Balladur verfügt über äußeren Stil und innere Kraft.
Zwar entspricht der äußere Stil nicht immer dem, was sich hinter der Fassade verbirgt; dennoch legt das Paris des ausgehenden 20. Jahrhunderts besonderen Wert auf eine glänzende Vorderfront. War hundert Jahre zuvor die Passage in Paris Ausdruck ihres Zeitalters als heimlicher Tempel der Ware und als Wohnung des Kollektivs, weshalb Walter Benjamin sich an sein Passagenwerk setzte, so ist die Fassade Sinnbild der jetzigen Epoche als Inbegriff der Individualisierung, der Kommerzialisierung des Lebens, ja, eine Darstellung der Ästhetik des kommerzialisierten Lebens. In den sechziger Jahren noch war Paris eine schwarze Stadt. Der weiche Kalksandstein der Fassaden schluckte jeden Schmutz, den Heizungen, Kamine, Autos und Industrie in die Luft beförderten, und nahm dessen Tönung an. Dann drückte Kulturminister André Malraux durch, daß die staatlichen Regelungen, wonach Fassaden in regelmäßigen Abständen zu reinigen seien, in die Tat umgesetzt wurden. Je weiter das 20. Jahrhundert voranschritt, desto mehr wurde geputzt und desto moderner wurden die Reinigungsmethoden. Als in den achtziger Jahren die Sozialisten regierten, nahm die Bedeutung der erneuerten Fassade zu, so daß auch staatliche Gebäude wie die Nationalversammlung, die Madeleine, das Hôtel de Matignon etc. plötzlich hell erschienen. Wobei die Pariser begannen, der Fassade solch eine Bedeutung zu geben, daß sie die Arbeiten an einer Fassade hinter einer künstlichen zweiten Fassade versteckten. Nichtssagende, architektonisch langweilige Wände wurden mit einem Trompe-l’œil, einer Augentäuschung, bemalt. Als das Palais de Justice auf der Île de la Cité ästhetisch verjüngt wurde, stand auf einer großen Stoffwand »lex«, und eine falsche Urkunde zierte für ein Weilchen ein Gerüst vor der Außenwand des Obersten Gerichtshofs von Paris, so als verdecke ein optisches Pflaster die Steinarbeiten.
Die barocke Kunst des Trompe-l’œil wurde wiedergeboren. Sowohl das Portal der Nationalversammlung als auch das der Madeleine wurden während des Steinputzes mit einer Leinwand abgedeckt, auf der die ursprüngliche Ansicht vorgetäuscht wurde. Irreale Fenster, vor denen echte Tauben schnäbeln, schmücken im Alltagsgrau leere Betonfassaden der Stadt. Früher waren es große Werbeflächen, die sich auf Häuserwänden in den Bestand der Stadt hineinmogelten, doch vor einigen Jahren hat Jacques Chirac als Bürgermeister von Paris das Motto angestimmt, die Wände erklingen zu lassen. Und seitdem zahlt das Rathaus Kunstmalern ein gutes Zubrot, damit sie stumpfe Ecken verwirrend schön abrunden. Fast achtzig große Gemälde haben sie für das lebende Stadtbild inzwischen fertiggestellt. Ein Spaziergang durch die Stadt wird so zum Museumsbesuch, dem Bücher über diese Trompe-l’œils als Katalog dienen. Manch eine Szene wirkt für das flüchtige Auge so täuschend echt, daß man sie kaum wahrnimmt. Andere Bilder sollen Aufmerksamkeit wecken, doch weil Frankreich das Geburtsland der Bürokratie ist, zieht es sich ewig hin, bis solch ein Gemälde an die Wand kommt. Selbst wenn die Finanzierung gesichert ist, ist der Weg durch die Amtsstuben der verschiedenen Rathäuser zum Verzweifeln lang und beschwerlich.
Nadine Le Prince hat auf diesem Weg nicht aufgegeben. Das Rathaus der Stadt Paris erteilte ihr die Genehmigung für ihren Entwurf, der Bürgermeister des 6. Arrondissements hat dagegen erst einmal protestiert. Nadine Le Prince wollte auf eine zehn Meter hohe Fassade Fenster malen, hinter denen scheinbar bewohnte Appartements liegen, wobei ein Fensterflügel in den oberen Etagen offensteht und ein Klettermax sich anschickt, dort einzusteigen. Der Protest des Bürgermeisters wandte sich gegen diesen Kletterer, der wie ein Dieb aussehen könnte. Den Einspruch mußte die Malerin ernst nehmen, weshalb sie einen Mädchenschatten ins Fenster malte. So wirkt der Mann eben nur wie einer, der fensterlt, was ja auch dem Klischee von Paris, wo die Liebe angeblich Tür und Tor öffnet, mehr entspricht.
Nadine Le Prince entstammt einer alten Malerfamilie aus Lothringen und malt ihre Trompe-l’œils am liebsten auf Leinwand. Die Kunst der Augentäuschung, die darin besteht, eine Perspektive vorzugeben, die eine vermeintliche Wirklichkeit darstellt, hat sie sehr bewußt für die Moderne adaptiert. »Ich sehe darin einen Weg, die bildliche Darstellung wieder zur Avantgarde zu machen«, meint Nadine Le Prince. »Das Trompe-l’œil erlaubt eine Malerei, die anders ist als der Realismus des 19. Jahrhunderts: mehr Möglichkeiten, mehr Magisches eröffnet. Denn es betrügt, gibt durch ein besonderes Spiel von Licht und Schatten ein Relief vor. Es besitzt außerdem eine lustige, verspielte Seite; dagegen ist die Malerei im 20. Jahrhundert sehr intellektuell, nimmt sich manchmal zu ernst, ist selbst ein wenig düster. Mit einem Trompe-l’œil kann man sich für eine Sache begeistern, nachdenklich sein und trotzdem den Humor bewahren.«
Das Leinwandbild mit der Fassade der Nationalversammlung ist nur die Darstellung einer Vorstellung, das Trompe-l’œil aber kann die Darstellung des Nicht-Vorstellbaren sein.[6] So entwickelt sich die Fassade zum Blendwerk, die den Eindruck erweckt, als wolle die Wirklichkeit eine Oper werden.
Selbst die Sprühdosen-Malerei, die Kunst auf der Fassade, hat in Paris ihren urwüchsigen Charakter der Ästhetik geopfert. BLEK[7] war der erste, der mit vorgefertigten Schablonen die aus New York gekommene Graffiti-Kunst in Paris weiterentwickelte. Seine großen schwarzen Figuren sprühte BLEK gerade dort an Wände, wo sie sich, wie etwa seine schwarze Madonna, im Einklang mit der Kultur der Bewohner des Viertels befanden. Denn – so BLEKS Interpretation seiner Kunst – die Schablonengraffiti sollen die Stadt widerspiegeln und ergänzen. Im Französischen nennt man die Serigraffiti, die ein populärer Ausdruck von Stadtkultur sind, pochoirs. Sie sind eine Weiterentwicklung der amerikanischen Graffiti.
»Die Pochoirs sind das Erbe der Graffiti«, erklärt BLEK. »Ein Pochoir basiert auf einer sehr sauberen Technik. Und zwar entsteht das Bild schnell mit der Sprühdose, und die Schablone hinterläßt einen klaren Umriß. Denn ich möchte, daß die Darstellung im Stadtbild ästhetisch wirkt. Anfangs habe auch ich versucht, direkt mit der Sprühdose zu malen, wie man das in New York auf der U-Bahn sieht, aber ich habe dies als Irrtum erkannt. Schließlich sind wir in Paris, deshalb suchte ich nach einer französischen Technik. Pochoirs stellt man zu Hause her. Erst dann wird das Bild auf die Mauern gesprüht. Es findet also ein Nachdenken vor dem Sprühen statt, eine Arbeit als Zeichner, als Maler. Spontanes Sprühen auf die Fassaden der Stadt kann sehr häßliche Bilder hinterlassen.«
Fast alle Pochoirs stellen unpolitische Themen dar und beschäftigen sich mit dem Alltagsgeschehen, worüber es auch Bildgeschichten gibt: etwa »Leben und Tod eines Scheißhaufens«, wie der Künstler eine Serie von Pochoirs nennt, wo ein Hund auf die Straße macht, sein Werk aber vom Schuh eines Passanten zermatscht wird. Und tatsächlich ist das Problem des Hundehaufens jedem bekannt, der in Paris lebt, wo über eine Million dieser Vierbeiner die Trottoirs beschmutzen und deshalb eigene Reinigungseinheiten eingesetzt werden müssen.
Die Arbeit des Sprühens ist mit Gefahr behaftet, denn verständlicherweise ist es verboten, fremde Fassaden zu beklecksen. Doch die Reaktion mancher Hausbesitzer, insbesondere in abgelegenen Vierteln, ist erstaunlich positiv. Der eine oder andere erkennt in dem Pochoir eine künstlerische Verzierung. Allerdings gab es auch Festnahmen, wenn Pochoirs-Künstler ihre Spuren an denkmalgeschützten Gebäuden hinterlassen. Auch BLEK mußte 1992 vor Gericht, wurde jedoch als Künstler anerkannt und nicht bestraft; es wurde ihm nur auferlegt, die von ihm besprühte Fassade wieder zu säubern.
Doch den Pochoirs folgte OLGA. OLGA ist die von der Stadtverwaltung eingerichtete Organisation zum Kampf gegen die Pochoirs. Mit einem eigens dafür entworfenen Wagen und besonderen Chemikalien rückt diese Sondereinheit den Pochoirs zu Leibe. Diese Ausstattung läßt sich übrigens gut verkaufen: Andere Städte wie Barcelona haben den OLGA-Wagen schon bestellt, aber auch die Künstler sehen in OLGA etwas für ihr Werk sehr Hilfreiches.
»Wir brauchen OLGA«, sagt Künstler BLEK, »da die Pochoir-Kunst vergänglich ist. OLGA löscht aus. Sie ist der Radiergummi des Zeichners, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß unsere Kunst in zwanzig Jahren noch einen Sinn hat. Und je mehr wir uns ausbreiten, desto mehr breitet OLGA sich aus.«
Doch alles Schöpferische, auch das angeblich Vergängliche, wird heutzutage festgehalten. So wurden Pochoirs (für diesen Zweck auf Tragbares gesprüht) bei Drouot, dem berühmtesten Versteigerungshaus von Paris, im gleichen Atemzug mit Jean Arp und Max Ernst versteigert, da Schablonensprüher ernst zu nehmende Künstler sind; denn auch bei ihnen hat sich eingebürgert, die Bilder auf den Fassaden zu signieren.
Während Fassaden eine vermeintliche innere Ästhetik nach außen spiegeln, die vorstellbare Wünsche darstellt, sollen sie in Paris noch zusätzlich die Örtlichkeit geschichtlicher und kultureller Abläufe gegenwärtig machen. Wo immer man durch die Straßen und über die Plätze der Stadt flaniert, begegnet man an den Fassaden leicht übersehbaren Spuren. Da steht auf kleinen marmornen Plaketten: Hier kaufte der Romancier Honoré de Balzac vor 130 Jahren Kerzen und Kaffee, dort trank der Fabeldichter La Fontaine frische Landmilch. Da wurde der arme Ritter de La Barre im Alter von neunzehn Jahren am 1. Juli 1766 zu Tode gefoltert, weil er eine Prozession nicht gegrüßt hat. In Paris lebten Lenin, Ho Chi Minh, Tschou En-lai, Sigmund Freud und die Exilanten Joseph Roth und Heinrich (Henri!) Heine – und die Fassaden verkünden es heute noch. Eine Plakette erinnert an den lateinamerikanischen Revolutionär Simón Bolívar, andere an Frédéric Chopin oder Maria Callas, die in Paris starb. Da wurde Heinrich IV. ermordet, hier wohnte Benjamin Franklin. Ein gewisser Herr darf natürlich nicht fehlen: Casanova, der noch heute fasziniert, weil er wie kein anderer die Damenwelt verzückte. Irgendwann wird in der Avenue Montaigne an einer Hauswand stehen: Hier lebte Marlene Dietrich bis zu ihrem Tod. An manchen Mauern erinnern gleich mehrere Plaketten daran, daß die Fassaden unentwegt das gleiche Äußere vorweisen, während heute kaum noch vorstellbar ist, was in ihnen geschah: Im selben Haus, in dem Honoré de Balzac die Handlung seines Romans »Das ungekannte Meisterwerk« spielen läßt, wohnte fast ein Jahrhundert später Pablo Picasso zwanzig Jahre lang und malte eines seiner berühmtesten Gemälde: »Guernica«.
Das gesäuberte Paris ist in seiner Essenz eine Stadt des Vordergrunds und des Hintergrunds, aber kaum der Gegensätze, selbst wenn Balladur gegen Mouna und Marabus steht. So trägt die Fassade von Paris nicht nur eine sichtbare Ästhetik zur Schau, sondern setzt für den wirklichen Genuß voraus, daß der Beobachter jenen immensen Teil von Geschichte und Kultur des Abendlandes kennt, der sich hinter ihr vollzogen hat.
Paris, Metropole – gelobt als Augenweide des 19. Jahrhunderts –, bietet sich nun auf ewig müßigen Flaneuren, Dandys, Bummlern zum Besichtigen an. »La ville lumière« wird die französische Hauptstadt gern genannt, wegen des milden Lichts, wegen der rosa Wolken vor dem hellblauen Himmel, Farben, die an Babywäsche erinnern, weshalb sich in dem Menschenkind, das vor dahinfließender Freude sein Da-Sein in Paris selig beseufzt, die kindlich-naivsten Gedanken von einer unberührt heilen Welt verbreiten. Oder das Halogengefunkele nachts. Thomas Edison hätte seine Freude an dem Geglitzer, an den angestrahlten Fassaden, beleuchteten Monumenten, an den schwimmenden Lichtorgeln auf den Bateaux-Mouches; Quai-Anrainer hängen sich vorsorglich dicke, lichtdämpfende Vorhänge an die Fenster. Und dann Weihnachten erst die Lichterketten in den Bäumen von Champs-Élysées und Avenue Montaigne!
Aber geht’s nur ums Licht? Fühlt sich Paris nicht immer noch verantwortlich für den Rest der Welt als nie versiegender Quell der »lumière«, wie die Aufklärung heißt? Dem Geist wird Licht gebracht … Nein, so scheint’s, in Paris erfrischt der Flaneur des 20. Jahrhunderts schauend sein Herz, nicht hörend das Hirn; Atlantis des vergangenen, des bürgerlichen Jahrhunderts, ein letztes menschliches Stadium der Millionenstadt vor dem Massenmoloch.
Paris! Ein Name, der stets an Aphrodite erinnert. Verlieh sie nicht Schönheit als höchstes Gut dem danach geifernden Paris?
Métromanie
Paris, »ville lumière«; bestaunt, ja, begehrt zu werden, daran labt sich wohlgefällig nur die Polis. In deren Métro aber, in die lebendige Unterwelt, führt manch verborgener, dunkler Schlund.
Nudelstil nennen Pariser die geschwungenen Linien der alten Métro-Eingänge und fanden sie natürlich gräßlich – damals, als sie nach den Plänen von Hector Guimard gebaut wurden. Aber dem Wahn, daß gut sei, was neu ist, sind die Franzosen ja nur selten verfallen – und haben sich stets daran gewöhnt, das einst Häßliche zu bewundern. Zudem: Erwartet man vom Herrn der Unterwelt nicht, daß er wenigstens den Einlaß dorthin geschmackvoll gestaltet? Wenn der schon unauffällig ist … Und mit den häßlichen, auffallend störenden Betoneingängen, mit denen deutsche Provinzstädte anzeigen wollen, daß auch sie Metropolis spielen möchten, muß er ja nicht unbedingt etwas gemein haben.
Nur Wissende können sündigen. Nur Sehende finden sie, diese wenigen Stufen, zu denen hin einige auf dem Teerboden der Trottoirs verstreute länglich-gelbe Rechtecke, ein braunes Magnetband quer über dem Rücken, wie heimliche Schnitzelzeichen führen. Für Wissende ist jenes braune Magnetband auf gelbem Rechteck ein täglich millionenfach verkauftes, zum Kultobjekt überhöhtes Firmensymbol: Métro.
Métro: Schuhe jeder Art in Bewegung, Gänge entlang, Treppen hinauf oder hinunter; Sneakers, Hochhackiges, Wildleder oder deftiges Schwein, Geschnürtes, Sandalen, mal Stiefel, eher Gummi- oder Kreppsohle statt Leder, Wollstrümpfe oder nackt, selten seidene, aber doch ab und zu, dann aber Métro Palais Royal oder Victor Hugo. Schuhe, die auf Laufbändern fahren oder auf den eisernen Stufen von Rolltreppen stehen; Füße, die sich treten, verlaufen oder warten, auf dem Quai, nach der zischenden Einfahrt, dem Klappern der aufspringenden Türen über die den Fuß mit Gumminoppen warnende Kante in den Wagen steigen, sich plazieren, an der Stange, vor dem Sitz. Von morgens bis abends: Füße von oben hinab, von unten hinauf. Allein vom Darandenken bekommt man müde, geschwollene Füße! Obwohl sie doch von der Métro gefahren werden in ihrem jeweiligen Schuhwerk.
Zischen. Türen auf. Füße drängen raus, andere stehen störrisch und störend davor, wollen rein. Türen wieder halb zu. Der dumpfe Warnton. Rennen noch Schuhe heran? Quetschen sich Ellbogen durch die Tür? Klappern der zufallenden Chromhaken in der Mitte der alten Türen. Elektrisches Summen des anfahrenden Zuges, vielleicht ein zu laut gestellter Walkman oder – selten – ein Gespräch zum Mithören.
Eine Minute zwischen jeder Station, rechnet man. Morgens Gelegenheit, eine Zeitung zu lesen oder ein Buch, Hausaufgaben nachzuholen, in Eile, oft angetrieben vom schlechten Gewissen. Eine Frau schminkt sich ungeniert.
Eine Minute zwischen jeder Station. Da muß der Auftritt auf die Sekunde ausgerechnet sein. Nicht in der Mitte, sondern an einem Ende eintreten. Der Mann wirkt gepflegt, von der Hände Arbeit hat er sicher gelebt, fünfundfünfzig mag er sein. Beim Anfahren erhebt er etwas zu laut, aber ohne zu zögern die Stimme: »Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos und kann die Miete nicht mehr bezahlen, habe kein Geld zum Essen. Wenn Sie einen Franc abgeben könnten (er beherrscht den Konjunktiv), würden Sie mir sehr helfen. Ich danke Ihnen.« Und dann geht er geschwind, aber nicht zu schnell durch den Wagen, eine Mütze in der Hand, damit man ihn nicht körperlich berühren muß, wenn man ihm eine Münze zusteckt. In dieser einen Minute ist es nicht leicht, zu entweichen; bevor der Zug hält, hat er den Wagen bis zum anderen Ende durchlaufen. »Je vous remercie.« Und zwanzig, dreißig Franc wird er wohl einstecken, zehn allein von mir. Lautlos verschwindet das schlechte Gewissen, als sei es nie dagewesen.
Dann treten die Füße heraus, und die Ohren melden: Unterwelt zwar, doch nicht Hölle. Ein klassisches Gitarrenkonzert in den Gängen der Station Auber, wo täglich eine Viertelmillion Menschen von einer Linie zur andern wechseln, hetzen und dann einen Moment verweilen; verschlossene Gesichter entspannen sich, vielleicht ein kleiner Traum für eine Seelensekunde, aus dem braunen Magnetstreifen auf dem gelben rechteckigen Papier erklingt einen Augenblick lang Musik.
Aus drei Abschnitten bestehe der Tag, heißt ein Motto in Paris: Métro-boulot-dodo. Morgens (und abends) Métro fahren, arbeiten/malochen, und dann ist man so kaputt, daß man nur noch erschöpft auf die Matratze fällt, um zu pofen. Métro-boulot-dodo: Métro-Maloche-Pofe. Unbeschädigt überlebt keine Seele diese Tretmühle.
Métro – molto allegro bieten statt dessen die Herren dieser Unterwelt als Verführung an. Nur: Kultobjekt wird ein gelbes rechteckiges Papier nicht von ungefähr. Drei Millionen Franc blättert die Métro-Verwaltung jährlich für ihre freien Konzerte hin, ob Blasorchester, Streicher oder Zupfhansel; und die Musiker freuen sich, mit leicht gestaltetem Programm ein Publikum zu erreichen, das normalerweise solche Musik wahrscheinlich nie anhören würde. Und in den Gängen – oder in der einen Minute zwischen zwei Stationen – gibt es ungeplante, aber geduldete Konkurrenz: Mit Flöte, Geige, Ziehharmonika lockt, wer sich getraut, den Hut vor sich hinzulegen, den Vorbeieilenden manch einen Zehner aus der Tasche, und Kenner melden guten Tagesverdienst, tausend Franc vielleicht – steuerfrei.
Der Blick fällt auf die lachende Kuh auf einem riesigen Werbeplakat, das so schön und ordentlich in den Keramikrahmen der Stationswand eingepaßt ist. Oder ein lächelndes Mädchen wirbt für Reizwäsche – welch ebenmäßiger Körper. Ein Moment, um in sich hineinzuversinken, zu sinnen, vielleicht auch, um zu begehren. Je nach Jahreszeit werden die Augen erinnert an rentrée und neue Schulkleidung, an billige Möbel oder einen neuen Reißer im Kino. Wo Höhlenwände den Blick abstumpfen, müssen Visionen erwachen: Gelb eingefaßt verspricht der braune Magnetstreifen Kultträume. Sehnsüchte sind die erste Stufe zur Sünde, der zweite Schritt liegt im Verlangen, und um Verlangen nach einer Sekunde leichten Lebens zu wecken, überließ man eine ausgediente Station Künstlern statt Werbekrämern. Métro La Croix-Rouge. Auf den Plakatwänden spiegelt blaues Papier den Himmel wider, den dazu passenden Sandstrand liefert gelber Karton, davor ein lebensgroßer Sonnenschirm, auf dem Quai eine Frau, ein Mann, ein dem Ball nachlaufendes Kind, ein Hund – als Pappsilhouetten.
Die Werber kommen nicht zu kurz. Doch nicht alles gelingt. Mit Fernsehen wollten sie auch noch das letzte Gespräch in der Métro ersetzen, denn dort, wo man eh wenig redet, lenkt der Blick auf die Mattscheibe ab, verkürzt ein Spot die Reisezeit, falls man darüber nicht auszusteigen vergißt. Die Wagen der Linie Pont de Neuilly – Bois de Vincennes wurden mit Monitoren versehen, doch die Augen erfuhren nur, welche Fahrplanänderungen notwendig waren, auf welcher Strecke gebaut wurde, wo Störungen zu erwarten waren. Zwischendrin erklärten kleine Filme, wie man Fahrräder repariert, und anderes mehr. »Indiana Jones sollte es geben statt ›Bildschmiertext‹(sic!)«, klagte ein junges Augenpaar. Das Experiment wurde eingestellt, vielleicht vergaßen zu viele auszusteigen. Auf die Quais hat man dann die Monitoren gestellt, weil beim Warten der Blick auf bewegte Bilder anreizen könnte. Auch das eine Pleite. Jetzt sieht man nur noch die Löcher im Boden, wo die Podeste verankert waren. Wer in der Métro wartet, hängt seinen eigenen Gedanken nach.
O ja, diese Unterwelt ist gesittet. Oben, im so häufig gerühmten Licht der Polis, steht der Louvre. Nach dem Umbau wird er ausgedehnter als Sankt Petersburgs Eremitage und dann der Welt größtes Museum sein. Da verzichtet die Métro auch unten auf lohnende Werbeflächen, opfert Mammon den Musen, weil kulturelles Ansehen den Wert eines mäßigen Schecks übertreffe. Statt Werbung ägyptische oder gotische Figuren, steif – hinter Glas. Métro Varenne: Rodins Denker und Balzac als ewige Passagiere auf dem Quai.
Auch jene Frau, die als lebende Versuchung gilt, läßt sich in die Dichte dieses Unterstadtverkehrs herabziehen, wenn nur die Verlockung groß genug ist. Métro Bastille – aux armes citoyens! Oben auf den Boulevards der Polis fährt Catherine Deneuve Rolls-Royce, aber die Ausstellung von Marianne-Büsten, gestaltet nach ihren Gesichtszügen, läßt sie sich nicht entgehen. Dann aber am späten Vormittag, wenn’s leerer ist; trotzdem drängeln die Photographen fürchterlich. Ein Blick auf diese Helena des heutigen Paris löst einen Adrenalinstoß auch bei dem aus, der auf dem Weg zur Maloche zufällig vorbeieilt und von ihr, der Blonden in Chanel, einen Blick erhascht. Mensch, du wirst nicht ahnen, wen ich heute gesehen habe.
Da hält der Wagen, öffnet sich die Tür, zuerst verharrt der Schritt. Man schaut zu, vielleicht denkt man nach, sagt sich, ach – das wär’ auch was für meine Kinder. Tanzen, Ballett … Von oben ist eine Ballettschule auf die Quais eingeladen worden. Leben und Denken der durch die Tunnel Eilenden will die Métro-Verwaltung anregen: Ausstellungen (über Kartoffeln in der Station Parmentier), Handwerksanweisungen, sogar eine Métro-Bibliothek bietet die Unterwelt-Organisation an.
Alles am Métrofahren ist praktisch. Wer seinen Weg sucht, der drückt auf einen Knopf, und schon zeigt die Leuchttafel die kürzeste Strecke – mit Umsteigen in verschiedenen Farben. Kaum ein Tunnelgewirr ist so übersichtlich und einfach zu durchfahren wie das von Paris. Was allein das Nützliche zum Maßstab hat, sei meist häßlich, heißt es. Ein Métroplan scheint für Pariser aber übersinnlich zu wirken, denn mit einem Wandgemälde aus Kacheln in Weiß, Rot, Schwarz, Gelb wurde die große Rückwand eines sechsstöckigen Schlafsilos geschmückt, auf dem Wegzeichen, Eingänge und Kreuzungen der unteren Welt als Plan von Paris entstehen – so, als wolle oder solle (?) man nach métro-boulot-dodo sogar noch davon träumen.
Aber auch in Paris ist die Métro weniger schön als die Polis. Dort, wo der Blick nicht durch schöne Fassaden getäuscht wird, spielen sich Leid, Qual, Einsamkeit vor aller Füßen ab. Da sitzt jemand schweigend, vielleicht vor einem Pappschild oder einem Hut, da hält ein Alter mit gesenktem Blick seine Handfläche nach oben; niemand kann dem entweichen, nur schlechten Gewissens wegschauen, aber dann bleibt immer noch Betroffenheit. Solidarität zeigt diese Menge nicht; der einzelne eilt vorbei, weil Eile ein Teil der Sühne in dieser Unterwelt ist. Ein Musiker hat deshalb ein Klavierstück über die Métro komponiert, er nannte es: »Nachgeahmter Galopp für Piano«.
Um ein Uhr nachts wird die Métro geschlossen. Der letzte Diensthabende zerrt vor die Eingangsschlünde große Scherengitter, windet Ketten herum und sperrt sie mit Schlössern zu. Nur in Wintermonaten, wenn draußen kalte Ostwinde es unmenschlich erscheinen lassen, die dort tagsüber auf den Bänken Wohnenden aus dem warmen Mief, der seinen besonderen Geruch hat, zu vertreiben, richtet man Obdachlosen in einem Métroschacht auf Feldbetten das Nachtquartier ein.
Man glaubt zwar, die Kriminalität sei unter der Erde größer als in den Straßen, doch dieser Glaube entspringt nur der ewigen Angst, die man vor dem Dunkel hat, vor Höhlen, vor Tunneln. Nimmt die Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft zu, dann steigt sie auch in der Métro. Polizeikontrollen beruhigen die Kunden mehr, als daß sie Diebe abschrecken. Jeder kennt einen, der in der Métro bestohlen worden ist. Jetzt sieht man sie immer mehr, die schwarzgekleideten Kerle mit den gefährlichen Hunden.
Mit versteckter Kamera und vier Schauspielern wurde ein Experiment gedreht: Hauptverkehrszeit. Drei als Raudis verkleidete Männer rauben in einem Gang, in dem viele Menschen dahinhasten, einem Mann die Aktentasche. Einer rempelt ihn an, er fällt gegen die Wand, der zweite entreißt ihm die Tasche. Niemand reagiert. Zweiter Versuch. Da greift ein kräftiger Mann ein, allerdings hilft er nicht dem Angegriffenen, sondern packt den, der die Aktentasche entrissen hat. Doch ehe die erhobene Faust niedersaust, wird der Mann über den Versuch aufgeklärt.
»Da habt ihr aber Glück gehabt, daß ich nicht gleich zugeschlagen habe«, meint er.
»Weshalb haben Sie denn nach der Tasche gegriffen und nicht dem Überfallenen geholfen?«
»Wenn mir so was passiert, möchte ich doch auch als erstes meinen Besitz wiedererlangen!«
Auf jedes Jahr kommt ein Mord in der Métro. Ist das viel bei einer Milliarde Passagiere in zwölf Monaten? Selbstmorde, Leute, die sich vor einen Zug werfen, auch das gibt es. Sie führen zu zwei Opfern, heißt es abschreckend in einer Negativwerbung: dem Selbstmörder und dem geschockten Zugführer. »Zazie dans le métro«, Romanschriftsteller, Filmemacher nutzen die Kulisse gern, besonders für Krimis. Die Wirklichkeit ist banaler. Taschendiebe und Kleinhändler in Sachen Drogen werden durch Türschlitze oder mit versteckten Kameras beobachtet und blitzschnell gegriffen. Oder auch nicht.
Der Überfall in der Métro wird dann durch Rollentausch zum Witz in der Werbung. So sieht der Spot aus: Ein junger, unrasierter Kerl, flott, mit modischer Sonnenbrille und in genoppter Lederkleidung, steht vor einem Automaten auf dem Quai und macht sich mit dem neuen Batterie-Rasierer (für den geworben wird) schön. Da nähern sich drei vornehm gekleidete Männer, sie wirken mit ihren Zweireihern und Aktenköfferchen wie Bankiers. Drohend gehen sie auf den Lederkerl zu. Schnitt. In Unterhosen kommt der Knabe aus der Métro, seine Freunde stehen oben bei ihren Motorrädern und lachen ihn aus. Schnitt. Unten in der Métro ziehen die Bankiers die Lederkleidung an, und einer rasiert sich mit dem neuen Produkt. Vorhang. Lachen.
Traurig und abgewrackt fand Franz Kafka die Reisenden, als er Anfang des Jahrhunderts in Paris weilte. Andererseits, meinte er, gebe die Métro die beste Gelegenheit, sich einzubilden, man habe schnell die Essenz von Paris verstanden. Ein paar Jahre später fügte der französische Schriftsteller und Kritiker Jean Paulhan hinzu: Für den Métrofahrer bestehe die Gefahr darin, sich an diese Welt so zu gewöhnen, daß er sie, durch die täglich genossene Dosis, schließlich nicht mehr entbehren könne. Das nenne man dann die »Métromanie«.
Nichts macht heute süchtiger, als was modern ist. Mal Sex, mal Kokain, mal das, was manche Kultur nennen. Und mit der Droge Métro spekuliert die Unternehmensleitung, so, als mache Métrofahren schön und glücklich. Ein Werbespot der Métro endet mit einem Pärchen, das auf einer Bank schmust, verliebt ist und plötzlich in Hochzeitskleidung dasitzt. Eine weiße Taube fliegt herbei und setzt sich auf ihren Schleier. Dann schließt sich der gelbe Vorhang mit dem braunen Querstreifen.
»Ticket chic, ticket choc«, spricht sich gut; »ticket chic, ticket choc«, klingt nach alter Eisenbahn; auch Rock zuckt im Rhythmus mit. Der Sinn dieses Spruchs? Das Eintrittsticket in die Métro sei so schick, daß es einen Schock versetze. Und dieser Gedanke wird vermarktet, in der Métro natürlich. In einem der vielen kleinen Läden in den Métrostationen sind métrogelbe T-Shirts mit magnet-braunem Streifen zu kaufen, dazu Handtücher, Radiergummis, Bleistifte, Mützen, Schals, was immer an Überflüssigem Geld bringt. Das »ticket chic, ticket choc« wird kulturell überhöht, und damit alles, was mit Métro verbunden ist. Die Métro, so ein Slogan, sei der Zweitwagen jeder Pariser Familie, für die meisten ist dies wohl der Wagen mit Chauffeur. Und weil es gelungen ist, das »ticket chic et choc« zum gesellschaftlichen Symbol hochzustilisieren, läßt es sich auch von Bastlern verarbeiten. Um dies in der Métro zu tun, brauchen sie nur eine Genehmigung für acht Mark, und so sitzt tagaus, tagein derselbe Bastler in der Station Palais Royal und falzt die Papierrechtecke geschickt zu Eiffeltürmen, Aschenbechern, Ohrringen und verhökert sie. Nicht teuer, aber sicherlich äußerst gewinnbringend, denn das Rohmaterial braucht er nur auf dem Boden aufzusammeln.
Die Métro, sagt Philosoph André Glucksmann, sei das wahre Kulturzentrum Frankreichs, da träfen sich alle Völker, Kulturen, Ausdrucksformen. Sicher nicht auf allen Linien. In Richtung Clignancourt stimmt das vielleicht, da fahren die Araber und Afrikaner in ihr Viertel. Aber gewiß nicht auf dem Weg zum Pont de Neuilly. Und nicht jeder steigt herab. Schließlich fährt oben der Bus, wenn auch die meisten dieser Gefährte ihre hintere Plattform verloren haben. Doch wer das Licht vorzieht oder die Menge scheut, der weiß bestens Bescheid über das komplizierte Geflecht von 62 oder 93, über Busstationen und wo man von Linie zu Linie umsteigt oder wo man durchfahren kann. Direkt geht’s eigentlich nie.
Irgendwann aber wird man doch von Maloche und Pofe eingeholt. Um sechs Uhr abends läßt man schon mal einen Zug weiterfahren, hoffend, daß der nächste weniger überfüllt ist. Wenn man dann im Wagen sitzt oder eingequetscht steht und doch allein ist, der Blick nicht mehr abgelenkt wird, versinkt man in sich selbst, der Geist löst sich, tritt einen Augenblick neben den Körper, erstarrt für Sekunden unter der Erde. Begräbnis der Träume in der Métro. Was bleibt nach der Maloche? Métro und Pofe.
Elysische Gefilde
Die Raffgier führt vielleicht nicht zum Untergang des Abendlandes, doch zu dem jener Pracht-Avenue, die in ihrem Namen den Mythos des Paradieses trägt. Sogar die »International Herald Tribune«, deren Redaktion in der nach Westen verlängerten Achse der Champs-Élysées liegt, bezeichnete sie letztens als »paradise lost«, als verlorenes Paradies. Denn »Kaufen, kaufen, kaufen!« lautet das Motto derjenigen, die das Kultobjekt Champs-Élysées betreten – oder betreiben. Kaufen, wie im Rausch ständig wiederholt … Massenware bringt nun einmal mehr als ein einzelnes, noch so teures Edelprodukt. Denn trotz Mengenrabatt sind die Endpreise so überhöht, daß ein echter Pariser dort keinen Laden betritt. Nur Leute aus der Provinz oder Touristen »from all over the world« glauben, Pariser Schick verbinde sich mit dem Wort Élysée. Die großen Namen aber haben diese Gefilde längst verlassen.
Die schönste Avenue der Welt, das Symbol des Goldenen Zeitalters, der Mode und des Films, so sahen die Franzosen die Champs-Élysées noch in den sechziger, vielleicht sogar in den siebziger Jahren, aber sicher nicht mehr in den Achtzigern, da merkte selbst der letzte schwärmende Blinde, daß hinter den inzwischen durch Sand- oder Wasserstrahl geweißten Kalkfassaden das Gold dem Glitter gewichen ist. Mit drei Worten bewarf die französische Presse die Champs-Élysées, so als seien es Schlammbollen: »Banalisation, Banlieusardisation, Boulevardisation«. Schlimmer konnt’ es nimmer kommen. Banalisation kann nichts anderes bedeuten als den Verlust von Mythen; aus der Banlieue drängen statt der Stars nur noch deren Autogrammjäger ins Zentrum, das stil-, also kulturlose Massenpublikum, das diese Avenue zu einem alltäglichen Boulevard verkommen läßt, wo Lust dem Lüsternen weicht.
So sind auch die Beine der Lustobjekte länger geworden – im Lido, wo vor sechzig Jahren, als der Nachtclub gegründet worden war, nur Französinnen tanzten, sind die heute in der internationalen Tanzgruppe rares Futter. Als für die französische Aufführung des Musicals »Cats« in Paris Tänzerinnen ausgesucht wurden, klagte der Regisseur über die kurzen Beine der sich bewerbenden Französinnen. Wenn auch die Show im Lido immer noch perfekt ist, der Champagner ist gerade gut genug für den banalen Boulevardbesucher aus der Banlieue oder von weiter her, Euskirchen oder Osaka, eben für den, der sich von Lichtern täuschen läßt: Nächtliches Geglitzer macht sie schön für Touristen, die sich wie Motten von den Champs-Élysées anziehen lassen, weil sie, die Avenue, überall in der Welt ein Pariser Klischee ist wie der Eiffelturm.
Noch spät am Abend bilden sich Schlangen auf den Trottoirs, aber die Wartenden verharren nicht auf der Suche nach Mangelware, sondern um sich für zwölf Mark auf der Leinwand etwas vorflimmern zu lassen. Trotz des Ansturms der Banlieue haben manche Kinos geschlossen. Andere haben ihre großen Säle in unbequeme kleine Kästen gesplittet und mußten wahrscheinlich gerade deshalb dichtmachen. Ein paar kluge Geschäftsleute habe ihre Cinéma-Säle mit äußerst bequemen Sesseln versehen; man sitzt dort wie im Salon und genießt: Das zieht die kinogeile Masse natürlich an – auch wieder aus der Banlieue, die weiß, daß hier mindestens ein Kino den Sex- oder Actionfilm spielt, den man sehen möchte, nicht aber die Wiederholung eines Klassikers.
Und über Ladenschlußzeiten lacht, wer kurz vor Mitternacht im Kaufhaus Prisunic oder bei Virgins, Europas größtem Plattengeschäft, sein Konto per Kreditkarte belasten will. Apropos Geschäftszeiten: Sonntags müßte Virgins, ginge es mit rechten Dingen zu, schließen, aber da ist halt der Zustrom der jungen Leute so groß, da macht das Geschäft solch einen Bilanzsprung nach oben, daß trotz Verbots die Kassen süßer nie klingeln. Da spielt es auch keine Rolle, daß die Präfektur jeden Montag einen Strafbefehl über mehrere zehntausend Franc schickt – das ist im Gewinn eingeschlossen.
Rummel zehrt und schafft Appetit. Weil die Champs-Élysées keine Pause kennen, schließen manche Lokale überhaupt nicht. Und hat er einen hinter die Binde gegossen, läßt ein Vorstadtprotzer im Verkehr auch mal die Sau raus, startet an der Ampel mit seinem Motorrad so gewagt, als befände sich der Cowboy beim Rodeo, das Vorderrad hoch über den Kopf gerissen, schräg eingestellt, mit der Arschbacke auf dem tief unten hängenden Sitz kurz über dem durchdrehenden Hinterrad, und laut röhrender Lärm zieht die Blicke an. Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob er es schafft, bis zu nächsten Ampel auf dem Antriebsrad zu fahren. Nicht immer klappt’s. Bis zum frühen Morgen wird man von Bremslichtern geblendet, und noch bevor der Kater einsetzt, beginnt der Berufsverkehr. Jeden Montag, wenn ich beim Rond Point die Avenue überquerte, um ins Büro zu gehen, lagen da die Glasscherben oder waren die Neonleuchtzeichen in der Straßenmitte umgesäbelt.
Unten am Obelisk, auf der Place de la Concorde, liegt die Wurzel der Champs-Élysées, deren wahrer Existenzgrund ist, Prachtstraße zu sein. Deshalb schmücken das Pflaster alle Arten von Zeichen, die nicht dem normalen Verkehr dienen: gelbe Kreise, grüne Punkte, Pfeile, die im Laufe des Winters verblassen und jeden Sommer nachgemalt werden. Damit sie, die Statisten von Militärspektakeln, ihre Rolle an der rechten Stelle der Bühne spielen, folgen sie mit ihren Stiefeln, Pferden, Panzern oder Lafetten den gelben und grünen Markierungen. Als sie vor zweihundertfünfzig Jahren geplant wurden, führten die Champs-Élysées durch sumpfiges Gebiet. Doch bald schon machte Napoleon sie zur Paradestraße Frankreichs, und voller Hochachtung nannte man sie eine Avenue, nicht einen ordinären Boulevard. Und jeden Juli, genauer gesagt – wer wüßt’ es nicht – am 14., gedenkt man mit einer Parade der Revolution.
Und Paraden sind es, die die Champs-Élysées mit Frankreichs Geschichte verbinden. 1944 haben die Alliierten die Deutschen aus Frankreich vertrieben, doch Paris zurückzuerobern, das überließen sie den französischen Truppen, so daß General de Gaulle die befreiten Champs-Élysées hinuntermarschieren und den Franzosen vorgaukeln konnte, ihr Land sei eine der Siegermächte. Nun gut – moralisch war das ja auch ein bißchen so! Doch kurz zuvor noch hatten die Herren mit dem Stechschritt Paris einen Blitzbesuch abgestattet und an der Place de la Concorde einen Wegweiser aufgestellt, der die Kilometer nicht nur nach Berlin, sondern auch nach Murmansk und Kiew angab.
Weniger martialisch hatten die Franzosen das Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert. Damals gab man noch zu, daß der Krieg tötete und verletzte. Da schleppten sich Veteranen auf Krücken, nicht-uniformierte Heldenbrüste auf dürren Beinen, das Pflaster hoch. Übrigens liegt sie nicht flach, die Avenue, nein, jeder, der in die Pedale tritt, weiß, sie steigt nicht unbedeutend zum Triumphbogen an, so daß sich die Avenue nach unten hin ganz Paris eröffnet, nach oben aber, am Ende der elysischen Gefilde, der freie Himmel den Träumen Platz läßt.
Parademarsch schwebte Napoleon wohl vor, als er 1806 die Schlacht bei Austerlitz gewonnen hatte und den Triumphbogen in Auftrag gab. Und weil dort heute das Grab des Unbekannten Soldaten – aus der Schlacht von Verdun – liegt und die ewige Flamme brennt, wird sie, die Avenue, zum Ärger der Pariser, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, häufig morgens von halb zehn bis zehn gesperrt. Dann nämlich, wenn Staatspräsidenten, Könige oder Kalifen kommen und das Ritual der Kranzniederlegung zelebrieren, werden alle Zufahrten gesperrt. Leer liegen die Champs-Élysées dann da, niemand schaut hin, nur eine Karawane schwarzer Limousinen rollt bedächtig nach oben. Und links und rechts gibt’s einen Stau, der sich in die ganze Stadt fortpflanzt und bis in den Abend hinein zu verspüren ist.
Bevor aber der hehre Kaiser Napoleon kam, tummelten sich die niederen Gelüste hinter den Büschen, denn im 18. Jahrhundert war die spätere Avenue eher ein sumpfiger Pfad. Nur die unten an die Tuilerien anschließenden Gärten wurden besucht, denn sie grenzten an die Parks der großen Palais, die an der Nordseite entstanden waren – darunter das heute noch berühmteste, in dem einst Madame de Pompadour lebte: das Palais de l’Élysée. Weil es dort aber häufig nicht mit rechten Dingen zuging, wurde ein Wachposten mit Schweizer Garden eingerichtet. Allerdings ließen die Soldaten sich gern mit den leichten Mädchen ein, betranken sich und begannen allerlei Händel mit den Spaziergängern oder anderen Soldaten.
Doch nicht nur die Wache sorgte für Aufregung, im Protokoll vom November 1788 vermerkt ein Wachmann: »Verhaftet, gegen acht Uhr am Abend, einen Geistlichen mit einer Negerin, der vorgab, ihr Beichtvater zu sein und sie zu unterrichten. Freigelassen, mit dem ausdrücklichen Befehl an Monsieur, den Geistlichen, nicht noch einmal unter den Bäumen die Beichte abzunehmen, besonders nächtens nicht.«
Mit der Revolution sieht die Avenue am 5. Oktober 1789 die von Théroigne de Méricourt und Reine Audu angeführten Frauen nach Versailles ziehen und die königliche Familie nach Paris holen; Chateaubriand beschreibt den vorbeiströmenden Tumult. Und als der geflüchtete Louis XVI mit seiner Familie in Varennes festgenommen wird, führt man ihn über die Champs-Élysées zurück nach Paris, vorbei an den Wachen, die ihre Gewehre mit dem Kolben nach oben präsentieren. Plakate weisen das Volk zum Stillschweigen an: »Wer dem König Beifall spendet, wird geprügelt, wer ihn beleidigt, wird gehängt.«
Nach der Terreur kommen die lebensfrohen Sitten zurück. Heute noch unvergessen ist der Auftritt von Madame Hamelin, die dort nur mit einer durchsichtigen Gaze-Tunika bekleidet spazierenging. Was hat sich seitdem geändert, außer daß wir prüder geworden sind? Die leichten Mädchen stehen jetzt nicht mehr am unteren, sondern am oberen Teil der Avenue, dort, wo die Leute aus der Banlieue mit dem Auto oder der RER, der Vorortbahn, eintrudeln. Und sie sind leider wärmer angezogen – nicht nur in Gaze.
Wenn die Sonne scheint und es wieder warm wird in Paris, dann bevölkern sich auch heute noch die Bänke in der Mittagszeit oder nach Büroschluß mit Männlein und Weiblein, die überwältigt von ihren Sinnen sich umschlingen, als seien sie der Geistliche und seine Negerin, die die Welt um sich herum vergessen – samt den vielen Polizisten, die hier mit Maschinenpistolen unterm Arm herumlungern, um den Präsidenten im Palais de l’Élysée zu schützen. Aber die schreiben niemanden mehr auf, verbieten niemandem, seine Liebe zu beichten.
Nur das untere Drittel der Avenue nennt man den Garten, le Jardin des Champs-Élysées. Zwischen alten Bäumen verstreut stehen prächtige Pavillons, drei für pompöse Restaurants, drei für die Theatermuse Thespis. Und nicht zu vergessen die Palais, Le Petit et Le Grand, das kleine und das große – moderne Bauten, als man sie errichtete: Eisen- und Glaskuppeln. Und oben an den Dachkanten und über den Portalen – heute wegen des Kitsches zum ironischen Lächeln verleitende – Figuren, aus Stein gehauen, meist Damen oben ohne, die sich regen und räkeln. Sie schauen hinab auf Leute, die bei Hitze oder Kälte, bei Regen oder Schnee Schlange stehen. Manchmal dauert es zwei Stunden, bis es einem von ihnen gelingt, ein kleines rosa Papier zu ergattern: Für den Preis einer Kinokarte ersteht man das Privileg, eine Kunstausstellung zu betrachten, von Rembrandt bis Picassos Erbzahlung an den Staat, von den ekelhaften Dickleibern des späten Renoir bis zu den wilden Tieren Henri Rousseaus. Von überall aus Europa kommen die Kunstbeflissenen, so als handle es sich bei den bedeutenden Ausstellungen im Grand Palais um die Kaaba von Mekka: Kultur als Religionsersatz (die Werke im Petit Palais gelten als Zugabe).
Einer besonderen kulturellen Leidenschaft frönen jene, die sich dienstags und donnerstags an einer bestimmten Ecke treffen: Louis-Philippe, Frankreichs letzter König, hat den Briefmarkensammlern das Privileg eingerichtet, an diesem Ort ihre Wertobjekte zu tauschen oder gar zu verkaufen, wobei gute Schnäppchen nicht selten sind, denn manch ein Unwissender trägt das ererbte Album hierhin, ohne zu wissen, welche Schätze es birgt. Aber der Erbe geht gerade an diese Ecke, die vom Rond Point über das östliche Trottoir der Avenue Matignon und das südliche der Avenue Gabriel den Jardin de l’Élysée eingrenzt, weil Geschäfte hier per Handschlag und bar abgeschlossen werden. Auf diese Weise hofft der Verkäufer, die Erbschaftssteuer zu sparen. Auf dem Gehweg der Avenue Matignon sitzen die Tauschhändler auf mitgebrachten Faltstühlen, auf den grüngestrichenen Parkbänken oder bleiben stehen, haben vielleicht zwei oder drei aufgeklappte Alben vor sich hingelegt, während in der Avenue Gabriel richtige Stände mit Eisenstangen und Zeltplane das Geschäft seriöser erscheinen lassen: In Kästen oder Plastiktaschen werden alte Postkarten angeboten, geordnet nach den Straßen von Paris oder den Gegenden Frankreichs. Die Händler sind fix, folgen den Zeitläuften – und haben hier als erste das neue Sammlerobjekt Telephonkarte entdeckt. Und schon kostet manch ausgefallener Plastikchip bis zu 10000 Franc. An diese Ecke der Avenue verirrt sich kein Banlieusard, kein Tourist, höchstens ein Filmteam, das die Szene anschließend im Studio mit Audrey Hepburn und Cary Grant nachdreht – und damit ist Pariser Flair eingefangen.
Ein Denkmal seien sie, die Champs-Élysées; ein Denkmal für die Geschichte, Kultur, Zivilisation Frankreichs. Davon weichen die Pariser trotz aller Kritik nicht ab. Und so sieht es auch der Vorstadt-Beau, der sich John nennt, mit schwarzer Lederkleidung und Texas-Boots über die Avenue schlendert und auf der Lehne einer Bank Platz nimmt, die spitzen Lederstiefel auf die Sitzfläche stellt und mit dem Kamm über die ölige Elvis-Schmachtlocke fährt: »Für mich sind die Champs-Élysées ein Denkmal, selbst um vier Uhr nachts gibt’s noch zu essen und zu trinken, und man trifft immer Leute.« Die Nouvelle Cuisine der Champs-Élysées stammt nicht mehr aus dem Lyonnais, sondern aus den Massenküchen, wo Fritten und Hamburger mit Ketchup auf Pappgeschirr in Sekundenschnelle hergerichtet und gleich hinter der Kasse verschlungen werden, wo man nicht den Rat des Kellners braucht und lange darüber grübelt, ob ein Sancerre besser dazu passe als ein Pouilly fumé. Da klagen sie wieder, die alten Pariser: »Avenue«, diesen Prestigenamen verliere sie nun wirklich, sie sei wahrhaftig nur noch ein Boulevard (und ganz Böse sprechen das Wort auf amerikanisch aus, um ihre Mißachtung über den Zerfall der Kultur kundzutun), ein Boulevard also, auf dem Massenbedürfnisse befriedigt würden. Wer kennt denn noch die Namen der verflossenen Restaurants, Hotels und Kinopaläste, wer denn?
Aber ein Trost bleibt, nicht nur die Fassaden sind geputzt worden, nein, auch der Massenmüll auf den Gehwegen wird ununterbrochen weggesaugt, von eigens hierfür entwickelten Autos, kleine, grün gesprühte Elektrowägelchen mit großer Plastikkanzel für den natürlich auch grün gekleideten Fahrer, der einen mehrere Meter langen, beweglichen grauen Schlauch von bestimmt fünfzehn Zentimeter Durchmesser vor sich herlenken kann, um aufzusaugen, was das Erscheinungsbild eines lebenden Denkmals stören könnte.
Aber nichts ist billig hier, trotz Massenproduktion der Fritten. Versteckten sich hinter den Fassaden einst prachtvolle Salons, so wurden sie zu muffigen Büros, denn für einen Quadratmeter erhält man, ohne zu feilschen, tausend Mark Miete pro Monat; nun kann man auch in Paris nicht ohne weiteres seine Wohnung in ein Büro verwandeln, doch manch ein Beamter zeigte für ein paar Franc mehr ein weiches Herz. Kein Wunder, daß gerade noch fünfundfünfzig wahlberechtigte Franzosen an der Prachtstraße wohnen, über deren Trottoirs täglich etwa 150000 Menschen trampeln, weshalb dies für bettelnde Zigeunerfrauen mit kleinen Kindern ein beliebter Arbeitsort ist. Man ist ganz froh, wenn man auf alte Leute trifft, die noch Werte haben.
Das Café de Paris, eines der ältesten an den Champs-Élysées, wahrt seine Tradition, paßt nur die Preise an. Die Besitzer hatten schon längst lukrative Angebote, doch sie wollen der Fritten-Invasion nicht weichen. Schließlich hat das Café de Paris seine Geschichte: Söldner aus aller Welt trafen sich hier zum Rendezvous mit Umstürzlern, die über pralle Krokobrieftaschen verfügten.
»Seitdem die Vorortbahn bis zu den Champs-Élysées führt«, klagt Monsieur Michel, seit fünfundzwanzig Jahren Kellner im Café de Paris, »kommen viele Leute aus der Banlieue. Das hat die Kundschaft unangenehm verändert, denn heute bleibt die bürgerliche, sehr vornehme Gesellschaft weg.«
Aber manch vornehmer Kunde wird noch mit Polizei-Eskorte im ältesten Lokal der Champs-Élysées abgesetzt, im Fouquet’s, welches als wahrer Freßtempel von Paris gilt, nicht das Maxim’s, wo sich nur noch amerikanische Millionäre sättigen, im guten Glauben, mitten in das Pariser Leben eingetaucht zu sein, was auch nicht ganz falsch ist, allerdings – es ist Jacques Offenbachs operettenhafte Inszenierung. Wenn Belmondo, Delon, Chabrol oder Lelouche einen Film planen, dann bereden sie ihn bei Fouquet’s am Mittagstisch, wenn der Film Premiere hatte, dann ziehen sie zur Feier ins Fouquet’s, und wenn schließlich der Abend mit der Verleihung der Césars, der französischen Filmtrophäe à la Oscar, bei viel Champagner ausklingen muß, dann natürlich bei Fouquet’s. Wenn Politiker, Industrielle, Bankiers sich verabreden – zuerst einmal versucht man einen Tisch bei Fouquet’s zu reservieren.
Oben, neben der Küche, kann man sich ins Chambre séparée verkriechen, und dort treffen sich regelmäßig ein paar reiche Leute, die geheimnisvoll wie Mafia-Bosse darüber beraten, wie man die Champs-Élysées retten könne. Natürlich geben sie nicht offen zu, daß sie gegen Fritten-Buden und Fummel-Boutiquen zu Felde ziehen, aber sie haben schon Angst, daß die Kinos bald in Sexshops und Peep-Shows verwandelt werden. »Die Champs-Élysées sind eine solch großartige Avenue, daß wir sie im jetzigen Zustand bewahren wollen«, sagt Maurice Cazeneuve, ehemaliger Fernsehintendant, der als Sprecher der Kaufleute, Medienzaren und Restaurantbesitzer, die sich versammelt haben, auftritt. Und dann meint er ganz rührend: »Wir wollen, daß für unsere Kinder die Champs-Élysées bleiben, was sie waren.«
Seit fast hundert Jahren steht die Bar des Fouquet’s, und Bilder berühmter Damen wie Sarah Bernhardt hängen an der Wand neben einem Schild, das unbegleiteten Frauen den Zutritt verbietet. Man möchte das ambulante Gewerbe fernhalten. Aber gleich neben der Bar gibt das Restaurant mit hier aufgenommenen Photos von Marilyn Monroe an. Viele Tische sind mit Namensschildern aus Messing versehen und geben so Auskunft über die Lieblingsplätze verstorbener, aber auch noch lebender Größen. Der unvergeßliche Charmeur Maurice Chevalier hatte seinen Stammplatz an einem Tisch neben dem von François Truffaut und Orson Welles. Und diejenigen, die heute noch regelmäßig kommen – und nach französischer Vorstellung weltberühmt sind –, haben einen eigenen silbernen Serviettenring.
Aber auch hier hält nichts ewig. »Die Macht des Geldes verändert die Avenue«, klagt auch Maurice Casanova, Besitzer von Fouquet’s, und wie ein alternder Don Giovanni sieht er wirklich aus – mit seinem künstlich geschwärzten Haar und dem gepflegten Bärtchen. »Durchs Geld werden Läden von niederem Niveau angezogen. Früher gab es hier nur Luxusgeschäfte, aber was die Immobilienspekulation schafft, sehen Sie selber.« Und dann macht er sich wieder Mut: »Trotzdem bleiben die Champs-Élysées triumphal, so wie sie Ludwig XV