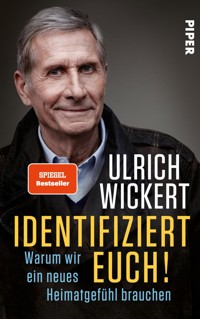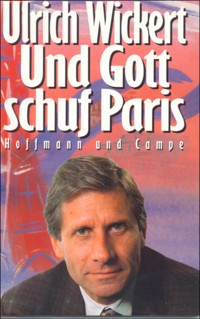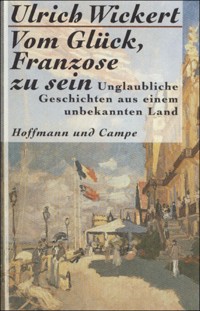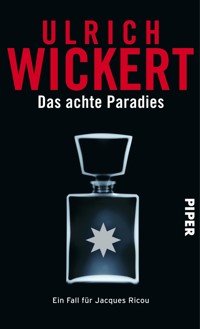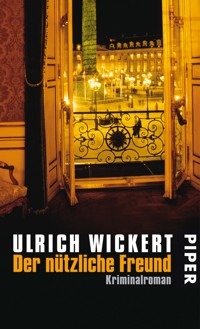21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
23 Kriege haben Frankreich und Deutschland in den letzten 400 Jahren geführt. Für den jungen Ulrich Wickert war Krieg mit Frankreich etwas ganz Normales. Wickert erzählt entlang seiner Biografie, wie die Freundschaft der »Erbfeinde« zur Europäischen Union führte. Als Journalist erlebte er persönlich, wie französische Präsidenten sich mit deutschen Kanzlern anfreundeten oder miteinander fremdelten. Er lernte sie alle kennen und erzählt unterhaltend auch von deren menschlichen Schwächen. Ulrich Wickert wirbt in seinem neuen Buch sehr entschieden für diese zentrale Säule eines starken Europas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Manfred Witt / VISUM
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Einige Worte zum Anfang
Die Schatten der Vergangenheit
Aller Anfang
Das Verständnis vertiefen
Vertrauen ist alles
Boches, Bismarckheringe und ein Nichts
Träume bringen die Welt voran
Eine Ohrfeige schreibt Geschichte
Im Augenblick der Versöhnung
Gut verdrahtet ist halb gewonnen
Erzangst
Es menschelt
Dämonen und Garantien
Erkenne dich selbst
Denk ich an Deutschland
Eine neue Generation
Dialog der Kulturen
Verstehen, um zu lieben – Lieben, um zu verstehen
Eine neue Partnerschaft
Beziehungskrise – Trennung von Problemen, nicht vom Partner
Postskriptum
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Einige Worte zum Anfang
»Der Bundeskanzler ist empört!«, beklagten sich Mitarbeiter von Olaf Scholz im Frühjahr 2024. Natürlich nur im Hintergrundgespräch! Er ist empört über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der hatte sich in einer Pressekonferenz in Paris süffisant über die deutsche Politik geäußert, als Olaf Scholz sich gegen Macrons Idee vom Einsatz von NATO-Soldaten in der Ukraine ausgesprochen hatte. Macron lästerte, dass die Deutschen zu Beginn des Ukraine-Krieges Helme und Schlafsäcke zur Unterstützung angeboten hatten.[1]
Die Presse beider Länder nimmt sich immer genüsslich vermeintlicher Krisen zwischen dem »couple franco-allemand – dem deutsch-französischen Paar« an.
Die französische Tageszeitung Le Monde widmete zwei ganze Seiten dem »tandem à l’épreuve de la guerre – dem vom Krieg geprüften Gespann«[2] und beschrieb den Kampf um die Führerschaft in Fragen der Verteidigung. Das ist in der politischen Beziehung zwischen Paris und Berlin nichts Neues. Mal ist der Kanzler empört, mal bemängelt der französische Präsident Emmanuel Macron öffentlich, Deutschland isoliere sich zunehmend in Europa. Und dem folgt das Echo. Macrons Klage nahm Jacques Attali, ein in Frankreich hochgeschätzter Intellektueller und ehemaliger Berater der Präsidenten François Mitterrand und Nicolas Sarkozy, aber auch Mentor von Emmanuel Macron, zum Anlass für die Warnung, Deutschland dominiere Frankreich. Deshalb müsse die Integration Europas schnell vollzogen werden, sonst werde ein neuer Krieg zwischen Deutschland und Frankreich vor Ende des Jahrhunderts möglich sein.[3] Da ist sie wieder, die Angst vor dem »nächsten Krieg mit Deutschland«. Als ich die Warnung Attalis las, schüttelte ich den Kopf und dachte mir sofort: »Quatsch. Der Mann lebt im falschen Jahrhundert.«
Das Thema der Angst vor einem zu starken Deutschland belebt offensichtlich bei französischen Intellektuellen immer noch den Gedanken an Krieg. So erschien einige Zeit vor dem Schreckensschrei von Attali ein Buch mit ähnlichem Titel: Vom nächsten Krieg mit Deutschland. Ich sagte mir damals: Seit der letzten Schlacht herrschen Freundschaft, Wohlstand und Frieden. Mit solch einer sensationsheischenden und populistischen Überschrift wollen Autor und Verlag nur einfältige Käufer ködern. Fällt denn auf diesen Trick heute noch jemand rein – so lange nach dem letzten Krieg?
Dreiundzwanzig Kriege haben Frankreich und Deutschland in den vergangenen vierhundert Jahren gegeneinander geführt. Der letzte, der Zweite Weltkrieg, war so mörderisch, dass in der Folge gerade in diesen beiden Nationen die Idee eines geeinten Europas geboren wurde, um endlich dauerhaft Frieden zu schaffen.
Und dieses Ziel wurde Schritt für Schritt umgesetzt. Den ersten deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichneten zwei alte Politiker, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die von den letzten Kriegen persönlich geprägt waren. Sie schufen ein Geflecht von bürgerschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern. Das deutsch-französische Jugendwerk sorgte für den Austausch zwischen Jugendlichen, Städtepartnerschaften leiteten so manch eine deutsch-französische Ehe ein. Ein französischer Präsident Giscard und ein deutscher Kanzler Schmidt legten den Grundstein für eine europäische Währung und gründeten den G7-Gipfel. Der französische Präsident Mitterrand stand Hand in Hand mit dem deutschen Bundeskanzler Kohl auf dem Gräberfeld von Verdun – siebzig Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Ein Jahr zuvor hatten sie eine deutsch-französische Brigade ins Leben gerufen.
Das nach dem Zweiten Weltkrieg geteilte Deutschland wurde nach der Zeit des Kalten Krieges wiedervereinigt, Europa gedieh und einigte sich sogar auf eine gemeinsame Währung; auch um zu verhindern, dass sich ein durch die neue Einheit gestärktes Deutschland wieder aus der Westbindung – Europäische Gemeinschaft und NATO – löste und anstrebte, eine selbstständige Mittelmacht mit osteuropäischen Satelliten und einer eigenen Atomstreitmacht zu werden. Weshalb jetzt also die Befürchtung eines »nächsten Krieges«?
»Das Unverständnis ist total: Deutschland beunruhigt und erschreckt uns«, meint Autor Philippe Delmas, Absolvent der Eliteschule ENA, einst Berater von Außenminister Roland Dumas in Verteidigungsfragen, später Vorstand bei Airbus. Die Angst vor Deutschland sei – mehr als fünfzig Jahre nach Kriegsende – das größte Problem der Franzosen, wenn Deutschland drohe, die europäische Konstruktion zu verlassen, »denn das, sagte de Gaulle, kann nur mit einem Krieg geregelt werden«[4] – so Delmas.
Heute kann ich mir einen »nächsten« Krieg zwischen Franzosen und Deutschen nicht mehr vorstellen. Allerdings war Krieg gegen Frankreich für mich als junger Schüler ein Normalzustand.
Die Schatten der Vergangenheit
Die erste Erinnerung, die mich mit Frankreich verbindet, stammt aus dem Jahr 1956, nur elf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zwölf Jahre nach der alliierten Landung in der Normandie und der Befreiung von Paris und fast ganz Frankreichs von den Deutschen.
Die Familie war aus Heidelberg nach Paris gezogen, wo mein Vater als Diplomat bei der deutschen Vertretung der NATO arbeiten würde. Deutschland war seit 1955 Mitglied des atlantischen Verteidigungsbündnisses, dessen Hauptquartier sich damals noch in Paris befand.
Im Sommer mieteten wir uns ein Haus am Meer in Franceville an der normannischen Küste. Ich war dreizehn Jahre alt. Die Spuren der Kämpfe vom D-Day, der Landung der Alliierten im Juni 1944, waren noch überall gegenwärtig. Bunkeranlagen in den Dünen, verrostetes Kriegsgerät an den Stränden, hie und da versunkene Landungsboote. Ganz nebenbei: Noch heute verwenden viele Deutsche ganz nachlässig den von den Nazis benutzten Begriff »Invasion« für die alliierte Landung, die ja keineswegs eine Invasion – kein feindliches Einrücken in fremdes Gebiet – war, sondern zur Befreiung Frankreichs von den deutschen Besatzern führte.
Auch in Franceville war im Juni 1944 heftig gekämpft worden. Schon gleich nach unserem Einzug in das gemietete Häuschen hatte jemand nachts Hakenkreuze an den Zaun gepinselt. Wir Kinder wussten nicht, was dieses Zeichen bedeutete. Auf dem Friedhof von Franceville standen einige Holzkreuze über Gräbern deutscher Soldaten. Unser Vater kaufte einen Topf schwarzer Farbe und gab uns auf, sie zu streichen. Eine alte Frau aus dem Dorf sah das und gab mir die Erkennungsmarken der Gefallenen. Ich schickte sie an das Rote Kreuz in Deutschland, das mir später genaue Angaben über die Toten mitteilte. Sie waren alle gerade einmal zwanzig Jahre alt geworden.
Ein paar Monate zuvor war ich in Paris in die SHAPE International School gesteckt worden, eine Schule, die den Namen des Hauptquartiers der NATO trug, denn hier wurden die Söhne und Töchter von Mitarbeitern der Organisation unterrichtet. Die deutschen Kinder wurden morgens mit einem Bus der Bundeswehr zur Schule und abends nach Hause gefahren. Ein Bus in dunkelgrüner, matter Militärfarbe, den ein Soldat in deutscher Uniform steuerte. Für mich bedeutete das jeweils eine Stunde Fahrt. Der Schulbesuch fiel mir nicht leicht, da ich bis dahin nur knapp drei Sätze Französisch sprach. In Heidelberg war ich auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, wo man Latein und Griechisch lernte.
Der französische Lateinlehrer an der Schule sagte mir in freundlichem Ton: »Du kannst den Lateintext auch ins Deutsche übersetzen. Ich verstehe das. Ich war nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft.« Aber ich möge bitte nicht in Sütterlinschrift schreiben, die könne er nicht lesen. Ich dagegen hatte diese deutsche Handschrift noch in der Volksschule gelernt. Der Lehrer behandelte mich mit dem gleichen Respekt wie alle anderen und ließ mich nicht spüren, dass unsere beiden Völker vor Kurzem noch Feinde gewesen waren, die sich gegenseitig totschossen.
Die tägliche Fahrt im Bus war lästig und der Unterricht in der SHAPE School so wirr und chaotisch, dass wir häufig schwänzten. Zur Überraschung meiner Eltern bat ich, in eine andere Schule gehen zu dürfen.
Nur zehn Minuten mit dem Fahrrad von zu Hause lag »La Source – die Quelle«, noch heute ein renommiertes Montessori-Institut, das mich aufnahm. Meine Klasse bestand nur aus zwölf französischen Jungs und Mädchen, die mich wie ihresgleichen behandelten. Bald sprach ich fließend Französisch. Und für meine Mitschüler war ich ein Franzose.
Aber mir wurde mit der Zeit klar: Zum wahren Verständnis zwischen Völkern gehört mehr als nur die Sprache.
In Heidelberg hatten wir im Geschichtsunterricht gelernt, dass die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg Ende des 17. Jahrhunderts Heidelberg viermal überfallen und zerstört hatten. Und da wir Schüler uns als Kurpfälzer empfanden und ständig auf die schöne Schlossruine schauten, empfanden wir den lang zurückliegenden Krieg als persönlichen Angriff. Wir waren betroffen von den Grausamkeiten der französischen Truppen. Sie hatten Hunderte Heidelberger in die Heiliggeistkirche gesperrt und das Gotteshaus dann angezündet. Viele Familien kamen dabei ums Leben. Erst als die Balken und die Glocken herabstürzten, wurden auf Flehen eines jungen reformierten Pfarrers die Pforten geöffnet.
Der französische Brigadier Comte du Mélac, der für diese Grausamkeiten bei der Zerstörung der Stadt verantwortlich war, war in Heidelberg um 1950, als ich dort zur Schule ging, unvergessen. Denn manche Leute nannten ihre Hunde in Erinnerung an die von ihm befohlenen Gräueltaten »Mélac«.
Ende der 1980er-Jahre erlebte mein französischer Freund Maurice Gourdault-Montagne, später französischer Botschafter in Berlin, in Mainz eine ähnliche Szene, die er in seiner Biografie schildert:
»Ich ging in der Gegend von Mainz spazieren und kehrte auf der Terrasse eines Gasthofes ein, als ich zu meinem Erstaunen hörte, wie eine alte Frau ihren herumlaufenden Hund rief: ›Mélac, komm her!‹ Der Hund hieß Mélac, genannt nach dem General von Ludwig XIV., der in dieser Gegend berüchtigt war wegen Machtmissbrauchs und Kriegsverbrechen während der Kriege des 17. Jahrhunderts, und die Brandschatzung der Pfalz hat nun einmal stattgefunden. Selbst wenn die alte Frau den Hund aus Gewohnheit so genannt hat, ohne den Sinn zu kennen, so müssen doch die Ereignisse und der, der sie verursacht hat, die Bevölkerung so stark geprägt haben, dass Jahrhunderte später noch Haustiere solch einen Namen erhielten …«[5]
In Heidelberg trug mein Gymnasium den Namen des ehemaligen pfälzischen Kurfürsten Friedrich II., der diese Schule 1546 gegründet hatte, um Schüler als künftige Studenten für die schon 1386 errichtete Universität Heidelberg heranzuziehen. Unser Namenspatron lag in der Heiliggeistkirche begraben, die Mélac von seinen Leuten anzünden ließ. Deshalb interessierten uns die Gräuelgeschichten aus dem Pfälzischen Erbfolgekrieg besonders. Die Gründe für diesen Krieg lagen nach Ansicht unseres Geschichtslehrers weit zurück.
Im Jahr 855 ging das Mittelfränkische Reich unter. Von da an stritten sich das Westfränkische Reich, aus dem Frankreich entstand, und das Ostfränkische Reich, das damals von Ludwig dem Deutschen regiert wurde, um die Gebiete rechts und links des Rheins. Was als Familienstreitigkeit der Nachkommen Karls des Großen begann, wurde über die Jahrhunderte hinweg ein Kampf um Ländereien und Macht.
Besonders machthungrig zeigte sich im 17. Jahrhundert Ludwig XIV., der jeden Vorwand nutzte, um die Grenzen Frankreichs an den Rhein vorzuschieben. Nachdem er den Spaniern Teile der Niederlande und Luxemburgs abgenommen hatte, ließ er sich als »Ludwig der Große« feiern, rühmte Frankreich als la grande nation und beschloss mit einer windigen Begründung, das Erbe von Kurfürst Karl II. zu beanspruchen. Des Königs Bruder, Herzog Philipp von Orléans, hatte Lieselotte von der Pfalz, die Schwester des kinderlos gestorbenen Kurfürsten, geheiratet. Bei der Eheschließung war ihr Erbverzicht ausgehandelt worden. Doch diesen Ehevertrag ließ König Ludwig XIV. 1688 kurzerhand vom Pariser Parlament für nichtig erklären und schickte seine Truppen über den Rhein. Denn er wusste seinen deutschen Gegenspieler Kaiser Leopold I. an der östlichen Front von den Osmanen bedrängt. Dessen Truppen würden Frankreichs Armeen nicht an der Besetzung der Pfalz hindern.
Den französischen Soldaten gelangen zunächst schnelle Siege. Erst nach einigen Monaten bildete sich eine antifranzösische Koalition in Deutschland, um die Franzosen zurückzuschlagen. Die gingen allerdings mit größter Brutalität gegen die deutsche Bevölkerung vor. Der französische Kriegsminister Marquis de Louvois schrieb seinen Generälen: »Seine Majestät legt Ihnen nahe, alle Orte entlang des Neckar, die Sie verlassen, gründlich zu zerstören, damit die Feinde hier weder Futter noch Lebensmittel finden und deshalb auch gar nicht versucht werden, sich ihnen zu nähern.«
Auf einer Landkarte wurden Mannheim, Heidelberg, Worms und Bingen markiert. Aber auch andere Städte in der Kurpfalz ließ Mélac zerstören und verfolgte eine Politik der verbrannten Erde mit der Begründung, es herrsche Krieg.
In Flugblättern, die damals in mehreren Sprachen in ganz Europa erschienen, wurde die Berufung auf das Kriegsrecht verurteilt und der französische König Ludwig XIV. als Verbrecher bezeichnet. Die Franzosen wurden als »Erbfeind« der Christenheit mit den Osmanen gleichgesetzt.
Der Begriff Erbfeind bezeichnete damals den Satan, den Teufel. Er kommt zum ersten Mal in der 1575 in »Franckfurt am Mayn« gedruckten Schrift Theatrum Diabolorum vor. In diesem Text wurden die muslimischen Türken als »Erbfeinde« bezeichnet, und da Ludwig XIV. sich aus machtpolitischen Gründen nicht an der »Heiligen Liga« zur Verteidigung des Christentums gegen das angreifende Osmanenreich beteiligte, um seinerseits ungestört Elsass und Lothringen zu erobern, bezog die katholische Kirche, die damals erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung hatte, den Begriff vom »Erbfeind« auch auf Frankreich. Ein Begriff, der in Deutschland damals jedoch politisch kaum aufgegriffen wurde. Der Rhein wurde zur Grenzlinie zwischen dem Reich und den angeblich »blutrünstigen« Franzosen.
Zu meinen Erinnerungsstücken gehört auch ein Foto, das mir mein Großvater mitbrachte, als er uns 1957 in Paris besuchte. Es zeigt ihn am 22. Januar 1914 in Galauniform mit Pickelhaube, als er die Ehre hatte, als Leutnant der Reserve im »Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pomm.) Nr. 14« vor dem Kaiser zu dessen Geburtstag im Rittersaal des königlichen Schlosses in Berlin zu defilieren. Auf die Rückseite des Bildes hatte er geschrieben: »Erinnerung an stolze deutsche Vergangenheit«. Wir Enkel lachten heimlich über diese uns mittelalterlich erscheinende Verkleidung. Pickelhaube! So was konnte man in Paris billig auf dem Flohmarkt kaufen.
Als Fünfjähriger hatte mich Großvaters Glatze fasziniert und ich strich gern darüber, wenn er in seinem Ohrensessel saß und Pfeife rauchte. Er schien es zu genießen. Später stellte ich fest, dass er sich regelmäßig einen breiten weißen Haarkranz abrasierte. Als ich ihn fragte, weshalb er die Haare nicht wachsen ließ, erklärte er mir, er habe sich im Ersten Weltkrieg daran gewöhnt, die Haare zu rasieren, denn auf einer Glatze hielt der innen mit Ledergurten versehene Pickelhelm besser.
Mein Großvater hatte schon ab August 1914 am Feldzug gegen Frankreich teilgenommen. Als er uns in Paris besuchte, hatte er ein besonderes Anliegen, mit dem er meinen Vater belästigte. Denn mein Vater hatte zu meinem Großvater noch aus seiner Studentenzeit in den 1930er-Jahren ein gestörtes Verhältnis. Mein Großvater lebte im Geiste seiner Zeit als Offizier, mein Vater hatte mit Erfolg alles unternommen, um nicht dienen zu müssen.
Aber nun war Großvater nach Paris gereist, um von hier aus noch einmal zu den alten Schlachtfeldern an der Marne zu fahren. Einen ganzen Tag chauffierte mein Vater seinen Vater nach dessen Angaben durch die Gegend nordöstlich von Paris. Sie kamen schweigend zurück.
Sehr viel später konnte ich im Hausbuch der Familie lesen, was mein Großvater im Krieg erlebt hat. Das Buch hatte schon sein Vater 1920 angelegt, um niederzuschreiben, »was ich von meinem Vater selig von unserem Herkommen hörte«. Diese Chronik hat mein Großvater dann weitergeführt – beide schrieben in der alten Sütterlinschrift. Sachlich, ohne literarischen Anspruch, beschreibt er schreckliche Kriegsszenen, wie sie – mit unterschiedlicher Absicht, aber ähnlicher erzählerischer Kraft – Ernst Jünger in In Stahlgewittern und Erich Maria Remarque in Im Westen nichts Neues schildern.
Da heißt es zum 26. August 1914: »Im ersten Gefecht betrugen die Verluste unserer Kompanie 15 Mann. Davon 1 Fähnrich verwundet. Der Bataillonskommandeur, Major Giese, fiel als einer der Ersten. Die Franzosen hatten schreckliche Verluste.«
Einen Tag später, am 27. August: »Eigene Verluste: 2 Mann tot, 3 Mann verwundet.«
Am 28. August: »Gefecht bei Morval. Unsere Verluste wieder 5 Mann, ich selbst bekam nur einen Granatsplitter gegen die Stiefelgamasche … Aber am 29. selbst hatten wir bis dahin blutigste Gefechte bei Mericourt … Unsere Verluste in der Kompanie waren groß, etwa 80 Mann. Alle Zugführer waren verwundet, darunter auch ich. Ich hatte einen Granatsplitter durch den Helm über das rechte Auge bekommen. Einige Stunden lag ich besinnungslos; als ich aufwachte, fand ich neben mir einen Feldwebel tot und 3 Mann verwundet. Gegen Mitternacht kam ich ins Biwak zur Kompanie; dort hatte man mich schon tot gemeldet. Nach Anlegung eines Verbandes blieb ich bei der Kompanie.«
Mein Großvater dachte bis zu seinem Lebensende eher wie Ernst Jünger: Krieg ist ein Stahlgewitter. In den ersten Septembertagen 1914 notiert er über die Schlacht nördlich von Paris: »Ich konnte von meiner vorgeschobenen Stellung gut beobachten, dass der Kampf zu unseren Gunsten auslief. Die Franzosen hatten schreckliche Verluste. Bataillonsweise wurden sie niedergemäht. Es fehlte von uns aus nur noch der letzte Sturm. Den Befehl dazu erhielt ich am 9. abends 20:00 Uhr … Ich ließ alles zum Sturme vorbereiten – Sturmgepäck fertig machen, Mantel rollen, Seitengewehr aufpflanzen usw. Es war mir klar, dass von den ersten Sturmreihen – das waren wir – keiner lebend davonkommen würde, aber das war nicht zu ändern.« Doch nach zwei Stunden »kam von hinten der Befehl zum Rückmarsch. Der unselige Abbruch der Schlacht, das Marnewunder der Franzosen!«.
Ende November wurde mein Großvater an die Ostfront versetzt, im Januar 1915 mit einer Lungenkrankheit ausgemustert. Im Oktober 1914 hatte er das EK II erhalten, im August 1918 noch das EK I. Bis zu seinem Lebensende war er überzeugt, dass die Armee im Ersten Weltkrieg »im Felde unbesiegt« geblieben war. In seinen Erinnerungen ist Frankreich zwar stets der Gegner, aber er nennt ihn nie den »Erbfeind«.
Als Großvater abends vom Ausflug an die Marne zurückkam, meinte er: »Die Deutschen hätten weiter vorrücken sollen und Paris nehmen können. Wir vorne hätten es zwar alle nicht überlebt. Aber das wäre auch nicht zu ändern gewesen.« Eine Erinnerung aus einer anderen Zeit an eine andere Welt.
Wenn ich dies heute lese, dann schüttle ich nur den Kopf. Zu fern erscheint das alles. Und doch ist es nah: Als ich mit Claire, einer französischen Freundin in Südfrankreich, über die besondere Beziehung der Deutschen und Franzosen redete, erzählte sie mir die Geschichte ihrer Familie. Claire war in einem kleinen Ort in der Mitte Frankreichs aufgewachsen, hatte Anfang der 1970er-Jahre einen Deutschen geheiratet und mit ihm in Deutschland zwei Kinder bekommen, die einen deutschen und einen französischen Pass erhielten. In beiden Familien wurde nicht über den Krieg gesprochen. Erst Claires Sohn fing an, sich für die Familiengeschichte zu interessieren, und fand heraus, dass der deutsche Großvater im Ersten Weltkrieg im gleichen Frontabschnitt wie der französische Großvater gekämpft hatte. Beide hatten mit Kanonen auf den jeweils anderen gefeuert.
Da war sie greifbar, die »deutsch-französische Erbfeindschaft«, die Schriftsteller, Historiker und Politiker auf beiden Seiten veranlasst hatte, die Geschichte so zu interpretieren, dass sie in die Idee einer »Feindschaft« passte, die angeblich nur durch Krieg überwunden werden konnte. Den Deutschen diente der »Erbfeind« in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sogar dazu, die eigene nationale Identität zu begründen.
Wie lange die Hassgefühle auch bei Franzosen nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 noch wach geblieben sind, schilderte mir 1987 – damals war ich Korrespondent in Paris – ein Bekannter meiner Großeltern in einem Brief, über den ich heute noch schmunzle.
Am Abend des 16. August 1907 besuchte mein Urgroßvater zusammen mit zwei Deutschen, darunter der Vater des Briefschreibers, in Paris das Kabarett Tabarin. In dem Brief heißt es: »Bei diesem Besuch kam es zu einem Zwischenfall, der Ihren Urgroßvater in höchste Lebensgefahr brachte. Im Varieté-Programm trat eine Deutsch sprechende Artistengruppe auf, deren Mitglieder sich vor jeder schwierigen Aktion auf Deutsch das Wort ›fertig‹ zuriefen. Hierzu bemerkte Ihr Urgroßvater, unter dem Gelächter der beiden anderen Herren, in Bezug auf den Ausdruck ›fertig‹, ›das ist das erste vernünftige Wort, das ich in Paris gehört habe‹.
Am Nebentisch müssen einige Franzosen gesessen haben, die dies hörten und in den falschen Hals kriegten, entweder im Hinblick auf die Niederlage vom 16. August [am 16. August 1870 besiegten zwei preußische Korps die zahlenmäßig deutlich überlegene komplette »Französische Rheinarmee« und zwangen diese zum Rückzug in die Festung Metz] oder auf den Ausspruch eines französischen Militärs: ›Nous sommes archiprêts – Wir sind erzfertig‹.
Als nach dem Schluss der Vorstellung die Besucher sich im Vestibül ihre Garderobe aushändigen ließen, wurde auf Ihren Urgroßvater ein Schuss abgefeuert, der seinem Kopf galt, aber gottlob nur oben durch den Hut ging. In dem allgemeinen Tumult konnte der Mordschütze unerkannt entkommen.« Die drei Parisreisenden nahmen es mit Humor.
Ich hingegen – nur drei Generationen später – habe den Rang eines Offiziers der französischen Ehrenlegion, ernannt von Präsident Jacques Chirac, wegen meines Einsatzes für die deutsch-französische Verständigung. Und ich bin Secrétaire perpétuel der Académie de Berlin, die sich ganz im Sinne Voltaires, der einige Zeit am Hof von Friedrich dem Großen verbracht und mit dem preußischen König einen langen Briefwechsel geführt hat, dem Austausch der Kulturen und der Pflege der Sprachen zwischen Frankreich und Deutschland widmet.