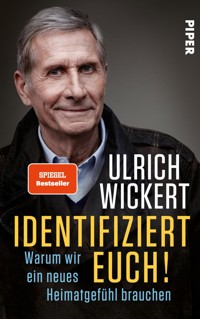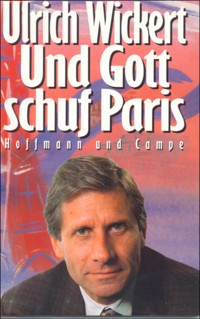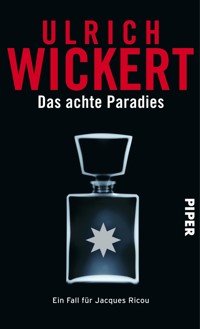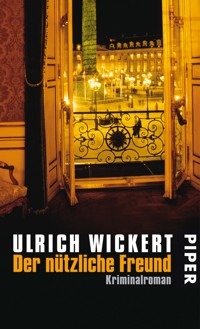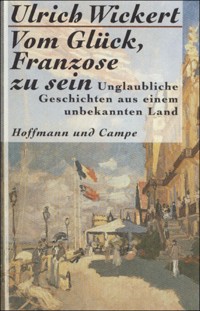
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köche, Agenten und Mätressen sind die Hauptfiguren der unglaublichen Geschichten aus Frankreich, von denen Ulrich Wickert mit Charme und Ironie erzählt. Szenen aus einem Land, das wir zu kennen glaubten ... Wer kennt schon das Land, in dem handgepflückte Kartoffeln zum Nachtisch serviert werden oder der Name eines Käses vom Zinsbetrug herrührt? Frankreich - wir meinen es zu kennen und haben doch oft nur die gängigen Bilder und Vorstellungen im Kopf. Ulrich Wickert, der kluge und charmante Causeur, lädt in seinen "unglaublichen Geschichten" dazu ein, (sein) Frankreich mit neuen Augen zu sehen. Auf diesem Streifzug erfahren wir Erstaunliches: Der Innenminister läßt den Staatspräsidenten durch Agenten der politischen Polizei beschatten; dieser wiederum ordnet an, schöne Schauspielerinnen, Journalisten und Schriftsteller abzuhören. Die Chauffeure der Minister müssen dem Innenminister melden, wenn sich ihr Chef zum Mätressenbesuch aufmacht. Und um sich das teure Leben mit einer Geliebten leisten zu können, erschleichen sich Politiker Scheinverträge mit Staatsunternehmen ... Es sind unerhörte Episoden, die Ulrich Wickert aus Frankreichs Geschichte und Gegenwart zu erzählen weiß. Er spannt einen weiten historischen Bogen und läßt es sich nicht nehmen, eine Fülle von komischen wie nachdenklich stimmenden Erfahrungen auszubreiten. Mit dem ihm eigenen Witz und mit pointierter Ironie wägt Wickert ab, was die Franzosen so liebenswert macht und weswegen man ihrer bisweilen überdrüssig ist. "Vom Glück, Franzose zu sein" - lauter wahre Begebenheiten, die so unglaublich klingen, als handelten sie von einem unbekannten Land: von Frankreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ulrich Wickert
Vom Glück, Franzose zu sein
Unglaubliche Geschichten aus einem unbekannten Land
Hoffmann und Campe Verlag
Die liebenswerten Franzosen
Es gibt Augenblicke, in denen ein normaler Mensch zu verzweifeln beginnt, nur weil eine technische Kleinigkeit nicht funktioniert, die ein Fachmann mit einem Handgriff und vielleicht einem Ersatzteil repariert. Doch leider sind Könner meist dann nicht zur Hand, wenn man sie braucht. Denn inzwischen hat sich überall in der Welt eingebürgert, daß sich Experten nach strengen Arbeitszeiten richten, und die werden immer kürzer. In Ländern wie den USA oder Deutschland erreicht man – besonders an einem Tag vor dem Wochenende oder gar einem Feiertag – schon ab mittags nur noch den automatischen Anrufbeantworter, der erbarmungslos auf die Öffnungszeit in drei Tagen hinweist. In Frankreich gilt inzwischen die 35-Stunden-Woche, aber glücklicherweise gibt es unter den Franzosen Menschen, die sich von solch modernen Regeln nicht einschüchtern lassen.
Der alte schwarze Uno sprang schon seit langem schlecht an, denn er wurde wochenlang nicht bewegt. Man hätte sich in jene Zeit zurückwünschen können, in der eine Kurbel ausgeholfen hätte. Doch da die Straße vor dem Haus einen steilen Hügel hinabführt, ruckelte der Motor, nachdem die Karre einige wenige Meter gerollt war, wenn man nicht vergaß, die Zündung einzuschalten und den zweiten Gang einzulegen. Dann tat das Benzin, was man von ihm erwartet, es zündete, trieb die Kolben an, und schon schnurrte der Motor, als sei nichts gewesen. Und nach wenigen Kilometern Fahrt war die Batterie wieder so stark aufgeladen, daß eine kurze Umdrehung des Schlüssels für die Zündung ausreichte.
Aber heute rührte sich gar nichts mehr. Gérard, der freundliche Nachbar, der einen Blumenladen in Grasse, hier unten an der Côte d’Azur, betreibt, kam herüber und schaute in den Motorraum, drehte die Stutzen an der Batterie auf, und sein Gesicht erhellte sich: »Ah, da fehlt Wasser.« Als geübter Bastler wußte er, was zu tun war. Gérard rollte den grünen Gartenschlauch neben den orangefarben blühenden Oleanderbüschen auf, öffnete den Wasserhahn und füllte mit Begeisterung und Kennernicken die Batterie auf, obwohl Adrienne zweifelnd fragte:
»Kann man dazu denn Leitungswasser nehmen?«
»Versuchen Sie’s jetzt mal!«
Tatsächlich sprang der leichte, kleine Wagen an, nachdem er nur zwanzig Meter gerollt war und Geschwindigkeit aufgenommen hatte. So konnte Adrienne hinunter ins Dorf fahren und in der abschüssigen Einfahrt von Mireille parken. Ihre beiden kleinen Kinder kletterten aus den Sitzen und sprangen in den Garten.
Währenddessen machte sich das Wasser aus dem Gartenschlauch auf den Weg zu allen Zellen der Batterie und zerstörte heimtückisch, was es – nach Gérards Vorstellung – heilen sollte. So sprang der Wagen überhaupt nicht mehr an. Der Anlasser drehte sich nicht einmal mit jenem bekannten müden Seufzen aus der Tiefe der Motorhaube, das ein Malheur ausdrückt. Gott sei Dank lag am Ortsausgang eine Fiat-Werkstatt.
Der Patron selbst kam an den Apparat, schließlich war es schon kurz nach sechs.
»Madame«, sagte er freundlich zu Adrienne, »morgen ist le quinze août. (Mariä Himmelfahrt. Und an diesem Tag, so weiß jeder Franzose, wird kein Handschlag getan.) Melden Sie sich übermorgen wieder.«
Da schnappte sich die energische Mireille den Hörer, und es sprudelte nur so aus ihr heraus, und zwar mit einer Geschwindigkeit, wie sie nur Franzosen beherrschen: »Hören Sie, Monsieur, c’est l’horreur! – Hier herrscht schlechthin das Grauen. Die junge Frau sitzt bei mir mit zwei weinenden Kindern. Und der Mann wartet darauf, abgeholt zu werden. Es hat schon richtig geknallt zwischen den beiden. Solch einen Ehekrach haben selbst Sie noch nicht erlebt. Sie können sich das gar nicht vorstellen, c’est l’horreur, Monsieur …«
Was in dem Patron vorgegangen sein mag, bleibt einem Fremden verborgen. Aber er reagierte auf jene einmalige Art und Weise, für die man Franzosen liebt: Zwanzig Minuten später startete der Motor mit einer neuen Batterie. Und weil er ja der Patron war, berechnete er nur den Preis für die Batterie, die Arbeitszeit dagegen … »Madame, c’était unplaisir … – Es war mir ein Vergnügen.«
Und auch als am Gründonnerstag die Heizung ausfiel, kam der Monteur noch abends um acht, stocherte mit einem Schraubenzieher so lange im Brenner herum, bis der wieder ansprang. Und auf den Dank antwortete er: »Madame, sonst frieren doch ihre Kinder!« So können Leute miteinander umgehen. Und weil es sich hier um Franzosen dreht, paßt, um den Geist zu beschreiben, der diese kleine Freundlichkeit beseelte, vielleicht das altmodische Wort Galanterie. Gott, sagt der Schwärmer, sind die Leute galant, die Frankreich bevölkern.
Frankreich lieben heißt für etwas schwärmen, das so zu sein scheint wie das Glück, von dem man träumt.
Woanders ist es immer besser. Das wissen wir alle. Und das gilt auch für Frankreich. Doch nehmen wir als Beispiel, um dies zu begründen, nun nicht einen der üblichen Frankophilen, die schon mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk oder über eine Städte-Partnerschaft Bande zu den Franzosen geknüpft haben; schieben wir den Romanisten, den Intellektuellen, den Anhänger Robespierres oder Sartres beiseite und wenden wir uns einer jungen Frau zu, die es in der deutschen Politik noch weit bringen will. Sie wurde, gerade weil sie erst 28 Jahre alt war und damit die Verjüngung der deutschen Politik darstellen sollte, als Kandidatin für die Bundestagswahl im September 1998 aufgestellt: Schließlich verkörperte Andrea Nahles als Vorsitzende der Jungsozialisten die Zukunft der SPD. Sie ist die Essenz eines gewissen deutschen Denkens.
Während des Wahlkampfes 1998 reiste sie durch die Bundesrepublik und kündete, wie es junge Leute tun sollen, von den Wundern einer besseren Politik – und eines besseren Lebens. Der Mensch solle nur noch halb soviel arbeiten und damit mehr Zeit für anderes haben. »In anderen Ländern, etwa in Frankreich«, schwärmte sie, klappe das prächtig. Überhaupt, in Frankreich, da habe man noch Zeit und Sinn für »andere Lebensentwürfe«.
Andrea Nahles behauptet zwei Dinge, von denen zumindest die erste Aussage, die Franzosen arbeiteten weniger als die Deutschen, nicht stimmt. Im Gegenteil, Franzosen arbeiten – so hält es die Statistik fest – sehr viel mehr Stunden in der Woche. Da schließen die Büros freitags nicht um zwei Uhr nachmittags, sondern um sechs oder sieben abends. Dieselbe Statistik verrät aber auch, daß die Franzosen in ihrer längeren Arbeitszeit weniger produzieren als die Deutschen. Das liegt vielleicht an ihrem »Sinn für andere Lebensentwürfe«.
Tatsächlich haben die Franzosen, anders als die Deutschen, ein entspanntes Verhältnis zur Wirklichkeit des Lebens. Eines Tages flog ich mit dem französischen Essayisten und Soziologen Jacques Leehnardt von Berlin nach Paris. Die Maschine landete in Roissy, und Leehnardt nahm mich in seinem alten Peugeot mit in die Stadt. Der verbeulte Wagen war zugemüllt. Vom Beifahrersitz mußten wir erst mal Bücher und eine leere Wasserflasche wegräumen, um Platz für mich zu schaffen.
»Meinen letzten Wagen«, so erzählte Leehnardt, »habe ich verkaufen müssen, da der Gestank selbst durch intensives Lüften nicht mehr zu beseitigen war.«
»Benzingestank?« fragte ich.
»Nein, ich hatte einen Camembert gekauft, den aber im Wagen vergessen und diesen bei größter Hitze drei Tage am Flughafen stehengelassen. So was kommt vor«, meinte er lakonisch. Verkauft hat er den Wagen im Winter, als es bitter kalt und der Gestank »eingefroren« war.
Ähnlich lakonisch gab sich mein Freund Philippe. Sein Leben lang hatte er nicht ernsthaft gearbeitet, da der Glückliche mit einer Erbschaft gesegnet war. Vor den Toren von Paris besaß er ein wunderschönes Wasserschlößchen am Wald von Chantilly, und im vornehmen 16. Arrondissement hatte er sich in einem Neubau eine große Wohnung gekauft.
Kurz nach seinem Einzug lud er zum Essen ein. Das Wohnzimmer wirkte so perfekt eingerichtet, als habe sich ein Innenarchitekt darum bemüht. Verborgene Lichter strahlten die geerbten Bilder von Matisse, Léger und Juan Gris an. Aber in der Diele und im Eßzimmer hingen noch die elektrischen Kabel an der unverputzten Wand.
»Ich weiß noch nicht«, sagte Philippe, »ob ich hier eine Tapete oder einen Wandbezug aus Stoff anbringen soll.« Er sei ja gerade erst vor zwei Monaten eingezogen.
Drei Jahre später wußte er immer noch nicht, ob Tapete oder Stoff. Aber inzwischen hatte nicht nur er sich, sondern hatten sich auch seine Freunde an den Zustand des Unfertigen gewöhnt.
Irgendwann, es mag fünf Jahre später gewesen sein, hat er einen eleganten Stoff spannen lassen.
Philippe ist kein Einzelfall. Wenn Gérard zu Sommerfesten an seinen Swimmingpool einlud, dann geschah das immer mit dem Hinweis, daß dieser noch nicht ganz fertig sei. Gérard hatte immer noch keine Steine um das Becken legen lassen. Sie waren zwar schon zwei Jahre lang in einer Ecke des Gartens gestapelt, aber …
Es muß nicht immer alles fertig und perfekt aussehen: Dies mag ein sympathischer Grundzug des französischen »Lebensentwurfs« sein.
Bevor wir uns weiter der Eigenart des französischen Lebensentwurfs widmen, sei eine kleine Zwischenbemerkung erlaubt: Selbst äußerst kritische Geister benutzen im täglichen Sprachgebrauch, wenn sie von einem Volk reden, immer wieder den Plural, sprechen von den Deutschen, den Franzosen, den Italienern etc. – aber dann stellt immer irgendwer die Frage: »Gibt es die Deutschen, die Franzosen … überhaupt?«, um dann gleich anzufügen, daß es die natürlich nicht gebe. Aber es dauert nicht lange, und wieder verfallen alle, die sich im Gespräch über »die Deutschen« etc. befinden, in den Plural. Das sei, bitte schön, auch hier gestattet. Schließlich wissen wir, daß der Plural eigentlich falsch angebracht ist, da die Deutschen schließlich keine Deutschen, sondern Bayern, Hessen oder Preußen sind, die Franzosen aber Korsen, Basken oder Bretonen. Aber trotzdem gibt es sie, die Franzosen – zumindest wenn man über sie redet.
Ja, ja, schon gut: Wenn wir dennoch von den Franzosen etc. sprechen, wissen wir, daß wir nicht das Kollektiv meinen, sondern einen gewissen Typus, eben den mit dem Camembert, der Baguette und der Baskenmütze. Schließlich haben die Franzosen auch ein gemeinsames Selbstverständnis und Grundvertrauen, weshalb sie sich alle, wenn sie von ihrem »Lebensentwurf« sprechen, etwas Gemeinsames darunter vorstellen können: etwa den Begriff der exception culturelle. Wenn es die kulturelle Besonderheit ihres Landes in Europa zu verteidigen gilt, gehen die Franzosen auf die Barrikaden, während die Deutschen entweder für den französischen, italienischen, amerikanischen, tibetanischen Lebensentwurf schwärmen oder hoffen, ihre eigene kulturelle Besonderheit möge sich möglichst schnell in Europa auflösen.
Die exception française als Lebensentwurf stellt sich gegen jene Gesellschaften, die sich nicht kulturell, sondern wirtschaftlich definieren, die sich als freie Marktwirtschaft bezeichnen oder die im Zeichen der Globalisierung das Leben modernistisch dem möglichst freien Wettbewerb der Kräfte unterwerfen und um die Deregulierung wie um ein goldenes Kalb hüpfen. Alle politischen Parteien Frankreichs bekennen sich zur exception française. Dies bedeutet, daß der französische Lebensentwurf eine kulturelle Grundlage hat, der sich wirtschaftliche und politische Theorien zu unterwerfen haben – und nicht umgekehrt, wie in den USA, in Großbritannien oder Deutschland.
Man sollte jedoch nicht glauben, die exception française ließe sich mit einem Wort erklären oder in einem einzigen Gedanken zusammenfassen. So ist es auch kein Wunder, daß sich Frankreich bis hinein in die Staatssymbole von anderen großen Nationen Europas unterscheidet. Britannia etwa und Germania sind Machtfiguren. Britannia rules the waves, herrscht also über die Ozeane der Welt; und die Germania trägt einen Brustpanzer samt Schwert. Aber es ist die Ausnahme, wenn Marianne, die Frankreich symbolisiert, ein Schwert neben sich auf den Boden stellt. Meist liegen die Waffen zu ihren Füßen, denn Marianne ist friedlich. Das zeigt sie mit ihrem entblößten Busen. Und sollte das nicht liebenswert sein?
Marianne verkörpert nicht nur die äußere Macht jenes Landes, das sich lange Zeit eine – eine?, nein: die grande nation nannte, sondern auch dessen Seele. Eine Macht läßt sich durch Truppen- und Waffenstärke definieren, eine Seele jedoch nicht. Und das ist das Schöne an Marianne, daß sie auf der einen Seite einen abstrakten Staat darstellt, auf der anderen Seite aber spricht ihre entblößte Brust von der Wirklichkeit des Volkes.
Marianne ist ein Kind der Französischen Revolution. Deshalb wird der Tag, an dem die Bastille gestürmt wurde, auch gern als Namenstag der Sainte Marianne bezeichnet. Die neue, aus der Revolution hervorgegangene patrie wurde als weiblich empfunden und geliebt. Da wird kein männliches Vaterland verehrt, das höchstens mit dem gruseligen Namen Bertha versucht, einer Kanone weiblichen Klang zu verleihen. Nein, verehrt wird la patrie nicht, das würde eine zu große Distanz zum citoyen, zum Bürger, herstellen. Man soll la patrie wie eine Frau lieben – mit all dem Ach und Weh, das solch eine Gefühlsaufwallung mit sich bringt.
Doch wie kamen die Revolutionäre auf den Namen Marianne? Im 18. Jahrhundert lautete der beliebteste Frauenname Marie-Louise, an zweiter Stelle folgte Marie-Anne. Da die französischen Könige häufig Louis hießen, war der Name Marie-Louise mit schlechten Andenken belastet. Dagegen bot sich den Revolutionären Marianne aus mehreren Gründen an. Es war nicht nur ein beliebter Name, sondern damit verband sich auch die symbolische Idee eines jungen, geliebten Mädchens, das zu erobern sich der in Liebe entbrannte Junge vornimmt. Zur Melodie eines klassischen Liebeslieds sang man schon in alten Zeiten in der Auvergne: »La bouole lo Mariano – la bouole, omaï l’aurai. (Ich will sie, die Marianne, ich will sie und werde sie haben.)« Durch diese beliebte Volksweise wurde der Name Marianne in Frankreich so populär, daß man ihn immer dann benutzte, wenn man ein geliebtes weibliches Objekt symbolisieren wollte; und so wurde die Marianne aus dem auvergnatischen Liebeslied zum Inbegriff der vom Verschwinden bedrohten okzitanischen Sprache.
Kein Volk scheint ohne Symbole auszukommen. Könige besitzen seit alters her Siegel und Wappen, in denen starke, wilde Tiere (Löwen, Bären oder Adler) die Macht verkörpern. Nun hatten die Franzosen aber ihren König und dessen Marie-Antoinette um den Kopf gebracht. Und so standen die Revolution und ihre neugeborene Republik nackt und ohne Wappentier da. Im Überschwang der Gefühle, vor lauter Liebe zu dem, was sie die universelle Revolution nannten, wählten die neuen Herren jene Marianne als ihr Wahrzeichen, das von nun an, mit einer etwas seltsamen Zipfelmütze versehen, leicht gekleidet, meist mit dem vollen Busen als Republik und Freiheit auftrat und den imperialen Adler verdrängte.
Ein einziges Tier hat im französischen Wappen die Revolution überlebt, und das tat es wahrscheinlich auch nur deshalb, weil es niemandem angst macht – der gallische Hahn. Seine Herkunft ist kein besonderes historisches Verdienst. Nur weil die Gallier herausfanden, daß der Gockel im Lateinischen gallus heißt, sahen sie eine Familienverwandtschaft zwischen gallus und Gallier.
Allerdings zog Napoleon für sein Wappen den König der Lüfte dem Herrscher des Hühnerhofs vor. Vielleicht behaupten die Franzosen deshalb, der Hahn stehe links, sei aber eher liberal denn radikal. In der Karikatur sieht man ihn auch in diesen Tagen noch häufig – Federn lassend und laut kreischend – vor dem deutschen Adler fliehen. Der Hahn schreit auf französisch: »Cocorico« statt wie im Deutschen »Kikeriki« – er hat also eine etwas tiefere Stimme. Und weil Hähne, besonders derjenige, der Frankreich symbolisiert, vor Stolz fast platzen, hat sich das Cocorico des Hahnes in der französischen Sprache zu einem eigenständigen Begriff entwickelt und bedeutet so etwas wie einen nationalistischen Brunftschrei.
Kein historisches Ereignis prägte Frankreich so sehr wie die Revolution, deren Feier zum 200. Geburtstag die ganze Welt in Atem hielt – schon allein deswegen, weil der französische Staatspräsident François Mitterrand den in diesem Jahr in Frankreich stattfindenden Weltwirtschaftsgipfel ganz bewußt zum 14. Juli nach Paris eingeladen hatte. An der Festparade sollten Dutzende von Staatsoberhäuptern und noch mehr Regierungschefs aus befreundeten Staaten teilnehmen.
An der Place de la Concorde wurden für 16000 Ehrengäste Tribünen aufgebaut. Knapp eine Woche vor der Veranstaltung fiel dem Festkomitee auf, daß für diese 16000 Menschen nicht eine einzige Toilette vorgesehen war. Nach einem kurzen Augenblick der Panik rief jemand bei einem Sanitärunternehmen an, das transportable WCs vermietet, und erkundigte sich, wie viele Häuschen denn für diese große Zahl vonnöten wären. Man nehme als Vorbild immer ein großes Langstreckenflugzeug, war die Antwort, das sei mit acht Toiletten ausgerüstet. Das Komitee rechnete nach und beschloß, für die 16000 Geladenen großzügig vierhundert Einheiten zu bestellen.
Nun konnte die Parade stattfinden. Sie dauerte vier Stunden. Nach einer Stunde verspürte eine äußerst hochgestellte Persönlichkeit jenen unwiderstehlichen, lästigen Druck auf die Blase und richtete an eine der Hostessen auf der Tribüne die Frage:
»Pardon, Mademoiselle, wo sind denn die Toiletten?«
»Ich fürchte«, antwortete sie, »es gibt keine. Aber ich werde Sie zur Organisationsleitung begleiten, und dort können wir fragen.«
Dort lautete die Antwort ganz unbeteiligt: »Nein, keine Sanitäranlagen.«
»Aber in der Zeitung hat doch gestanden, es würden vierhundert bereitgestellt …«
»Ich weiß, aber wie das so ist, es gibt keine. Und fragen Sie mich nicht, warum, denn ich weiß es nicht. Sie können sich ja mal an die Polizei wenden …«
Der erste Gendarm erklärte: »Nein, ich weiß auch nicht, was Sie da tun können …«
»Aber es drängt. Können wir Ihren Vorgesetzten fragen?«
Der zweite Gendarm war mit mehr Ehrenzeichen versehen und hatte einen höheren Rang: »Also gut, ich werde Ihnen die Absperrung an der Ecke der Avenue Gabriel öffnen, und dann – débrouillez-vous – schauen Sie zu, wie Sie zurechtkommen.«
Gesagt, getan. Der Gendarm fügte noch mitleidig hinzu: »Die armen Damen …«
Dem ersten Würdenträger folgten viele andere, so daß es in der Hitze des nächsten Tages an der Ecke der Avenue Gabriel so penetrant stank wie seinerzeit, als es in Paris noch keine Kanalisation gab, weshalb der König die Stadt verließ und sich ein Schloß in Versailles bauen ließ. Das Pikante an unserer Geschichte ist: An der Ecke der Avenue Gabriel befindet sich die amerikanische Botschaft.
Dieses Verhalten sei typisch für den französischen Staat, meint der Publizist Jean Vermeil. Er plustert sich oben auf, aber unten kümmert er sich um nichts. Oder aber, wie mein Metzger in der Rue de Varenne zu sagen pflegte: Der Hahn ist das einzige Tier, daß selbst noch hurra schreit, wenn es mit den Füßen im Mist steckt.
Marianne hat in den mehr als zweihundert Jahren seit der Revolution nichts an Bedeutung eingebüßt. Auf der Briefmarke prangt ihr Konterfei; eine Büste der Marianne steht in jeder Mairie. Daneben hängt das offizielle Foto des jeweiligen Staatspräsidenten, als bildeten sie ein Paar: sie, die dauerhafte Königin, er, der vergängliche Regent. Und wie nah Marianne dem Volk ist, zeigen ihre Gesichtszüge. Sie drücken keine hehren Ideale aus, sondern sollen Frauen des Volkes sein. Nun gut, auch da gibt es Unterschiede. Doch nicht die politische, kulturelle oder wirtschaftliche Bedeutung einer Frau führt dazu, daß Marianne nach ihren Gesichtszügen modelliert wird.
Die Liebste ist dem Liebenden immer die Schönste. Und das gilt auch für die Marianne. So werden Leinwandschönheiten, wie etwa Brigitte Bardot oder Catherine Deneuve, als Vorbild für die Gipsstatuen in den Rathäusern genommen. Einem Deutschen würde eine Schauer über den Rücken laufen, würde Germania einer Schauspielerin ähneln. Es würde als Sakrileg beklagt oder als Kitsch belacht – schließlich ist Germania für die meisten Deutschen inzwischen auf dem Sperrmüll gelandet.
Man liebt Frankreich, weil Frankreich sich durch Frauen definiert, und die Frau wiederum ist die Inkarnation der Liebe. Wobei sich die philosophische Frage stellt, was denn wohl zuerst da war, die Liebe oder die Frau? Lieben wir Frankreich, weil es die Liebe zur Frau ausdrückt?
Neben Marianne taucht auch die Säerin auf Geldstücken oder Scheinen auf – als Symbol des Fortschritts wie auch des bestellten Ackers. Doch manchen männlichen Kritikern ging das im letzten Jahrhundert entschieden zu weit: Da maßt sich eine Frau einen Männerjob an und sät auch noch falsch. Denn der nach hinten wehende Schal zeigt, daß sie den Samen gegen den Wind streut. Und welcher Bauer würde über den Acker barfuß laufen? Aber wenn es um Mythologie geht, ist viel erlaubt. Was haben die Göttinnen der griechischen Sagenwelt den Männern im Kampf um Troja nicht alles abgenommen!
Marianne ist jedoch keine Figur mit einem eindeutigen Charakter. Anfang dieses Jahrhunderts wird das Leben der Marianne in der Zeitschrift »L’Assiette au beurre« in vielen bebilderten Szenen erzählt. Ihr Vater, ein Arbeiter, hebt auf den Barrikaden die Neugeborene mit beiden Armen hoch. Ihre ersten Schritte macht sie an der Hand eines alten Mannes mit dem Gesicht von Victor Hugo in einer Umgebung, die an Jean Valjean und Cosette aus »Les Misérables« erinnert. Zur Mademoiselle gereift, läßt sich Marianne versuchen – von einem Soldaten, einem hohen Beamten, einem reichen Bourgeois. Dick geworden, weigert sie sich schließlich, in dem Bettler eine Jugendliebe wiederzuerkennen, bis sie als alte Vettel volltrunken von einem Geistlichen und einem Offizier ins Hospital gebracht wird.
Marianne stellt mindestens zwei Frauen dar. Die eine ist das jeweils wechselnde Regime, die andere die Nation – une et indivisible, einmalig und unteilbar. Unter Mariannes Namen verbergen sich auch zwei unterschiedliche Sichtweisen von der Republik: »La nôtre – die Unsere«, eine junge hübsche Frau mit nacktem Busen, zwischen einem sympathischen Soldaten und einem netten Arbeiter, hält eine große Fahne; »la leur – die der anderen«, eine fette Frau mit Küchenschürze tritt auf die Gesetzestafeln und greift mit vollen Händen in den Staatssäckel. Die eine Frau nennt sich »die Republik«, die andere »die Macht«.
Selbst unter den Linken ist man sich nicht einig, wie man diese Frau bewerten soll. Von den einen wird Marianne geliebt, von den anderen gehaßt. Bei Arbeiterdemonstrationen im 19. Jahrhundert waren Frauen selten zu sehen, doch wenn sie sich einmal emanzipiert hatten, dann liefen sie in der vordersten Reihe mit und trugen die Fahne. In den Parteibüros der Sozialisten und zu Hause bei den Genossen entwickelte sich ein wahrer Mariannenkult. Für diesen Teil des Proletariats war Marianne eine Art Madonna, die in ähnlicher Weise verehrt wurde wie Mutter Maria von den Katholiken.
Der andere Teil des Proletariats lehnte sie ab, da sie die Republik verkörperte, eine Republik, die als bourgeois verteufelt wurde. Marianne soll – als Symbol der Republik – das Volk einen, doch sie ist umstritten, weil auch die Republik keine einhellige Zustimmung erfährt. Das macht eben den Charme Frankreichs aus. Nichts ist eindeutig. Nichts entspricht einer festen Ordnung. Das mag derjenige sympathisch finden, der aus einem Land stammt, in dem die Ordnungswut herrscht. Das französische Chaos entschuldigt so vieles. Doch Jean Vermeil klagt: »Unordnung ist unser größtes Übel. Wir tun so, als wären wir stolz darauf: Das sei eben unser gallischer Einschlag, le baroud d’honneur (ein Scheingefecht), das einige Stämme noch einmal führten, bevor sie sich der Pax Romana unterwarfen. Unsere Unordnung ist das Kind von Lügen und Erfindungen.«
Warum wir dennoch an den Franzosen verzweifeln
Es gibt so viele Gründe, Frankreich und seine Bewohner zu mögen. Doch Franzosen können auch unerträglich arrogant sein, nicht nur wenn man sie mit ausländischen Augen beurteilt. Und ich kenne Leute, die voller Abneigung gegen die Franzosen sind, weil sie sich von ihnen als Untermenschen abgelehnt fühlen.
»Ach, was sind die Italiener dagegen für liebenswerte Menschen«, sagen sie. »Wenn man die nach dem Weg fragt, überschlagen sie sich vor Höflichkeit, während ein Franzose auf die Leute hochnäsig herabschaut, die nicht mindestens so gut französisch sprechen wie sie selbst.«
Ich liebe Frankreich, denn es ist mir eine Heimat geworden. Dennoch bin auch ich nicht frei von Zweifeln. Sie fangen vielleicht schon morgens an, bei der Bushaltestelle auf dem Boulevard Saint-Germain, in der Höhe der Rue du Bac. Wie überall in der Welt kommt der Bus Nummer 83, mit dem ich morgens zur Arbeit fahre, für meine Bedürfnisse viel zu spät, denn er steckt, wie überall auf der Welt um diese Zeit, mitten im Verkehrschaos. Dann drängen sich die Passagiere hinein, und zwar nach dem Motto: Wer zuerst drin ist, kommt auf jeden Fall mit. Einer Frau oder gar einem alten, gebrechlichen Menschen den Vortritt zu lassen, scheint keiner gelernt zu haben. (Als ich im Alter von etwa fünfzehn Jahren in der Metro aufstand, um einer Frau meinen Sitz anzubieten, sprach mich ein Franzose staunend an und fragte: »Sie sind doch sicher Ausländer?« – »Wieso?« – »Ein französischer Junge wäre nie aufgestanden.«)
Und weil die Franzosen einfach nicht verstehen, weshalb sie sich hinter einen anderen in einer Schlange anstellen sollen, sei es an der Kinokasse, beim Bäcker oder an der Bushaltestelle, wurde zumindest hier in den fünfziger Jahren eine Regel gehandhabt, um Ordnung zu schaffen und die rücksichtslos drängenden Franzosen in Bahnen zu lenken. An jeder Haltestelle hing in Augenhöhe ein Kasten, aus dem der auf seinen Bus wartende Passagier ein längliches Stück Papier mit einer eingestanzten Nummer zog. Fuhr der Bus vor, erkundigte sich der Schaffner nach der niedrigsten Nummer und rief dann die Nummernfolge auf – ähnlich, wie es heute beim Besteigen der Flugzeuge üblich ist: zuerst die Reihen fünfzehn bis dreißig, dann … – Sie wissen schon, was ich meine. Wessen Zahl der Schaffner aufrief, der stieg ein.
Dieses Ordnungsverfahren wurde meist nur dann angewandt, wenn es notwendig war, morgens oder abends, wenn die Busse schon überfüllt an der Haltestelle vorfuhren. Dann brauchte man sich nicht dem Kampf mit den Ellenbogen auszusetzen, sondern war sicher, in der richtigen Reihenfolge aufgenommen zu werden, mußten doch die mit einer höheren Nummer, weil später gekommen, warten – allerdings ohne sich demütig in eine Schlange einordnen zu müssen. Hintereinander anstehen scheinen Franzosen als Zumutung, ja als Erniedrigung zu empfinden; denn da stand man sichtlich hinter jemandem, der bevorzugt war, da er ja zuerst in den Bus steigen durfte, und damit war man selber einem anderen unterworfen, wenn auch nur in einem ordnenden System.
Aber leider wurden eines Tages die Schaffner abgeschafft, dann die alten Busse, bei denen man hinten auf einer Plattform einstieg – und die Reise im Freien genießen konnte –, und schließlich auch die Kästen, an denen man sein Nümmerchen zog: denn jetzt gab es ja keinen Schaffner mehr, der sie ausrufen würde.
Der »83er« gehörte zu einer der letzten Buslinien, die noch eine Plattform hatten, wenn auch nicht die, wo man von hinten während der Fahrt aufspringen konnte. Selbst im Winter stand man bis zum Schluß draußen. Nach dem Motto: Besser in der mit Abgas geschwängerten Luft von Paris als drinnen im engen, feuchten Menschenmief.
Heute quetscht man sich vorn am Chauffeur vorbei in den Leib des Busses, weist seine Monatskarte vor oder entwertet sein Billet, in dem man es in den Schlitz eines Automaten steckt, der hinter dem Sitz des Fahrers angebracht ist und mit einem elektronischen Piepsen dem Fahrschein seinen Wert abringt. Und dann drängt man sich nach hinten. Ja, und schon tritt mir die Nachbarin mit dem spitzen Absatz auf den Fuß. »Aii!« – ruft man in Frankreich, wenn es weh tut, statt »Aua!«. Dabei dehnt man das »i« je nach der Stärke des Schmerzes.
Aus Reflex hätte ich mich bei der Dame fast dafür entschuldigt, daß mein Fuß unter den ihren geraten ist. Aber sie verzieht keine Miene, so als habe sich nichts ereignet. Wenigstens ein entschuldigendes Lächeln könnte sie mir doch gönnen, wenn schon kein »Pardon«.
Aber dann sage ich mir: Sie ist doch Französin! Und ich versetze mich in die Dame hinein und verstehe. Weil sie Französin ist, weiß sie nicht, daß Menschen sie umgeben. Vielleicht ist sie zu spät aufgestanden, vielleicht ist der Bus wieder im Verkehr steckengeblieben und zu spät dran. Dann mußte sie sich mit aller Gewalt noch durch die Tür kämpfen, und jetzt denkt sie an Jules, das Büro und vielleicht auch an ihr Kind, das sie trotz leichten Fiebers eben noch im jardin d’enfants abgeliefert hat. Sie fährt irgendwie ganz allein im überfüllten Bus und nimmt niemanden um sich herum wahr. Sie hat sich in sich selbst zurückgezogen. Sie schaut in sich hinein, als übe sie Zen, Yoga oder autogenes Training …
Dieses Verhalten ist anerzogen, es gehört zum guten Ton und hat mit dem Begriff discrétion zu tun, einer Verhaltensweise, für die ich die Franzosen liebe. Die Bourgeoisie, die heute noch den Stil prägt, versteckt ihre Häuser hinter hohen Mauern. Dieses Versteckspiel hängt auch damit zusammen, daß die Bourgeoisie schon zu Beginn ihrer sozialen Entwicklung von der christlichen Kirche beschuldigt wurde, nur an den Gewinn zu denken und nicht an die Menschen, die für sie arbeiteten. Den Gewinn versteckt die Mauer. Sich so nach außen abschotten, das kann mit dieser Perfektion nur ein Franzose. Und wer nicht gelernt hat, mit der dadurch entstehenden Distanz umzugehen, der bricht leicht in Haßtiraden über die unzugänglichen Franzosen aus.
Wenn Sie zu einem förmlichen Abendessen eingeladen werden, dann mag Ihr Tischnachbar ein äußerst eleganter Franzose sein. Sie sehen seiner dezenten Kleidung zwar nicht die neueste Mode, aber den teuren Schneider an, dem Haar den wöchentlichen Besuch beim Friseur und den Händen die professionelle Maniküre. Während des Essens unterhalten Sie sich angeregt und intelligent, denn der Mann ist galant und gebildet. Zu jedem Thema kann er beisteuern, was de Gaulle, Montesquieu, Lacan oder Sartre dazu dachte, was Bourdieu, Finkielkraut, Crozier oder BHL (so bezeichnen Wissende den inzwischen schon etwas älteren nouveau philosophe Bernard-Henry Lévy) in diesem oder jenem Fall sagen würde. Und wenn Sie sich gegen Mitternacht begeistert von den Gastgebern verabschieden und erwähnen, wie vorzüglich Sie sich unterhalten hätten, dann werden Sie plötzlich nachdenklich anhalten und sich erkundigen, wer das wohl war, neben dem Sie zwei oder gar drei Stunden saßen. Von ihm selbst haben Sie nichts erfahren: weder seinen Namen noch den seines Schneiders, nichts über seine Tätigkeit, keinerlei Andeutung seines Berufs, schon gar nicht seine eigene Meinung. Sie haben sein Inneres nicht einmal von außen gesehen. Er hat Sie mit zwar höchst interessantem, aber in jeder besseren Bibliothek nachzuschlagendem Wissen unterhalten. Über sich selbst hat er geschwiegen.
So sieht die Perfektion des sich In-sich-selbst-Zurückziehens aus, wie Franzosen es lieben. Einem Fremden mag dieses Verweigern der eigenen Person leicht als Arroganz vorkommen. Doch von Ihnen wird die Diskretion verlangt, nicht nach dem zu fragen, was der andere nicht von sich aus sagen will. Es gehört zum guten Ton, in einem Gespräch mit dem richtigen Gebrauch der Sprache zu glänzen, wie es überhaupt einer guten Erziehung entspricht, an jedem Gespräch lebhaft teilzunehmen, wobei nicht der Inhalt, sondern an erster Stelle die Form des Gesagten beurteilt wird. Und obwohl Franzosen viel reden können, ohne etwas zu sagen, so wissen sie doch auch im rechten Moment zu schweigen.
Und deshalb schauen Mitglieder der oberen Kasten auf das Volk nieder, das beim Spaziergang auf dem Land oder im Wald auch einem Fremden ein freundliches Bonjour zuruft. Das ist in dem Verständnis nobler Leute doppelt falsch, denn der gute Ton verlangt, daß ein Gruß unweigerlich mit der Bezeichnung Monsieur oder Madame verbunden wird. Die richtige Begrüßung (oder Verabschiedung) findet nüchtern und ohne viele Worte statt. Vielleicht gibt man sich die Hand, und eventuell nickt man sogar mit dem Kopf. »Bonjour, Madame – bonjour, Monsieur.«
Das Schweigen dient als Vorlauf zum nun folgenden Gespräch oder als dessen Abschluß.
Das Schweigen kann aber auch als Ablehnung gedacht sein, um einen mißliebigen Gesprächspartner in seine Schranken zu weisen; der andere wird ignoriert, nicht gesehen und damit von jedem weiteren Gespräch ausgeschlossen. In beiden Fällen lebt das Schweigen von den Worten, die ihm vorangegangen sind, die folgen oder die erwartet, aber ganz bewußt zurückgehalten werden. So setzt das Schweigen das Sprechen fort. Im richtigen Augenblick zu schweigen gilt als Zeichen guter Erziehung. Indem er das Schweigen in das Regelwerk zwischenmenschlicher Beziehungen einbezieht, will der vornehme Franzose sich von den niedrigeren Klassen absetzen, bei denen Stille ein Laster und Lärmen eine Tugend ist.
Das Schweigen dient dem einzelnen aber auch als notwendiges Gegengewicht zum manchmal erdrückenden Einfluß der häufig immer noch sehr geschlossenen Familien. Von einer Anfang des Jahrhunderts geborenen Frau stammt folgende Schilderung: »1916 ist meine Cousine, die mein geistiger ›Zwilling‹ war, gestorben. Nach einem Monat auf dem Land haben wir uns zum ersten gemeinsamen Diner versammelt, die Stimmung war so bedrückend, daß ich in Tränen ausbrach und den Tisch verließ. Niemand ist mir gefolgt, niemand hat mich getröstet, niemand hat am nächsten Tag davon gesprochen. Alle hatten verstanden, aber man hatte eine große Scheu vor Gefühlen und achtete den inneren Bereich eines jeden. So haben einige Dramen in unserer Familie stattgefunden, ohne daß auch nur ein Wort darüber gewechselt wurde; Dramen, die man nur durch irgendwelche Zeichen verstand, die man mit Besorgnis aufnahm. Auf das kleinste Zeichen hin wäre man sofort bereit gewesen zu trösten. Aber ohne das hätte man sich keinen Blick des Mitleids erlaubt.«
Der französische Sozialwissenschaftler Eric Mension-Rigau meint, der Sinn für das Schweigen erkläre sich bei den stilbildenden Schichten in Frankreich möglicherweise durch die Tatsache, »daß diese Leute in einer Umgebung leben, in der Gewalt nur in Form von Sprache erlaubt ist. Dadurch haben die Betroffenen ein starkes Bewußtsein dafür entwickelt, daß auch Worte lebensgefährliche Verletzungen beibringen können. Die Weisheit lehrt sie deshalb, voreilige Worte zu meiden und lieber zu schweigen.«
Wer lang genug unter Franzosen gelebt hat, weiß dieses Verhalten – in Grenzen – zu genießen. Es kann aber auch äußerst lästig sein, nicht wahrgenommen zu werden. Wer an einem Montagvormittag in Paris einen Laden betritt, der mag das Pech haben, daß die drei Verkäuferinnen gerade mit sich selbst beschäftigt sind. Sie stehen in einer entfernten Ecke, reden und gackern, als seien sie allein auf der Welt. Sie müssen die Erlebnisse vom Wochenende austauschen, und da stört der Fremde nur, der der Einfachheit halber nicht bemerkt wird.
Die Franzosen heben gern hervor, sie seien gegenüber den unhöflichen Teutonen nicht nur viel zivilisierter, sondern sie gingen mit Kunden auch sehr viel freundlicher um. Und sie glauben sogar, was sie da sagen. Aber auch hier zeigen die Franzosen ihre Extreme. Wir haben es erlebt. Geradezu katastrophal endete der Versuch, in der Marina Baie des Anges bei Nizza den – wie er sich selbst nennt – »größten Fitness-Club der Côte d’Azur« auszuprobieren. Die Baie des Anges ist eines jener gräßlichen Architektur-Monstren, die aus weiter Entfernung von einem Boot auf dem Meer originell wirken. Elegant schwingen sich zwei im Halbrund gebaute, pyramidenförmige Hochhäuser um einen Jachthafen. Doch einmal drinnen, erschlägt einen der Beton.
An einem Ende des Hafenbeckens befindet sich der in Ellipsenform angelegte Club Biovimer. Biologie, Leben und Meer verbindet dieser Name. »La Thalasso« bietet er an, er wirbt also mit der Heilkraft des Meerwassers; Salzwasser gehört zwar zu den ältesten Kuren im Mittelmeer, aber heute wird dem ein moderner Klang verliehen – und eine besondere, nämlich verjüngende Wirkung.
An einem regnerischen Samstag im April kamen wir auf die Idee, den Club – von dem wir uns schon Monate zuvor Prospekte besorgt hatten – auszuprobieren. Die Preise waren horrend. Ich rief an und fragte:
»Bieten Sie einen Einführungstarif an?«
»Die Tageskarte kostet 300 Franc.«
»Aber gibt es für Leute, die den Club erst einmal kennenlernen möchten, eine ermäßigte Karte?«
»Es gibt jeden Abend um 18 Uhr eine Führung.«
»Aber es gibt keinen Schnuppertarif?«
»Nein. Da müssen Sie bei unserem service commercial anrufen, der ist am Montag wieder besetzt.«
Wir sind dennoch hingefahren. Inzwischen regnete es. Es hat lange gedauert, bis wir einen Parkplatz fanden. Der Eingang des Club ist wie in einem Hollywood-Film weitläufig und prunkvoll angelegt. Dort schiebt die Empfangsdame ein ellenlanges Formular über die Theke, das zu bewältigen den Besitz einer Lesebrille voraussetzt, die aber zu Hause liegt. Denn wer nimmt schon die Lesebrille mit in die »Thalasso«? Mit dem Formular geht man zur Kasse und steht ewig an, denn das Formular muß bearbeitet werden. Keine Angestellte macht auch nur die geringste Anstrengung, Neulingen den Weg zu weisen. Also erkundige ich mich, werde an eine Garderobe geschickt, wo eine muffige Frau – ja, sie war wirklich dick und häßlich – den Ansturm der Gäste nicht bewältigt.
Das geheizte Meeresbad im Freien mit Überlaufkante tröstet über die ersten Enttäuschungen hinweg, wenn auch auffällt, daß die Mosaiksteine am Rand dutzendweise abfallen. Man hat den Eindruck, im Mittelmeer zu schwimmen. Die Luft ist kalt, es regnet, aber das salzige Wasser trägt den Körper und verleiht ihm eine angenehme Leichtigkeit. Die verliert er sofort wieder nach dem Anblick der Sauna. Die Türen faulen, weil es in Frankreich üblich ist, eine Einrichtung nicht ständig zu unterhalten, sondern sie einfach zu ersetzen, wenn sie völlig in sich zusammengefallen und nicht mehr tragbar ist. Das ist einfacher, als sie immer wieder mit Farbtopf und Pinsel auszubessern. Im Hammam, dem Dampfbad, setzt man sich nicht auf Stein, sondern auf schmutziges Plastik … Wir haben bald genug. Als ich nach draußen trete, gehe ich ein paar Schritte auf die Planken, an denen die Segelboote vertäut sind. Ein älterer Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelt mir entgegen, das linke Hosenbein hochgekrempelt. Blut läuft aus einem Loch unterhalb des Knies. Ich packe ihn unter dem Arm.