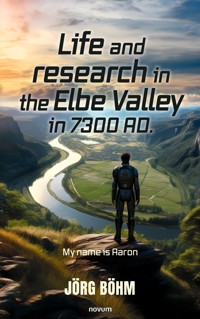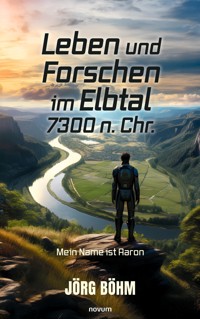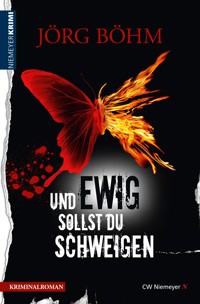7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DER TOD HATTE DIE AUFGABE, MENSCHEN ZU ERLÖSEN, OB SIE ES WOLLTEN ODER NICHT Emma Hansens dritter Fall Die Landesgartenschau 2015 soll das Ereignis für Landau werden. Doch das Großprojekt droht zu scheitern, als zwei Skelette auf dem Gelände entdeckt werden. Wer sind die beiden Toten? Und vor allem: Wer hat sie dort verscharrt? Je weiter Hauptkommissarin Emma Hansen in die Fälle einsteigt, desto tiefer wird sie in einen Strudel aus abgrundtiefem Hass und unbändiger Gier hineingezogen. Und begeht schließlich einen tödlichen Fehler …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autor
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Epilog
Danksagung
Jörg Böhm
Und ich bringe dir den Tod
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Der Umschlag verwendet Motive von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-8322-4
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Der Journalist Jörg Böhm (*1979) war nach seinem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia. Danach arbeitete Jörg Böhm als Kommunikationsexperte und Pressesprecher für verschiedene große deutsche Unternehmen. Seit 2014 widmet er sich nur noch seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. Neben dem 1. Kreuzfahrtkrimi „Moffenkind“, den er exklusiv in Kooperation mit der Reederei AIDA Cruises geschrieben hat, sind mittlerweile drei Krimis um seine dänisch-stämmige Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen erschienen. Aktuell schreibt er an seinem vierten Emma-Hansen-Krimi, der im März 2017 erscheinen wird. Als bester Nachwuchsautor wurde er für seinen ersten Krimi „Und nie sollst du vergessen sein“ mit dem Krimi-Award „Black Hat“ ausgezeichnet.
Mehr über Jörg Böhm und seine Aktivitäten erfahren Sie unter jörgböhm.com
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Für Andrea, Beata, Claudia und Lydia
–
in Verbundenheit
„Man muss sein Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach
Prolog
Juni 1984
Das Kind wusste, der Tod konnte eine Erlösung sein. Das hatte es bei seiner Oma gesehen, als sie friedlich eingeschlafen war, nachdem die Ärzte die Maschinen abgestellt hatten.
Der Tod war aber auch für die befreiend, die zurückbleiben mussten. Die gefangen waren in einer Welt, in die sie nicht hineinpassten. In die sie nicht hineingehörten. Und er hatte die Aufgabe, diese Menschen zu erlösen – ob sie es selbst wollten oder nicht.
Das Kind saß in seinem Kinderzimmer und schaute den Regentropfen zu, die an der Fensterscheibe abwärts liefen. Der Sommer war seit Wochen warm und schwül und heftige Gewitter zogen über das Land. Auch heute donnerte es wieder. Aber das Grollen kam nicht aus den Wolken, sondern aus der Wand. Doch es war nicht nur das Krachen, welches das Kind aufschrecken ließ. Es waren auch die Geräusche, die es immer wieder aufs Neue erschauern ließen, es einfach nur anekelten. Es waren Laute, als ob eine Kuh ein Kalb zur Welt bringen würde – im Kampf zwischen körperzerreißenden Schmerzen und adrenalingesteuerter Ekstase. Oder – und das hatte das Kind schon einmal auf einem Bauernhof gesehen – als würde ein Pferd ein anderes besteigen.
Von da an hatte es Kühe und Pferde und eigentlich alle Tiere gehasst, die solche Laute von sich gaben. Doch am meisten hasste es seine Mutter. Früher hatte sich das Kind stets Sorgen um sie und ihr Wohlbefinden gemacht, wenn sie wieder einmal so gestöhnt hatte. Doch seit es wusste, was sie da tat, verachtete es sie abgrundtief. Und das war eigentlich schon zu viel, denn wenn es ehrlich war, dann waren seine Gefühle ihr gegenüber wie ausgelöscht. Als ob es diese nun einmal bestehende, emotionale Bindung zu seiner Mutter nie gegeben hätte.
Dabei hatte das Kind seine Mutter so sehr geliebt. Es hatte sie sogar dann noch verteidigt, als es von den Nachbarn immer häufiger angesprochen wurde, wenn es wieder einmal vor der Tür saß, nur weil seine Mutter es nicht hereinlassen wollte. So wie gestern, als die alte Hexe von nebenan es wieder vor der Tür hatte sitzen sehen.
„Na, hat sie wieder Besuch?“, hatte es die Nachbarin mit nicht zu überhörender Abneigung in ihrer Stimme gefragt.
Die Nachbarin. Sie war eine ältere Frau, Anfang siebzig vielleicht, mit weißen Locken auf dem Kopf und einem spitzen Mund. Sie ging krumm, musste sich unentwegt am Geländer festhalten, damit sie nicht hinfiel, und war von zierlicher Gestalt. Und – das konnte das Kind auch schon in seinen jungen Jahren einschätzen – schien selbst noch nie Besuch gehabt zu haben – weder den einen noch den anderen.
„Tja, was soll man da machen? Keiner kann was für seine Erzeuger – oder für die Brut, die er hinterlässt“, sagte sie und stapfte unbeholfen und steif die Treppe hinunter. Das Kind hatte sie noch nie leiden können. Weder an Weihnachten noch an Neujahr hatte sie ein freundliches Wort übrig und es konnte sich noch genau daran erinnern, wie sie es schon mehrmals bei der Polizei angezeigt hatte, nur weil es mit seinen Freunden Klingelstreiche bei ihr gespielt oder die Wäsche von der Leine genommen und durch eine Pfütze gezogen hatte.
„Wegnehmen sollte man ihr dieses Blag. Dann kommt sie vielleicht endlich wieder zur Besinnung!“ So hatte das Kind sie dann noch mit der Frau tuscheln hören, die mit ihrem Sohn und ihrer Tochter die Wohnung genau unter ihnen bewohnte und in der es auch öfters polterte, ehe sie dann das Haus durch den engen, dunklen Flur verlassen hatte.
Das Kind schob die Erinnerung an den gestrigen Tag beiseite. Es hatte keine Lust und vor allem keine Energie mehr, sich mit der alten Hexe zu beschäftigen. Zu viel stand auf dem Spiel und eigentlich ging es ja sowieso nur noch um sein Leben. Denn der einzige Mensch, der sich wirklich darum kümmern konnte, war das Kind selbst. Und nur es. Das hatte das Kind verstanden. Schon längst. Mechanisch, fast schon abwesend, erhob es sich aus dem Schneidersitz, stand auf und ging zum Kleiderschrank hinüber. Es öffnete ihn, nahm seine Lieblingsjacke, einen blauen Blouson, vom Bügel und zog ihn an. Mit dieser Jacke fühlte es sich sicher, sie bot ihm Schutz, so wie es eine Rüstung für einen Ritter tat.
Das Kind schaute noch einmal aus dem Fenster, dann drehte es sich um und ging zur Tür. Nachdem es die Tür leise geöffnet hatte, hörte es das ausgelassene Stöhnen, das gedämpft aus dem Schlafzimmer kam. Das Kind ekelte sich, als es den Flur betrat, der nach irgendeiner Mischung aus inkontinentem Kater und abgestandenem Müll roch.
Vorsichtig und auf Zehenspitzen schleichend ging es ins Wohnzimmer. Das Kind wählte die Wahlwiederholung und wartete ab, bis sich jemand am anderen Ende meldete. Das Gespräch dauerte keine Minute, dann beendete es das Telefonat so wortkarg, wie es das Gespräch begonnen hatte, und legte den Telefonhörer wieder auf die Gabel.
Das Kind wusste genau, was es zu tun hatte. Es schlich sich in die Küche, nahm ein paar Scheine aus dem Portemonnaie seiner Mutter und steckte sie in die Hosentasche seiner Jeans, ehe es wieder vorsichtig zurück ins Wohnzimmer ging. Vor dem Couchtisch blieb es stehen. Das Kind musste sich schütteln, als es mit dem Zeigefinger der rechten Hand über die Holzmaserung fuhr. Es konnte jetzt noch das Klatschen der kalten Hand auf seine nackten Pobacken hören. Immer und immer wieder. Wenn es nur bei der Hand geblieben wäre! Eine Träne kullerte über seine Wange, während ihm eine innere Stimme zurief, dass es jetzt kein Zurück mehr gab.
Das Kind nahm das Streichholz aus der Box, zog es über die Zündfläche und entzündete die rote Duftkerze, die vom hart gewordenen Wachs gehalten auf einer Untertasse neben einem Stapel alter Frauenzeitschriften stand. Achtlos warf es das Streichholz in Richtung Couch, ehe es die Kerze umstieß. Es dauerte nicht lange, bis das Papier der Magazine knisterte, die vormals zarte Flamme immer größer wurde und sich Zentimeter für Zentimeter ins Boulevard hineinfraß.
Teilnahmslos und ohne jedwede Regung ging das Kind in den Flur zurück, stieg in seine knöchelhohen Schuhe und verließ die Wohnung.
Ja, der Tod konnte wirklich eine Erlösung sein. Auch der eigene ...
Kapitel 1
30 Jahre später
Freitag, 5. Januar 2014
„Arschloch!“ Sie knallte die Tür zu und lief, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter. Dafür wirst du noch büßen, dachte sie und der Groll stieg in ihr hoch, als sie sich an den jüngsten Streit mit ihm zurückerinnerte. Sie wollte, sie musste weg. Das war klar. Wenn es da nicht dieses eine Problem geben würde.
Sie hielt kurz inne, als sie die Eingangstür erreicht hatte. Sie lehnte sich gegen die kalte Wand, die mit kleinen, bunten Mosaiksteinen besetzt war, und dachte nach. Der Flur war schmal. Ein abgestelltes Fahrrad und ein zusammengeklappter Kinderwagen, der am Treppenabgang zum Keller postiert worden war, machten ihn noch enger. Die Helligkeit des Wintertages, die sich durch das Oberfenster ausgebreitet hatte, tauchte das Treppenhaus in ein warmes Licht, das jedoch keinen einladenden Charakter besaß.
Das war es dann also! Herzlichen Glückwunsch! Und was wird jetzt aus mir? Wo soll ich hin?
In Gedanken schrie sie sich an, um sich zu beruhigen. Unbändiger Trotz und schiere Panik wechselten sich im Sekundentakt ab, doch den Luxus darüber nachzudenken, wie sie es ihm am besten heimzahlen konnte, konnte sie sich jetzt nicht leisten. Sie musste sich endlich wieder auf das konzentrieren, worauf es ankam. Ihre Rettung.
Sie warf einen letzten Blick ins Treppenhaus und öffnete die Tür. Der Winter begrüßte sie mit einer eisigen Böe. Aber sie fror nicht nur deswegen. Sie wartete noch einen Transporter ab, ehe sie die Rheinstraße, eine der Hauptstraßen Landaus, überquerte und zu ihrem Wagen lief, den sie auf der anderen Straßenseite abgestellt hatte. Sie setzte sich hinters Steuer und wollte gerade den Motor starten, als die Gedanken sie wieder einholten. Je mehr sie versuchte, die bösen Geister zu vertreiben, desto stärker wurden sie.
Und dann gab es kein Halten mehr. Die Tränen liefen ihr nur so über die Wangen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals so verzweifelt wie in diesem Moment gewesen zu sein. Warum bin ich nur immer wieder so blöd, ärgerte sie sich über sich selbst, während sie in ihrer Handtasche nach einem Papiertaschentuch suchte.
Durch den Tränenschleier hindurch schaute sie kurz aus dem Fenster der Beifahrertür. Direkt hinter dem Bürgersteig begann der kleine Park, in dem die Jugendstilfesthalle feierlich thronte. Doch an diesem Sonntagnachmittag strahlte sie eher etwas Bedrohliches aus und es fühlte sich an, als würde sie von den mächtigen Mauern erdrückt werden.
Hier hatten sie sich kennengelernt. Beim Neujahrsempfang einer großen Volkspartei war sie ihm das erste Mal begegnet.
„Möchten Sie auch ein Glas Sekt pur oder gemischt?“, erinnerte sie sich daran, wie sie ihn angesprochen hatte. Sie hatte den Job als Servicekraft über eine Freundin bekommen und war den ganzen Tag über damit beschäftigt gewesen, die wichtigen und weniger wichtigen Menschen der Landauer Politik- und Unternehmerprominenz zu bedienen und anzulächeln. Eigentlich war ihr diese Kaste, dieses elitäre Gehabe und Von-oben-herab-Herumkommandiere zuwider. Aber sie brauchte das Geld und man wusste ja nie, wem man an solch einem Tag alles begegnen würde – so die überzeugenden Worte ihrer Freundin. Er war kein besonders ansehnlicher Mann gewesen. Keiner, dessentwegen man alles stehen und liegen ließ oder seinen Freund betrog. Er war noch nicht mal einer, nach dem man sich auf der Straße umdrehte. Und dennoch hatte er etwas an sich. Damals konnte sie nicht beschreiben, was genau es war. Machthungrig, visionär, strategisch – das waren die Attribute, die ihr direkt eingefallen waren. Aber jetzt, nach genau einem Jahr, wusste sie, was es wirklich war: Er war der Einzige, der sich wirklich für sie interessierte. Der fragte, wie es ihr ging, was sie fühlte und vor allem, ob sie sich wohlfühlte. Nicht nur in sexueller Hinsicht.
Und nun hatte sie ihn verraten. Sie musste es tun, dass war sie ihrem Freund schuldig gewesen. Doch anstatt ihr dafür dankbar zu sein, hatte er sie beschimpft und ihr hinterherspioniert. Es ging so weit, dass sie ihn vor wenigen Minuten mit ihrem Handy in der Hand erwischt hatte, als sie nach einer langen und wohltuenden Dusche aus dem Badezimmer gekommen war.
„Was ist das hier?“, hatte er sie gefragt, während sie ihm, nur mit einem großen Badehandtuch bekleidet, entgegengesprungen war. Sie hatte versucht, ihm das Handy aus der Hand zu reißen, doch er war ihr geschickt ausgewichen. Ihre noch nassen Haare flogen wie gewellte Spaghetti um ihren Kopf herum und sie hörte sich jetzt noch hysterisch schreien, als sie zu einem zweiten Sprung ansetzte und halb auf seiner Hüfte, halb auf seinem Steiß landete.
„Warst du wieder bei ihm? Was hat er dir diesmal versprochen, du marie-salope?“
Er schrie plötzlich auf. Das Handy flog durch die Luft, als er einen stechenden Schmerz in seinem Ohrläppchen spürte, während ihre rechte Hand peitschenartig immer wieder in sein Gesicht knallte. Als sie sah, wo das Handy gelandet war, ließ sie von ihm ab, schob mit dem Fuß den Couchtisch zur Seite und nahm das Handy wieder an sich, während er in die Küche zum Kühlschrank gerannt war und nun versuchte, mit Kühlakkus den Schmerz in seinem Gesicht zu mildern. Dabei fluchte er unentwegt, doch sie konnte nicht verstehen, ob die Worte ihr oder den Schmerzen galten. Aber es war ihr auch egal gewesen.
Sie hatte sich dann schnell angezogen, Handy, Portemonnaie, Ladekabel, Deodorant, Anti-Baby-Pille, Lipgloss und Wimperntusche, Autoschlüssel und ein Haargummi in ihre Tasche gestopft und sich die Haare zu einem lieblosen Dutt zusammengebunden.
Sie war gerade dabei, sich ihren Anorak überzuziehen – den Autoschlüssel schon in der Hand –, als er ihr aus der Küche entgegenkam.
„Wohin gehst du?“, fragte er mit hasserfülltem Blick.
„Das geht dich nichts ...“ Doch weiter kam sie nicht. Er hatte sie schon an ihren Haaren gepackt und wollte sie in die Küche ziehen, als sie mit der linken Hand nach ihm schlug. Dabei waren die Schlüssel, die als Bund an einem langen Band hingen, nach vorne geschnellt und hatten ihn mitten ins Gesicht getroffen. Er hatte sofort ihren Arm losgelassen und war sich mit der rechten Hand übers Gesicht gefahren.
„Was hast du gemacht, du Schlampe?“, schrie er und zeigte ihr seine blutverschmierte Hand. In Höhe der rechten Augenhöhle war seine Haut gut drei Zentimeter aufgeplatzt. Auch aus seiner Nase lief bereits Blut. Immer und immer wieder wischte er sie sich an seinem Kapuzenpullover ab, doch der Blutlauf wollte nicht versiegen. So legte er den Kopf tief in den Nacken, während er zurück in die Küche lief. Für einen kurzen Moment war sie versucht, ihm zu helfen, ihm das Küchenpapier zu reichen und das Blut vorsichtig vom Gesicht zu tupfen.
Sie wollte gerade ansetzen, sich zu entschuldigen, als er plötzlich wieder im Flur stand. In der Hand hielt er das große Küchenmesser, mit dem er im Sommer immer die Wassermelonen halbiert hatte, und bedrohte sie.
„Hau ab! Hau endlich ab, du Miststück, und lass dich hier nie mehr blicken.“
Was für ein Wichser! Sie wischte sich die Tränen an ihrem dunkelgrünen Anorak ab und schaute mit trübem Blick durch die Windschutzscheibe.
Nein, so lasse ich mich nicht mehr von dir behandeln. Das war zu viel.
Plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Endlich konnte sie wieder lächeln und sie spürte, wenn auch nur zaghaft, wie sich Entschlossenheit in ihrem Körper ausbreitete – trotz ihres noch immer schmerzenden Rückens, sodass sie sich in ihrem Autositz hin- und her bewegen musste, um ihn irgendwie zu entlasten.
Er wird noch für das, was er mir angetan hat, büßen, dachte sie und freute sich jetzt schon darauf, wie er bald angekrochen kommen würde, um sich bei ihr für sein Verhalten zu entschuldigen. Doch dann würde es zu spät sein und er könnte seine Karrierepläne ein für alle Mal in den Wind schießen.
Wer ist hier eigentlich wirklich die kleine, dumme mariesalope?
Sie startete den Motor ihres Wagens, schaute in den Rückspiegel, setzte den Blinker und fuhr aus der Parklücke. Sie wusste nun, wo sie hinwollte. Wo sie hingehörte. Und er würde sich wenigstens auf sie freuen, auch wenn sie sich sicher war, ihren Fehler nie wieder gutmachen zu können. Aber darüber konnte sie sich später noch Gedanken machen. Er würde es sicherlich verstehen beziehungsweise schon eine Lösung für das Problem finden. So wie er bisher immer und für alles eine Lösung parat gehabt hatte.
Ihr Ziel lag in einer ruhigen Seitenstraße eines Landauer Vororts. Prächtige Villen wechselten sich mit gepflegten Stadthäusern ab. Große schwarze, silberne oder auch weiß lackierte Autos standen in den Einfahrten oder parkten unter den ausladenden und teilweise mehr als hundert Jahre alten Bäumen, die zu dieser Jahreszeit ihr Blätterkleid schon lang verloren hatten und – derart kahl dastehend – fast noch mächtiger und würdevoller aussahen als sonst.
Mit Einbruch der Dunkelheit war eine ungemütliche Feuchtigkeit aus den Tälern des Pfälzerwaldes in die Straßen und Gärten gezogen und breitete sich jetzt überall dort aus, wo ihr nichts und niemand Einhalt gebieten konnte.
Sie verabscheute den Winter mit seinen kurzen Tagen, den wenigen Sonnenstunden, der lebensfeindlichen Kälte und konnte es kaum erwarten, dass der Frühling das Land endlich wieder erobern würde. Doch am meisten hasste sie den Schnee. Sie war einfach ein Sonnenkind und konnte mit Skifahren, Schneeballschlachten und Schneemännerbauen so gar nichts anfangen. Zumal sich das himmlische Weiß in Landau auch nur selten von seiner strahlenden Seite präsentierte. Vielmehr war das, was sich vor einiger Zeit als Schneegriesel über die Stadt gelegt hatte, schnell zu einer schmierig grau-braunen Pampe geworden, die sich jetzt als Matsch links und rechts der geräumten Straßen, in Parks und auf öffentlichen Plätzen ausgebreitet hatte. Vor allem in diesem Nobelvorort, in dem selbst die Mülltonnen so angeordnet waren, als wären sie einem Einrichtungsmagazin entsprungen, wirkte der Matsch störend. Fremd. Wie nicht dazugehörend.
So hatte auch sie sich gefühlt, als sie das erste Mal hier gewesen war. Er hatte sie wie eine Prinzessin willkommen geheißen, auch wenn er eigentlich etwas anderes von ihr wollte als royales Verhalten.
Sie lächelte erneut. Nein, sein Reich war Tabu gewesen für alles, was sie sich beide zu geben hatten. Dafür hörten sie hier Musik, genossen das gute Essen, das er extra für sie in stundenlanger Akribie gezaubert hatte und träumten vor dem knisternden Kamin von einer gemeinsamen Zukunft. Es waren glückliche Monate gewesen, bis, ja bis alles von jetzt auf gleich abrupt geendet war. Zerplatzt wie eine Seifenblase. Sie schluchzte erneut, denn sie wusste, es würde kein Zurück mehr geben. Oder doch?
Sie stieg aus ihrem Wagen, den sie einige Meter vom Anwesen entfernt abgestellt hatte, und ging langsam den Jägerzaun entlang zur Auffahrt. Sie musste mit ihm reden. Es ging um sie beide, um ihr gemeinsames Leben.
Die Auffahrt war hell erleuchtet. Anders als bei anderen Häusern gab es hier keine Bewegungsmelder, durch die das Licht automatisch ansprang. Er liebte die Illumination, sie gäbe ihm das Gefühl von Geborgenheit, sagte er, und daher brannten die Lichter im Garten, am Pool und entlang der Auffahrt sowie am Haus, sobald es dunkel wurde.
Ob er alleine ist?
Sie war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob die Idee eines Überraschungsbesuchs wirklich die beste Taktik war. Auch wenn er selbst hin und wieder gern so agierte, hatte sie jetzt das Gefühl, dass ihn ein persönliches Überrumpeln eher zu einem Gegenangriff veranlassen könnte – mit ungeahnten Folgen. Und sie brauchte jetzt alles, nur keine Abfuhr.
Sie ließ die Haustür links liegen und lief seitlich in den Garten hinein. Die Dämmerung war längst zu tiefer Dunkelheit geworden. Nur der Mond zeigte seinen atemberaubenden Hof, der nicht nur am Firmament leuchtete, sondern auch die Eiskristalle auf den Grashalmen vor ihr glitzern ließ.
Anscheinend war schon länger niemand mehr hier entlanggelaufen, denn sie konnte keine Fußspuren auf dem Weg erkennen. Und sie bemühte sich nicht, selbst keine Spuren zu hinterlassen. In der kommenden Nacht sollte es in der Rheinebene schneien und das weiße Pulver würde die Spuren ihrer Anwesenheit somit bereits in wenigen Stunden verschwinden lassen.
Das Esszimmer und der grüne Salon, sein Lese- und Arbeitszimmer, waren an diesem Abend entgegen seiner Gewohnheit fast dunkel. Nur schwach drang das Licht des Kronleuchters aus dem Flur in die beiden Zimmer vor, die zur Straße hin zeigten, aber dank einer halbhohen Hecke im Vorgarten nicht wirklich einsehbar waren. Einzig die grüne Leselampe auf seinem Schreibtisch war eingeschaltet.
Er ist also zu Hause!
Sie spürte, wie sich ihr Puls langsam erhöhte, als sie um das Haus herum lief. Im hinteren Teil befand sich neben dem neu errichteten Wintergarten, der sich direkt an das Esszimmer anschloss, auch das Wohnzimmer. Es war einer ihrer Lieblingsräume. Und auch seiner.
Der Raum hatte eine hohe Decke, die mit Stuck verziert war. Eine große weiße Bücherwand krönte die Kopfseite des Raumes, in dessen Mitte zwei hellbeige Dreisitzer standen.
Auch hier hatte er sie vor dem Kamin geliebt, mit ihr auf den Sofas gekuschelt, einen guten Tropfen getrunken und dabei über Gott und die Welt philosophiert. Und hier hatte er ihr zum ersten Mal die berühmten drei Worte gesagt. Ein wohlig warmer Schauer überzog ihren Körper. Und dann sah sie ihn. Und nicht nur ihn! Sie erschrak.
Was will die denn hier?
Wenngleich sie mit dem Anblick eigentlich hätte rechnen müssen, war sie doch über das, was sie sah, geschockt. Wie entgeistert starrte sie in den hell erleuchteten Raum. Darin redete eine Frau in einer Tour auf einen hilflos in einem Sessel sitzenden Mann ein. Es war, als würde sie mit einem Klopfer unentwegt auf einen Teppich einschlagen, mit dem Ziel, nicht nur den Staub, sondern am liebsten den Stoff, das Muster und die einzelnen geknüpften Haarknoten aus dem Teppich herauszuklopfen.
Was hätte nur aus uns werden können, dachte sie und versuchte, sich die Bilder einer glücklichen, aber fast schon verblassten Vergangenheit in ihre Erinnerung zurückzurufen.
Nun war ihre letzte Möglichkeit also auch dahin! Bravo! Dabei hatte sie etwas, was sie ihm unbedingt zeigen musste. Aber jetzt und hier, an diesem matschigen Wintertag, in diesem Viertel, konnte sie sich das ein für alle Mal abschminken. Nichtsdestotrotz würde ihre Zeit noch kommen, dessen war sie sich sicher.
Erneut kullerten ihr Tränen über die kalten Wangen – nur dieses Mal war es der Zorn über sich selbst und die Wut über ihr verkorkstes Leben, die das Gefühlschaos in ihr auslösten.
Sie hatte Raum und Zeit völlig vergessen, als sie zwei ernste Blicke auf sich ruhen spürte. Entsetzt duckte sie sich unter das Fenster. Hatten die beiden sie wirklich gesehen oder hatte sie sich das nur eingebildet? Sie zählte bis fünf, dann hob sie vorsichtig den Kopf. Das Licht brannte wie zuvor, doch der Raum war leer. Sie wusste, sie war gesehen worden!
Ich muss weg! Sofort!
Auch wenn sie keine Angst hatte und selbstbewusst genug war, sich der Situation zu stellen, so wollte sie eine offene Konfrontation jetzt nicht riskieren. Sie hörte noch, wie das Adrenalin in ihren Ohren rauschte, ehe sie querfeldein durch den Vorgarten in Richtung Auffahrt rannte. Sie kämpfte sich durch eine Armada von Hortensien-Sträuchern, kletterte durch eine Kirschlorbeer-Hecke und hätte fast ihren Schal in einer roten Zwergberberitze verloren, die direkt am Zaun zur Auffahrt gepflanzt worden war.
Sie war gerade darüber geklettert, die letzten Meter der Auffahrt hinuntergelaufen und aus dem Sichtfeld der Haustür verschwunden, als sie die beiden Stimmen hörte. Sie atmete erleichtert auf, während sie ihren Oberkörper nach vorne beugte und versuchte, sich zu beruhigen. Erneut zählte sie bis fünf und richtete sich dann langsam auf, als sie plötzlich in dunkle, leuchtende Augen blickte.
„Was willst du denn hier?“, zischte sie. „Musst du mich so erschrecken?“ Sie hätte nie damit gerechnet, ausgerechnet diese Person hier anzutreffen. „Verfolgst du mich etwa?“, fragte sie immer noch etwas außer Atem, doch ihr Gegenüber erwiderte nichts. „Dann eben nicht! Ich muss eh gehen“, sagte sie, doch die schwarze Gestalt machte keine Anstalten, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Einzig ein tiefgründiges Lächeln, das sie an den Joker aus Batman erinnerte, signalisierte ihr, dass die Person echt war.
„Was willst du?“, blaffte sie und merkte, wie der Zorn erneut in ihr hochstieg.
„Es war ja klar, dass ich dich hier finden würde, du ...“
„Und, das ist doch wohl meine Sache, oder?“
„Ich glaube, jetzt nicht mehr!“ Wieder funkelten die Augen der Gestalt und sie fragte sich, wie lange sie schon von ihr beobachtet worden war.
„Ah ja?“, fragte sie spitz.
„Und wohin willst du?“
„Weg, einfach nur weg.“
Und wieder lächelte die Person.
„Dann komm!“, forderte die dunkel gekleidete Gestalt sie auf. Für einen kurzen Augenblick überlegte sie, ob sie das Angebot annehmen sollte, dann folgte sie ihr in die schwarze, eisige Winternacht.
Kapitel 2
Sieben Monate später
Sonntag, 17. August 2014
„Luiz, Mündchen auf und happ.“ Emma schob den Kinderlöffel in einen weit aufgerissenen Babymund. Der kleine Mann im Kinderwagen hüpfte vor Freude, während sich sein Mund nicht entscheiden konnte, ob er weiter lachen, drauflos brabbeln oder einfach nur das Vanilleeis lutschen wollte. Erste milchige Speichelfäden liefen ihm die Mundwinkel hinunter, als er den Löffel freudestrahlend wieder freigab.
„Hättest du dem Jungen nicht wenigstens einen dänischen Vornamen geben können? Frederik, Magnus oder den schönen Namen deines Bruders, Erik? Musste es gerade ein brasilianischer sein?“ Emmas Mutter Marit Hansen, die gerade eine neue Diät ausprobierte und sich daher nur einen grünen Tee bestellt hatte, schaute widerwillig auf den kleinen Wonneproppen, der seit gut einem Jahr ihr Stiefkind und ihr Pflegeenkel in einer Person war.
Es war das erste Mal, dass sie ihn nun hautnah und live erlebte, denn bisher hatte sie ihn noch nie gesehen. Sehen wollen. Sie lehnte dieses Etwas – wie sie den unehelichen Sohn ihres Mannes seit dem Bekanntwerden seiner Existenz nur nannte – mit jeder Faser ihres Körpers ab. Er existierte für sie einfach nicht. Deshalb hatte sie auch ihre regelmäßigen Besuche bei Emma eingestellt. Seitdem fand jede zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mutter und Tochter nur noch am Telefon oder via Kurznachricht übers Handy statt. Bis zu einem Dienstag vor drei Wochen, als Emma aufgelöst und nervlich angespannt bei ihr angerufen und sie um Unterstützung gebeten hatte. Schweren Herzens hatte sie zugesagt, um ihre Tochter bei der neuen und nicht ganz freiwilligen Herausforderung, als ungeplante Mutter Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen, zu unterstützen.
„Papa hat sich diesen Namen gewünscht. Er sprach immer von seinem Luiz. Er war sein Lichtblick.“ Leider hat er ihn ja nicht mehr persönlich kennenlernen dürfen, ergänzte Emma gedanklich, setzte sich wieder ihre Sonnenbrille auf, die sie sich zuvor ins Haar gesteckt hatte und schaute über den Landauer Rathausplatz, das pulsierende Herz der pfälzischen Hauptstadt, wie die Landauer ihre Stadt liebevoll nannten.
Das Eiscafé lag direkt neben einem großen Drogeriemarkt. Folgte man dem Blick weiter in nördliche Richtung, dann erhob sich nach einigen weiteren kleinen Geschäften das Alte Kaufhaus, eines der ältesten Gebäude der Stadt, in dem seit einigen Jahren verschiedene Kulturveranstaltungen stattfanden. Mitten auf dem Platz stand ein weiteres Wahrzeichen der ehemaligen Garnisonsstadt: das Luitpold-Denkmal. Ein bronzenes Reiterstandbild, das der Bildhauer Ruemann bis 1893 angefertigt hatte und an dessen Sockel sich jetzt zwei Mädchen sonnten und dabei ebenfalls genüsslich an ihren Eistüten schleckten.
Es war einer der wenigen Sommertage, die erträglich waren und an denen man sich bedenkenlos im Freien aufhalten konnte. Denn auch wenn vom Pfälzer Hügelland immer mal wieder eine angenehme Böe über Landau wehte und das Klima, die Landschaft und die Lebensweise nicht umsonst an die italienische Toskana erinnerten, so hatte sich in diesem Jahr der Sommer schon seit Wochen mit einer lähmenden Trockenheit übers Land gelegt. Die Erde lechzte nach Wasser, Reben und Weinstöcke waren trocken wie Zunder und auch die satt- und tiefgrünen Wipfel der mächtigen Buchen, Fichten und Kiefern des Pfälzerwaldes waren an vielen Stellen bereits braun vor Wassermangel.
Selbst die Gauner und Halunken – so hatte Emmas Opa, der selbst Hauptkommissar in Kopenhagen gewesen war, die Schwerverbrecher immer genannt, um Klein-Emma die Angst vor seiner Arbeit zu nehmen – hielten sich in diesem Sommer auffallend zurück. Einige urlaubsbedingte Einbrüche, die angespülte Wasserleiche eines seit Monaten vermissten Mannes im Altrhein, einem Seitenarm des Hauptstroms, und ein Überfall auf eine Bankfiliale in Schifferstadt waren die einzigen aktuellen Fälle, die gerade bei Emma Hansen und ihrem Kollegen Matthias Roth auf dem Schreibtisch lagen.
Aber Emma war dankbar, dass die vergangenen Wochen deutlich ruhiger, ja fast schon entspannt verliefen. Und das nicht nur wegen der dramatischen Mordserie in Burrweiler, die im Januar ihre ganze Konzentration gefordert hatte. Seit jenen Tagen, konkret seit dem 31. Januar, war sie nicht mehr allein. Und auch wenn sie sich die Vorgeschichte anders gewünscht hätte, so war an diesem Freitag einer ihrer größten Wünsche endlich in Erfüllung gegangen: Sie war von einem auf den nächsten Augenblick Mama geworden. Zwar ohne Mann und vor allem ohne eigenes Kind, dafür aber glücklich und geerdet. Denn Emma war endlich nicht mehr auf der Suche nach sich selbst. Zumindest hatte sie das Gefühl, auch wenn Luiz, so hieß der Sohn ihres Vaters, von jetzt auf gleich ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigte und Emma erst gar nicht mehr zu sich selbst finden ließ.
Luciana Santos, die Geliebte ihres Vaters, hatte ohne Ankündigung oder Vorwarnung, wie es Emmas Mutter Marit gerne abfällig umschrieb, das Kind einfach ohne weitere Nachricht für Emma im Ludwigshafener Polizeipräsidium abgegeben. Was für ein Schock – nicht nur anfangs, wie sich Emma auch heute noch eingestehen musste. Dass ein Kind ihr Leben über Nacht so komplett verändern würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Auch wenn sie den kleinen Luiz von ganzem Herzen liebte und eigentlich nicht wieder hergeben wollte – Emma war davon überzeugt, dass ein Kind und seine Mutter zusammengehörten. Und deshalb setzte Emma alles daran, Luciana zu finden.
Aber weder das direkte Umfeld der ehemaligen Samba-Tänzerin aus Porto Alegre noch die vermeintlichen Freunde ihres Vaters, denen er sich möglicherweise noch vor seinem Tod anvertraut hatte, und erst recht nicht das brasilianische Konsulat konnten Emma bei ihren Bemühungen, Luciana ausfindig zu machen, weiterhelfen.
Ganz im Gegenteil: Je tiefer Emma bohrte, je intensiver sie recherchierte und nachfragte, desto nebulöser wurde der Mensch, den ihr Vater bis zu seinem Unfall geliebt hatte.
Luciana Santos schien wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein und genau dieser Erdboden hatte nicht vor, sie auch wieder auszuspucken.
Und so war Emma sprichwörtlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Auch wenn ihrer Mutter das alles andere als in den Kram gepasst hatte.
Erst sollte ich keine Kommissarin werden und jetzt soll ich mich nicht um das Kind meines Vaters kümmern, nur weil nicht Marit, sondern Luciana die Mutter des Kleinen ist, dachte Emma und folgte mit ihrem Blick einer Taube, die mit einer anderen Taube um ein großes Stück einer Eiswaffel kämpfte, um sich dann als Siegerin und mit dem Waffelstück im Schnabel auf dem gläsernen Dach eines Toilettenpavillons niederzulassen.
„Lichtblick? Das ich nicht lache! Anhängsel oder Ballast trifft es da wohl besser.“
„Mutter, jetzt reicht‘s! Der Kleine kann ja wohl nichts für eure …“
„Unsere gescheiterte Ehe? Ja, sprich es nur aus, Emma. Aber wir wären nicht gescheitert, wäre diese …, diese Tänzerin nicht in Knuts Leben getreten.“ Marit Hansen nahm erneut einen Schluck ihres grünen Tees, den sie wegen des schneller einsetzenden Sättigungsgefühls und trotz der hohen Temperaturen warm trank.
„Zu einer Ehe gehören immer zwei …“
Marit Hansen hätte sich fast verschluckt.
„Willst du mir damit etwas sagen …“, presste sie hervor, ehe sie loshustete.
„Ach Mutter, das ist mir jetzt zu blöd. Du weißt ganz genau, was ich damit meine“, erwiderte Emma und winkte einer Servicekraft zu. Als diese aber wieder ins Café zurückeilte, anstatt an Emmas und Marits Tisch zu kommen, stand Emma auf und folgte ihr.
„Entschuldigen Sie, könnten wir noch etwas …“, rief Emma der jungen Frau, die gerade mit einem mit Eisbechern, Gläsern und Flaschen beladenen Tablett zwischen den Tischen Slalom tanzte, hinterher, als sie mit einem Mann zusammenstieß, der Emma auf der Suche nach einem freien Platz völlig übersehen hatte.
„Hej, passen Sie ...“
„Oh, Pardon. Ich habe Sie nicht gesehen“, entschuldigte sich der Mann und lächelte Emma etwas unbeholfen zu.
Emma lächelte schwach zurück.
„Ist ja nichts passiert.“
Was für ein attraktiver Mann, schoss es ihr durch den Kopf, auch wenn sie selbst für einen Flirt gerade so gar keinen Kopf hatte.
„Der Heißhunger auf einen Eiskaffee hat mich wohl erblinden lassen. Aber wie ich gerade sehe, scheint wohl nichts mehr frei zu sein.“ Der Mann zuckte mit den Schultern, nachdem er mit einem schnellen Blick die gut zwei Dutzend Tische abgescannt hatte, die zum Außenbereich des Eiscafés gehörten.
„Wollen Sie sich zu uns an den Tisch setzen? Einen Eiskaffee muss man ja genießen!“
„Ja, sehr gerne.“ Der Mann folgte Emma, die die Bedienung und ihr Anliegen völlig vergessen hatte. „Und so ein Becher to go ist nicht nur eine kulinarische Sünde. Er birgt auch ganz andere Gefahren.“ Der Mann zeigte auf sein Hemd. Ein großer brauner Fleck hatte sich im Brustbereich direkt an der Knopfleiste in die hellblau gefärbte Baumwolle gesaugt. „Und das war nur ein normaler Kaffee heute Morgen im Büro.“
„Ich bin übrigens Emma.“ Emma streckte dem Mann ihre Hand entgegen, als sie den Tisch erreicht hatten.
„Hast du jetzt eine Flasche stilles Wasser für mich bestellt?“, fragte Marit Hansen ihre Tochter, ehe sie den Mann dezent musterte.
„Meine Mutter Marit Hansen und Luiz ... also ...“
„Ihr Pflegekind“, grätschte sich Marit Hansen in die Vorstellungsrunde ein.
„Sehr erfreut, Stefan Bellheim ist mein Name“, sagte der Mann und grüßte erst Marit Hansen und schüttelte dann Luiz’ kleines Händchen, der den fremden Mann ebenfalls interessiert inspizierte.
„Und was ist jetzt mit meinem Wasser? Ich wäre eben fast erstickt!“
Stefan und Emma wechselten rasch einen Blick, dann winkte Stefan der Kellnerin zu, die seinen Wink registrierte und nach einer aufgenommen Bestellung zwei Tische weiter zu ihnen kam.
„Was darf’s denn sein?“, fragte die junge Frau, die Emma auf höchstens Anfang zwanzig schätzte.
„Ich brauche dringend ein stilles Wasser, aber nicht gekühlt“, ergriff Marit Hansen das Wort.
„Und ich hätte gerne einen Eiskaffee“, schloss sich Stefan Bellheim der Bestellung an.
Keine fünf Minuten später genoss Stefan seinen Eiskaffee mit schokolierten Kaffeebohnen, einer Haube Sahne und einigen Spritzern Schokoladensauce. Das Schirmchen, das, warum auch immer, ebenfalls zur Dekoration gehört hatte, hatte er Luiz gegeben, der nun wild damit herumfuchtelte, ehe er es mit einem lauten Lachen auf den Boden warf.
„Wie alt ist denn der kleine Mann?“, fragte Stefan, während er sich nach dem gelben Schirm bückte und ihn aufhob.
„Fast anderthalb“, entgegnete Emma rasch, die nicht wollte, dass erneut ihre Mutter für sie antwortete. Luiz und sein Alter. Auch das war so eine dieser unzähligen Geschichten, die Emma viel Rechercheaufwand abverlangt hatten. Denn natürlich hatte Luciana keine Papiere zurückgelassen oder dem kleinen Luiz mit in den Maxi Cosi gelegt, als sie ihn im Polizeipräsidium abgegeben hatte. Ihr Kollege Matthias Roth und sie hatten sich dann durch die Ludwigshafener Kliniken, bei verschiedenen freiberuflichen Hebammen und den Kinderärzten der Region durchtelefoniert.
Es dauerte fast einen Monat, bis Emma und Matthias endlich die richtige Person erwischten, die ihnen alle wichtigen Informationen geben konnte. Luiz war am 20. März 2013 geboren worden, so die damalige Hebamme, die Luciana geholfen hatte, Emmas Halbbruder auf die Welt zu bringen. Luciana hatte sich für eine Hausgeburt in der Wohnung von Emmas Vater in Frankenthal entschieden, der zu diesem Zeitpunkt aber nach dem schweren Arbeitsunfall bereits im Wachkoma gelegen hatte.
„Und Sie haben ihn zur Pflege?“ Stefan schien, so vermutete Emma, sehr angetan zu sein und freute sich sehr, dass wenigstens ein fremder Mensch ihr Engagement zu schätzen wusste, wenn es ihre eigene Mutter schon nicht tat.
„Es ist alles etwas kompliziert“, schaltete sich nun wieder Marit Hansen ins Gespräch ein.
Als sie meinte, durch die Gläser der Sonnenbrille einen fragenden Blick bei Stefan gesehen zu haben, wollte sie gerade weiter ausführen, als ihr Emma zuvorkam.
„Was meine Mutter sagen will: Luiz ist eigentlich mein Halbbruder, der kleine Sohn meines Vaters. Doch mein Vater ist im Januar verstorben und seitdem kümmere ich mich um den Kleinen.“
Stille.
Ob ich ihn jetzt geschockt habe, fragte sich Emma, schämte sich aber im nächsten Augenblick für diesen Gedanken. Sie liebte ihren Sohn! Ja, ihren Sohn! Und sie hasste es, in diesem Punkt um den heißen Brei zu reden oder gar eine Verschleierungstaktik anzuwenden, nur um aus ihrem Sohn ein Pflegekind zu machen, so wie es ihre Mutter ständig tat.
Emma wollte Luiz gerade demonstrativ aus seinem Kinderstuhl heben, als plötzlich ihr Handy das mittlerweile unangenehme Schweigen am Tisch unterbrach. Emmas Mutter war die Erste, die wieder Worte fand.
„Wer stört dich denn jetzt am Sonntag, Kind. Doch nicht etwa deine Dienststelle?“, fragte Marit Hansen und wandte sich gleich an Stefan. „Meine Tochter ist Kriminalhauptkommissarin bei der Mordkommission in Ludwigshafen. Noch, denn sie möchte in absehbarer Zeit diese Abteilung leiten.“
„Mutter, bitte!“ Emma warf ihrer Mutter einen bösen Blick zu.
„Es ist Rike. Ich glaube, da muss ich mal kurz rangehen, entschuldigt bitte! Ich mach’s auch kurz“, versprach Emma und strich über das Display ihres Handys, ehe sie aufstand und sich etwas vom Tisch entfernte.
„Hej Rike“, hörten Marit und Stefan noch, wie Emma ihre Freundin aus gemeinsamen Studienzeiten begrüßte.
„Und was machen Sie so?“, fragte Marit Hansen beiläufig und nahm einen Schluck Wasser.
„Ich möchte nicht länger stören, bin schon auf dem Sprung“, erwiderte Stefan.
„Jetzt bleiben Sie doch noch“, entgegnete Marit Hansen überrascht. Sie konnte ihre Enttäuschung ob seines hastigen Aufbruchs nicht verbergen.
„Ich würde noch sehr gerne bleiben, aber ich muss wirklich.“ Er reichte ihr die Hand und lächelte sie an: „Grüßen Sie Ihre Tochter von mir. Es war sehr schön, Sie kennenzulernen.“ Er reichte Luiz noch sein Kuscheltier, das er ebenfalls zum wiederholten Male auf den Boden hatte fallen lassen und verschwand in Richtung Trappengasse, die seitlich des Drogeriemarktes abging.
„Wo ist er hin?“, fragte Emma, als sie keine Minute später an den Tisch zurückkehrte.
„Ich sag’s ja, dieses Kind ist ein Hindernis!“
„Was hat denn Luiz damit zu tun?“
„Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als du gesagt hast, das Luiz dein Kind ist. Auch wenn er ja nicht dein Sohn ist, aber das ist eine andere Geschichte. Männer stehen einfach nicht darauf, die Kinder anderer Männer großzuziehen und durchzubringen.“
„Du spinnst!“
„Nein, auch im Tierreich töten Löwen die Jungtiere ihrer Vorgänger.“ Jetzt wurde Marit durch das Klingeln ihres Telefons unterbrochen. „Es ist dein Bruder, Emma. Aber ich rufe ihn später von dir zu Hause aus an.“ Sie legte den Kopf in den Nacken und genoss den Augenblick. Viel länger wollte sie ihr Gesicht auch nicht frontal den aggressiven Sonnenstrahlen aussetzen.
„Wie spät ist es eigentlich?“
„Scheiße, schon so spät“, erwiderte Emma und sprang so schnell von ihrem Stuhl hoch, dass der gesamte Tisch wackelte.
„Emma! Pass doch auf!“
„Ich muss los!“
„Wie, du musst los?“ Marit Hansen nahm hastig ihre Sonnenbrille vom Gesicht und schaute ihre Tochter irritiert an. „Ich dachte, es wären Schulferien.“
„Ja, aber wir sind weder Schüler noch haben wir Lehrer in unserer Tanzgruppe. Außerdem“, Emma hob Luiz aus seinem Stühlchen, setzte ihn in den Kinderwagen, schnallte ihn an und gab ihm seinen Schnuller, während sie mit der anderen Hand bereits das Etui ihrer Sonnenbrille und ihr Handy in ihren Shopper stopfte und parallel mit den Fingern nach ihrem Portemonnaie fischte, „ist uns das Tanzen so wichtig, dass wir auch während der Sommerferien nicht darauf verzichten wollen.“
„Das Tanzen ist dir also wichtiger als ...“
„Ah, hier ist es!“ Emma überging den Einwand ihrer Mutter, während sie mit einem Lächeln ihre Geldbörse aus der übergroßen Handtasche zog. „Kannst du bitte den Rest zusammenpacken und mit Luiz und dem Kinderwagen ein paar Schritte gehen? Ich zahle nur schnell und dann fahre ich euch nach Freinsheim.“
„Emma!“
Emma flog über die Autobahnen und Straßen zum ehemaligen Mannheimer Flughafen. Dort hatte im alten Terminalgebäude vor gut zwei Jahren das Tanzstudio Flying Tango eröffnet, in dem Emma in der Formationstanzgruppe des TSC Blau-Gelb Royal Mannheim jeden Mittwochabend und Sonntagnachmittag lateinamerikanische Tänze trainierte. Die Mannschaft, bestehend aus zehn Tanzpaaren, startete in der Regionalliga, der dritthöchsten Tanzliga, und Emma liebte den sportlichen Wettbewerb um die beste Synchronität, die außergewöhnlichste Choreographie und das beste tänzerische Vermögen.
Für eine Fahrt, die laut Navigationsprogramm und ohne Verkehrsstörungen 35 Minuten dauerte, benötigte Emma heute nur 23 Minuten. Dann hatte sie ihren Mini auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Abfertigungsgebäude abgestellt und eilte die Treppen zum Tanzstudio hoch.
Sie war – wie eigentlich immer – zu spät.
Doch ihre Unpünktlichkeit hatte seit ihrem Mama-Dasein noch drastisch zugenommen. Wenn sie es überhaupt zum Training schaffte.
„Wo ist denn Matthias?“, fragte Emma und schaute ihren Tanzpartner Oliver mit großen Augen an, als sie zu der an diesem Sonntag deutlich kleineren Gruppe von Tänzern stieß. Sie wunderte sich nicht nur darüber, dass er ihr nicht abgesagt hatte, nein, sie war sogar ein wenig traurig, weil er sich nicht bei ihr gemeldet hatte. Bisher hatte er das immer getan, wenn er mal nicht konnte und daher eine Tanzstunde verlegen oder ganz ausfallen lassen musste.
Seit ihrem gemeinsamen intensiven Einsatz in Burrweiler waren die beiden ein eingeschweißtes Team geworden, auch wenn sie sich ab und an noch kabbelten. Aufeinander verlassen konnten sie sich immer. Auch und erst recht, seitdem Emma Matthias’ Frau in der Klinik Residenz Nova Vita kennengelernt hatte. Isabell lag dort seit gut zwei Jahren nach einem missglückten Selbstmordversuch im Koma.
„Er war eben kurz da und bat um Verständnis, dass er das Training heute nicht leiten könnte. Er hätte noch einen wichtigen Termin, den er leider unmöglich verschieben könnte.“
Isabell! Wie ein Blitz schlug der Name bei Emma ein. Ob irgendetwas vorgefallen und er dringend zu ihr gerufen worden war?
Emma lief so schnell sie konnte wieder die Treppen hinunter in die Damenumkleide. Dort angekommen öffnete sie ihren Spind, holte ihren braunen Shopper hervor und kramte nach ihrem Handy. Sie hatte es ausgeschaltet, nachdem sie Luiz und ihre Mutter in Freinsheim abgeladen hatte. Ein dummer Fehler! Hoffentlich kein tödlicher, dachte sie, während ihre Finger über das Display flogen, um mit der richtigen Zahlenkombination das Handy zu entsperren.
Eine neue Nachricht auf ihrer Mailbox! Emma spürte, wie ihr Herz schneller schlug, als sie ihren Anrufbeantworter abrief.
„Emma, hier ist Matthias. Ich wollte dir nur sagen: Ich habe es getan.“
Dann war das Gespräch beendet.
Kapitel 3
Die Hitze stand in der Rheinebene. Es war kurz vor 16 Uhr, der Asphalt dampfte und die Straße flimmerte vor seinen Augen. Matthias Roth war angespannt, aber er wusste, er kam um diesen Termin nicht herum. Die Entscheidung, die er zu treffen hatte, würde sein ganzes Leben verändern. Und nicht nur das Seine. Doch das Allerschlimmste war: Diese Entscheidung war unumkehrbar. Final. Und niemand konnte ihm sagen, wie es ausgehen würde.
Ich habe keinen Bock mehr! Warum nur immer ich?!
Er fuhr sich durch sein in den vergangenen zwei Jahren lichter gewordenes Haar. Automatisch musste er wieder an seine Frau denken, die ihm immer liebevoll durchs Haar gewuschelt hatte, bevor sie ihre Arme um seinen Oberkörper gelegt und anschließend seinen Nacken mit zärtlichen Küssen liebkost hatte.
Ja, Isabell war seine Traumfrau gewesen. Das hatte er schon gewusst, als er sie das erste Mal gesehen hatte. Er hatte sie auf einem Weinfest in der Pfalz kennengelernt und sie hatte ihn von der ersten Minute an mit ihrem ansteckenden Lachen, ihrem feinen Humor und ihrer lebensbejahenden Art für sich eingenommen. Und so waren sie einfach nur glücklich gewesen, bis das Schicksal erbarmungslos zugeschlagen hatte.