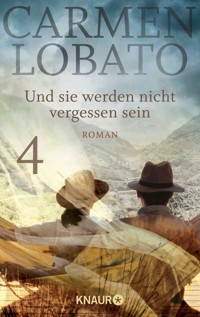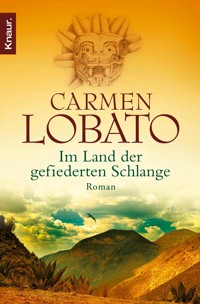1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Teil 2 des sechsteiligen Serials! Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carmen Lobato
Und sie werden nicht vergessen sein 2
Serial Teil 2
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Inhaltsübersicht
Zweiter Teil
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweiter Teil
Berlin, London, Doğubeyazıt
»Hier war mein Glück zu Hause. Und meine Not.
Hier kam mein Kind zur Welt. Und musste fort.
Hier besuchten mich meine Freunde.
Und die Gestapo.«
Mascha Kaléko
9
EvaBerlin. Oktober 1937
Abscheulich. Kaputt. Entartet. Verdorben.
Die Worte hämmerten in Evas Kopf. Seit vier Monaten, seit dem Raub ihrer Bilder, hatte das Hämmern der Worte nicht mehr aufgehört. Es waren lediglich neue hinzugekommen, der Hammer spitz und hart wie der Bossentreiber, mit dem Bildhauer Spalte in Stein trieben. Jedes Wort trieb einen Spalt in Evas Schläfe:
Gequälte Leinwand.
Seelische Verwesung.
Krankhafte Fantasten.
Geisteskranke Nichtskönner.
Das hatte Zeile für Zeile auf den Handzetteln gestanden, die in den Straßen verteilt worden waren, um zum Besuch der Ausstellung aufzufordern. Blutrote Handzettel. Damals, für Evas erste Berliner Ausstellung, hatte Alfred Renke-Levin ebenfalls Handzettel drucken lassen, die in harmlosem Weiß gehalten waren. Atemberaubend und nie dagewesen, hatte in der Kopfzeile gestanden. Eva Löbel fängt auf der Leinwand ein, was dem Blick verborgen bleibt.
Über die Formulierung hatten sie endlos debattiert. Eva erschien sie zu betulich, zu zahm, zu wenig provokant. »Klingt wie im Raritätenkabinett«, hatte sie gesagt. »Eva Löbel, Kalb mit drei Köpfen, tausendmal gesehen, reißt nicht mal die tatterigste Oma vom Hocker.«
Letztendlich hatte sie sich gefügt, weil man das als unbekannte Malerin auf Berlins umkämpftem Pflaster eben tat. Insgeheim aber hatte sie sich eine andere Ausstellung gewünscht, eine große, spektakuläre, die nicht nur vom Hocker riss, sondern schockierte. Die nicht den Atem raubte, sondern das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Die hatte sie bekommen. Zwar nicht in Berlin, doch dafür in München, das sich rühmte, die Kunststadt Deutschlands zu sein. Zwar nicht für sich allein, doch dafür zwischen den Werken von Meistern, auf deren Gesellschaft sie unter anderen Umständen maßlos stolz gewesen wäre. Entartete Kunst hieß die Ausstellung. Ein Bossentreiber war ein hartes Werkzeug, das Brocken aus Granit schlug. Die Worte Entartete Kunst waren noch härter. Sie schlugen Brocken aus Evas Herz.
Zwei ihrer Bilder – der junge Mann, den Chaja den traurigen Clown nannte, und die Frau, auf die niemand wartete – waren nach München geschleppt und in die Ausstellung Entartete Kunst gehängt worden. In eine Ausstellung, die von München aus durch das gesamte Reich wandern und allen Deutschen zeigen sollte, wie geisteskranke Nichtskönner malten. Wie Kunst aussah, von der die deutsche Seele krank wurde und verweste.
Damals, im Juni, war Eva Amok gelaufen. War von Pontius zu Pilatus gerannt, um herauszufinden, was mit ihren Bildern geschehen war. Amok lief sie noch immer, selbst wenn sie still saß, wenn Wilma und Paul wagten, aufzuatmen. Die zwei waren derart rastlos um sie bemüht, dass Eva sich schämte. Womit hatte ausgerechnet sie solche Freunde verdient? Wilma und Paul wichen nicht von ihrer Seite, überschütteten sie mit ihrem Pernod, ihrer Zärtlichkeit, ihren Durchhalteparolen, und Eva war nicht einmal in der Lage, es ihnen mit einem Lächeln zu danken.
Tief im Innern wünschte sie sich, dass die beiden Chaja nähmen und gingen, damit sie, Eva, allein sein konnte. Sie wollte keine Liebesbezeugung, sie wollte nicht einmal Pernod und erst recht kein Es-wird-alles-wieder-gut. Sie wollte nur eines: kreuz und quer durch ein Land jagen, das verrücktspielte, und ihre Bilder finden. Ihre Bilder und die Steinriesen, die noch unwiederbringlicher waren.
Wilma und Paulchen taten, was sie konnten. Es war nicht ihre Schuld, dass Eva sich nicht beruhigen, nicht warnen, nicht aufhalten ließ. Wilma verkaufte Schnaps und Schmalzstullen, und Paul schrieb Gutachten über irgendwelche alten Tonscherben. Wie es sich anfühlte, ein Menschengesicht auf Papier zu bannen und es dann zu verlieren, konnte keiner von ihnen ahnen.
»Jetzt reg dich doch nicht schon wieder so auf, bijou«, sagte Wilma auch heute und versuchte, Eva zu umarmen. »Du hast doch ganz andere Sorgen.«
Seit jenem Abend im Juni hatte Eva das Gefühl, aus Glas zu sein – aus hoch erhitztem Glas, das bei Berührung zersprang. »Ich habe keine anderen Sorgen«, erwiderte sie und kämpfte sich frei. »Ich will meine Bilder. Sonst nichts.«
»Et merde!«, rief Wilma. »Die Bilder sind doch nicht aus der Welt. Ja, sie haben sie abgeholt, und das schreit zum Himmel, aber spätestens, wenn diese ganze braune Scheiße vorüber ist, müssen sie dir die ja wohl wiedergeben.«
Ihr Vater hatte ihr das Bild von der Mutter nicht wiedergegeben. Ihre Zeichenlehrerin hatte ihr die Bilder mit den kaputten Fratzen auch nicht wiedergegeben. Eva überlegte. Sie konnte sich nicht erinnern, wie jene Bilder ausgesehen hatten, sie konnte sich nicht einmal richtig erinnern, wie ihre Mutter ausgesehen hatte. Ihre Bluse sah sie noch vor sich, den steifen, nicht ganz sauberen Stoff auf der Brust, doch wenn sie sich ihr Gesicht vorstellen wollte, verblasste die Form und wurde leer, ohne Züge, wie eine Puppe zum Aktzeichnen.
Eva erschrak. Wie sahen die Bilder aus, die die Nazis ihr gestohlen hatten? Verschwammen diese ebenfalls schon, wenn sie versuchte, sie sich ins Gedächtnis zurückzurufen? Sie musste sie wiederbekommen, jetzt und nicht erst, wenn die braune Scheiße vorüber war. Ohne ihre Bilder war sie wie im Innern ausradiert.
»Ich muss gehen.«
So hatte sie etliche Male jede Diskussion beendet, war aufgesprungen und hatte das Babeurre verlassen. Jetzt wollte sie es wieder tun, sie wurde verrückt, wenn sie länger als eine Stunde tatenlos in einem Raum saß. Zumal sie inzwischen endlich zu wissen glaubte, was mit ihren Bildern – und womöglich mit den beiden Skulpturen, die noch wertvoller waren – geschehen war. Zwei von ihnen waren also in die Münchner Hofgartenarkaden geschafft worden, um in der Ausstellung Entartete Kunst zu hängen wie am Pranger: geschmäht, dem Hohn preisgegeben, weit weg von ihrer Schöpferin, die sich hätte vor sie stellen können.
Lieber hätte Eva sich selbst mit Dreck bewerfen lassen als ihre Bilder. Ihre Bilder, das war sie selbst, der Rest war nur eine Hülle.
Einen Tag vor der Eröffnung der Ausstellung war ein paar Straßen weiter die bombastische Halle, die Hitler sich hatte bauen lassen, das Haus der Deutschen Kunst, mit einem Festakt eingeweiht worden. Dort fand zeitgleich die Große deutsche Kunstausstellung statt, die zeigte, was fortan in Deutschland erwünscht war: Gefällige Gesichter wie die von Gertrud und Sibylle, brave Mittelmäßigkeit von Pinselaffen, die keine Schläge auf Herz und Mut verdienten.
Von Evas Bildern hingegen blieb nur der rote Handzettel. Für Jugendliche verboten stand darauf, damit keine zarte Seele von ihrem schändlichen Geschmier verdorben würde. Die Menschen auf den Bildern hatten ihre Würde verloren, sie würden nie mehr dieselben sein. Aber wie sollte sie das Wilma und Paul erklären, die sich so verzweifelt bemühten, ihr zu helfen?
Sie erklärte besser gar nichts, sondern ging und versuchte zum hundertsten Mal, das Übrige zu retten. Vor allem das Beste, was sie in ihrem Leben geschaffen hatte: die Steinriesen aus Babelsberg. Sie waren monumental wie die leblosen Muskelpakete, die Hitler sich vor sein Olympiastadion hatte stellen lassen, doch ihr sardonisches Grinsen war fragil wie Menschenhaut. Wenn Eva sie nicht verlieren wollte, musste sie sie wiederfinden und in haltbares Material übertragen. Gips beispielsweise. Sie hatte bislang nie mit Gips gearbeitet, wusste nicht einmal, wo sie eine solche Arbeit in Angriff nehmen sollte, aber eines wusste sie: Sie musste es tun. Ohne die Steinriesen war alles hinfällig, ohne den Gipfel war die Mühe des Weges umsonst.
Und dann, als sie schon zu fürchten begann, ihr ginge die Kraft aus, hatte ihre verzweifelte Suche in Galerien, Akademien und Amtsstuben doch noch Erfolg. Sie hatte jeden Menschen bestürmt, der vom Verbleib ihrer Werke auch nur das Geringste ahnen konnte, und endlich hatte sich einer erbarmt. Wilhelm, ein wilder Dadaist, der sich vor Jahren den Leib grün bepinselt hatte, ehe er mit ihr ins Bett gestiegen war, hatte ihr gesteckt, was sie um jeden Preis wissen wollte: Die meisten in Berlin beschlagnahmten Kunstwerke waren nach Kreuzberg verschleppt worden, in den Viktoriaspeicher, ein Lagergebäude im Osthafen.
Das Gebäude war ausladend und hatte fünf Stockwerke mit himmelhohen Decken. »Wenn du Monumentalskulpturen vermisst, wirst du da wohl fündig«, nuschelte Wilhelm so dicht an ihrem Gesicht, als wollte er sie küssen. »Aber ich hab nichts gesagt, verstehst du? Ich hab Kinder, für mich geht’s um alles. Und du tust auch besser daran, diese Skulpturen abzuschreiben. In Sicherheit wiegen kann sich keiner von uns. Und hat nicht irgendwer erzählt, der schöne Martin hätte sich davongemacht, weil mit deiner Herkunft was nicht stimmt?«
Der ehemals grün bepinselte Dadaist malte jetzt Landschaften mit kernigen Bauerntöchtern und war Hitlers Partei beigetreten. »Nicht aus Überzeugung«, hatte er kläglich beteuert, als wäre nicht Eva der Bittsteller, sondern er. »Aber von irgendwas muss der Mensch doch leben.«
»Von Kartoffelsuppe«, hatte Eva erwidert und war gegangen. Was das bedeutete, würde sie Wilhelm nicht erklären. Sie würde es niemandem erklären, denn es tat zu weh, daran zu denken. Außerdem war ihr egal, wovon Wilhelm, der Grün-Braune, lebte, sie wollte nur ihre Steinriesen zurückhaben.
Am besten ginge sie jetzt los, hinaus in den Regen, und schnappte sich ein Taxi, obwohl das für Juden verboten war. Eva Löbel sah nicht aus, wie Taxifahrer sich eine Jüdin vorstellten, nicht verhärmt und unterwürfig, sondern forsch, frech und so schön, wie es Jüdinnen in Hitlerland gewiss verboten war. Außerdem hatte sie Geld. Sie würde ein Taxi auftreiben, und wenn sie ihre Riesen gefunden hatte, auch einen Transportunternehmer, der sie ihr in die Bleibtreustraße schaffte.
Wie sie die zwei Riesen die Treppen hinauf bis in die Wohnung bekäme, war das kleinste Problem. Sie hatte Paul und Wilma, die ihr nichts abschlugen, selbst wenn sie es für verrückt hielten, und der Blockwart war ein Schrumpfgermane, der zu sabbern begann, sobald er ihr, der verabscheuungswürdigen Jüdin, leibhaftig gegenüberstand. Wenn sie die Skulpturen flach hinlegen ließe, würden sie das gesamte Wohnzimmer ausfüllen, aber sie wären immerhin in Sicherheit.
Mit vier raschen Schritten war Eva bei der Tür.
»Eva.« Paul, der sonst viel zaghafter mit ihr umging als Wilma, stellte sich ihr in den Weg. »Bitte, Eva – du darfst das nicht.«
»Ich darf was nicht?«, blaffte sie. »Mir meine Arbeiten zurückholen? Lass mich vorbei, Paul. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, die ihr sowieso nicht versteht, und ich nehme euch auch nichts übel. Ich will nur wiederhaben, was mir gehört.«
»Du nimmst uns nichts übel?« Das kam von Wilma hinter dem Tresen, wo sie versuchte, Chaja mit ein paar Bierfilzen und einer Schachtel Farbstifte beschäftigt zu halten. Chaja war anders geworden seit jenem Abend, ein völlig anderes Kind. Still. Ohne Ansprüche. Verkrochen in sich selbst. »Heilige Scheiße, wenn du so weitermachst, bist du es, der du etwas übelnehmen musst.«
»Ich wüsste nicht, warum«, sagte Eva.
»Weil du für die arme chou-chou zu sorgen hast!«, platzte Wilma los. »Ja, dir ist übel mitgespielt worden, und das Schwein Martin Serner soll mir im Leben nicht mehr unter die Augen kommen, aber du darfst doch deshalb nicht den Verstand verlieren. Du bringst dich in Gefahr, begreifst du das nicht? Um deine Sicherheit musst du dich kümmern, nicht um Bilder – die werden nicht in Lager verschleppt oder totgeschlagen.«
»Doch, genau das werden sie!«, schrie Eva, die sich auf einmal wie blind fühlte. So war es immer, wenn einer erwähnte, was Martin getan hatte: seine Liebe, die alles aushielt, für Kartoffelsuppe verkauft. Wenn jemand daran rührte, verstellte es Eva den Blick. »Meine Bilder sind verschleppt worden«, sagte sie. »Und wer weiß, ob sie nicht totgeschlagen werden – zerrissen und zerstört.«
»So etwas darfst du nicht einmal denken!« Paul hob die Hände, um nach Eva zu greifen, hielt dann jedoch inne. »Deine Bilder sind Kunstwerke, und Kunst ist das, was von uns übrig bleibt. Wer sie vernichtet, vernichtet Erinnerung, und nicht einmal die Nazis würden so weit gehen.«
Paul war ein reizender Mann, einer, den sie sogar ihrer Mutter in Niedernhausen als Schwiegersohn hätte vorstellen können. Aber machte ihn das überzeugend? In den Nebeln, die Eva die Sicht raubten, glaubte sie, ihre Steinriesen zu erkennen, die gepackt und davongeschleift wurden. Stein, selbst solcher aus Pappmaché, konnte nicht schreien vor Schmerz, nur sardonisch grinsen.
»Lass mich gehen«, sagte Eva zu Paul.
Paul ließ die Arme sinken. »Wilma hat recht«, sagte er. »Ich wollte diese Karte nicht gegen dich ausspielen, aber du musst an dein Kind denken.«
Das brauchte nicht ausgerechnet Paul, der Chaja geradezu ängstlich aus dem Weg ging, ihr zu sagen. Eva hatte es sich selbst schon gesagt. Hunderte von Malen. Chaja hatte ihren Vater verloren. Das in Liebe eingesponnene Sonnenscheinkind hatte seine heile Welt verloren und durfte nicht obendrein seine Mutter verlieren. Aber sich das zu sagen half nicht. Eva, die stundenlang mit Chaja gemalt und erzählt, gelacht und sich gebalgt hatte, schaffte es jetzt kaum noch, das Kind zu füttern und mit sauberer Kleidung zu versorgen. Und einen anderen gab es nicht mehr. »Frau Klagenfurt wird mich begleiten, aber Fräulein Podewils bleibt bei dir und wird sich auch um den Haushalt kümmern«, hatte Martin erklärt, um ihr oder sich zu beweisen, wie fürsorglich er seinen Verrat organisiert hatte.
Lob bekam er dafür nicht. Eva hätte kein Wort herausgebracht, und das fürsorglich organisierte Fräulein Podewils blieb nicht lange. »Das ist ja jetzt gar nicht mehr erlaubt, dass Deutsche beim Juden im Dienst stehen«, hatte sie zu Eva gesagt.
Offiziell stand sie zwar nicht beim Juden, sondern bei Hagen Fidelis im Dienst, doch das spielte offenbar keine Rolle. So wie es auch keine Rolle mehr spielte, dass sie Chaja allmorgendlich an sich gedrückt hatte, bis diese protestiert hatte: »Nicht so fest, Podewils’chen, sonst geh ich noch kaputt!«
Zum Abschied drückte sie Chaja nicht. »Ich brauche kein Zeugnis«, sagte sie zu Eva. »Dass ich beim Judenkind war, macht sich nicht gut.«
Judenkind. Chaja. Martin Serners Tochter.
»Ich wollte dir nicht weh tun.« Verzagt berührte Paul ihre Wange.
Eva wich zurück. »Das weiß ich«, sagte sie. »Ihr beide seid das Beste, was einem in diesem verfluchten Mist passieren kann, aber ich kann meine Arbeit nicht den Schlächtern zum Ausweiden lassen. Meine Arbeit, das ist mehr ich als ich, und wenn ich das nicht habe, hat Chaja auch nichts von mir.«
Wie aus Gewohnheit flog ihr Blick zu ihrem Kind. Früher hätte Chaja den Kopf gehoben und sich empört: »Warum redest du über mich? Ich bin doch da, du kannst doch mit mir reden!« Jetzt reagierte sie nicht einmal, sondern strich schweigend den Farbstift über den Bierfilz. Das Haar fiel ihr vors Gesicht, so dass sie unmöglich sehen konnte, was sie malte. Sie hatte sich in der Tat verändert. Aus der Königstochter, dem kleinen Star von Babelsberg, war ein Judenkind geworden, dem ein Platz einem deutschen Kindergarten verwehrt worden war.
Jüdischer Mischling ersten Grades, hatte Eva auf dem Formular ankreuzen müssen. Ihr war übel geworden. Eine Woche später erhielt sie die Papiere per Einschreiben zurück. Auf dem Formular prangte der Stempelaufdruck: Aufnahme abgelehnt.
An jenem Abend hatte sie Chaja die venezianische Kette mit dem Davidstern um den Hals gelegt, den ihre Schwester Esther ihr zu Chajas Geburt geschenkt hatte. Warum sie das tat, hätte sie keinem Menschen erklären können, und von ihrer Schwester hatte sie nie mehr etwas gehört.
»Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll«, begann Paul. »Du bist kein unbeschriebenes Blatt, Eva. Wenn du in der Stadt herumläufst, gegen die Nazis wütest und deine Werke zurückverlangst, bringst du dich in eine Gefahr, die keiner von uns ermessen kann. Leute sind schon für viel weniger verhaftet worden und entweder gar nicht wiederaufgetaucht, oder …«
»Oder was?«
Paul blickte zu Boden, scharrte mit der Spitze seines schlecht polierten Schuhs auf den Fliesen. »Es gibt Dinge, über die möchte ich nicht nachdenken«, murmelte er. »Weil man sonst überhaupt nichts mehr wagt, keinen Schritt aus seinem eigenen Haus. Ich komme mir jetzt schon tagtäglich wie ein Feigling vor.«
»Ich nicht«, versetzte Eva kalt. »Wenn die meinen, sie müssen mich umbringen, weil mir meine Arbeit zu schade für ihre Jauchegrube ist, dann sollen sie das eben tun.«
»Und was wird aus deiner Tochter?«, rief Wilma. Sie hatte die Kellerklappe geöffnet, war hinuntergestiegen, um Flaschen zu holen, und ihre Stimme drang dumpf herauf. »Ich habe dir gesagt, ich hätte mir im Leben kein Kind angeschafft, und weißt du auch, warum? Weil man dann im Notfall nicht mal krepieren darf. Du hast aber eines. Und da das Schwein von Vater den Schwanz eingekniffen hat, ist für dich Krepieren nicht drin.«
»Dass Martin ein solches Schwein ist, glaube ich nicht«, ließ Paul sich leise vernehmen.
»Was soll das denn heißen?« Wilmas Kopf tauchte aus der Kellerklappe auf wie ein Frosch aus dem Tümpel. »Einer, der nicht nur seine Frau, sondern sein eigenes Kind einem Haufen von irren Mördern überlässt, soll kein Schwein sein? Die Einzigen, die sich das verbitten dürften, sind die armen Schweine.«
»So ist es doch nicht.« Pauls Stimme war noch immer so leise, dass Eva Mühe hatte, ihn zu verstehen. »Er überlässt ihnen Eva und Chaja ja nicht, sondern bemüht sich, sie zu schützen.«
»Du komischer Quarkschädel in deinem Elfenbeinturm, du bist zu gut für die Welt«, brummte Wilma.
»Ich versuche nur, nicht in jedem, den ich als angenehmen Zeitgenossen kannte, auf einmal den Teufel zu sehen«, sagte Paul. »Wir können unmöglich über Nacht ein Volk von Dämonen geworden sein – genauso wenig wie eines von Helden.«
»Aber eines von Arschlöchern«, versetzte Wilma. »Ein Held zu sein verlangt ja keiner von dem Serner – ein anständiger Kerl hätte völlig genügt.«
»Weißt du, was mir Angst macht?«, fragte Paul. »Dass das in unserer Zeit das Gleiche zu sein scheint. Man setzt sich doch mit jedem Wort, das man nicht ausspricht, schon ins Unrecht. Weißt du, wofür bei uns in den Fakultäten jetzt Leute gesucht werden? Für eine Forschungsgruppe zur Lage von Atlantis. Atlantis! Ich bitte dich. Wir sind Wissenschaftler, keine Scharlatane, und wir schweigen dazu!«
»Hast du keine anderen Sorgen?«, blaffte Wilma. »Wenn nicht, übereigne ich dir hiermit mein Leben, und du kannst mir deins mit der Post schicken. Als Werbesendung. Zu acht Pfennigen.«
»Atlantis, die Geburtsstätte der arischen Rasse«, stammelte Paul, ohne darauf einzugehen. »Dafür vergibt man jetzt Forschungsgelder. Ich bin eigentlich kein Mann, der solche Plattitüden gern nachbetet, aber in dem Fall glaube selbst ich, der arme Plato würde sich im Grabe umdrehen.«
»Und hat das für irgendeinen Menschen Konsequenzen? Für einen lebenden, meine ich. Nicht bei den Mumien eingegraben wie ihr in eurem Institut.«
»Professor Brandstätter, einer der führenden Köpfe der Altertumswissenschaft, hat ein Veröffentlichungsverbot erhalten, weil er diese Atlantis-Theorie öffentlich als Unsinn bezeichnet hat«, erwiderte Paul.
Eva, der das Wortgefecht der beiden an den Nerven zerrte, wollte sich schon an ihm vorbeischieben, da wandte er sich noch einmal an sie. »Mir kommt es vor, als ziehe die Bedrohung immer weitere Kreise«, sagte er. »Sei vorsichtig, Eva. Wenn du um jeden Preis herausfinden musst, wo deine Werke aufbewahrt werden, dann geh bitte zu Martin. Lass ihn Erkundigungen einziehen, aber fahr auf keinen Fall auf eigene Faust zum Viktoriaspeicher. Was sie mit Leuten machen, die sie festnehmen, weiß ich nicht genauer, als ich es dir gesagt habe. Und bei Gott, ich möchte es auch nicht wissen.«
10
Warum sie sich schließlich dafür entschied, auf Paul zu hören, war Eva nicht ganz klar. Gewiss nicht, weil das, was ihr passieren mochte, sie schreckte. Was konnte es Schlimmeres geben als das, was ihr bereits passiert war? Angst hatte sie nicht, und dennoch nannte sie dem Taxifahrer Martins Adresse in Lichterfelde, statt ihn zu bitten, sie an die Spree, zum Viktoriaspeicher, zu fahren wie geplant.
Vielleicht weil sie das Aussichtsreichste tun wollte, um ihre Steinriesen wiederzubekommen. Sie waren zerbrechlich und brauchten Platz, außerdem mussten sie den Nazis über die Maßen verhasst sein, weil entartete Kunst einfach nicht so gut sein durfte. Damit waren sie mehr als der Rest ihrer Arbeit gefährdet, aber Martin hatte sie geliebt wie sie. Sie gehörten zu seinem schönsten Film, und er würde ihr helfen, sie zu bewahren. Er hatte Eva und Chaja preisgegeben, aber er konnte nicht das Beste preisgeben, was er je gemacht hatte.
Das war als Grund gut genug. Doch es gab noch andere.
Vielleicht fuhr sie zu Martin, weil sie mit ihm über Chaja reden musste. Nachdem die Behörde, die sich Nationalsozialistische Volkswohlfahrt nannte und als Träger für den Kindergarten fungierte, ihren Aufnahmeantrag abgelehnt hatte, hatte Eva einen Brief geschrieben und um einen Platz für ihre Tochter regelrecht gebettelt. Sie durfte Wilma nicht auf ewig ausnutzen, und sie selbst hatte keine Kraft, die sie Chaja hätte geben können. Chaja aber brauchte Kraft. Sie sollte wieder sie selbst sein, vorlaut, gewitzt und gescheit, nicht eingeschüchtert und linkisch, wie Eva es in ihrem Alter gewesen war. Der Kindergarten würde ihr guttun. Chaja liebte Menschen, sie stand so gern im Mittelpunkt, und das zurückgezogene Leben, das sie neuerdings führten, schadete ihr.
Die Behörde hatte Eva umgehend geantwortet. Das war auch neu im Hitlerland: Während in der Republik briefliche Anfragen ständig verschlampt worden waren, erhielt man von Nazi-Ämtern auf alles eine Antwort:
An Frau Eva Löbel, wohnhaft bei Hagen Fidelis, Bleibtreustraße 12.
Nachdem Sie uns durch Ihr Schreiben vom 4. Oktober 1938 zur Kenntnis gebracht haben, dass es sich bei Ihrer am 2. Juni 1933 geborenen Tochter Chaja Christiane Löbel angeblich nicht um eine Volljüdin im Sinne der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 handelt, sondern um einen jüdischen Mischling im Sinne derselben Verordnung, wäre eine Unterbringung der Löbel in der von Ihnen benannten Einrichtung unter gewissen Umständen möglich.
Wie lange brauchten Menschen, um einen solchen Galgenstrick von Satz aufs Papier zu bringen? Eva hatte versucht, ihn zu lesen, und hatte sich darin wie in Fesseln verfangen. Noch weniger verstanden hatte sie das, was folgte: Chaja als jüdischer Mischling ersten Grades konnte unter Umständen in den Kindergarten aufgenommen werden – aber nur wenn Eva nachwies, dass die Löbel tatsächlich ein jüdischer Mischling ersten Grades war.
Nein, sie ist keiner, hätte Eva schreien wollen. Sie ist Chaja, Kind der Leidenschaft, gezeugt zwischen Wiesenkräutern, Champagner, Steinriesen und Liebe, die alles aushält. Geliebt von Hagen Fidelis, Doktor Paul Vollmer, Wilma Duvenage, ganz Babelsberg und halb Berlin. Angebetet von ihrem Vater, der ein Lächeln nur für sie allein hat. All das hätte sie der Behörde mit ihren Galgenstricksätzen erklären wollen, doch stattdessen musste sie beweisen, dass Chaja ebendies war – ein jüdischer Mischling ersten Grades. Das aber konnte sie nicht: Auf der Geburtsurkunde ihrer Tochter stand, wie seinerzeit von Hagen erdacht und von Eva kaum beachtet: Vater unbekannt.
Sie musste mit Martin sprechen. Sie war es Chaja schuldig.
Waren das ihre einzigen Gründe, Chaja und die Steinriesen? Das Taxi schoss durch den regnerischen Abend, der schon in die Schwärze der Nacht hinüberglitt. Es waren nicht die einzigen Gründe, aber der dritte schnürte Eva die Kehle zu: Sie fuhr in einem Taxi durch dunkle Alleen, in denen jedes Gartentor, jede aufragende Villenfassade Privatheit atmete, weil sie nach vier Monaten noch immer nicht glauben konnte, was ihr angetan worden war.