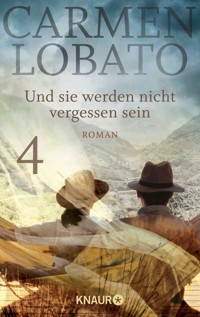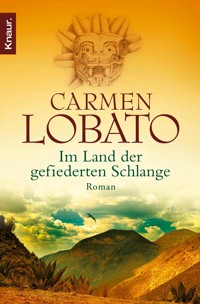1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Teil 3 des sechsteiligen Serials! Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carmen Lobato
Und sie werden nicht vergessen sein 3
Serial Teil 3
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Inhaltsübersicht
Dritter Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Dritter Teil
Berlin, London, Paris
»Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen,
Fror ich mich durch die finsteren Jahre.«
Mascha Kaléko
18
PaulBerlin. November 1938
Die Frauen, die Paul begehrte, waren groß, schlank, gebildet und wortgewandt. Sie gaben ihm das Gefühl, der Unterlegene zu sein, und gingen mit Männern wie Martin Serner und Arman Artsruni durch, statt an Paul Vollmer hängen zu bleiben. Sooft er sich insgeheim eine von der anschmiegsamen Sorte gewünscht hatte, die mädchenhaft zu ihm aufblickte, hatte er sich prompt wieder an eine verloren, die sich ein paar Wochen lang gönnerhaft seiner annehmen mochte, der er auf Dauer aber nicht gewachsen war.
So war er allein geblieben und zu der Ansicht gelangt, er habe sich damit abgefunden. Jetzt aber fiel das Alleinsein über ihn her, als stürze ihm das Dach seines Hauses auf den Kopf. Er war nicht allein. Er war einsam. Von den Kollegen, die er in besserer Zeit seine Freunde genannt hatte, konnte er mit niemandem reden. Viele waren nicht mehr da, und von den übrigen durfte er keinem vertrauen. Der einzige Mensch, der seine Sorge teilte, war eine zu kurz geratene Kugel von Kneipenwirtin mit einer Schnauze, die Pauls Vater ihr mit Seife ausgewaschen hätte.
Er durfte Wilma Duvenage nicht allzu häufig besuchen. Ohne Zweifel standen sie längst unter Beobachtung, doch die Angst machte das Alleinsein zur Qual. Tagsüber fehlte ihm jede Konzentration, und nachts träumte er von den Fingern der jüdischen Studentin in der Tür. Wenn er von der zerquetschten Hand aufblickte, sah er in Evas Gesicht, sah in ihren Augen eine Anklage, die niemand zu Ende sprechen musste: Warum hast du nicht …?
Ihnen lief die Zeit davon. Seine Seminare waren von Tag zu Tag schlechter besucht. »Die Grippe«, bemerkte Karl Denitz mit einem Unterton, den Paul neuerdings dauernd zu hören glaubte. »Um diese Jahreszeit ist das ja nie viel anders, und so ausnehmend scheußlich war der November noch nie.«
Wann hatte der Dekan begonnen, vom Wetter zu schwatzen, wann hatten sie alle begonnen, im Bemühen um Unverfänglichkeit permanentes Geplapper zu erzeugen? Paul hielt es nicht aus, noch länger zu zögern. Nach der letzten Vorlesung machte er sich auf den Weg in die Bleibtreustraße.
Juden, deren Geschäfte in der Kristallnacht verwüstet worden waren, hatten für ihre Schäden selbst aufzukommen. Das Gesicht des eleganten Viertels um den Savignyplatz war nicht wiederzuerkennen. Zerstörte Schaufenster waren notdürftig mit Pappe vernagelt, belebte Einkaufstraßen blieben leer und still. Wie das Gesicht eines Menschen, durchfuhr es Paul. Er hatte von Greueln nur gehört, nie jemanden gesehen, der von Gestapo-Verhören zurückgekehrt war. In seinem Beruf hatte er gelegentlich mit Archäologen zu tun, die menschliche Schädel und Skelette auf Verletzungen untersuchten, und er war jedes Mal froh, dass dies nicht zu seinen Aufgaben gehörte. Amarnas Mann hatte ein hängendes Augenlid, das sein romantisches Äußeres eher betonte, als es zu entstellen. Als Amarna Paul einmal ins Gesicht geschrien hatte, woher es stammte, war ihm übel geworden.
Vermutlich steigerte er sich in etwas hinein. Eva war eine Frau. Kein Mann, auch kein Nationalsozialist, ging mit einer schönen Frau um wie mit seinesgleichen. Paul bog in die Straße ein, in der Eva wohnte, und glaubte, sie vor sich zu sehen, wie sie im Babeurre stand und alle Blicke auf sich zog, wie sie den Kopf mit dem glänzenden Haar in den Nacken warf und spöttisch lachte.
Beim nächsten Schritt löste das Bild sich auf und wurde überlagert von dem verzerrten Gesicht der Studentin mit den gebrochenen Fingern.
Wilma Duvenage stand vor der Tür ihrer Kneipe, die mehr denn je wie ein Kartoffelladen aussah, und gab einer Frau mit krummem Rücken ein Tuch, in das etwas geknotet war. Die Frau sah Paul kommen, drückte das Tuch an die Brust und lief weg. Wilma drehte sich zu ihm um. Sie trug ihr ewiges ›kleines Schwarzes‹, das über dem Kugelbauch spannte, und von ihren dicken Armen perlten Regentropfen.
»Wilma.«
»Paulchen.«
Ihren Blick hätte ein Blinder übersetzen können: Hast du Nachricht von Eva? Paul schüttelte den Kopf, und etwas in Wilmas Gesicht erlosch. »Komm rein.« Sie zog ihn in den Laden und schloss hastig die Tür. Zum Vernageln des Fensters hatte sie Bretter von Spirituosenkisten benutzt, die vom Licht der Straßenlaternen kaum etwas durchließen. Früher war in diesem Raum ein einziges Glitzern gewesen, das in Pauls Augen gebrannt und ihn verwirrt hatte: Glas und Licht und mit Klunkern behängte Hälse. Jetzt war von alledem nur noch der Geruch übrig: schwarzer Tabak, schweres Parfüm und angefaulte Kartoffeln.
»Wo ist das Kind?«, fragte Paul.
Wilma wies mit dem Kopf auf den Durchgang hinter dem Tresen. »Ich hab sie schon hingelegt. Essen wollte sie nicht, und letzte Nacht hat sie wieder kaum geschlafen.«
»Und du hast wirklich nichts gehört?«
»Merde alors, würd’ ich sonst hier stehen und dich anglotzen, als hätt’ ich noch nie einen blonden Kerl gesehen? Ich dachte, du hast was gehört. Als ich gesehen hab, wie du die Straße runtergetrottet kommst, hab ich gedacht: Dieu merci, das Paulchen hat den Arsch zusammengekniffen und dem Schwein Serner klargemacht, dass er unsere Eva da rausholen muss.«
»Ich tue es jetzt«, beschloss Paul. »Hast du das Visum für die Kleine bekommen?«
Wilma schüttelte den Kopf. »Ich war bei der Reichsvertretung der Juden, aber denen rennt die halbe Stadt die Bude ein. In dieser Kristallnacht haben sie ein ganzes Waisenhaus abgefackelt, und mit den Kindern, die das überlebt haben, sind schon die meisten Plätze besetzt. Mir haben sie gesagt, Chaja wird nicht mal bevorzugt behandelt, wenn sie die Königin von Saba wär’.«Sie steckte zwei Zigaretten an und gab Paul eine davon. »Mon chou ist die Prinzessin von Saba. Tu was, Paul, oder ich bring einen um.«
Er tat etwas. Hielt ein Taxi an und gab dem Fahrer Serners Adresse in Lichterfelde, dieses eine Mal, ohne lange zu fackeln. Unterwegs versuchte er, so schnell zu denken, dass ihm keine Zeit blieb, sich zu fürchten. Er fürchtete sich trotzdem. Als er ausstieg und den Kerl mit dem Hund hinter dem mannshohen Gartenzaun ausmachte, noch einmal umso mehr. ›Dem Paule rutscht das Herz in die Hose‹, hatte sein Vater das genannt. Es fühlte sich an, als sitze das Herz tatsächlich zwischen seinen Beinen und hämmere gegen den Stoff.
»Was wollen Sie denn?« Die Stimme des Mannes mit dem Hund war von trügerischer Gutmütigkeit. Mann und Hund hatten ähnlich platte Gesichter. Paul empfand gegen die gebleckten Zähne von Hunden beinahe so viel Widerwillen wie gegen den Streichriemen seines Vaters. Es bedurfte größter Überwindung, um näher an den Zaun zu treten.
»Der tut Ihnen nüscht.« Der Mann klang jetzt geradezu traurig. »Armes Vieh. Ich bin morgen hier weg. Aber den Hund mitnehmen darf ich nicht.«
»Wo sind Sie denn ab morgen?«
Der Mann rollte die fleischigen Schultern. »Holland. Hab da Verwandte. Kleiner Besuch zur Erholung.«
Der Blick, den er Paul zuwarf, erzählte eine andere Geschichte. Der Wachmann oder was immer er hier für eine Stellung versah, musste aus Hitlers Deutschland weg wie so viele. Hatte Martin Serner ihm geholfen? Wenn er dazu in der Lage war, musste er auch Eva helfen können!
»Um den Hund bricht’s mir das Herz«, sagte der Wachmann. »Hugo heißt er. Feiner Kerl. Hat was mit Ihnen gemeinsam.«
»Mit mir? Was denn?«, fragte Paul.
Der Wachmann kraulte den Hund hinterm Ohr. »Ich hab ihn in der Gosse aufgelesen und was aus ihm gemacht, aber jetzt will keiner was von ihm wissen. Weil er aussieht wie ein Totmacher. Dabei tut er keiner Seele was zuleide. Ein bisschen wie Sie, oder?«
Ein bisschen wie ich, dachte Paul.
»Bist ja mein Bester, Hugo.« Der Wachmann kraulte den Hund. »Bist ja mein Allerbester.« Schräg von unten blickte er zu Paul. »Sie wissen wohl nicht zufällig jemanden, der einen guten Hund brauchen kann?«
Der Hund hieß Hugo. Wie Hugo Winckler, der die Hethiterstadt Hattuša entdeckt hatte. In Hattuša hatte Paul um die Liebe seines Lebens gekämpft und verloren, und hinterher hatte er über die Expedition seine Doktorarbeit und ein ziemlich talentloses Buch geschrieben. Er hätte sich alles lieber als einen Hund angeschafft, aber hätte er einen besessen, hätte der Name Hugo ihm gepasst.
Hugo hechelte. Zum ersten Mal sah Paul einem Hund ins Gesicht. Im Grunde gab es kein Tier, für das er viel übrig hatte. Nach Hattuša waren sie auf Pferden geritten, und er hatte vor Angst schlotternd im Sattel festgeschnallt werden müssen, während sein Rivale mit wehendem Haar ins Herz von Pauls Mädchen galoppiert war. Sein Leben lang hatte sein Interesse einzig Menschen gegolten, die über die Fähigkeit, sich zu zivilisieren, verfügten. Deshalb faszinierten ihn die Städte bauenden Hochkulturen Mesopotamiens, während ihm Geschöpfe, die mit Fäusten, Zähnen oder Klauen kämpften, Angst einflößten. Als er jetzt in die Augen des Hundes sah, war er nicht mehr so sicher. Sie waren überraschend rund für das geplättete Gesicht, und die Stirnfalten verliehen ihm etwas seltsam Sanftes.
»Ich muss zu Herrn Serner«, rang er sich ab. »Es ist dringend.«
»Das sagen alle«, erwiderte der Mann. »All die Leute, die mal mit ihm gearbeitet haben und denken: Der Martin ist nicht wie die. Der Martin wird uns schon helfen. Recht haben die ja. Ich hab selbst mit ihm gearbeitet, Beleuchter war ich, und als die UFA mich an die Luft gesetzt hat, hat er dafür gesorgt, dass ich unterkam. Aber ein Gott ist der Martin nicht. Und er hat eben auch nur einen Hals.«
»Bitte glauben Sie mir, ich muss ihn wirklich sprechen!«
»Das sagen sie auch alle«, erwiderte der Mann. »Eben deshalb habe ich Anweisung, niemanden vorzulassen. Ohne Ausnahme. Keine heulenden Mütter mit Kindern, keine Greise, kein Nichts.«
»Anweisung von Martin Serner?«
»Von wem auch immer«, erwiderte der Mann. »Auch der Martin kann keine schiefe Welt aus den Angeln heben. Dass ich zu meinem Vetter nach Amsterdam komm, hat er geschafft, aber für den Hugo kann er nichts tun. Dem wird’s hier schon gutgehen, sagt er. Hunden tun sie nichts an. Nur – wo soll er denn hin?«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Paul. »Sie sorgen dafür, dass ich Martin Serner sprechen kann, und ich sorge für Ihren Hund.« Er konnte nicht glauben, dass er das gesagt hatte. Er hatte schon ein Kind am Hals, das nicht seines war, eine verhaftete Frau, die sich aus ihm nichts machte, und einen alten Mann, der nicht sein Vater war.
Der Wachmann wirkte höchstens eine Sekunde lang perplex. Dann handelte er. Zog eine Leine aus der Jackentasche und hakte den Karabiner am Halsband des Hundes fest, entriegelte das Tor und ließ Paul eintreten. »Sie werden’s nicht bereuen.« Er hielt Paul die Leine hin. »Ist ein Guter, mein Hugo. In der Welt, in der wir leben, können Sie so einen brauchen.«
Paul zitterte der Arm, als er die Leine nahm. Er musste vollends den Verstand verloren haben, aber der Hund trottete neben ihm her, als hätte er das schon sein Leben lang so gemacht. Den schweren Kopf ließ er hängen, und von der Lefze tropfte ihm ein Speichelfaden.
»Viel Glück mit Ihrem Anliegen!«, rief ihm der Mann hinterher.
An der Haustür betätigte er viel zu leise den Klopfer. Das Haus kam ihm leer vor, es gab kein einziges erleuchtetes Fenster. Dennoch dauerte es nicht lange, bis die Tür geöffnet wurde. Martin Serner verbarg sich dahinter, hielt ihm nur das Gesicht entgegen. Beneidenswert gutaussehend, fand Paul, wie stets, wenn er dem Mann begegnete. Er selbst galt dem Geschmack der Zeit nach als attraktiv, aber Martin Serners Züge besaßen Charakter. Etwas, das sich wie mit einem Meißel ins Gedächtnis prägte. Die müde Traurigkeit stand ihm so gut wie die düstere Beleuchtung. In der weiten Eingangshalle brannte nur eine schwache Wandlampe.
»Paul«, sagte er.
Sie waren stets ein wenig ungelenk miteinander umgegangen, was Paul bei zwei Männern, die die Muttermale derselben Frau kannten, nicht verwunderlich schien. »Darf ich hereinkommen?«
»Natürlich.«
»Den Hund hüte ich für deinen Wachmann«, sagte Paul entschuldigend, während das Tier ihm ins Haus folgte. Gediegen war das Wort, das ihm zur Einrichtung der Halle einfiel. Er verstand nichts von Möbeln, doch die Stücke schienen handverlesen, wenn sie auch nichts von der Ausstrahlung ihres Besitzers aufboten.
Martin beachtete den Hund gar nicht. »Du kommst wegen Eva?«
Paul nickte.
»Ist etwas passiert?«
»Das musst du doch wissen. Die Gestapo hat sie verhaftet.«
Gequält drehte Martin den Kopf zur Seite. »Ja, das ist mir bekannt. Ich hatte halb gehofft und halb gefürchtet, du wüsstest etwas Neues.«
»Wir sind ohne Nachricht«, sagte Paul. »Wilma hat alles versucht, um wenigstens herauszubekommen, wo sie sie hingeschafft haben, aber wenn man niemanden kennt, ist es praktisch unmöglich, etwas zu erfahren.«
Martin stützte eine Hand an der Wand ab, schloss die Augen und stöhnte. Er hatte das Gleiche in Semiramis getan, und die Nation hatte geweint. Paul war keiner, den Melodramen auf Zelluloid zum Schmelzen brachten, aber geweint hatte er ebenfalls. Warum, ließ sich schwer sagen. Wohl weil etwas so zerbrechlich Schönes, Verfeinertes nicht derart leiden durfte. »In die Prinz-Albrecht-Straße?«, raunte Martin gequält. »Sag mir die Wahrheit, Paul – haben sie meine Eva in die Prinz-Albrecht-Straße gebracht?«
Von der Gestapo-Zentrale wollte niemand mehr als Gerüchte gehört haben, aber jeder begann mit gesenktem Blick zu murmeln, sobald der Name der Straße fiel: »Prinz-Albrecht-Straße … Sie wissen doch …«
Wir wissen alle, dachte Paul, und wir wollen nicht wissen. Würde man mich dorthin verschleppen, dann würde ich mir wünschen, an der Angst zu sterben. »Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen«, sagte er zu Martin. Das war auch eine der Phrasen, zu der neuerdings jedermann griff.
»Das darf nicht sein.« Martin stöhnte. »Das dürfen sie ihr nicht antun.«
»Das denke ich auch«, erwiderte Paul. »Selbst diese Leute müssen irgendwelche Grenzen des Anstands kennen. Aber Gewissheit gibt es eben nicht, solange Eva nicht frei ist.«
»Du hast recht.« Martins Kiefer mahlten, wie um Worte zu erzeugen. Noch ehe es ihm gelang, knirschte der Schlüssel im Schloss. Der Hund, der flach auf dem Boden gelegen und den Paul schon fast vergessen hatte, sprang auf seine vier Beine und entließ aus seiner Kehle eine Mischung aus Knurren und Bellen.
»Schnauze halten«, sagte Hagen Fidelis, der die Tür einen Spaltbreit öffnete und sich hereinzwängte. Er schloss seinen Schirm und schüttelte sich. Offenbar hatte es draußen zu regnen begonnen. »Du hast Besuch, wie ich sehe«, sagte er zu Martin und wandte sich an Paul. »Sei mir nicht böse, aber ich hoffe, du bist nur auf einen Sprung hereingeschneit. Die Entscheidung über einen neuen Vertrag steht an, Martin und ich ersticken sozusagen in Gesprächsbedarf.«
»Ich gehe gleich wieder«, sagte Paul. Der Hund hatte aufgehört, zu knurren, aber er legte sich nicht wieder hin. »Ich bin nur gekommen, um Martin zu bitten, etwas für Eva zu tun.«
»Paul glaubt, sie ist in der Prinz-Albrecht-…«, begann Martin, brach aber ab, als Hagen ihm ein Handzeichen gab.
»Ich schneide ungern wohlmeinenden Menschen das Wort ab«, sagte Hagen zu Paul. »In diesem Fall aber will ich dich davor bewahren, deinen Atem zu verschwenden. Was getan werden konnte, ist getan. Ohne Erfolg, so leid es mir tut, doch es gibt nun einmal Dinge, die sich so wenig zwingen lassen wie die Zeit.«
»Hagen!« Martin schoss so heftig herum, dass Paul zusammenfuhr. »Wir müssen etwas tun!«
»Ach ja?« Hagen wandte ihm das Gesicht zu, das er sich umständlich trockentupfte, und hob die Brauen über den Rand der Brillengläser. »Habe ich dir das nicht jahrelang wie ein Wanderprediger vorgebetet? Wir müssen etwas tun. Das holdselige Fräulein Löbel muss zu einer Art von Einsicht kommen. Hat es geholfen? Und stehe jetzt erneut ich als derjenige da, der die Säulen des Herakles aus ihren Grundfesten heben soll? Aber das funktioniert nicht, Martin. Du magst es wollen, und sogar ich mag es wollen, doch bei aller Liebe – es funktioniert nicht.«
»Es muss funktionieren.« Martin war kein Angsthase, der sich die Hosen vollpinkelte. Er stand kerzengerade und bot Hagen die Brust dar. »Ich kann Eva nicht diesen Monstern überlassen. Finde einen Weg, Hagen, egal, was es mich kostet.«
»Und wenn es dich den Film kostet?«, fragte Hagen. »Presse und Wochenschau feiern dich, aber dass das dem Befehl von höchster Stelle zu danken ist, weißt du selbst. Die, auf die’s ankommt, die kleinen Leute, die ihr Herz ins Kino tragen, haben den Atlantis-Film nicht gemocht. Zu gewollt, zu flach, zu wenig lebenssüß.«
»Ich habe ihn auch nicht gemocht«, sagte Martin. »Es ist ein dummer kleiner Film.«
»Immer feste drauf, mein Guter. Leider klang das ein wenig anders, als er dir angeboten wurde, aber mit den Jahren lässt unser Gedächtnis eben nach. Also einigen wir uns auf Folgendes: Dein Atlantis-Film war ein Schuss in den Ofen. Viel mehr als einen von der Sorte kannst du dir nicht leisten, oder du gehörst zur traurigen Gattung der sinkenden Sterne.«
Tief holte Martin Luft. »Scheiß darauf«, sagte er dann. »Scheiß auf meinen nächsten Film und auf was immer du willst. Hier geht es um die Frau, die ich liebe, Hagen.«
Hagen nickte, ging zu einer exquisit bezogenen Sitzbank an der Wand und setzte sich mit übereinandergeschlagenen Beinen. »Habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest, dass ich deine Mitwirkung am neuen Film als Druckmittel benutze, um Eva Löbel aus dem Kerker freizukaufen?«
»Ja«, sagte Martin. »Das möchte ich.«
Bravo, dachte Paul. Er hatte sich in dem Mann getäuscht: Martin Serner gehörte doch nicht zu den Hosenscheißern, sondern zu den Helden.
Hagen zog einen silbernen Gegenstand aus der Tasche, der sich beim Aufklappen als tragbarer Aschenbecher entpuppte. Als Nächstes förderte er ein Etui zutage, dem er eine angeschnittene Zigarre entnahm. »Bei aller Liebe«, sagte er, nachdem er sie entzündet hatte. »Diesen Drachen tötest du ohne mich. Ihr zwei Königskinder, du und dein Burgfräulein, habt ihr auch nur einen Atemhauch lang begriffen, nach was für Regeln hier gespielt wird? Menschen sind ersetzbar, Martin. Auch König Ara von Urartu, dessen einziger tauglicher Film von der Erde getilgt ist, als hätte er nie existiert. Hitlers Lieblingsschauspieler ist der Rühmann, nicht der Serner, und Goebbels hat zwar ein Auge für Talent, aber wenig Geduld.«
»Was heißt das?«, fragte Martin.
»Dass es schon bald nicht mehr darum gehen könnte, wer hier noch Filme dreht, sondern wer in diesem Keller sitzt und sich das hübsche Gesicht zerschlagen lässt.«
Martins Kiefer mahlten. »Müsste das nicht ich sein? Eva ist eine Frau.«
»Männer sind auch nur Menschen«, sagte Hagen.
»Und wozu taugt ein Mann, der seine Frau nicht schützt? Mit welchem Recht bezeichnet der sich als Mann?«
»Ich verstehe.« Hagen zog an seiner Zigarre. »Und was willst du tun? Einem Diktator, der sich anschickt, nach der Weltherrschaft zu greifen, ein kleines Tauschgeschäft vorschlagen? Nehmen Sie mich, lassen Sie mich die Rolle des tragischen Helden spielen, und schenken Sie dafür der jüdischen Staatsfeindin die Freiheit. Nett gemeint, Martin. Nur hast du leider nichts anzubieten. Hitler schont dich, solange er Lust auf dich hat. Sollte ihm die vergehen, sackt er dich ohne Gegenleistung ein.«
»Soll das heißen, ich kann überhaupt nichts tun?«
»Genau das heißt es.«
Jäh überkam Paul das Gefühl, keiner Szene seines Lebens beizuwohnen, sondern einem Film, in dem der Regisseur ihn in die Richtung führte, wo er ihn haben wollte, ihm vorgaukelte, was er für bittere, unabänderliche Wahrheit halten sollte. Im Film setzten dazu dann Geigenklänge ein, aber Paul war unmusikalisch. »Herrgott, Sie plänkeln hier herum, und Eva wird gefoltert!«, schrie er.
Amarna hatte das einmal getan: Das Wort, und keine barmherzige Umschreibung, in den Raum geworfen, und auf einen Schlag war alles still gewesen. Jetzt war es genauso. Paul selbst hatte Mühe, weiterzusprechen. »Von den Künstlern, die mit ihr zusammen gegen die Vernichtung ihrer Bilder protestiert haben, sind fünf verhaftet worden. Bisher ist keiner zurückgekehrt.«
Mit drei langen, von Stöhnen begleiteten Schritten ging Martin zur Wand. Zuerst hieb er seine Fäuste dagegen, dann mit der gleichen Wucht seine Stirn. Der kleine Stich mit dem Jagdmotiv, der zu seiner Linken hing, hüpfte am Nagel, und der Hund knurrte.
»Sei nicht kindisch«, sagte Hagen.
Martin fuhr herum, die edlen Züge verzerrt. »Was weißt denn du?«, schrie er. »Hast du je etwas anderes geliebt als deine Provisionsabrechnung?«
»Nicht einmal die«, erwiderte Hagen. »Die großen Gefühle überleben nur Filmfiguren unverletzt.«
»Zur Hölle, ich hätte Eva heiraten sollen, statt auf dein kaltschnäuziges Gelaber zu hören.«
»Warum hast du es dann nicht getan?«, fragte Hagen und sah der Zigarre beim Ausglühen zu.
Martin starrte seine Hand an. Dann holte er aus und schlug sie sich klatschend über die Wange. Leute behaupteten allenthalben, sie könnten sich ohrfeigen, aber Paul hatte nie einen gesehen, der es tat. Geradezu sehnlich wünschte er sich, den Hund zu nehmen und diese zwei sich selbst zu überlassen. »Ihr bleibt also dabei, ihr wollt für Eva nichts tun?«, fragte er.
»Ich habe sie doch nach Paris bringen wollen«, rief Martin, die schönen Augen geschlossen, die Hand auf die Stirn gepresst. »In ihr geliebtes Paris, aber wenn es dafür doch zu spät ist – was bleibt mir denn?«
Für sie zu sterben, dachte Paul. Als Mann der Vernunft musste er solche Taten als sinnlos abtun, aber etwas in ihm hielt trotzig daran fest. »Dann helft uns wenigstens, das Kind in Sicherheit zu bringen«, sagte er. »Ich habe in London einen Bürgen für sie gefunden, aber die Warteliste ist endlos, und weder Wilma noch ich haben Beziehungen.«
»Chaja«, murmelte Martin und starrte in seine Hände. »Meine Prinzessin Chaja.«
»Wenn es also die Möglichkeit gäbe, der Kleinen einen Platz auf diesem Transport zu verschaffen, fände sich in England eine angemessene Unterkunft für sie?«, fragte Hagen.
Paul nickte. »Bei Bekannten von mir – diesem türkischen Bildhauer, der euch so begeistert hat, und seiner deutschen Frau.«
»Arman Artsruni?« Hagen sah aus wie ein kleines Raubtier, das Beute erspähte und Männchen machte. »Ist das dein Ernst?«
Noch einmal nickte Paul.
»Das ist allerdings zu bedenken«, murmelte Hagen auf Beutefang. »Also schön. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Allerdings erwarte ich dafür ein gewisses Entgegenkommen.«
»Was für ein Entgegenkommen?«
Die Antwort kam prompt: »Lass Martin seine Arbeit tun. Dazu ist er auf der Welt, mit allem anderen ist er überfordert.«
So wie ich, dachte Paul. »Martin hat aber nun einmal Frau und Kind.«
»Ich weiß«, unterbrach ihn Hagen. »Und ich spreche mich nicht frei von Schuld. Dem Vulkan, den diese Liebschaft in ihm entfesselt hat, vermochte ich nicht zu widerstehen, und nach Abschluss der Dreharbeiten war ja alles zu spät. Ich werde ihm trotzdem nicht erlauben, sich den Hals zu brechen, und ich verlange von dir und der eminenten Mademoiselle Duvenage, dass ihr das respektiert.«
»Hör auf, von mir zu sprechen, als wäre ich nicht im Raum!«