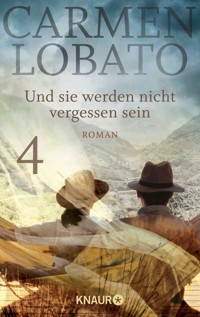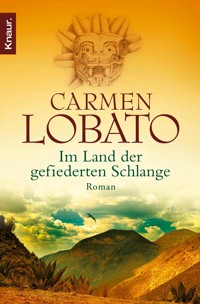0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Teil 1 des sechsteiligen Serials! Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Carmen Lobato
Und sie werden nicht vergessen sein 1
Serial Teil 1
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
To »the few«
Thank you. Still owing you so much.
Im Gedenken an
Primo Levi, Komitas Vardapet, Jean Amery, Jean Moulin, Missak Manouchian.
Bewundernd. Traurig.
»Was geschehen ist, ist eine Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld.«
Karl Jaspers
»Pour toi, Arménie.«
Charles Aznavour
Erster Teil
Berlin und London
»Es wartet niemand in dieser Stadt.«
Mascha Kaléko
1
EvaVor Berlin. Juni 1937
Weißt du, was noch widerlicher ist, als mit Schweinen zu verkehren?«
Die Stimme ihres Geliebten schreckte Eva aus ihrer Betrachtung. Sie stand über die Halbtür des Kobens gebeugt, der Gestank war zum Gotterbarmen, und der Anblick kein bisschen erfreulicher. Dennoch musste sie sich zwingen, den Blick von den zwei Tieren abzuwenden. Mit den aufgetriebenen Leibern der Schweine erging es ihr wie mit allem, das aus der Masse hervorstach und ihren Blick einfing. Ihre Augen saugten sich fest. Ihr Hirn nahm Maß und fertigte eine Skizze an.
»Ich habe dich etwas gefragt«, sagte Martin. »Aber dass du eine Frage, die derart absurd klingt, ignorierst, wundert mich nicht.«
Statt zu antworten, nahm Eva ihn in Augenschein. Sein Gesicht hätte zu einem asketischen Mönch des Mittelalters gehören können. Sandhell und fein wie Kinderflaum tanzten Haarsträhnen über seiner Stirn und ließen die Haut auf dem markanten Schädel schimmern. Von seinen Augen schwärmte die halbe Nation. Ihr vages Graublau war die einzige Farbe, die nicht in der Tierwelt, sondern nur bei Menschen vorkam.
Eva lebte seit fünf Jahren mit ihm, sie neigte eher zum Spötteln als zum Schmachten, doch der Schnitt seiner Züge weckte noch immer die Schwärmerin in ihr. Sie war Künstlerin, Ästhetin, sie hatte das Recht, sich einen Mann zum Gefährten zu wählen, nach dem der Rest der weiblichen Bevölkerung mit umwölkten Blicken lechzte. Der schöne Martin. Etwas erschrocken lachte sie auf, weil eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schweinen sich nicht leugnen ließ. Die rosige Nacktheit. Die Borsten, die aus der Schwarte wuchsen.
Beschimpften Menschen einander deshalb als Schweine? Weil die Ähnlichkeit sich aufdrängte?
»Darf ich wissen, was so lustig ist?«, fragte Martin.
»Darf ich wissen, was dir die Petersilie verhagelt hat?«, fragte Eva zurück.
»Das alles hier.« Martins Lippen wurden schmal. »Dieser traurige Zirkus.« Er zog sie an sich und küsste sie, als wollte er im Schweinestall mit ihr ins Bett. »Lass uns nach Hause fahren, ja? Jetzt gleich.«
»Ohne das heilige Abendbrot?« Eva zog die Brauen hoch und äffte den leidenden Tonfall von Martins Mutter nach: »Jetzt habe ich extra meinen feinen Kartoffelsalat gemacht, soll ich den etwa wegschmeißen?«
Martin verzog keine Miene. »Mir egal«, sagte er. »Ich will zurück nach Berlin.«
Aber Eva war noch nicht fertig. Während der Wochenendbesuche bei Martins Eltern fühlte sie sich stets, als müsste sie rund um die Uhr die Luft anhalten, und irgendwann platzte es dann aus ihr heraus. »Unsereins hat’s nicht so dicke«, wimmerte sie, die Stimme der Mutter weiter imitierend. »Bei uns wird die ganze Woche gekratzt, damit’s am Sonntag zu Buletten reicht, aber ihr seid natürlich was Feineres gewöhnt. Mit einfacher Hausmannskost kann man solchen wie euch ja nicht kommen.«
Wen Hildchen Serner mit »solchen wie euch« meinte, brauchte sie Eva nicht zu erklären. Ihren Zorn lebte sie an ihrem Haarknoten aus und rupfte daran, bis die Nadeln sich lösten. Auf der Schulter spürte sie schwere, streichelnde Strähnen, und ihr Hirn produzierte das Bild, das sich Martin bot: Eva, die Versucherin, den Verlust des Paradieses wert. So erging es ihr ständig: Immer sah sie das Bild, das andere von ihr hatten, so, als hätte sie die Augen ihrer Mitmenschen im Kopf.
»Meine Schädelinnenwand muss als Leinwand für mein ewiges Selbstporträt herhalten«, hatte sie Wilma erklärt, der göttlichsten Freundin, die eine Frau nur haben konnte.
Wilma hatte gelacht. »Das kann ich deiner Schädelinnenwand nicht verdenken, bijou.« Sie lachten so viel, wenn sie zusammen saßen, vor sich die hohen Tassen mit Wilmas Kaffee, in denen sie je nach Weltlage den Anteil an Pernod erhöhten, und eingenebelt in Wolken von Wilmas schwarzem Zigarettentabak. An manchen Tagen lachten sie die ganze Nazi-Partei, deren tausendjähriges Reich und alles, was daran kaputtging, weg.
Martins Miene war noch immer unbewegt. Er hielt Eva bei den Schultern und blickte sie mit seinen Menschenaugen an. Sie wollte auch weg. Weg von Schweineställen und Buletten, Blicken voll Argwohn und der Düsternis in Brandenburgs Dorfstraßen. Zurück nach Berlin, in ihr brausendes Meer von Lärm und Lichtern, zurück in ihre weltschönste Straße, die selbst die Nazis nicht kleinkriegten, und auf einen Pernod in Wilmas Bistro.
Zurück zu Chaja.
Eva gehörte nicht zu den Frauen, die es kein Wochenende ohne die kostbare Frucht ihres Leibes aushielten. Sie gehörte nicht einmal zu den Frauen, die sich eine solche Frucht gewünscht hatten. »Ich male Bilder, von mir bleibt genug auf der Welt«, hatte sie denen entgegnet, die sich mit gekrauster Stirn erkundigt hatten, ob sie sich denn keine Kinder wünsche.
Sie hätte noch immer das Gleiche gesagt. Gegen ihre Sterblichkeit malte sie wie besessen an, dafür brauchte sie kein Kind. Sie war auch noch immer wild auf durchliebte Wochenenden ohne Chaja. Nicht gerade im Brandenburgischen, bei Hildchen Serners Schlachtschweinen, aber in Florenz oder am liebsten in Paris, diesem Schmelztiegel, der sämtliche Sinne zum Überkochen brachte. Es war ein köstliches Vergnügen, auf die Kulturschätze einer Traumstadt zu pfeifen und zwei Tage nur im Bett zu vertrödeln, ohne dass eine goldige Vierjährige ihre Himbeerbonbons in die Besucherritze zwischen den Matratzen klebte.
Aber zu Chaja nach Hause zu kommen, war nicht weniger köstlich. Irgendwann während des Heimwegs stellte sich unweigerlich der Chaja-Hunger ein, die Gier, diesen kleinen Körper an den eigenen zu pressen, die zarten Glieder zu spüren und die Nase in den Duft nach Honigmilch und Seife zu tauchen. Dem Vogelstimmchen zu lauschen, der atemlosen Folge von Liebeserklärungen. Chaja liebte den Postboten, den Sprecher der Funkstunde, den Hund des Eiermanns, Martins Agenten Hagen Fidelis, Wilma, die sie ma tante nannte, sämtliche Kinder, die sie kannte, und ihre Kinderfrau, das Fräulein Podewils. Inniger als all jene zusammen liebte sie jedoch Martin und Eva, und am allerinnigsten liebte sie sich selbst.
Ich bin Chaja Löbel, das zuckersüße Zentrum des Universums.
Eva musste noch einmal lachen.
»Darf ich jetzt vielleicht wissen, was so komisch ist?«, fragte Martin gereizt.
»Nichts«, sagte Eva. »Ich habe nicht gelacht, weil etwas komisch wäre.«
Die Schweine wühlten im Breischleim und gaben röchelnde Geräusche von sich. Als das fettere zu schmatzen begann, kapitulierte Evas Magen.
Martin fixierte sie. »Fahren wir nach Hause?«
Eva nickte und trat schon zum Ausgang. Der Gestank war auf einmal nicht mehr auszuhalten.
Die meisten Menschen, die aus dem brandenburgischen Kaff, in dem Martins Eltern lebten, nach Berlin reisten, nahmen den Zug. Martin hatte einen Chauffeur, den die Reichskulturkammer ihm stellte, aber während dieser Wochenendbesuche fuhr er selbst, um von niemandem gesehen zu werden. Er tat es, weil er das Kaff samt den Eltern, die ihn dort aufgezogen hatten, tunlichst verschwieg. Der schöne Martin verschwieg so manches.
Sie kamen rasch voran. Seit die Nazis ihre Reichsautobahnen bauten, als müssten alle Straßen nach Berlin führen, war die Strecke nur noch ein Katzensprung. Obendrein war es Sommer und der Abend hellgolden.
Eva war eine Stadtpflanze, süchtig nach menschlicher Schönheit und blind für die Reize von Landschaften. Sie malte Straßenschluchten, Hinterhöfe, Irrenhäuser, Gefängnisse und Leichenhallen, doch vor allem malte sie die Gestalten, die darin herumgeisterten. Gesichter, die im steinernen Dschungel verloren gingen, wenn niemand sie auf eine Leinwand bannte. Dinge, die unvergänglich waren, malte sie nicht. Keine Sonnenuntergänge über sandigen Urstromtälern, kein Gelb von Rapsfeldern, über die sich Nachtschwere senkte, keinen blühenden Holunder zwischen Tannenzweigen.
Dass auf dieser Reise in den Abend dennoch ein Zauber wirkte, überraschte sie. Jäh sehnte sie sich danach, die Geschwindigkeit zu drosseln, in der Schläfrigkeit des Ackerlandes dahin zu zockeln, statt Berlin entgegenzurasen, als könne keine Naturgewalt den Zwölfzylinder aufhalten. Als warte daheim, auf ihrer Insel in der Bleibtreustraße, eine Katastrophe auf sie.
Die letzten Male schon, als sie von einem Besuch bei Gerhard und Hildchen Serner zurück nach Berlin gefahren waren, hatte Eva einen Anflug von Beklommenheit verspürt, aber der hatte sie nie so eisig gepackt wie heute. Lass uns anhalten, hätte sie gern zu Martin gesagt, und im hohen Frühsommergras ein Picknick teilen, das nur aus Champagner besteht. So wie damals, als wir uns gerade gefunden hatten, als unsere Liebe uns derart einzigartig schien, dass alles, was wir taten, ebenfalls einzigartig sein musste.
Unsere Liebe ist einzigartig. Ich war die wilde Eva, der Sündenfall auf langen Beinen, in der Berliner Bohème gab es keinen einzigen hübschen Kerl, der nicht wusste, wie ich im Hotelbett schmeckte. Mit dir bin ich nicht in ein Hotel gegangen, sondern in mein Turmzimmer über der Kunsthandlung, in mein gläsernes Traumkabinett. Um deinetwillen bin ich weitergezogen, fort aus dem Turmzimmer, in deine Bleibtreustraße. Für dich bin ich sesshaft geworden und so gut wie treu, von ein paar Nächten, die nicht zählen, abgesehen. Von dir habe ich mir ein Kind machen lassen, einen dicken Bauch, in dem ein Tropfen Du und ein Tropfen Ich zu einem Ganzen schmolzen. Meine Liebe zu dir ist einzigartig, ob ich hundert Kerle vor dir hatte oder tausend. Ich habe von keinem ein Kind. Nur von dir.
Und deine Liebe zu mir?
Damals hast du, besoffen vom Kirschwein, behauptet: »Meine Liebe hält alles aus.«
Ich habe dich geküsst, bis es weh tat, und in die flimmernde Abendluft gebrüllt: »Meine nicht. Wenn du dir Speck am Hintern zulegst oder röhrende Hirsche in Stuben hängst, fliegst du raus. «
Sie betrachtete ihn von der Seite, das anbetungswürdige Profil und die Linien des Körpers, der seine Drahtigkeit bewahrte, obwohl die Hüften inzwischen merklich gepolstert waren. Es machte ihr nichts aus. Sie liebte ihn. Über schlechten Geschmack zerrissen sie sich noch immer die Mäuler, auch wenn er in letzter Zeit Zugeständnisse machte, die ihr den Appetit verdarben.
Wenn einer behauptete, seine Liebe halte alles aus – fragte der sich in dem Moment, was das bedeuten konnte, über dicke Hintern, schlechten Geschmack und ein, zwei Treuebrüche hinaus?
Evas Herz schlug heftig. Sie wollte Martin bitten, den Wagen am Straßenrand abzustellen und mit ihr in die Felder zu laufen, sich irgendwo zwischen die Halme fallen zu lassen und alles zu vergessen, was in Berlin auf sie warten mochte.
Zugleich setzte der Chaja-Hunger ein. Die Sehnsucht nach dem Kind, das sie gemacht hatten, damals in Babelsberg, im Schatten himmelhoher Filmkulissen. Chaja war in den Tagen entstanden, in denen ihre Liebe so neu und blank gewesen war wie eine leere Leinwand. Eva hatte immer darauf geachtet, nicht schwanger zu werden, seit sie mit siebzehn ihrer Familie im Taunusstädtchen Niedernhausen davongelaufen war, um sich im Hinterzimmer eines Frankfurter Varietés entjungfern zu lassen. Bei Martin vergaß sie die Überzieher und dachte später: Ich wollte ein Kind von ihm. Ich habe es nur nicht gewusst.
Das Licht wurde schwerer. Die Dunkelheit lauerte sprungbereit auf den Moment, sich herabzusenken. Berlin war schon nahe. Einst war es die einzige Stadt gewesen, in der Eva hatte sein wollen, überzeugt, nur dort, im Strudel der Metropole, malen, lernen, atmen zu können. Die Avantgarde der ganzen Welt zog es ja dorthin, jeden, der nach Neuem, Wildem, Unerhörtem strebte, der sich das Alte, Überholte, das ihn am Boden hielt, von den Fesseln schütteln wollte. In der Enge des Frankfurter Vororts, in dem Evas Familie ihr wohlanständiges Leben fristete, wäre Eva erstickt. Ihre Hitze gehörte in den Schlund des Vulkans. Nach Berlin.
»Was willst du denn da?«, hatte ihr Vater gefragt. »In dieser Stadt wartet doch kein Mensch auf dich.«
»Das ist mir egal«, hatte Eva gesagt. Dass kein Mensch auf einen wartete, bedeutete Freiheit ohne Grenzen, aber das hätte ihr Vater als Frechheit abgetan. In seiner peinlich auf Anpassung bedachten Spießbürgerwelt kam keine Freiheit ohne Grenzen vor. »Wenn du uns das antust, wartet auch hier niemand mehr auf dich, Eva.«
Sie war gegangen und hatte Niedernhausen nie wiedergesehen. Komme ich in Berlin nicht zurecht, gehe ich eben anderswohin, hatte sie gedacht. Ich bin frei, auf mich wartet nirgendwo ein Mensch.
Heute war das anders, und Eva erschrak, als sie begriff, wie verletzlich sie das machte: Heute warteten Wilma, eine Straße voller Freunde und ein Atelier voller Bilder. Bilder von Menschen, die niemand anderer als Eva hätte festhalten können und die sie brauchten, wie Eva sie brauchte, weil sie einander Unsterblichkeit verliehen. Heute wartete Chaja. Ein Kuss, der nach Himbeerdrops schmeckte. Es gab keine Freiheit mehr – und keine andere Stadt.
»Woran denkst du?«, fragte Martin.
»An Chaja«, antwortete Eva.
Für gewöhnlich lächelte er bei dieser Antwort, wie es kein Mensch bei dem gefeierten Star der UFA kannte. Er spielte feurige Liebhaber. Keine lächelnden Väter. Heute lächelte er jedoch nicht.
»Du hast vorhin meine Frage nicht beantwortet«, sagte er.
»Welche Frage?«
Seine Hände krampften sich um das Steuer. »Weißt du, was noch widerlicher ist, als mit Schweinen zu verkehren?«
Evas Herz schlug schmerzhaft gegen den Brustkorb. Wie mit einem Eispickel. Dass er von den Schweinen sprach, die seine Eltern in ihrem Koben mästeten, um sie irgendwann für Buletten durch den Fleischwolf zu drehen, wagte sie nicht zu hoffen.
Sie musste sich beherrschen, um sich nicht an ihn zu klammern wie ein verhuschtes Mäuschen, das sie nie gewesen war. Sie hatte Männer gewollt, die sie erregten, reizten, herausforderten, und Martin gelang all das wie keinem vor ihm. Einen Mann, der sie beschützte, hatte sie nicht gebraucht, sie konnte bestens auf sich selbst aufpassen. Wer hätte auch eine streitbare Amazone wie Eva Löbel beschützen wollen – und vor allem: wovor?
Aber eine Amazone, der ein Kind am Bein hing, kämpfte mit verminderter Kraft, und ein Feind, der von allen Seiten näher rückte, ließ sich nicht frontal mit einer scharfen Zunge besiegen. Beschütze mich und dein Kind, wollte etwas in ihr zu Martin hinüber wispern. Sag mir, dass uns nichts geschehen kann, was immer in Berlin auf uns wartet.
»Du antwortest mir noch immer nicht«, beharrte Martin, der über die leere Autobahn der Stadt entgegenjagte.
»Zum Teufel, ich habe keine Ahnung, was für eine Antwort du hören willst! Was ist denn noch schlimmer, als mit Schweinen zu verkehren?«
»Ein Schwein zu sein«, sagte Martin und raste in die anbrechende Nacht.
2
Berlin. Juni 1932
Eva und Martin hatten sich bei der Arbeit an dem Film kennengelernt, der ihm schließlich seinen Durchbruch bescherte. Bekannt war er zuvor schon gewesen, ein Talent, dem nur das passende Sprungbrett fehlte. »Er spielt in öden Filmen, aber er sieht umwerfend gut aus«, schwärmten die Kundinnen bei Evas Friseur. »Einen Blick hat der – erhaben wie ein junger Gott.«
Wenn der erhabene Junggott dennoch hinter seinen Konkurrenten zurückblieb, dann lag es daran, dass sich Blick und Gesichtszüge nicht für die neckischen Komödien eigneten, in denen Willy Fritsch und Heinz von Cleve brillierten. Martin Serner, das war pure Leidenschaft, das Dunkle, Überlebensgroße, das einen Monumentalfilm brauchte, ein Epos von zeitloser Gültigkeit. Und ein solches hatte sein Agent für ihn aus dem Boden gestampft.
An einem Samstagabend im Frühsommer hatte er auf der neu gelegten Telefonleitung in Evas Turmzimmer angerufen. Eva, die im Begriff stand, sich ins Nachtleben der Stadt zu stürzen, hatte vor dem Spiegel gestanden, um ihr naturgegebenes Gesicht in ein ureigenes Werk zu verwandeln. Das war das Beste am Eintauchen in den Strudel der Berliner Nächte: die Masken, die sie sich anlegen konnte, für jeden Zug um die Häuser eine neue, wonach immer ihr der Sinn stand. Paul, der reizende Akademiker, mit dem sie derzeit schlief, behauptete: »Ich habe nie etwas Intimeres gesehen als dich beim Schminken.«
Der Anruf verdarb Eva die Laune wie alles, was sie beim Gestalten störte. Entsprechend unwirsch hatte sie sich gemeldet, ohne ihren Namen zu nennen.
»Einen angenehmen Abend wünsche ich.« Der Anrufer schnaufte beim Sprechen. Seine Stimme beschwor das Bild eines possierlichen Nagetiers herauf. »Spreche ich mit Fräulein Eva Löbel?«
»Wen erwarten Sie denn sonst, wenn Sie sich mit meinem Anschluss verbinden lassen?«
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte der Nagetiermann betulich. »Ich habe Ihre Ausstellung in der Galerie Renke-Levin gesehen. Gesichter des Wahnsinns. Höchst beeindruckend. Alfred Renke-Levin war so freundlich, mir Ihre Nummer zu geben, nachdem ich ihm versichert hatte, dass Sie die Frau seien, nach der ich mir die Finger wund suche.«
»Das nenne ich einen Frontalangriff.« Evas schlechte Laune zerschmolz. »Zu den Männern, die um den heißen Brei reden, gehören Sie offenbar nicht. Leider bin ich heute Abend schon vergeben, aber ich setze Sie gern auf meine Warteliste.«
»Um Gottes willen, gnädiges Fräulein! Sie missverstehen mich. Hätte ich je daran gedacht, mich zu verheiraten, dann könnten Sie gut und gern meine Tochter sein. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen, ehe ich auf mein Anliegen zu sprechen komme: Mein Name dürfte Ihnen nichts sagen, ich bin die notorische graue Eminenz, die im Hintergrund an Fäden zieht. Den meines Klienten haben Sie dagegen mit Sicherheit schon gehört. Sie sprechen mit Hagen Fidelis, dem Agenten von Martin Serner.«
Zufällig war Eva an jenem Tag beim Friseur gewesen. Den Namen Serner hatte sie noch im Ohr. »Ist das dieser Schauspieler, der angeblich aussieht wie ein junger Gott?«
»Er sieht nicht nur so aus«, erwiderte Hagen Fidelis todernst. »Er ist einer.«
»Oha«, machte Eva. »Wenn man Ihnen etwas vorwerfen wollte, dann keinesfalls Tiefstapelei.«
»Im Fall von Martin wäre Tiefstapeln sinnlose Heuchelei«, entgegnete Hagen Fidelis.
Schwul, dachte Eva. Der junge Gott ebenso wie sein possierlicher Agent. Sie hatte gern mit schwulen Männern zu tun, weil die ihrer Arbeit längere Blicke gönnten, ehe sie unweigerlich auf ihren Körper umschwenkten.
»Nach dem Film, um den es mir geht, wird es am Himmel über diesem Land keinen helleren Stern mehr geben als Martin«, fuhr Hagen Fidelis fort. »Zumindest wenn es mir gelingt, den Rahmen zu zimmern, in dem ein solches Talent sich entfalten kann. Das Sujet hat mir eine Suche abverlangt, die den stärksten Mann zermürbt hätte: Semiramis. Sagt Ihnen das etwas? Eine große Geschichte, Fräulein Löbel. Groß genug, um die Welt zu umarmen.«
»Einer von diesen monumentalen Schinken wie Fritz Langs Nibelungen?«, fragte Eva. »Alles auf Effekte ausgerichtet, einstürzende Himmel, verschlingende Ozeane, explodierende Riesenbauten? Tut mir leid, Herr Fidelis. Ich weiß zwar noch immer nicht, was Sie eigentlich von mir wollen, aber ich fürchte, Ihr zermürbend gesuchtes Sujet interessiert mich nicht.«
»Bitte warten Sie.«
Eva glaubte vor sich zu sehen, wie der Nagetiermann sich den Hörer zwischen Ohr und Schulter klemmte und beschwörend die Hände rang. »Semiramis braucht einen Himmel, der einstürzt, damit liegen Sie richtig, aber Sie wollen mir doch wohl nicht erzählen, dass Sie das abschreckt? Ich habe Ihre Bilder gesehen, Gesichter des Wahnsinns. Würde nicht in jedem Gesicht, das Sie malen, ein Himmel einstürzen, hätte ich Sie nicht angerufen.«
Eva war so überrumpelt, dass sie nichts zu erwidern wusste. Sie lebte von den bitterbösen Karikaturen, die sie für die Satirezeitschrift Der Wahre Jakob zeichnete und über die ihre Freunde in hämisches Gelächter ausbrachen. Ihre Gemälde – verwischte Aquarelle und schweres, dunkles Öl – fanden kaum je Erwähnung. Den meisten waren sie zu kompliziert, zu wenig eindeutig für eine Zeit, in der es Plakate brauchte, klare Aussagen, die dem Betrachter ins Gesicht sprangen.
Die Zeichenlehrerin an dem Mädchengymnasium, das ihre Eltern für standesgemäß gehalten hatten, hatte Evas Bilder vor den Augen der Klasse zerrissen. »Du hast nicht aufgepasst«, hatte sie sie getadelt. »Ansonsten könntest du auch so nette Gesichter zeichnen wie Gertrud und Sibylle, nicht solche scheußlichen, kaputten Fratzen.«