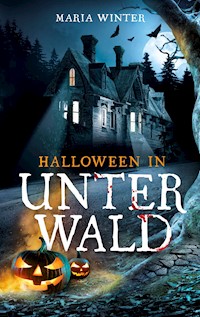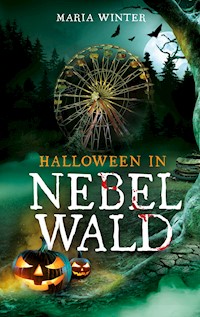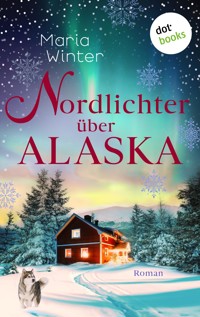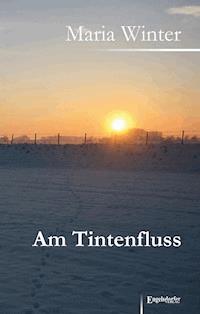Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wo ist dein Platz in einer Welt voller Monster? Im England des 19. Jahrhunderts dominieren die eitlen Nobils die Welt der Werwölfe. Die strenge Untergliederung nach Fellfarben bestimmt den Platz in der Hierarchie. Nur die Wölfin Maya Black scheint keiner Rasse anzugehören. Als Außenseiterin schlägt sie sich allein durch und lässt niemanden an sich heran. Doch als die Nobils sie gefangen nehmen und ihr ein Leben als Sklavin in einer Welt voll Demütigung und Unterdrückung droht, setzt die freiheitsliebende Maya alles daran, aus ihren Ketten auszubrechen. Aber ihr Unterfangen scheint aussichtslos, als sie an den verschlossenen Ethan verkauft wird. Die Schlinge um ihren Hals zieht sich Tag für Tag weiter zu. Um aus ihrem Gefängnis auszubrechen, benötigt sie all ihre Kräfte - und muss hinter Ethans kalte Maske blicken...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PLAYLIST
Imagine Dragons
–
Radioactive
Zayde Wolf
–
Cold-Blooded
Sam Tinnesz
–
Far From Home
Tommee Profitt
–
In The End
Sam Tinnesz
–
Even If It Hurts
Evanescence
–
Missing
Ruelle
–
Genesis
Zayde Wolf
–
Heroes
Zayde Wolf
–
Born Ready
Tommee Profitt
–
Free
Hozier
–
Arsonist`s Lullabye
Zayde Wolf feat. Ruelle
–
Walk Trough The Fire
Ursine Vulpine
–
Wicked Game
MIIA
–
Dynasty
Ruelle
–
Live Like Legends
Tommee Profitt
–
I’m Not Afraid
Tommee Profitt
–
Tomorrow We Fight
Diese Lieder inspirierten mich beim Schreiben von „Under the Moon: Gefangen“.
TRIGGERWARNUNG!
Dieses Buch enthält Triggerhinweise auf der letzten Seite!
Für eine Jugend voller
Fantasie und Abenteuer
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
PROLOG
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
VORWORT
Europa im 15. Jahrhundert. Mittelalter. Ein Zeitalter geprägt von Intrigen, Machtspielen und blutigen Kriegen. Von öffentlichen Hinrichtungen, bei denen der wütende Mob dem Opfer in die Augen sehen konnte, wenn es bei lebendigem Leib verbrannte oder gevierteilt wurde. Und von tagelangen Schlachten, bei denen die Kämpfer manchmal knöcheltief in Blut und Eingeweiden ihrer Gegner oder Verbündeten standen. Nicht umsonst wurde es auch das dunkle Zeitalter genannt.
Doch nur wenige wissen, dass nicht nur die grausigen Taten der Menschheit für diesen Ruf verantwortlich waren. Neben all dieser Barbarei schlichen sich unbemerkt Wesen der Finsternis in die Gassen der Siedlungen. Wesen mit vor Mordlust glühenden Augen, die einen um den Verstand brachten. Mit Mäulern voll messerscharfer Reißzähne und riesigen Pranken, die den Kopf eines ausgewachsenen Mannes mit Leichtigkeit zerquetschen konnten.
Monster.
Werwölfe, die sich über den kompletten Kontinent verteilten und bei Vollmond ganze Städte in Angst und Schrecken versetzten. Das Mittelalter wurde auf einen Schlag wesentlich dunkler.
Bis die mutigen Retter auftauchten: ausgebildete Jäger, die erst mit versilberten Klingen, später mit Silberkugeln Hunderte Monster zur Strecke brachten.
Die Werwölfe begannen fortan vorsichtiger zu sein.
Einige führten ein unscheinbares Leben inmitten der Menschen, andere zogen sich in unbewohnte Gegenden zurück. Viele trieb es nach Transsylvanien, in die Karpaten. Nach den anfangs friedlichen Jahren, sorgten zunehmend Meinungsverschiedenheiten um die Ressourcen und Gebiete des Gebirges für Streitigkeiten unter den Wölfen. Einigungen wurden immer rarer, die Fronten verhärtet. Die Wölfe spalteten sich in verschiedene Lager und teilten sich letztendlich nach ihrer Fellfarbe in drei große Rassen auf.
Die Luminos, die weißen Wölfe im Osten, die schwarzen Umbras im Süden der Karpaten. Die Nobils, die grau- und braunfarbenen Wölfe, waren der Streitereien längst überdrüssig. Sie verließen das Territorium, das mittlerweile einem Pulverfass glich, und siedelten sich in verlassenen Burgen an.
Aus bloßen Streitigkeiten ging ein Konflikt hervor, der in einer Jahrhunderte überdauernden, unüberwindbaren Kluft zwischen den Rassen gipfelte. Das Spannungsfeld zwischen den Luminos und Umbras in den Karpaten verteilte sich über den ganzen Kontinent und die Nobils nutzten die brenzlige Situation zu ihrem Vorteil. Während die schwarzen und weißen Wölfe in ihren persönlichen Kleinkrieg verwickelt waren, bauten sie sich ein kleines Handelsimperium auf, das ihnen den Weg zu beachtlichem Reichtum ermöglichte. Immer mehr Burgen in ferneren Ländern wurden besetzt.
Um den steigenden Bedarf an verschiedenen Ressourcen zu decken, benötigten sie kräftige Arbeiter. Sie krallten sich die schwächsten Wölfe, die Luminos, die ihnen ohne jede Unterstützung von außen ausgeliefert waren. Einige Umbras stellten sie sogar an, um die Lumino-Sklaven zu beaufsichtigen.
Ein Rad, das sich seit dem Mittelalter drehte und eine ganz eigene Dunkelheit ins neunzehnte Jahrhundert brachte.
PROLOG
HERZOGTUM SACHSEN-MEININGEN,1863
»Du musst dich von ihnen fernhalten, hast du mich verstanden?«
Es war eine wolkenlose Nacht. Der beinahe kugelrunde Mond stand hoch am Himmel und blickte auf uns herunter. Das weiße Licht fiel auf Deans harte Gesichtszüge; sein kurzes blondes Haar schimmerte wie flüssiges Silber. Er schaute mich ernst an. »Das ist der beste Weg, glaub mir.« Eine bedrückende Stille breitete sich zwischen uns aus. »Du bist anders«, sagte er schließlich. »Anders als die anderen.«
Ich wusste, was folgen würde. Es war nicht die erste Unterhaltung dieser Art, die wir führten, seitdem ich vor einem Dreivierteljahr auf Dean getroffen war. Aber es würde die letzte sein. Für sehr lange Zeit.
»Du gehörst weder zu den Umbras, noch bist du ein richtiger Lumino. Von den Nobils ganz zu schweigen.«
Obwohl mir diese Tatsache mehr als bewusst war, hallten seine Worte schmerzhaft in meinem Herzen nach. Wie so oft, wenn wir über dieses Thema sprachen. Einmal mehr wurde mir in diesem Augenblick klar, dass ich in eine Welt hineingeworfen worden war, von der ich keine Ahnung hatte. Bis vor einigen Monaten hatte ich nicht einmal das Geringste von ihrer Existenz geahnt.
Die Schauergeschichten, die mir meine Eltern in meiner Kindheit vor dem knackenden Kaminfeuer erzählt hatten, um mich vor nächtlichen Alleingängen im Wald abzuhalten, hatten mich ohnehin nie beeindruckt. Wer glaubte schon ernsthaft an Monster mit messerscharfen Krallen und zentimeterlangen Reißzähnen, die zwischen den Bäumen ihrer Beute auflauerten?
Dean packte mich fest an den Schultern. »Dein Platz ist überall und nirgendwo, Maya.«
Ich konnte nur nicken und schaffte es nicht, seinem durchdringenden Blick standzuhalten.
»Vergiss nicht, die Menschen werden dich jagen. In ihren Augen bist du bloß ein weiteres Ungeheuer auf der Abschussliste. Umbras werden dich für einen Lumino und damit für einen Feind halten. Die meisten werden auf Krawall aus sein. Einige, da bin ich mir ziemlich sicher, werden versuchen, dich zu fangen und an die Nobils auszuliefern. Denen ist es letztendlich egal, was du bist. Du hast weißes Fell. Du wirst ein potenzieller Sklave sein.
Anders verhält es sich mit den Luminos. Die Rassen haben in den vergangenen Jahrhunderten ein Gespür dafür entwickelt, wer zu ihnen gehört. Sie werden spüren, dass du keine von ihnen bist. Sie werden dich auf Abstand halten.«
Er ließ seine Hände sinken und trat zwei Schritte zurück.
»Du musst gut auf dich aufpassen, Maya.«
Er wandte sich abrupt von mir ab und ging zu seinem Pferd. Der schwarze Hengst gab ein lautes Schnauben von sich, als Dean noch einmal den Sattelgurt nachzog. Der bittere Geschmack von Abschied breitete sich auf meiner Zunge aus.
Dean kam nicht aus dieser Gegend. Er würde weiterziehen.
»Dean?«, fragte ich, bevor er sich auf den Rücken des Pferdes schwang. »Was, wenn ich es nicht schaffe? Das Fernhalten.«
»Du kannst und du musst.« Seine Stimme duldete keine Widerrede, wie so oft.
Alles, was er sagte, entsprach der Wahrheit. Gänzlich und vollkommen, dennoch – oder gerade deswegen? – bahnte sich eine hartnäckige Frage ihren Weg entlang meiner Kehle. Ich musste sie stellen.
»Die Jäger, die Umbras, die … Nobils, was, wenn sie mich doch eines Tages … finden?«
Dean setzte seinen Fuß in einen der Steigbügel und ließ sich in den Sattel fallen. Er signalisierte dem Pferd, loszulaufen und ritt direkt neben mich.
»Menschen und Werwölfe können schrecklich sein, Maya. Sie tun widerliche, abscheuliche Dinge und viele sind wahrhaftige Monster. Besonders hier drin.« Dean presste eine Faust auf seine Brust.
»Aber vergiss nicht …« Seine Lippen verzogen sich zu einem düsteren Grinsen. »… du bist nicht länger ein zerbrechlicher Mensch, sondern ebenso ein Teil dieser Welt voller Schatten und Monster.« Er zwinkerte mir zu. »Du bist ebenso ein Monster wie sie.«
1. KAPITEL
NORDENGLAND,1874
Deans Worte hallten in meinen Ohren nach, während ich mir auf Dragons Rücken einen Weg durch den Schneesturm bahnte. Der Hengst stieß ein extrem langgezogenes Schnauben aus und ich wuschelte durch seine wilde schwarze Mähne, um ihn wenigstens eine kleine Weile bei Laune zu halten.
»Es ist verdammt kalt, ich weiß«, sagte ich mitfühlend, obwohl mir selbst die Kälte wenig anhaben konnte. Die flaumartigen Schneeflocken, die im Sekundentakt auf meine Wangen wirbelten, hinterließen ein angenehm kühles Gefühl auf meiner Haut.
Die gesenkte Kälteempfindlichkeit als Werwolf, egal ob in animalischer Gestalt oder in menschlicher, stellte sich immer wieder als vorteilhaft heraus. Nur selten kam es vor, dass eisige Temperaturen mir etwas anhaben konnten.
Dafür, dass das britische Festland selbst zu dieser Jahreszeit für seine milden Temperaturen bekannt war, hatte es mein erster Winter auf der Insel allerdings ganz schön in sich.
Eisiger Wind blies uns entgegen. Auf den freien Flächen zwischen den Hügeln gab es so gut wie keinen Schutz vor dem winterlichen Orkan, geschweige denn gegen den starken Schneefall, der wasserfallartig vom grauweißen Himmel herabstürzte.
Mittlerweile war es elf Jahre her, dass Dean jene Worte zu mir gesagt hatte, doch sie schwebten nahezu jeden Tag durch meine Gedanken und mahnten mich zur Vorsicht. Es war unsere letzte Begegnung gewesen und sie hatte sich für immer in meine Erinnerung eingebrannt.
Einer der Gründe, weshalb ich auch heute abseits der gängigen Wege unterwegs war.
Du musst dich von ihnen fernhalten, hatte er mich damals gewarnt. Menschen und Werwölfe können schrecklich sein.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Vorstellung davon, wie schrecklich sie sein konnten. Nach all dem, was ich im vergangenen Jahrzehnt als Werwolf erlebt und gesehen hatte, schien das Wort schrecklich nicht auch nur im Entferntesten auf diese Kreaturen zuzutreffen.
Er hätte sagen sollen: Menschen und Werwölfe konnten blutrünstig, trügerisch, verräterisch und mordlüstern sein. Sie fanden Gefallen daran, andere zu Tode zu foltern, sie zu schänden und zu missbrauchen. Sich gegenseitig auf unerträgliche Weise zu quälen.
Leider hatte ich derartige Wesenszüge viel zu oft und viel zu deutlich an ihnen feststellen müssen.
Ich musste daran denken, wie ich in meinem ersten Jahr als Werwolf von einigen Dorfbewohnern nahe des Rheins fälschlicherweise für eine Hexe gehalten worden war und mir daraufhin der Prozess gemacht werden sollte. Nur mit Glück hatte ich mir den Weg kurz vor dem Scheiterhaufen freikämpfen können. Seitdem war ich wachsamer geworden, auch in Bezug auf menschliche Siedlungen.
Von meinen Erfahrungen mit anderen Werwölfen ganz zu schweigen …
Ich musste zugeben, die Sache mit dem Fernhalten war lange nicht meine Stärke gewesen, obwohl ich mich stets bemüht hatte, einen weiten Bogen um jegliche Lebewesen zu machen.
Abseits der gängigen Wege, mit Schlafplätzen im Wald und ohne Bekanntschaften, ließ es sich am einfachsten leben. Nicht, dass Letzteres für mich überhaupt eine Rolle spielte.
Plötzlich blieb Dragon stehen. Seine Ohren bewegten sich nervös in alle Richtungen.
Ich seufzte, nahm die Kapuze meines schwarzen, eingeschneiten Umhanges ab und schloss die Augen, um mich besser auf die Geräusche meiner Umgebung zu fokussieren. Dabei tätschelte ich beruhigend Dragons Hals. »Schon gut. Ist schon gut.« Unter meinen kalten Händen machte sich eine angenehme Wärme breit. »Ich höre sie auch«, sagte ich leise und konzentrierte mich auf die lauter werdenden, merkwürdigen Geräusche. Der am Boden liegende Schnee gab knautschende Laute von sich, ein animalisches Schnaufen ertönte, gefolgt von einem Räuspern.
Meine Augenlieder flogen auf. »Sie sind hinter uns.«
Fünfzehn, vielleicht zwanzig … Menschen? Nicht in diesem Gebiet. Es ist so gut wie menschenleer. Möglicherweise befinden sie sich auf der Durchreise? Nein, nicht heute. Kein Mensch würde sich bei diesem Wetter vor die Tür wagen.
Es gab nur eine logische Erklärung. Und diese war die denkbar schlechteste von allen.
Nobils. Auf der Reise zu einer anderen Burg? Oder auf der Rückreise von einer … erfolgreichen Jagd?
Bei dem Gedanken breitete sich ein säuerlicher Geschmack in meinem Mund aus. Wie ich ihre kranke Vorstellung einer Jagd doch verabscheute.
Dabei waren keine Tiere das Ziel. Sondern Werwölfe. Um genauer zu sein Luminos – Werwölfe, deren Fellfarbe die gleiche war wie meine.
Eine weitere Windböe erfasste mich und trieb meinen viel zu kräftigen Wolfsgeruch direkt in ihre Richtung.
Äußerst ungünstig.
Schnell setzte ich die Kapuze wieder auf, obwohl mir bereits klar war, dass es nichts mehr nützen würde. Zu spät.
Vielleicht würden sie trotzdem keine Notiz von mir nehmen. Oder sie würden mich ignorieren und weiterziehen?
Das glaubst du doch selbst nicht, brummte eine penetrante Stimme in meinem Schädel.
Nein, tat ich nicht. Es würde ihnen nicht sehr ähnlichsehen. Nicht, wenn ein möglicher Sklave ihren Weg kreuzte.
Ich wog mein begrenztes Kontingent an Möglichkeiten ab.
Zu fliehen wäre das Beste. Jedoch hatte Dragon schon Schwierigkeiten, durch den tiefen Schnee voranzukommen, und bei mir würde das sicher nicht anders aussehen. Ein schnelles Davonkommen konnte ich mir also aus dem Kopf schlagen. Außerdem würde ich mich mit diesem Verhalten sofort verraten. Nur potenzielle Sklaven flohen vor Nobils.
Ich berührte den hölzernen Griff meines Kurzschwertes, welches in seiner Scheide an Dragons Satteltasche ruhte. Es war kein filigraner Degen, wie es um diese Zeit Mode war, sondern ein echtes Schwert mit einer breiten, messerscharfen Klinge.
Einer sehr tödlichen Klinge.
Kämpfen war eine weitere Möglichkeit. In all den Jahren hatte ich ziemlich viel Erfahrung darin gesammelt. Meistens unfreiwillig.
Allerdings würden sie in einer übermächtigen Überzahl sein, wie ich bereits anhand der Fülle ihrer Geräusche ausgemacht hatte.
Kämpfen wäre sinnlos, auch wenn ich mir das nur ungern eingestand.
Ich machte Pferde aus, die sich mir näherten. Die Stimmen ihrer Reiter wurden mit jedem Meter lauter und deutlicher.
»Sie kommen«, flüsterte ich, rieb noch einmal über Dragons Hals und richtete mich in dem Sattel auf.
Der Moment, der mir die minimale Chance einer Flucht geboten hatte, war verstrichen. Da war noch die Idee, mir ein Versteck zu suchen, in dem sie mich inmitten des Schneesturmes nicht aufspüren konnten. Doch um mich herum gab es nichts als kahle Ebenen. Nicht unbedingt die besten Bedingungen, mich unsichtbar zu machen.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf das Beste zu hoffen und vor allem eine gute Portion Glück zu haben.
Ein schiefes Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus. Glück zu haben zählte nicht gerade zu meinen Stärken.
Die Fremden ritten um mich herum und stoppten ihre Pferde in meiner Nähe. Durch meine weit nach unten gezogene Kapuze erhaschte ich nur einen Blick auf die Fesseln der Tiere. Aber mehr musste ich nicht sehen.
Werwölfe. Ganz sicher.
Ihr Geruch drang in meine Nase. Selbst in ihrer menschlichen Gestalt ging ein unverkennbarer Duft nach frischem Nadelwald und umherstreifendem Wolf von ihnen aus.
Dragon schnaubte und bewegte den Kopf auf und ab. Ich hatte ihn monatelang trainiert. Er war an die Existenz von Werwölfen, egal ob in ihrer menschlichen oder animalischen Gestalt, gewöhnt und hatte schon vor etlichen Jahren die natürliche Furcht vor uns verloren. Jedoch schien auch er die ins Negative umschlagende Atmosphäre zu bemerken.
»Ihr da? Wer seid Ihr und was macht Ihr bei diesem Wetter ganz allein hier draußen?«, rief mir eine tiefe, männliche Stimme zu.
»Ich bin auf der Durchreise«, entgegnete ich knapp.
Hinter mir hörte ich das Rascheln von stählernen Kettengliedern. Aus Erfahrung wusste ich, es gab nur einen einzigen Grund dafür.
Sklaven. Adrenalin schoss durch meine Adern. Das war der Beweis.
Nobils. Es sind Nobils!
»Auf der Durchreise, soso.« Die Stimme des Mannes triefte vor Misstrauen. »Ich frage Euch jetzt noch einmal, wer Ihr seid, und Ihr werdet mir gefälligst antworten!«
Ihr werdet antworten, schwappten seine Worte in Form kleiner Wellen durch meine Ohren. Noch ein Indiz dafür, dass es sich um Nobils handelte. Kein Mensch sprach sich in der heutigen Zeit mit dieser formellen Anrede an. Sie war als Relikt aus dem Mittelalter hängengeblieben. Aus der Zeit, in der einige Werwölfe ganze Dörfer in Angst und Schrecken versetzt hatten und andere sich immer weiter von diesem grausigen Bild entfernt hatten, indem sie Stück für Stück die Gebräuche und Gepflogenheiten aristokratischer Menschen übernahmen. Allen voran die Nobils.
»Ich bin niemand.« Ein schwacher Versuch, das Unausweichliche abzuwenden.
Sie werden nicht aufhören.
Sieben Männer hockten auf den Rücken ihrer Pferde wenige Schritte vor mir, zwei weitere hatten sich an meinen Seiten positioniert und ich hätte wetten können, hinter mir befand sich dieselbe Anzahl an Reitern.
Ausweglos.
»Zeigt uns Euer Gesicht und wir lassen Euch passieren.«
Er lügt. Sie müssen mittlerweile gewittert haben, dass ein Werwolf vor ihnen sitzt.
Zu meinen Gedanken schlich sich erneut die fiese Stimme: Sie spielen mit dir, Maya.
Natürlich spielten sie mit mir. Taten sie dies nicht immer? Und wenn ich jetzt meine Kapuze abnahm, würden sie mich erkennen. Dann wäre ich so gut wie tot.
Aber was hatte ich für eine Wahl? Tat ich es nicht, würden sie mich früher oder später angreifen. Wohl eher früher.
Ich atmete tief aus, machte mich bereit für das, was gleich geschehen würde, packte meine Kapuze an beiden Seiten und schob sie langsam nach hinten.
Der Mann, der mich zuvor angesprochen hatte, wurde plötzlich blass um die Nase.
»Da… das ist sie! May…«, stammelte er leise. Der tobende Schneesturm verschluckte seine Worte beinahe.
Und dann brach Chaos aus.
Während die anderen ihre Waffen zückten, nutzte ich das kurze Überraschungsmoment, griff nach meinem Schwert und sprang von Dragon.
Das sahen sie nicht kommen. Weshalb sollte sich jemand, der in der Falle saß, in eine ungünstigere Position bringen? Es gab nur einen einzigen Grund, den ohnehin niemand außer mir nachvollzog.
Mit einer Hand versetzte ich dem Hengst einen Schlag auf den Hintern und schickte ihn damit aus der Situation. Um jeden Preis wollte ich verhindern, dass mein jahrelanger treuer Begleiter in die Hände der Nobils fiel.
Mit der anderen Hand rammte ich die Klinge meines Schwertes in die Brust des Mannes rechts über mir, der mit seiner eigenen Waffe bereits gefährlich weit ausgeholt hatte. Er blickte auf das silbrig glänzende Metall hinab, das in seinem Körper steckte und auf dessen Oberfläche dunkles Blut entlangrann. In einer ruckartigen Bewegung zog ich die Klinge aus seinem Fleisch. Mit weit aufgerissenen Augen sackte der Mann zur Seite und stürzte zu Boden. Ich holte erneut aus und schlitzte einem zweiten Reiter den Mantel und die darunter liegende Bauchdecke auf.
Es wird nichts bringen. Der Kampf ist sinnlos, dachte ich finster.
Aus seiner Schockstarre gelöst, brüllte der Mann mit der tiefen Stimme: »Auf sie! Na los. Aber ich will sie lebend!«
Was jedoch nicht heißt, dass ich ihnen nicht ordentlich Feuer unter den Hintern machen kann.
Zwei Männer glitten unbeholfen aus den Sätteln und stürzten mit gezogenen Schwertern auf mich zu, während die anderen Reiter einen immer engeren Kreis um mich zogen und mir so Bewegungsspielraum nahmen. Ein taktisch intelligentes Vorgehen, das musste ich ihnen lassen.
Ich wehrte den Hieb des vorderen Mannes gekonnt ab und drehte mich um die eigene Achse, um mit der Spitze meines Schwertes den hinteren Mann zu attackieren, streifte jedoch nur seinen Oberarm. Blutstropfen spritzten auf den Stoff meines schwarzen Umhanges.
Ich wollte gerade auf den anderen Angreifer zustürmen, als sich die Reiter nah um mich herum postierten und mit ihren gezückten Schwertern auf meinen Kopf zeigten. Wenn ich mich nicht selbst aufspießen wollte, war es keine gute Idee, einen Schritt vor zu machen.
Das war‘s.
Es musste so enden. Ich hatte es gewusst. Es waren einfach zu viele gewesen.
»Andrew, er stirbt!«, ertönte eine Stimme aus dem hinteren Teil des Feldes.
Ich war mir ziemlich sicher, dass damit ebenjener Reiter gemeint war, dem ich meine Klinge in die Brust gebohrt hatte.
»Du verdammte Hure!«, brüllte mich Andrew an. Ich vermutete, dass er die Stellung eines Anführers einnahm, so wie er sich vor den anderen aufspielte.
Ich legte all meinen Hass in den Blick, den ich ihm zuwarf. Ein kräftiger Tritt gegen meine Kniekehle streckte mich zu Boden. Ein weiterer Nobil ergriff die Chance und schlug mir mein Schwert aus der Hand.
Halb schockiert, halb vorausschauend sah ich zu, wie es wegflog und einige Meter entfernt im Schnee verschwand.
Ich war unbewaffnet, schutzlos und ihnen ausgeliefert.
Mit einem Mal wurde mir schlecht. Ich ekelte mich vor dem unbehaglichen Gefühl, das meine Glieder entlangkroch und mir klarmachte, dass Angst wohl die angebrachte Reaktion war.
Der Mann, der mich mit einem weiteren, nun ziemlich toten Wolf angegriffen hatte, packte mich bei den Schultern und drückte mich hinab in den Schnee. Mein Kopf verschwand in der dichten, kalten Masse und ich musste mich beherrschen, nicht automatisch nach Luft zu schnappen. Zwei weitere Paar Hände hielten mich unten, während mir irgendjemand die Arme auf den Rücken drehte. Der Verschluss der Kettenglieder rastete ein und augenblicklich reagierte meine Haut gereizt auf das silberne Metall an meinen Handgelenken. Ich ignorierte die brennenden Stiche, die sich entlang meiner Unterarme ausbreiteten. Als hätte ich mit der Hand ins offene Feuer gefasst. Ich kannte diese Reaktion meiner Haut auf das Metall und hasste sie.
Sie war unsere Schwachstelle und dazu eine äußerst schmerzhafte.
Ein Angreifer zerrte mich an meinen Haaren gepackt unsanft auf die Knie zurück. Der Anführer dieser Truppe baute sich mit seinen breiten Schultern vor mir auf.
Schwer atmend hielt ich seinem vernichtenden Blick stand. Er war offensichtlich wütend. In seinen Augen loderten die Flammen des Zorns und eine Hand umklammerte den Griff seines Schwertes derart fest, dass das Weiße seiner Knöchel hervortrat. Mir drängte sich die Frage auf, warum er mich nicht auf der Stelle umbrachte.
Stattdessen wickelte er mit der anderen Hand mein dunkelbraunes Haar um seine Faust und zwang mich so, den toten Nobil inmitten der Männer anzusehen. Blut sickerte aus seinen Wunden und färbte den umliegenden Schnee rot.
Ich betrachtete den Anblick mit ausdrucksloser Miene. Ich war niemand, der gern tötete, sondern nur, wenn es unbedingt notwendig war. Und der Versuch, nicht in ihre Hände zu geraten, fiel definitiv in diese Rubrik.
Zudem war ich mir sicher, dass der Mann sein Schicksal verdient hatte. Ich kannte keinen Nobil, der es nicht hätte.
»Das wirst du noch bereuen.«
Er ließ mich los und spuckte mir ins Gesicht. Ich starrte selbstbewusst zurück. Davon ließ ich mich nicht einschüchtern oder erniedrigen.
Das Silber zwang mich, meine Schwächen zu enthüllen. Bei diesem Mistkerl ließ ich das allerdings nicht zu.
»Genau wie deine Taten an unseren Brüdern und Schwestern. Ja, wir wissen wer du bist, Maya Black.« Er verzog seine Lippen zu einem gefährlichen Grinsen und erinnerte mich an einen tiefen Abgrund, in den ich zu fallen drohte.
Nein, ich wollte keine Schwäche zeigen. Zumindest noch nicht.
»Teico wird begeistert sein, wenn er sieht, wen wir ihm mitbringen.« Er senkte seinen Kopf zu mir herab, sein Atem heiß und kalt zugleich an meinem Ohr. Angewidert wollte ich mich von ihm wegdrehen, doch er packte erneut meine Haare und zwang mich, seine Nähe auszuhalten. »Erinnere dich an meine Worte. Du wirst dir noch wünschen, uns nie begegnet zu sein.«
Ich kannte die Nobils. Ich wusste, zu was sie fähig waren. So ungern ich es mir eingestand: Sie würden alles daransetzen, diese Drohung wahr werden zu lassen.
2. KAPITEL
Die Nobils brachten mich und die anderen Gefangenen, insgesamt zwölf Wölfe, zu ihrer Burg. Über ihrem massiven Holztor hatten sich gigantische Eiszapfen gebildet, die mich sicher ohne weiteres erschlagen könnten.
Obwohl Andrew mit seinen Worten versucht hatte, mir Angst einzujagen, war es ihm nur bedingt gelungen. Einerseits wusste ich genau, welch abscheuliche Sachen die Nobils mit ihren Gefangenen oder ihren Feinden anstellten. Auf der anderen Seite beruhigte genau das meinen nervösen Herzschlag: Mich konnte kaum noch etwas überraschen.
Vielleicht war es diese Erkenntnis, die mich nicht resignieren ließ, sondern die dazu führte, dass ich mich sehr lebendig fühlte, als ich den ersten Schritt in den Innenhof der Burg machte.
Mal sehen, wie lange, schoss es mir durch den Kopf. Ich konnte mir ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen. Es war klar gewesen, dass mein Leben irgendwann so endete. Dass es hier endete.
Ich konnte mich von diesen ganzen Monstern nicht fernhalten. Wie auch, wenn sie überall lauerten?
Eins stand jedenfalls fest, Dean würde mich windelweich prügeln, wenn er wüsste, in welchen Schwierigkeiten ich steckte, in die ich mich auch noch selbst manövriert hatte. Aber vielleicht würde er auch ein wenig grinsen und über mein Verhalten den Kopf schütteln.
Ich versuchte meine Umgebung genau wahrzunehmen. Vielleicht könnte mir dieses Wissen nützlich sein, auch wenn ich daran meine Zweifel hatte.
Links von mir, unweit vom Eingang der Burg, befand sich der steinerne Palas mit winzigen Fenstern. Dieses Gebäude stammte eindeutig aus längst vergangenen Tagen. Der Palas zeichnete einen Knick und reichte über die Hälfte der sich anschließenden Burgmauer. Direkt dahinter stand ein weiteres Gebäude, erbaut aus hellerem Stein mit einer anschließenden Stallung. Ich vermutete, dass dort die Unterkunft der Umbras lag.
Nirgends fand ich eine Tür oder ein weiteres Tor, die einen Weg in die Freiheit bieten könnten. Es schien nur diesen Zugang zur Burg zu geben.
Nicht, dass das irgendeine Bedeutung hatte. Ich würde sie nie wieder verlassen, zumindest nicht lebendig.
Mit unserer Ankunft strömten die Bewohner der Burg aus dem Palas. Männer und Frauen versammelten sich gemeinsam mit den Jägern zu einer Traube aus verschiedenfarbigen, edlen Gewändern und beobachten uns aus sicherer Entfernung. Wüste Beschimpfungen wurden uns von der anderen Seite des Burghofes aus entgegengeschleudert. Zweifellos handelte es sich bei ihnen um Nobils. Genauer gesagt um das Burgvolk.
»Stehen bleiben«, befahl Andrew.
Der Nordwind blies mir ins Gesicht und umwehte meinen Körper. Zwar hatte der Schneesturm im Laufe der letzten Stunden nachgelassen, die strenge Kälte jedoch war geblieben.
Blut rauschte in meinen Ohren und heißes Adrenalin wärmte zusätzlich meine Adern, als sich einige Männer, vermutlich Wachen der Burg, um uns herum aufstellten. Unter ihren langen, schwarzen Umhängen zeichneten sich Waffen ab. Schwerter, Dolche, einer trug sogar eine Armbrust bei sich. Umbras, die Handlanger der Nobils. Sie erledigten die Arbeiten, zu denen sich die Nobils für gewöhnlich nicht herabließen. Eine war es, sich um die Sklaven in den Burgen zu kümmern. Für ihre Dienste wurden sie fürstlich entlohnt. Außerdem durften sie als Gegenleistung oftmals in abgegrenzten Bereichen der Burgen wohnen. Die Anstellungen waren sehr begehrt und die meisten nahmen ihre Arbeit sehr ernst. Manchmal etwas zu ernst.
Mein Blick blieb an ihrer schweren Bewaffnung hängen. Ich hätte wetten können, einige brannten nur darauf, eine Möglichkeit zu bekommen, sie gegen die gefangenen Luminos zu verwenden.
Ein stattlicher Mann mit einer Glatze trat aus der Menge. Über seinen Schultern hing ein hochwertiger Mantel aus verschiedenen dunklen Pelzen und seine kräftigen Hände steckten in schwarzen Lederhandschuhen.
Eine Eigenheit der Nobils. Nur sie kamen auf die Idee, die Häute und Felle von Wölfen zu tragen. Welch Ironie und welch Respektlosigkeit zugleich.
Der Anführer der Jäger eilte zu ihm und unterrichtete ihn mit knappen Worten über die Jagd. Von dem Gespräch bekam ich nicht alles mit.
»Wir konnten insgesamt zwölf Luminos aufspüren, verteilt über mehrere Orte. Deshalb hat unsere Rückkehr so lange gedauert. Es war gar nicht einfach, sie aufzuspüren. Die Vorräte an Sklaven auf der Insel sind erschöpft.«
In diesem Augenblick wurde mir klar, dass es sich bei dem breitschultrigen Mann um den Burgherrn handeln musste. Er hatte hier also das Kommando inne. Und ich betrachtete ihn als meinen ärgsten Feind. Sie alle waren mir mit Sicherheit nicht wohlgesonnen. Aber er war es, der mich das am meisten spüren lassen konnte. Und der es tun würde, wofür ich ihn schon verabscheute.
»Ist die Ware brauchbar?«, fragte er, als ob es das normalste der Welt wäre, so über andere fühlende Lebewesen zu reden.
»Ich denke, es ist für jeden Geschmack unserer Kunden etwas dabei«, entgegnete Andrew. »Außerdem haben wir dir jemand ganz besonderen mitgebracht.«
Andrew drehte seinen Kopf in meine Richtung. Der andere Mann folgte diesem Blick.
Der Burgherr nickte kaum merklich, ohne seinen von mir zu nehmen, auch wenn in seiner starren Maske etwas zu arbeiten begann, und schickte Andrew anschließend mit einer Handbewegung fort.
Er verschränkte die Arme hinter seinem Rücken und lief mit quälender Langsamkeit die Reihe aus neuen Sklaven ab. Ein abschätziger Blick für einen scheinbar wertlosen Wolf, ein anzügliches Grinsen für ein hübsches, blutjunges Mädchen.
»Eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann. Sehr gute Arbeit, Andrew. Sehr gute Arbeit, Männer«, rief er aus.
Er drehte sich zu mir um. Der Ausdruck in seinen anthrazitfarbenen Augen wurde mit jeder Sekunde frostiger, als verspürte er das dringende Bedürfnis, sein inneres Biest auf mich loszulassen.
Ich konnte nichts gegen die Gänsehaut tun, die sich unter meiner dünnen Kleidung auf meiner Haut ausbreitete. Das war eindeutig ein Typ Wolf, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellten, da ich seinen Zorn auf mich gezogen hatte.
Aber ich hatte nicht vor, mich von ihm einschüchtern zu lassen, und schon gar nicht wollte ich ihm das offen zeigen. Ich verfluchte meinen Körper für seine unwillkürliche Reaktion.
»Kennst du mich, Miststück?« Er durchbohrte mich förmlich mit seinem Blick, aber ich hielt ihm eisern stand. »Mein Name ist Teico Redvers und du befindest dich auf Shutter Castle. Viel wichtiger ist jedoch, ich kenne dich, Maya Black.« Er machte eine ausladende Handbewegung in Richtung des restlichen Burgvolks. »Jeder hier kennt dich. Wie könnten wir auch diejenige vergessen, die fünfzehn unserer Schwestern und Brüder auf dem Gewissen und noch dazu vor wenigen Stunden einen meiner Männer getötet hat.«
Redvers stieß einen animalischen Laut aus, der mich an den Donner während eines Unwetters erinnerte, und schmetterte seine Faust gegen meine Nase. Sekunden später machte sich der metallische Geschmack von Blut in meinem Mund breit, als die Flüssigkeit an meiner Oberlippe entlangrann. Schwarze Sterne kreiselten vor meinen Augen, hervorgerufen durch den stechenden Schmerz in meiner Nase. Redvers schien nur allzu gut zu wissen, welche Körperteile die verletzlichsten waren.
»Maya Black, Verantwortliche für den Fall einer unserer Burgen im Norden Rumäniens; Dragan Castel.«
Er räusperte sich und zielte erneut auf meine Nase. Ein Schwall dunklen Blutes schoss hervor und landete auf meinem Umhang und dem plattgetrampelten Schnee.
Der Schmerz zog bis in die Rückseite meines Schädels und mein Gesicht begann zu brennen.
Ich hatte Mühe, meine Gedanken inmitten dieses Wirbels aus Schmerz und Blut zu sortieren. In diesem Durcheinander hörte ich sie plötzlich wieder: Die Stimme, die rief …
3. KAPITEL
2 JAHRE ZUVOR
»Beeilt euch! Sie versucht zu fliehen.«
Der Lautstärke der Worte nach zu urteilen, befanden sich meine Verfolger ein gutes Stück hinter mir.
Trotzdem peitschte ich Dragon immer weiter in den dichter werdenden, stockfinsteren Wald. Für meinen Geschmack waren die Stimmen viel zu nah und ich war nicht scharf darauf, dass sie mir noch näher kamen.
Ausgerechnet sie. Denen ich am allerwenigsten über den Weg laufen sollte, wenn ich auch nur einen Funken an meinem Leben hing.
Ausgerechnet sie waren mir gefährlich nah. So nah wie nie zuvor in meinen Tagen als Werwolf.
Ich trieb Dragon weiter vorwärts und zeichnete eine ruckartige Linkskurve. Ein Versuch, sie abzuschütteln. Doch so leicht gab ein Räuber seine Beute nicht frei. Es überraschte mich kaum und trieb dennoch meinen Puls in ungeahnte Höhen. Ich spürte, wie Panik durch meine Adern floss – ein Gefühl, welches ich seit Ewigkeiten nicht mehr derart intensiv wahrgenommen hatte. Winzige Eiskristalle hefteten sich an meine Blutbahnen und umhüllten mein Herz mit schmerzhafter Kälte. Es war äußerst unangenehm und überhaupt nicht nützlich, weshalb ich versuchte, es bestmöglich zu ignorieren.
Es gelang mir nur mit Mühe.
Das Gelände unter Dragons Hufen fiel immer steiler ab. Neben den wuchtigen Baumstämmen säumten abgestorbene Äste und kniehohe Büsche den Boden. Immerhin gelang es uns, diese Hindernisse trotz der Dunkelheit auszumachen. Was es jedoch nicht leichter machte, ihnen im vollen Galopp auszuweichen.
»Los jetzt, sonst entwischt sie uns noch!«, erklang die Stimme wieder.
Unter normalen Umständen hätte ich mein Pferd nicht wie eine Irre diesen Abhang hinuntergetrieben. Unter normalen Umständen hätte ich es sich langsam vortasten lassen, Stück für Stück. Aber unter normalen Umständen musste ich auch keinen Feind abhängen. Und mir war klar, dass in Dragons Schnelligkeit die einzige Möglichkeit lag, meine Verfolger abzuschütteln.
Ich presste meine Schenkel gegen seine Flanken und lehnte mich leicht zurück, um das Gleichgewicht besser halten zu können.
Ich hatte ihn nicht einmal mehr satteln können, so überrascht hatten sie mich. Kein Wunder, im Schlaf war ich am leichtesten zu überwältigen. Glücklicherweise war einer beim Anpirschen an meinen Schlafplatz unter einer alten Eiche auf einen Ast getreten, dessen knackendes Geräusch mich sofort aus meinem Schlaf geweckt hatte. Instinktiv hatte ich nach meinem Schwert gegriffen und war mit hämmerndem Herzen aufgesprungen.
Da hatte ich sie entdeckt: meine Angreifer, die halb versteckt zwischen Büschen oder Baumstämmen lauerten.
Im ersten Moment hatte ich Schwierigkeiten gehabt, einzuschätzen, um wen es sich handeln könnte. Im zweiten war mir klargeworden, dass das keine Rolle spielte.
Nur eine einzige Tatsache war von Bedeutung: Es waren zu viele, als dass ich sie angreifen konnte und sollte.
Egal, wer versuchen wollte, mich im Schlaf zu überwältigen – es war vorerst besser, vor ihnen zu fliehen.
Daher war ich in einem Satz auf Dragons Rücken gesprungen und ließ all mein Hab und Gut – seinen Sattel, meinen Rucksack mit Kleidung, Nahrung und anderen, unbedeutenden Habseligkeiten – zurück. Lediglich mein Schwert schaffte ich noch in der Scheide an dem Gürtel meiner Hose zu verstauen.
Erst nachdem ich über eine breite Lichtung geritten war und bemerkte, dass sie mir ebenfalls zu Pferd folgten, wurde mir mit schlagartiger Deutlichkeit klar, wer mich geweckt hatte.
Eine Horde Menschen hätte vielleicht versucht, mich auszurauben. Eine Gruppe Umbras ebenfalls, oder sie hätten mich einfach vertrieben.
Nobils jedoch nahmen die Jagd auf. Einen möglichen Sklaven ließen sie nicht einfach entkommen. Schon gar nicht, wenn sie in so einer Überzahl waren.
Die Erkenntnis traf mich wie ein Fausthieb. Ich hatte nicht vor, als einer ihrer Sklaven zu enden.
In meiner gesamten Zeit als Werwolf war mir bereits zweimal ein verspäteter Hexenprozess gemacht worden. Ich war von Umbras angegriffen worden und von diversen selbsterklärten Werwolfjägern. Aber von allen Strafen, die man mir je androhen könnte, wäre das mit Abstand die Schlimmste.
Klar war mir nur nicht, wie sie darauf kamen, dass ich ein Lumino war. Vermutlich hatten sie meinen Geruch gewittert und ausgeschlossen, dass ich zu ihrer Rasse gehörte. Womöglich war sogar ein Umbra unter ihnen, der ebenfalls keine Verbindung zu mir spürte, wie es innerhalb einer Rasse üblich war.
Was immer noch nicht erklärte, weshalb sie mich gefunden hatten. Bevor ich meinen Schlafplatz aufgeschlagen hatte, war ich sichergegangen, mich auf neutralem Gebiet zu befinden. War die nächste Burg der Nobils nicht viel zu weit weg?
Doch ich kam nicht mehr dazu, den Gedanken zu Ende zu führen. Ein Blitzschlag zuckte durch meinen Körper und setzte ihn augenblicklich unter Strom. Zumindest fühlte sich der Schmerz, den meine rechte Schulter ausstrahlte, so an.
Erschrocken schnappte ich nach Luft. Dragons Zügel glitten mir für den Bruchteil einer Sekunde aus den Händen. Ein Bruchteil, in dem er sich mit seinen Vorderbeinen im Gestrüpp verfing und ich das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte.
Viel zu schnell rutschte ich von seinem Rücken und stürzte kopfüber den Abhang hinab, bis ich mit dem Gesicht zum Boden liegen blieb.
Der Duft feuchten Waldbodens stieg in meine Nase. Begleitet vom Gefühl Dutzender Stiche kleiner Tannenadeln, die sich in meine Wangen gruben.
Ich brauchte einige Augenblicke, um zu begreifen, was passiert war. Wo ich mich befand und dass ich trotz des Schmerzes in meiner Schulter, der nun wieder übermächtig wurde, schnellstmöglich wegmusste.
Es waren nur wenige Augenblicke, dennoch reichten sie aus, um mein Leben in den Abgrund zu stürzen.
Als ich mich auf meine Hände stützen und aufstehen wollte, wurde ich nach unten gedrückt. Ein Knie presste sich zwischen meine Schulterblätter. Der Schmerz in meinem Rücken wurde beinahe unerträglich und das Gewicht des Mannes auf meinem Körper quetschte meine Lungenflügel zusammen, sodass ich kaum noch atmen konnte.
»Ah, haben wir dich doch.« Neben dem kratzig rauen Klang der Stimme des Mannes, hörte ich das triumphierende Grinsen deutlich.
Aus meinem eingeschränkten Sichtfeld heraus bemerkte ich, wie sich die anderen um mich herum versammelten. Trotzdem begann ich mich unter dem Gewicht des Mannes zu winden. Es schien ihn jedoch kaum zu beeindrucken.
»Schicker Schuss, Velkan.«
»Jahrelange Übung, jahrelange Übung«, witzelte einer der Männer, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte.
Meine Bewegung erstarrte in dem Moment, als irgendetwas meinen gesamten Rücken aufschnitt. Von meiner Schulter an, entlang meiner Wirbelsäule, bis hinab zu meinem Steißbein.
Jegliche Luft wich aus meinen Lungen. Selbst zum Schreien fehlte mir der Sauerstoff, sodass ich nur stumm meinen Mund aufreißen und eine Grimasse ziehen konnte.
Das amüsierte die Jäger. »Sei doch nicht immer so grob, Adrian.« Ein Lachen ging durch die Gruppe.
»Ich und grob?«, fragte Adrian mit gespielter Verwunderung in der Stimme. Endlich verschwand das Gewicht von meinem Körper und ich saugte Luft in meine Lungen. Luft, an der ich mich erst einmal verschluckte. »Ich bin doch nicht grob!«
Erneut lachten die Männer auf und Adrian ließ neben mein Gesicht einen Gegenstand fallen. Es war eine Pfeilspitze mit einem abgebrochenen Schaft. Mein Blut klebte an der gesamten Spitze sowie an einigen Zentimetern des Holzes.
Der Pfeil musste sich tief zwischen meine Knochen gebohrt haben; und Adrian hatte ihn einfach aus meinem Fleisch gerupft und damit die Wunde um das Dreifache vergrößert.
Meine Verletzung schien jedoch niemanden zu interessieren. Auch nicht, als sich zwei andere Männer daranmachten, meine Arme auf den Rücken zu drehen und meine Handgelenke zu fesseln.
Das war die Nacht, in der ich zum ersten Mal die Bekanntschaft mit Nobils schloss.
Und in der ich begann, sie für den Rest meines Lebens zu hassen.
4. KAPITEL
Hass war auch, was ich spürte, nachdem der Schwall aus Blut zu einem dünnen Rinnsal aus meiner Nase versiegt war. »Aber wie es das Schicksal so will, haben meine treuen Jäger dich aufgespürt. Nach zwei Jahren auf der Flucht kannst du nun endlich deiner gerechten Strafe zugeführt werden.«
Es gab nur eine gerechte Strafe nach der Auffassung der Nobils. Der Tod war eine ziemlich endgültige.
Ich würde sterben. Ganz unweigerlich. Das seltsame daran war, es löste nicht das Geringste in mir aus. Was mich selbst stutzig machte. Sollte da nicht irgendetwas sein? Irgendein Anflug von Trauer, von Verzweiflung, von Wut?
Vielleicht lag es daran, dass ich schon zu viele schreckliche Dinge gesehen hatte, die Menschen und Werwölfe einander antaten. Allen voran die Nobils. Ich war in Dragan Castel Zeuge von Folter, Erniedrigungen und Tötungen geworden. Manchmal hörte ich im Schlaf die Schreie der Opfer. Womöglich hatte ich es einfach satt, diese Erinnerungen tagtäglich mit mir herumzuschleppen. Vielleicht kam es mir deshalb nicht unbedingt wie eine Strafe vor, sterben zu müssen, sondern eher wie eine Erleichterung.
Auch wenn dieser Gedanke gegen all meine Prinzipien verstieß. Ich war jemand, der sich wehrte. Jemand, der kämpfte. War jetzt tatsächlich der Punkt gekommen, an dem es keinen Sinn mehr hatte? Es schien so.
»In Anbetracht der Tatsache, dass dabei einer meiner besten Jäger sein Leben lassen musste, gibt es nur eine Strafe, die auch nur annähernd gerecht wäre.«
Na los, mach schon, sag es!, drängte ich in Gedanken.
»Tod durch Hinrichtung.«
Das Burgvolk und die Jäger grölten zustimmend.
»Aber …« Er hob eine Hand. Sein Innehalten irritierte mich.
Was hatte er vor?
»Aber«, begann er erneut. »Ich denke, wir sind uns alle einig, dass sie keinen schnellen Tod verdient.«
Er drehte sich erneut zu mir. Am liebsten wäre ich vor ihm zurückgewichen. Redvers‘ Blick sprühte Funken – ein Ausdruck, den ich insbesondere in Dragan Castel einige Male gesehen hatte und der nie etwas Gutes verhieß.
Es war der Blick eines Irren - eines Sadisten.
»Nein, den hast du wahrlich nicht verdient.«
Ich hatte es hier nicht mit einem gewöhnlichen Burgherrn zu tun. Obwohl ich Teico Redvers erst seit wenigen Minuten kannte, sagten seine dominante Körperhaltung und sein herabwürdigendes Verhalten weit mehr über ihn aus, als ich in Gesprächen mit oder über ihn je hätte herausfinden können.
Er war nicht irgendwer. Er war jemand, der es verstand, Sklaven zu foltern. Der es vermutlich perfektioniert hatte, weil er den Sklaven nicht nur Schmerzen zufügte, wenn sie nicht gehorchten, sondern auch aus purer Belustigung und dem starken Bedürfnis heraus, ein anderes Wesen zu seinen Füßen kriechend und um Gnade bettelnd zu sehen.
Er war jemand, für den ich nichts weiter als Abscheu und Hass empfand.
Ich straffte meine Schultern und erwiderte Redvers‘ feurigen Blick.
Mir war bereits in Dragan Castel bewusst gewesen, welche Konsequenzen meine Handlungen nach sich ziehen würden. Dieses Wissen hatte mich dennoch nicht von meiner Handlung abgehalten. Ich war das Risiko eingegangen, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden.
Die letzten beiden Jahre war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich wieder in ihre Fänge geraten würde. Ihre Burgen lagen über den gesamten Kontinent verteilt, wie ein wucherndes Geschwür hatten sich diese Wölfe in jeder Gegend ausgebreitet. Ein Ort, der sich außerhalb ihres Einflussbereichs befand, war blanke Illusion.
Er streckte seine rechte Hand aus. Ein mir unbekannter Mann durchquerte den Hof und reichte Redvers einen Gegenstand, der nicht gerade selten in den Burgen der Nobils zum Einsatz kam. Redvers hob ihn vor meinen Augen in die Höhe, sodass ihn jeder sah – ein Holzstab mit einer langen ledernen Schnur, um die sich ein silberner Draht schlängelte.
Er wollte mir Angst einjagen und wollte, dass ich um mein Leben bettelte. Doch auf diese Genugtuung konnte er lange warten. »Sechzehn tote Nobils. Sechzehn Peitschenhiebe, um sie an jeden einzelnen zu erinnern.«
Erwartungsvolles Jubeln strömte aus der Menge der Nobils.
Kein Wunder. Wenn man auf ihrer Seite des Burghofes steht, kann man es sich leisten, zu jubeln, dachte ich spöttisch.
Zwei Männer packten mich an den Seiten und drängten mich quer über den Platz zu einem Pfahl. Ich wand mich in ihren Armen und versuchte mich unter großen Schmerzen aus ihrem Griff zu befreien. Vergeblich. Diese verdammten Ketten!, fluchte ich gedanklich.
Ich ließ meinen Widerstand fallen, sparte meine Kräfte. Viel wichtiger war es, mich auf das vorzubereiten, was gleich passieren würde.
Die beiden Männer schälten mich aus meinem Umhang, bevor sie die silbernen Ketten durch Schellen, die mich an den hölzernen Pfahl vor mir fixierten, ersetzten. Anschließend rissen sie die Rückseite meines Hemdes auf. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie jemand Redvers den Mantel abnahm und dieser trotz des ergiebigen Schneefalls sein weißes Hemd hochkrempelte und die Bullenpeitsche in der Hand wog.
Ich fixierte einen Punkt vor mir, atmete langsam ein und wieder aus.
Dean hatte einst zu mir gesagt: Du darfst auf keinen Fall panisch werden. Du musst immer die Kontrolle behalten. Ein Ratschlag, auf den ich in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren hatte zurückgreifen müssen. Öfter, als mir lieb gewesen war.
Keine Sorge, Dean, das mit der Panik habe ich mittlerweile im Griff.
Ich erinnerte mich an seine weiteren Worte, suchte mir einen Punkt an dem Pfahl vor mir und versuchte alles andere auszublenden.
Er wird mich nicht brechen, sagte ich mir. Das schafft er nicht.
Ich atmete abermals langsam ein und noch langsamer aus und beruhigte meinen Puls.
Stille legte sich über den Hof.
Das Burgvolk wartete.
Die Jäger warteten.
Ich wartete …
Komm schon, du Stück Scheiße!
»Eins«, fauchte Redvers.
Die Peitsche zischte durch die Luft und knallte auf meine Hüfte.
Feuer, nein, Eis grub sich unter meine Haut und sandte ein schmerzhaftes Stechen durch meinen ganzen Körper.
Halt bloß den Mund, tadelte ich mich selbst. Ich erlaubte mir nicht die geringste Reaktion. Ich würde diesem Mistkerl keinen Anlass zur Freude geben.
Am Anfang kommt der Schock, dachte ich an ähnliche Situationen. Danach wusste ich, wie es sich anfühlen würde, und konnte mich darauf einstellen.
Ich streckte meinen Rücken durch und spannte meine Muskeln für den zweiten Hieb an.
Ich biss die Zähne zusammen.
»Zwei«, zählte Redvers und schlug abermals mit voller Wucht zu. Zitternd ließ ich die Luft aus meiner Lunge.
Atme. Verdammt, atme!, erinnerte ich mich selbst.
Beim sechsten Hieb drang der Geruch frischen Blutes in meine Nase. Ich sah es nicht, aber ich spürte deutlich, wie es über meinen Rücken rann.
»Sieben!«, brüllte Redvers.
Auch wenn ich es nicht für möglich gehalten hätte, schienen seine Hiebe mit jedem Mal kraftvoller zu werden. Wütender.
Nach dem zwölften Hieb fiel es mir zusehends schwerer, aufrecht stehen zu bleiben und nicht vor Schmerz zu keuchen. Tränen brannten in meinen Augen und drohten über meine Wangen zu laufen.
Die Schmerzen befanden sich längst über der Grenze des Erträglichen. Mit jedem Hieb riss der Burgherr eine bereits vorhandene Wunde weiter auf. Das Leder bohrte sich immer tiefer in mein Fleisch.
Doch er würde mich nicht zerstören; diesen Triumph gab ich ihm nicht. Das hatten schon genug andere vor ihm versucht.
Die letzten vier Hiebe folgten schnell aufeinander und das Knirschen von Schnee verriet mir, dass Redvers an mich herantrat. Beim letzten Schritt brüllte er laut auf und schlug so fest zu, dass ich einen Moment befürchtete, er würde meine Wirbelsäule in tausend Teile sprengen.
Eine kräftige Hand packte mich an meinen Haaren und riss meinen Kopf nach hinten. Redvers zwang mich, ihn anzusehen. Sein Gesicht war von hellroten Blutspritzern gesprenkelt.
Er schien noch immer außer sich vor Wut, doch dann kehrte ein distanzierter Ausdruck zurück auf sein Gesicht. Er passte zu den harten Zügen um Mund und Nase.
Redvers neigte seinen Kopf ein Stück zur Seite, betrachtete die zerfetzte Haut auf meinem Rücken und gab einen zufriedenen Laut von sich. »Ich bin gespannt, wie lange du durchhältst.«
Ich war zu erschöpft, um über seine Aussage empört oder erschrocken zu sein. Wahrscheinlich hätte ich es sein sollen.
Er stieß mich gegen das Holz vor mir und entfernte sich.
Ich schaute seinen breiten Schultern hinterher. Das Bild verschwamm allmählich und wurde zu einem unklaren Brei. Mein Bewusstsein rann mir durch die Finger.
Er hat mich am Leben gelassen.
Ich schloss meine Augen und lehnte meine Stirn gegen den Pfahl.
Nur damit ich jetzt einen langsamen, qualvollen Tod sterbe.
5. KAPITEL
Die Wachen drängten mich gemeinsam mit den anderen Sklaven in den Kerker. Hier unten brannten nur vereinzelt Fackeln, was den Wölfen die Sicht jedoch nicht erschwerte. Wir fanden uns auch im Dunkeln zurecht.
Es fiel mir schwer, das Gleichgewicht auf den Treppenstufen zu halten. Die unaussprechlichen Schmerzen, die von meinem Rücken ausstrahlten, betäubten meine Gliedmaßen.
Reiß dich gefälligst zusammen, schnauzte ich mich innerlich an.
Ich hoffte inständig, nicht auf der Stelle in meiner Zelle zusammenzubrechen. Vor den Augen dieser verdammten Handlanger.
Einer der Männer öffnete die Gittertür einer Zelle, der andere schubste mich unsanft hinein.
»Viel Vergnügen beim Sterben«, meinte einer. Ich drohte, nach vorn umzukippen und stützte mich im letzten Moment mit einer Hand an der steinernen Wand ab. Der schmutzige Boden unter mir drehte sich gefährlich schnell.
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du schaffst das, sagte ich mir. Es ist nicht das erste Mal, dass du mit einer solch extremen Situation umgehen musst.
Ich atmete abermals tief ein und zitternd wieder aus. Der Schwindel und das Taubheitsgefühl in meinen Beinen zwangen mich in die Knie; stöhnend glitt ich an der Wand hinab.
Immerhin trug ich keine Ketten mehr, die mir die Haut wundscheuerten. Höchstwahrscheinlich hielten sie mich nach dem, was Redvers mir angetan hatte, für ungefährlich.
Ein Mann lehnte neben mir an der Wand einer weiteren Zelle. In seinen Armen hielt er ein Mädchen, das ich nicht älter als zwölf Jahre schätzte. Er nickte mir stumm zu.
Der Mann gehörte nicht zu den Sklaven, die mit mir hergebracht worden waren. Er musste schon länger hier sein.
»Du verlierst viel Blut«, sagte er nach einer Weile mit ruhiger Stimme. Er musste längst gespürt haben, dass ich kein Lumino war.
Mit einer Spur Resignation und Fassungslosigkeit schaute ich zu ihm hinüber. Aber die Folter forderte ihren Tribut, sodass ich über das sonderbare Verhalten nicht länger klar nachdenken konnte. Geschweige denn einen anderen Gedanken fassen.
Ich nickte ihm kaum merklich zu und ließ mich vorsichtig auf vergammeltem Stroh und dem steinernen Zellenboden nieder.
6. KAPITEL
2 JAHRE ZUVOR
»Sperrt sie ein. Der Burgherr wird sie morgen früh begutachten.«
Als wir in der Burg ankamen, war es noch mitten in der Nacht. Was darauf schließen ließ, dass ich einen folgenschweren Fehler begangen hatte.
Ich hatte nichts von der Existenz dieser Burg gewusst. Hatte nicht ausreichend recherchiert, mich nicht aufmerksam genug umgehört.
Obwohl ich meine Reise durch Rumänien sorgsam geplant hatte – erst recht in der Hinsicht auf die heimischen Gebiete der Luminos und Umbras – war ich hier gelandet. Als ich das stählerne Burgtor passierte, breitete sich Fassungslosigkeit in mir aus.
Wie, zum Teufel, war mir dieser Fehler nur unterlaufen? Ich war alles andere als unvorsichtig, zumindest wenn es sich vermeiden ließ. Und ich plante stets meine Routen, um zu verhindern, irgendeiner anderen Rasse über den Weg zu laufen.
Jetzt befand ich mich in den Händen der Nobils.
Nein, nicht nur in ihren Händen.
Während sich das Burgtor hinter mir schloss, wurde mir klar, dass ich mich von nun an in ihrer Gefangenschaft befand. Als eine ihrer Sklavinnen.
Ein Umstand, der die Macht hatte, mir den Verstand zu rauben. Und mit dem ich mich auf keinen Fall abfinden wollte.
Während die Männer ihre Pferde stoppten, suchte ich mit Blicken den Burghof ab. Vielleicht gab es irgendeine Schwachstelle, die ich mir zunutze machen könnte?
Doch trotz meines ausgeprägten nächtlichen Sehvermögens erspähte ich wenig. Der Burghof lag vollständig in Schatten. Ich konnte lediglich ausmachen, dass er nicht besonders groß war. Den Rest konnte ich wohl erst bei Tageslicht herausfinden.
Velkan, der Mann, der auf mich geschossen hatte, packte mich an meiner Hüfte und zerrte mich von Dragons Rücken. Neben mir hatten sie mein Pferd ebenfalls mitgenommen. »Einen so kräftigen Hengst lassen wir nicht zurück. Nehmt ihn mit«, hatte der Mann namens Adrian befohlen.
Das war er tatsächlich. Kräftig und drahtig, mein Begleiter und nicht ihr Eigentum. Ich war alles andere als einverstanden, dass sie ihn mir wegnehmen würden, aber was spielte das im Augenblick für eine Rolle?
Meine Hände waren noch immer hinter meinem Rücken gefesselt, dennoch wand ich mich in Velkans Griff.
»Na los doch, bringt sie in den Kerker. Dort kann sie sich erst einmal beruhigen«, kommandierte Adrian mit einer wegwerfenden Handbewegung und wandte sich bereits wie einige andere seiner Begleiter zum Gehen. Doch dann hielt er inne und brüllte über die Schulter: »Ach ja, und vergesst nicht, ihr die Wunde zubrennen zu lassen. Nicht, dass die Kleine uns noch abklappt.«
Ehe ich mich versah, packten mich weitere Hände und ich wurde von zwei Jägern eine Treppe hinabbugsiert. Hier unten war es ebenso dunkel wie im Wald außerhalb der Burg. Daneben schlug mir der Gestank von Schweiß, Verdorbenem und Fäkalien entgegen. Er war wie eine Wand, gegen die ich rannte und die mich unwillkürlich die Luft anhalten ließ.
Am Ende der Treppe lag auf der linken Seite eine dicke Holztür, die von einem der Männer geöffnet wurde. Der andere schubste mich unsanft über die Schwelle.
Zum ersten Mal in dieser Nacht erblickte ich Feuer. An den Wänden brannten insgesamt vier Fackeln, die dem Raum eine warme, fast heimelige Atmosphäre verliehen. Dabei war er alles andere als gemütlich eingerichtet. Lediglich drei Stühle und ein Tisch füllten sein Inneres. Um ihn herum saßen zwei weitere Männer, die Karten spielten und Bierkrüge neben sich stehen hatten.
»Lucian und Sorin«, begrüßte Velkan die beiden.
»Ein neuer Sklave?«, fragte der Größere. Er war ein richtiger Hüne mit stoppeligem braunen Haar und fleischigen Lippen.
Am liebsten wäre ich einen Schritt zurückgewichen. Nicht, dass ich in dieser Burg jemanden traute. Aber dieser Mann strahlte eine Härte und Erbarmungslosigkeit aus, die mich verunsicherten.
»Ganz richtig. Sie hat eine Wunde an der rechten Schulter, Lucian.«
Lucian nickte lediglich, griff nach dem Schwert hinter ihm an der Wand und hielt die Spitze der Klinge in eine Flamme.