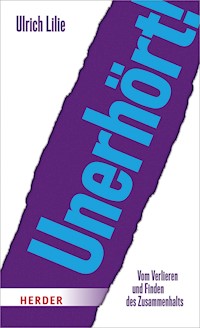
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Es gärt in Deutschland: Millionen Menschen fühlen sich abgehängt, unverstanden und vor allem: ungehört. Andere möchten nichts mehr mit "denen da unten" zu tun haben und bilden Parallelwelten. Die Folgen sind dramatisch: Der Zusammenhalt der Gesellschaft geht verloren und wird verdrängt durch Enttäuschung, Frust und Wut. Die Rufe nach Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Integration, Teilhabe und Solidarität werden immer lauter und dürfen nicht mehr überhört werden. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, kennt diese Rufe und gibt den "Ungehörten" in seinem neuen Buch eine Stimme. Er weiß: In Zeiten, in denen die Menschen sich gegenseitig mit einer nie gekannten Dichte und Anzahl von digitalen Nachrichten "zutexten", schrei(b)en viele ihre Meinung im Modus der Empörung geradezu heraus. Lilie hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gespräch nicht stattfindet, Aufgebrachtheit der Umgangston der Wahl ist und sich gegen Politiker, alte Mensch, Flüchtlinge, Obdachlosen und besorgte Bürgerinnen und Bürger richtet. Die grassierende Empörungslust kennt kein politisches Lager. Sie existiert in rechten, liberalen oder linken Spielarten. Für die Demokratie hat das mindesten zwei negative Nebenwirkungen: Der Dauerton der Empörung behindert einerseits jeden konstruktiv-kritischen Dialog. Andererseits bewirkt der aufgeregte Ton der medialen, politischen, aber auch im Privaten geführten Debatten, dass zu häufig zwar noch über, aber nicht mehr mit denen gesprochen wird, die Gegenstand der Empörung sind. Mit den Menschen also, um die es geht, die aber in den lärmenden Debatten nicht gehört werden. Die Kunst des Zuhörens droht in Vergessenheit zu geraten. Die Kraft des vernünftigen Arguments, die Anstrengung des kontroversen Dialogs gilt als vorgestrig. Dabei liegt auf der Hand, dass diese Kunst in einer Bundesrepublik Deutschland der vielfältigen Lebensentwürfe und Kulturen durch nichts zu ersetzen ist. Ulrich Lilie hilft in seinem Buch nicht nur, die grassierende Empörungslust zu verstehen. Sein Buch erzählt von berührenden Gesprächen, von Begegnungen mit "Ungehörten" genauso wie von Spaziergängen mit Spitzenpolitikern durch Problem-Viertel. Er benennt scharfsinnig die Probleme und Nöte in der Gesellschaft und erklärt, was schief läuft in diesem Land. Vor allem aber zeigt Lilie, wie wir die Kunst des Zuhörens wiederentdecken können und wie damit der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Gemeinsinn erneuert werden können. Sein Buch ist damit nicht nur kluge Analyse, sondern auch ein leidenschaftliches Plädoyer für ein Land, in dem es sich zu leben lohnt – für jeden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Lilie
Unerhört!
Vom Verlieren und Finden des Zusammenhalts
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein
ISBN E-Book 978-3-451-81438-9
ISBN Print 978-3-451-38175-1
Für alle bürgerschaftlich Engagierten,
die tagtäglich ihr Bestes geben.
Ohne sie wäre unsere Gesellschaft
für sehr viel weniger Menschen eine Heimat.
Inhalt
Widmung
Vorwort
Die unerhörte Gesellschaft
»Rentner first!«
»Die hören mir nicht zu.« – Die bunte Gesellschaft der Unerhörten
Respekt oder die Kultur des Zuhörens
Worüber reden wir eigentlich?
Geschlossene Gesellschaft. Wer gehört dazu?
Gebrochene Versprechen: Von Liebe und blühenden Landschaften
»Wir haben diese Leute alleingelassen.« – Die ohnmächtige Wut der Vergessenen
Von der Politik verlassen
Zuhören, bitte!
Den Unerhörten zuhören. Eine Kampagne der Diakonie
Multikulti braucht »Mover«
Nachbarschaft gestalten – Gemeinsinn für ein gutes Leben
Wir schaffen das nur gemeinsam
Unerhört – der Rest der Welt ist auch noch da
Ein Epilog für religiös Musikalische
Literaturauswahl
Quellenangaben
Über den Autor
Vorwort
»Betrachtet genau das Verhalten dieser Leute: Findet es befremdend, wenn auch nicht fremd. Unerklärlich, wenn auch nicht gewöhnlich. Unverständlich, wenn auch die Regel. (…) Untersucht, ob es nötig ist. Besonders das Übliche! Wir bitten euch ausdrücklich, findet das immerfort Vorkommende nicht natürlich! Denn nichts werde natürlich genannt (…) Damit nichts unveränderlich gelte.«1
Bertolt Brecht
»Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.«
Jakobusbrief 1,19
Wir leben in Zeiten von populistischen Krachmachern und medialen Krawallmachern. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die das Gefühl haben, mit ihren Anliegen und Geschichten kein Gehör zu finden. Deswegen geht es in diesem Buch um das Hören, genauer gesagt um das Zuhören. Denn die Kunst des Zuhörens droht in der »unerhörten Gesellschaft« auf den Hund zu kommen.
In Zeiten, in denen die Menschen sich gegenseitig mit einer nie gekannten Dichte und Anzahl von digitalen Nachrichten »zutexten«, schrei(b)en viele ihre Meinung im Modus der Empörung geradezu heraus. Zu viele zeigen dabei kein wirkliches Interesse an ihrem Gegenüber. Wie es den anderen geht, den Empfängerinnen und Empfängern ihrer Kurznachrichten und Reden, was ihr Leben belastet oder worin ihre Überzeugungen bestehen, ist dabei ohne echte Bedeutung. Gespräch findet nicht statt, Aufgebrachtheit ist der Umgangston der Wahl: »Unerhört! Diese Politiker! Diese Alten! Diese Flüchtlinge! Diese Obdachlosen! Diese besorgten Bürgerinnen und Bürger!«
Die grassierende Empörungslust kennt kein politisches Lager. Sie existiert in rechten, liberalen oder linken Spielarten. Für die Demokratie hat das mindesten zwei negative Nebenwirkungen: Der Dauerton der Empörung behindert einerseits jeden konstruktiv-kritischen Dialog. Andererseits bewirkt der aufgeregte Ton der medialen, politischen, aber auch im Privaten geführten Debatten, dass zu häufig zwar noch über, aber nicht mehr mit den »lebendigen Gründen« der Empörung gesprochen wird. Den Menschen nämlich, um die es geht – seien es Obdachlose, Flüchtlinge oder »besorgte Bürger« – die in den lärmenden Debatten nicht gehört werden. Die Kunst des Zuhörens droht in Vergessenheit zu geraten. Die Kraft des vernünftigen Arguments, die Anstrengung des kontroversen Dialogs gilt in der »vertalkten« Republik als vorgestrig. Dabei liegt auf der Hand, dass diese Kunst in einer Bundesrepublik Deutschland der vielfältigen Lebensentwürfe und Kulturen durch nichts zu ersetzen ist.
Darum ist dieses Buch ein Plädoyer für das Zuhören. Das ist mir am wichtigsten. Damit das gelingt, ist das Buch auch ein Versuch, die grassierende Empörungslust besser zu verstehen. Nicht zuletzt weil diese Empörung sehr viel Energie bindet, die wir in unserem Land – konstruktiv gewendet – sehr gut gebrauchen könnten. Und wenn wir nicht verstehen, weshalb so viele Menschen empört sind und sich unerhört fühlen, werden wir das Gesprächsklima und damit das Zusammenleben in unserem Land nicht verbessern können.
Dieses Buch ist ein Versuch, den Zustand unserer Gesellschaft zu verstehen, will aber nicht bei der Theorie stehen bleiben, sondern anhand von konkreten Beispielen zeigen, warum und wie sich gerade schwierige Gemeinwesen positiv verändern können, wenn Menschen ihre Dialog- und Kooperationsfähigkeit wiederentdecken. Das Leben einer Gesellschaft gewinnt an Qualität, wenn Zuhören die Basis bildet: in den großen politischen Debatten genauso wie in der konkreten Nachbarschaft, im »bunter« werdenden Dorf oder in den Stadtteilen, in denen die kulturelle Vielfalt auch an den Nerven zerrt.
Zu meiner Perspektive: Ich schreibe als westdeutsch sozialisierter evangelischer Pfarrer, der in seinem bunten Berufsleben in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet hat: in Klinik, Hospiz, Gemeindepfarramt, als Superintendent, als Theologischer Vorstand einer großen diakonischen Einrichtung und derzeit als Präsident eines der größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland, der Diakonie. Egal wo ich gearbeitet habe, mir war immer wichtig, mich nicht in einer kirchlichen Sonderwelt einzuigeln. Ich bin neugierig auf andere Lebensentwürfe und Denkansätze. Es gibt immer etwas zu lernen.
Die Diakonie: Man kann nicht voraussetzen, dass alle wissen, was sich dahinter verbirgt. Etwas salopp gesagt: Diakonie, das sind die mit der Nächstenliebe, und zwar die evangelische Variante. Seriöser formuliert: Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Ich bin seit 2014 Präsident der Diakonie Deutschland. Das ist ein Spitzenverband, der auf Bundesebene als Werk der Kirche und großer Unternehmensverband nach außen vor allem sozialpolitische Lobbyarbeit macht. Seinen Sitz hat er in Berlin. Mein Einfluss in diesem Amt beschränkt sich weitgehend aufs Reden. Ich kann Vorschläge machen, Impulse geben, Diskussionen anstoßen, mich an Debatten beteiligen. Was ich für eines der größten Privilegien meiner Aufgabe halte, ist, dass ich mit sehr unterschiedlichen Menschen reden darf – das Spektrum umfasst die Pflegefachschülerin und die Bundeskanzlerin, den Demografiespezialisten ebenso wie den unbegleiteten minderjährigen Flüchtling.
Ich halte viel von der Kraft des Arguments und möchte dazu beitragen, dass die Positionen der Diakonie in der vielfältigen Gesellschaft in Deutschland und Europa gehört und diskutiert werden. Auch in der sich pluralisierenden Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland ist zivilisierte Religion eine konstruktive Kraft, dafür trete ich öffentlich ein. Aber anders als manche sich vorstellen, sitzen wir im Vorstandskollegium nicht in einer Art evangelischem Sozial-Imperium am Hebel der Macht.
Trotzdem ist die Diakonie ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Faktor in unserem Land. Dafür sprechen schon die Zahlen: mehr als 525.000 Hauptamtliche, 700.000 Ehrenamtliche und rund 10 Millionen Menschen, denen diakonische Krankenhäuser, Pflegeheime, Beratungsstellen und Sozialstationen, Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, Werkstätten und Kindergärten Unterstützung anbieten. Diakonie ist allerdings kein hierarchisch operierender Konzern, sondern eher ein föderal-diskursiver Kosmos mit einer im Selbstbestimmungsrecht der Kirchen begründeten besonderen Stellung im deutschen Rechtssystem. Sie hat jedenfalls eine komplexe, übrigens auch für Beteiligte mitunter schwer zu greifende Struktur, die sich deutschlandweit in selbstständige Landes- und Fachverbände verzweigt, zu denen (wieder selbstständige) Mitglieder gehören. Das können große Gesundheits-Unternehmen oder Bildungsträger sein, aber auch kleinste Beratungsstellen oder Kindergärten, auch diakonische Lebensgemeinschaften gehören dazu. 80 Prozent unserer diakonischen Mitgliedsunternehmen beschäftigen weniger als einhundert Mitarbeiter.
»Wir« funktionieren als diakonisches Netzwerk mit zahlreichen Knoten. Und wir »funktionieren« nicht immer und überall gleichermaßen gut. Gemeinsam ist allen Beteiligten in diesem Netzwerk der Diakonie: Wir arbeiten gemeinnützig. Gemeinnützig heißt, die Gewinne, die erwirtschaftet werden, müssen in die soziale oder gesundheitspflegerische Arbeit reinvestiert werden – wo das nicht geschieht, liegt ein schwerer Regelverstoß vor. Und wir wurzeln in christlichem Grund evangelischer Prägung; dazu gehört der Glaube an einen menschenfreundlichen Gott, der will, dass allen Menschen geholfen werde. Das orientiert das Handeln in der Diakonie. Deswegen stehen unsere Angebote vorbehaltlos allen Menschen offen. Das »Wir« wiederum, der Gemeinsinn, das ist eine entscheidende Basis, die zu erodieren droht, die aber auch oft falsch verstanden oder gar missbraucht wird. Auch darüber schreibe ich hier.
Diakonische Denkansätze und Kompetenzen sind nützlich für unsere vielfältigen Gemeinwesen. Noch mehr, wo es gelingt, im Interesse der Menschen mit Partnern aus Politik, Kultur, Wirtschaft etc. zusammenzuarbeiten. Mir ist wichtig, dass die Diakonie gemeinsam mit anderen nachhaltig zur Verbesserung der Lebensqualität im Land beiträgt und so »Teil der Lösung« der gesellschaftlichen Herausforderungen wird. Ich nenne das »Diakonie mit anderen«. Denn Diakonie leistet schon jetzt einen wichtigen Beitrag dazu, den Zusammenhalt und das Gefühl der Zusammengehörigkeit in einer offenen, vielfältigen und ungleichen Gesellschaft der kontroversen Ansichten und Lebensstile zu verbessern. Davon profitieren alle.
Ich habe beim Verfassen dieses Buches in vielfacher Weise von wertvollen Hinweisen, der redaktionellen Unterstützung und der Zuarbeit meiner Mitarbeiterin Evamaria Bohle profitiert. Dafür danke ich ihr sehr!
Berlin, Juli 2018
Ulrich Lilie
1 Bertolt Brecht, Die Ausnahme und die Regel. Gesammelte Werke, Bd.2, Frankfurt a.M. 1990, Seite 793.
Die unerhörte Gesellschaft
»Rentner first!«
Sehr geehrter Herr Lilie,
wir finden, dass Flüchtlinge dort bleiben sollten, wo sie herkommen. Warum wir dieser Meinung sind? Wir sind Rentner und erhalten nach 46 Jahren Arbeitszeit im Schnitt 1.250 Euro Rente. Netto. Unsere Mieten liegen aber zwischen 900 und 1.000 Euro. Deswegen müssen wir uns alle etwas dazu verdienen, sonst hätten uns unsere Vermieter längst gekündigt.
Ich bin seit über einem Jahr auf der Suche nach einer Sozialwohnung. Und immer, wenn ich dachte: »Jetzt klappt es!« setzt das Wohnungsamt mir irgendwelche Flüchtlinge vor die Nase. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass Flüchtlinge gegenüber deutschen Rentnern bevorzugt werden. Deshalb wird unser Hass auf Flüchtlinge immer größer. Und die Diakonie und andere wollen trotzdem mehr Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Das geht nicht! Bevor weitere Flüchtlinge kommen, müssen erst ein paar Millionen Sozialwohnungen gebaut werden, damit auch deutsche Rentner, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollten, zu günstigen Wohnungen kommen. Erst stehen uns Sozialwohnungen zu und nicht den Flüchtlingen. Rentner first!!!2
»Die hören mir nicht zu.« – Die bunte Gesellschaft der Unerhörten
Verlassen in Deutschland
»Unerhört! Diese Flüchtlinge.« Und: »Unerhört! Diese Obdachlosen.« Viele tausend Großplakate, zunächst in Berlin, und dann auch in anderen deutschen Städten, an Flughäfen und Bahnhöfen. Weiße Schrift auf violettem Grund. Darunter: #zuhören. Das ist im Januar 2018 der Startschuss der auf drei Jahre angelegten Diakonie-Kampagne, mit der wir aufstören und für das Zuhören werben wollen. Das Beispiel der eingangs paraphrasierten Mail zeigt, dass das offenbar gelingt. Solche E-Mails erreichen mich täglich, anonym oder mit vollem Namen unterzeichnet. Ich stelle sie diesem Kapitel voran, weil sie für mich den Kern dessen trifft, was mich im Blick auf unser Land beschäftigt: der gefährdete soziale Zusammenhalt, das schwindende Gefühl von Zugehörigkeit, das oft von einem Gefühl der Verlassenheit begleitet wird. Und die Frage, wie ein sozial gerechteres Miteinander der unterschiedlichen Gruppen, Menschen und Milieus in unserem Land gestaltet werden kann, das den Unterschieden und den Unterschiedlichen gerecht wird.
Als 2015 die »Flüchtlingskrise« ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, arbeitet auch die Diakonie für eine Willkommenskultur. Seitdem ist sie zusammen mit Kommunen, Arbeitsagenturen und anderen Kooperationspartnern im Marathonlauf der Integration engagiert. Wir setzen uns – trotz öffentlichem und politischem Gegenwind – immer noch für den Familiennachzug von engen Familienangehörigen für subsidiär Schutzbedürftige ein. Wir unterstützen die Zuflucht Suchenden bei ihrer Ankunft in unserem Land: in Migrationsberatungsstellen, durch Sprach- und Integrationskurse oder durch andere Beratungsangebote. Wir errichten zusätzliche Kitaplätze und schaffen neuen Wohnraum, nicht nur für Geflüchtete. Dafür wurden und werden wir gewürdigt und gleichzeitig kritisiert. Wie in der Mail eingangs, aber auch in ganz anderer Tonlage: »Flüchtlingsgewinnler« oder »Asylindustrie« schimpfen uns manche. Helfer oder Mitarbeiterinnen der Diakonie werden handgreiflich angegangen, und das, obwohl wir niemals aufgehört haben, uns genauso engagiert auch für all die anderen »Menschen in Notlagen« in Deutschland einzusetzen. Seien es chronisch Kranke in Bochum, alte Menschen mit Pflegebedarf auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern oder junge Erwachsene ohne Schulabschluss in Bremen – mit oder ohne Migrationshintergrund.
Mir geht es hier aber gar nicht darum, irgendein Loblied auf die Diakonie zu singen. Mir geht es um etwas Grundsätzliches: All diese Menschen, die Neuankömmlinge, Kranken, Arbeitslosen oder andere, gehören zu unserer Gesellschaft und wir alle gemeinsam tragen Verantwortung, unser Zusammenleben so zu organisieren, dass alle teilhaben können. Ich jedenfalls will in einer friedlichen, gerechten, freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft leben; und ich will, dass das nicht nur für unsere vier Kinder und deren Kinder eine selbstverständliche und von der breiten Mehrheit der Bevölkerung getragene Leitvorstellung in unserem Land bleibt. Das Fäuste-Recken, die kalte Wut in den Gesichtern mancher Merkel-Kritiker, der blanke Hass in den Äußerungen vieler Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem Kurs der Regierung und unseres Landes, hat viele in den Medien, in der Politik, den Gewerkschaften und auch in der Freien Wohlfahrt oder den Kirchen verstört. Auch mich. Die aggressiven fremdenfeindlichen Debatten, Wahlerfolge wie der Donald Trumps mit seiner polternden »America First«-Politik oder die Zustimmungsraten für die AfD mit ihrem teilweise rechtspopulistischen Personal, aber auch Recep Erdogans despotische Machtentfaltung in der Türkei zeigen, dass öffentliches Eintreten und tägliches Arbeiten für eine offene und sozial gerechte Gesellschaft der Unterschiedlichen wichtiger sind denn je. Das Ausmaß von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, die Verrohung in den sozialen Medien, die groben populistischen Vereinfachungen komplizierter Problemlagen, die nationale Verengung des Denkens sind bestürzend. Nichts von dem hilft die komplexen Herausforderungen der Gegenwart zu bearbeiten, genauso wenig wie der Straßenkampf und die Plünderungen beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. Doch: Wie umgehen mit der Gewalt und den Gewalttätern, dem Populismus und den Populisten?3 Wie umgehen mit den vielen wütenden, enttäuschten Menschen, die mit ihrer Wut genauso zum bunten Deutschland gehören wie fastende Muslime, grillende Hipster, grölende Fußballfans, bibelfeste Evangelikale, feministische Krankenschwestern oder konventionelle Schweinezüchter – um wahllos nur einige zu nennen? Diese Fragen treiben mich um. Ich möchte besser verstehen, woher die Wut und die Ängste dieser Menschen kommen, die Empörung und die Resignation, die ich nicht teile. Warum finden die oft kruden und krausen, rückwärtsgewandten politischen Ideen und Konzepte so viele Freundinnen und Freunde in allen Schichten unserer Gesellschaft? Haben sie Gründe, womöglich gute Gründe für ihre Empörung? Was sehe ich nicht, was sie sehen? Was empfinden sie, was ich nicht empfinde? Ich möchte diese Emotionen ernst nehmen und besser verstehen. Mit dem Soziologen Heinz Bude4 bin ich überzeugt, dass sich »die Wahrnehmung dieser Menschen, ihr Leben sei insgesamt unsicherer geworden (…), nicht mit Wahrscheinlichkeitstheorien wegrationalisieren«5 lässt.
Mich beschäftigt – wie viele andere – auch die zunehmende Schräglage in manchen Debatten zwischen »rechts« und »links«. Auch hier kommt die Mail vom Anfang ins Spiel: Wenn von »Unerhörten«, von den Vergessenen, den Abgehängten geredet wird, wie es in den politischen Debatten, im Streiten um die Werte, die unser Gemeinwesen leiten sollen, zu Recht geschieht, gehören auch wohnungssuchende deutsche Rentner mit Hass auf Flüchtlinge dazu. Ich teile ihre politische Meinung und ihren Hass nicht, aber auch ich finde es schwer erträglich, dass sie unter den Folgen der Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus zu leiden haben.6 Jeder Mensch hat ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum, selbstverständlich ohne Gesinnungs- oder Herkunftsprüfung.
Es gibt in diesem Land offensichtliche Probleme mit Gerechtigkeit, mit gerechter Teilhabe und dem Gefühl, gehört zu werden. Es gibt Probleme mit bezahlbarem Wohnraum, mit ungerechten Zugangschancen zu Bildung und ungleichwertigen Lebensbedingungen, mit abgehängten Stadtteilen und ganzen Regionen, um die sich niemand mehr wirklich kümmert. Und es gibt massive Probleme mit der Art der sich verändernden öffentlichen medialen und politischen Auseinandersetzung, auch wenn es dabei um berechtigte Anliegen wie Zugehörigkeit, Gerechtigkeit und Teilhabe geht.
Wir brauchen keine populistischen Symboldebatten und auch kein Heimatministerium, wir brauchen vielmehr einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch, der auch diesen Rentnern, die 47 Jahre gearbeitet haben, ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt und eine Perspektive. In einem sich grundlegend ändernden Land in einem kriselnden Europa in einer sich grundlegend verändernden Welt mit einer dramatischen Ungleichheit und einer ökologischen Jahrhundertherausforderung brauchen wir dringend ein neues politisches und gesellschaftliches Klima, das auch diese Rentner mitgestalten können und wollen. Und wir brauchen endlich eine Politik, die ihrer Lebenssituation tatsächlich Rechnung trägt. Wir brauchen Volksparteien, Wohlfahrtsverbände und Kirchen, die in die chancenreichen, aber derzeit vernachlässigten Stadtviertel, Dörfer und Landstriche zurückkehren: an die Orte, in denen nicht nur die öffentlichen Briefkästen, sondern oft die gesamte soziale Infrastruktur verschwunden ist.
Ein solcher gemeinsamer Aufbruch von Zivilgesellschaft und Politik beginnt, und damit sind wir bei der Idee der Unerhört-Kampagne der Diakonie, zuallererst mit qualifiziertem Zuhören, mit Verstehen-Wollen, mit echtem Interesse an der Lebenslage der anderen. Es gibt viel zu viele Unerhörte in unserer Gesellschaft: Menschen, die zunehmend ein Gefühl von Verlassenheit beschleicht, das Gefühl, dass ihnen und ihren Ängsten niemand Aufmerksamkeit schenkt. Menschen, die zu Recht den Eindruck gewonnen haben und täglich die Erfahrung machen, dass ihre Interessen, ihre berechtigten Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Wohlstand nicht gesehen werden oder bedroht erscheinen. Und die mit ihren Lebensentwürfen in den gesellschaftsbegleitenden und -formenden Diskursen in den Medien und der Politik, und eben auch in unseren Kirchengemeinden oder den Sportvereinen nicht oder zu wenig vorkommen. Über die allenfalls in schlauen Kommentaren geschrieben wird, mit denen aber nicht oder viel zu wenig gesprochen wird. Zu Recht erleben diese Menschen diese permanente Nichtbeachtung als Abwertung ihrer Biografie, ihrer Lebensleistung.
Solche Menschen finden sich nicht nur unter Obdachlosen, Flüchtlingen, Hartz-IV-Empfängerinnen oder anderen Menschen in Notlagen, die von Diakonie und anderen Wohlfahrtsverbänden begleitet und unterstützt werden. Sie finden sich zunehmend – eine schwer zu akzeptierende Einsicht – in allen Schichten der Gesellschaft. Schwer zu akzeptieren, weil diese Haltung auf den ersten Blick leicht wehleidig wirken kann und in einem der reichsten Länder der Welt als eine weitere Spielart der »German Angst« oder als »Jammern auf hohem Niveau« erscheint. Der Eindruck »Die hören uns nicht zu« ist aber der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich gegenwärtig viele sehr unterschiedliche Leute verständigen können, die sonst keine Gemeinsamkeiten aneinander entdecken. »Die hören uns nicht zu« – das ist ein zu weit verbreitetes Gefühl in diesem Land, obwohl Massenmedien, Internet und Soziale Medien uns in nie gekannter Weise mit persönlich zugeschnittenen Nachrichten, personalisierter Werbung und Teilnahmemöglichkeiten überschütten.
Die Gefühle der Verunsicherung und des Ausgeschlossenseins verbreitern sich von den »Rändern« bis tief in die Mitte unserer Gesellschaft und verbinden sich mit tatsächlichen kulturellen, sozialen und ökonomischen Disparitäten. Das ist ein echtes Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Oder weniger hochtrabend: Es ist ein zunehmendes Problem für ein friedliches Miteinander und für die konkrete Nachbarschaft von Menschen ganz unterschiedlicher Bildung, Meinung, Gesundheit, Sprache, Weltanschauung, von unterschiedlichem Geschlecht und Alter in unserem Land. Das ist eine krisenhafte Gemengelage für die vielgesichtige Gemeinschaft in den deutschen Städten und Dörfern im Herzen eines sich rapide wandelnden Europas in einer Welt, die »im Zeitalter der Nebenfolgen«7 vor gewaltigen (Menschheits)-Problemen steht. Die Situation ist komplex, einfache Lösungen gibt es nicht, und wer sie verspricht, ist so vertrauenswürdig wie ein Hirnchirurg, der sich mit einer Axt ans Werk macht.
Relativ arm im reichen Deutschland
Ortswechsel: Der Mann sieht gar nicht »arm« aus, er trägt sogar einen Anzug. Es ist Dienstagvormittag, wir stehen nebeneinander in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche. Und er erzählt mir von seinen früheren Schwierigkeiten, mit Menschen wie mir überhaupt ins Gespräch zu kommen. »Leute wie Sie sprechen einfach eine andere Sprache«, erklärt er mir. »Früher hätte ich mich gar nicht getraut, einen wie Sie direkt anzusprechen.« Für Politiker gelte das auch: »Ihr kommt alle aus einer anderen Welt.« Er nimmt einen Schluck Kaffee und ergänzt lächelnd: »Ist für mich wie Fremdsprachen lernen.« Heute könne er, wenn die Sozialministerin komme, so reden, dass sie ihn verstehe, und auch er verstehe mehr von dem, womit sie sich beschäftige: »Viele von uns jammern und schimpfen ja nur.« Das reiche nicht, wenn es zum Beispiel um eine gerechtere Rentenpolitik ginge. Er macht eine Geste in den Raum: »Hier habe ich gelernt, so zu reden, dass Sie mir zuhören.«
»Hier« ist das »12. Treffen der Menschen mit Armutserfahrungen«, die die Nationale Armutskonferenz (NAK)8 seit 2006 jährlich in unterschiedlichen Städten veranstaltet. Mein Gesprächspartner besucht dieses Treffen regelmäßig: Hier tauscht er sich mit anderen Betroffenen aus, pflegt Kontakte, vernetzt sich und lernt reden, argumentieren und – zuhören.
Aus dem gleichen Grund bin auch ich hier, um zuzuhören; um Menschen zu treffen, mit denen ich derzeit meist nur indirekt zu tun habe – weil sie in den Gremiensitzungen, Konferenzen und Gesprächsrunden nicht vorkommen, in denen ich berufsbedingt viel sitze.
»Die Armen«, für deren Interessen sich die NAK einsetzt, sind eine große Gruppe von Menschen, über die in unseren öffentlichen Diskursen zwar oft kontrovers gestritten wird, mit denen aber kaum jemand wirklich mehr spricht. Armut in Deutschland hat sehr viele Gesichter. Die sozialen Wirklichkeiten in Stadt und Land, im Osten und Westen, Norden und Süden der Bundesrepublik unterscheiden sich gravierend. Mitunter fährt man nur wenige Kilometer oder spaziert in einer Stadt nur von einem Stadtteil in den anderen und hat schon sehr konkret vor Augen, wie unterschiedlich die Bedingungen sind, unter denen sehr verschiedene Menschen – oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt – bei uns leben. Obwohl unsere Volkswirtschaft zu den prosperierenden der Welt gehört und aus der Perspektive des Südsudans etwa nahezu jeder Deutsche als unfassbar reich erscheinen muss.





























