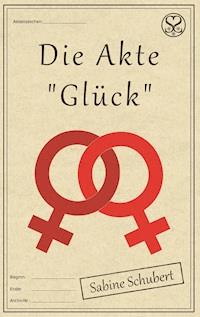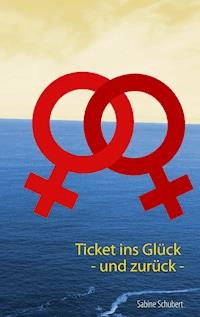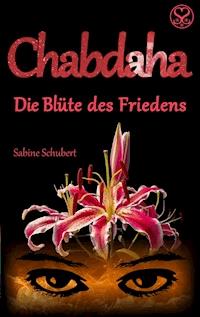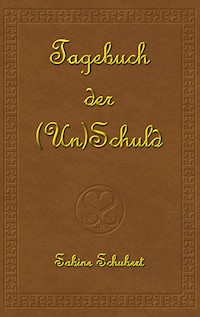Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich bin eine Spießerin. Pläne, Ordnung und Sauberkeit gehören ebenso zu mir wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Dafür bezahle ich mit Freiheit und ausgelassenem Spaß, denn das sehen Zeitpläne nicht vor. Ich dachte immer, so bin ich eben und muss mich mit der Einsamkeit abfinden, solange sich kein Mann als Ergänzung für mein Leben findet, der meine Sorgfalt mit mir teilt. Und dann kommt Juliana. Unpünktlich, unordentlich, chaotisch und auffällig. Alles, was ich ablehne, vereint sie in sich. Aber sie ergänzt das Negative mit dem, was ich ersehne: Lebensfreude, Spontanität und Albernheit. Und sie reizt mich auf eine Weise, auf die ich von keiner Frau gereizt werden möchte. Anders zu sein, abnormal zu sein, sehen meine Pläne nämlich auch nicht vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erinnerungen
Wendung
Chaos
Er & Sie & Ich
Entscheidungen
Erinnerungen
Meine Mutter sagte mal zu mir: „Folge deinem Herzen nur so weit, wie es dein Verstand ertragen kann.“
Dieser Satz verfolgt mich seit meinem ersten Schwarm. Er war ein Idiot, aber solche Geschichten kann wohl jeder zum Besten geben. Ich war damals Zwölf und verliebt bis über beide Ohren. In meinen Träumen läuteten schon die Hochzeitsglocken, ich sah ein kleines Häuschen mit weißem Gartenzaun und eine Kinderschar. Wie sollte es anders sein ... Es betraf den Schwarm der ganzen Schule. Alle Mädchen aus meiner Klasse waren hinter ihm her. Aber wie die Jungen in dem Alter eben sind, er hasste alle Mädchen und wollte nichts mit mir zu schaffen haben. Nicht mal den Schulweg mochte er mit mir gehen, dabei wohnte er nur zwei Häuser weiter.
Na ja, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wem nicht wenigstens einmal das Herz bricht, der hat keines. Ich war damals am Boden zerstört und glaubte, die Welt würde untergehen. Ich traute mich kaum noch in die Schule. Alle wussten von dem Liebesbrief, den ich ihm geschrieben hatte. Er hatte es allen vorgelesen und mich die ganze Klasse ausgelacht. Und trotz Betteln und Flehen schickten mich meine Eltern selbstverständlich in die Schule. Ich habe an dem Morgen tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ganz weit und für immer wegzulaufen. Aber der Satz zum Abschied, den mir meine Mutter mit auf den Weg gegeben hat, hallte mit ihrer sanften Stimme immer wieder durch meinen Kopf. An dem Tag, an dem ich den Brief geschrieben habe, war mein Herz eindeutig stärker als mein Verstand. Der Kerl hatte mir deutlich genug gesagt, dass er kein Interesse hatte. Hätte ich mein Hirn benutzt, dann hätte ich gewusst, dass ein Brief rein gar nichts daran ändern würde. Na ja, eine der vielen Erfahrungen, die uns zu dem machen, was wir sind.
Heute bin ich Zweiunddreißig und stehe kurz vor einem Wiedersehen mit eben diesem Jungen. Vor zwei Monaten kam eine Einladung zum Klassentreffen ins Haus geflattert. Ich weiß zwar nicht, ob Thomas überhaupt kommt, aber ich freue mich, ihn und die anderen wiederzusehen. Vor zwanzig Jahren habe ich ein oder zwei Tage Spott ertragen müssen und viel geweint, dann war es vergessen und der Nächste stand im spöttischen Rampenlicht. Ich habe nie wieder einen solchen Brief geschrieben.
Vermutlich ist das der Grund, warum niemand zu Hause auf mich wartet. Mit Beuteln beladen komme ich von der Arbeit heim in eine stille und kalte Wohnung. Nirgends brennt Licht, niemand hat die Heizung für den Abend aufgedreht. Nur Henry ist da und maunzt um meine Beine herum. Ich frage mich, wieso er nicht warten kann, bis ich mich ausgezogen und die Einkäufe abgestellt habe. In umgekehrter Reihenfolge natürlich. Zuerst stelle ich die Einkäufe ab, dann ziehe ich die dicke Jacke aus und schenke Henry ein flüchtiges Streicheln.
„Ja, mein Kleiner. Ich bin ja wieder da.“
Ich rede mit ihm, damit ich vor mir selbst rechtfertigen kann, dass ich keine Selbstgespräche führe. Das wäre erbärmlich.
Es ist Freitag, das heißt, es gibt einen besonderen Einkauf. Auf dem Weg vom Büro nach Hause komme ich am Wochenmarkt vorbei. Ortsansässige Bauern verkaufen ihr Gemüse, Fleisch, Eier und so weiter. Mit drei überquellenden Beuteln muss ich mir wieder etwas einfallen lassen, wo ich das alles verstauen soll. Wie jede Woche habe ich mehr gekauft, als ich überhaupt unterbringen kann. Die Eier und die frische Milch wandern mit dem Fleisch und der Wurst in den Kühlschrank, aber dann ... Ich habe eindeutig zu viel Gemüse gekauft. Das meiste Obst kann ich in der schönen Schale drapieren, die meine Großmutter mir gekauft hat.
Diese Frau ist unverbesserlich. Da mache ich mir mit ihr einen schönen Tag in der Stadt, weil ich ihr eine Freude machen will, und sie kauft mir die teuerste Schale, die man sich vorstellen kann. Wir bummelten gemütlich durch die Innenstadt, haben die Schaufenster bewundert und waren in dem ein oder anderen Laden drin. Zum Mittag habe ich sie in ihr Lieblingsrestaurant eingeladen und zum Kaffee lud sie mich zu Kuchen ein. In einem der vielen Schaufenster an diesem Tag habe ich eine wunderschöne Glasschale gesehen. Sie war nicht einfach rund und durchsichtig, sondern blau eingefärbt. Das Blau zog sich in Schleiern durch das Glas, als hätte man Lebensmittelfarbe in einen plätschernden Gebirgsbach gegossen. Die Form ist schwer zu beschreiben. Am besten drückt es das Wort unförmig aus. Der Rand endet rundherum in unregelmäßigen, tropfenförmigen Auswölbungen. Ich fand sie damals wunderschön und finde sie noch heute traumhaft.
Bei dem Stadtbummel habe ich zu meiner Oma gesagt, ich würde nie in meinem Leben über dreihundert Euro für eine Schale bezahlen! Da kann sie noch so schön sein! Und einen Monat später bekam ich sie von meiner Oma zum Geburtstag. Ich wäre beinahe umgekippt! Ich musste ihr versprechen, sie nicht verstauben zu lassen. Ich soll sie benutzen, auch auf die Gefahr hin, dass sie kaputtgeht, und jedes Mal an meine Oma denken. Seither steht sie auf dem Tresen, der die offene Küche vom Wohnzimmer trennt. Und jeden Freitag landet das Obst darin und ich denke bei jeder Kirsche, jeder Weinbeere, jedem Apfel an meine Oma.
Heute weiß ich, dass sie damals die Krebsdiagnose schon hatte. Drei Monate nach meinem Geburtstag starb sie. Überraschend für meine Mutter und mich, weil meine Oma niemandem davon erzählt hat. Ihr Arzt hatte uns dann nach ihrem Tod aufgeklärt.
„Ach Omi.“, seufze ich leise, als ich mir gleich eine Pflaume nehme. Sie hat die Schale noch hier stehen sehen, das beruhigt mich irgendwie. Ich hatte sie zum Kaffee in meine Wohnung eingeladen und da es Samstag war, war die Schale prall mit Obst gefüllt gewesen. Sie hat sich wahnsinnig darüber gefreut und gesagt, ich sei ihr jeden Cent wert. Und jetzt, drei Jahre später, finde ich die Schale noch genauso schön wie damals im Schaufenster.
Neben der Schale habe ich die Post abgelegt. Als die Einkäufe mehr oder weniger gut verstaut sind, kann ich mir die Briefe vornehmen. Henry erinnert mich daran, dass die Post warten muss.
„Ist ja gut.“, lache ich und hebe ihn hinauf in meine Arme. Er schmiegt sich in meine Umarmung, als wüsste er, dass ich genau das jetzt brauche. Die Nähe zu einem Lebewesen, das mir etwas bedeutet.
„Du hast Hunger, was?“
Und da ich meinen Kater liebe, kann ich das natürlich nicht zulassen und gebe ihm sein Futter. Auch mein Magen sagt, es ist an der Zeit, etwas zu essen. Gemüse hab ich ja genug, also ist es die perfekte Zeit für eine Gemüse-Quiche. Positiver Nebeneffekt: Ich habe wieder Platz in meinen Schalen.
Zum Essen sitze ich meistens am Couchtisch, der Fernseher dudelt im Hintergrund, der Laptop vor mir wartet darauf, ob ich ihn brauche, und ich öffne die Post des Tages. Henry liegt neben mir auf der Couch. Statt auf seinem Kissen, das ich ihm extra gekauft habe, liegt er neben mir, ganz dicht an meinem Bein, und putzt sich.
Mir wird mal wieder bewusst, wie alt ich bin. Das Klassentreffen ist morgen, da kommen Erinnerungen auf. Erinnerungen an meine Pläne und Träume von früher. Erreicht habe ich nicht viel. Immer noch Single, immer noch Mieter einer Wohnung und zu alt, um noch auf viel zu hoffen. Woher sollte auch jemand kommen? Meine einzigen sozialen Kontakte beschränken sich auf meine Arbeit und sporadischen Kontakt zu Freunden in sozialen Netzwerken. Heute hab ich mal wieder eine Nachricht von einer Freundin, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Seit zwei Jahren schreiben wir uns in langen Abständen. Ich habe keine Lust, ihr zu schreiben, dass es nichts zu schreiben gibt. Was passiert denn in meinem Leben? Ich stehe auf, gehe zur Arbeit, komme heim, schlafe allein und fahre dann wieder zur Arbeit. Mehr hat mein Leben offenbar nicht vorgesehen.
Ich bin hundemüde und beende nach dem Essen meinen Tag. Schnell duschen und die Tasche für morgen packen, das muss genügen. Innerhalb von fünf Minuten bin ich eingeschlafen, als hätte ich einen besonders anstrengenden Tag hinter mir, dabei war es ein ganz normaler Arbeitstag.
Ich fühle eine Müdigkeit in mir, die eher auf eine Achtzigjährige deuten lässt. Die kleinsten Anstrengungen sind mir zu viel. Es fühlt sich an, als hätte ich keine Kraft mehr. Meine Arbeit macht mir Spaß, aber sie schafft mich auch. Mehr als früher. Ich muss einsehen, ich fühle mich alt. Nicht so alt wie kurz vor der Rente, wenn Gevatter Tod schon in Sichtweite rückt. Eher wie betäubt. Der immer gleiche Ablauf und die Ödnis in meinem Leben lähmen mich. Ich finde nicht mal genug Kraft in mir, um am Wochenende auszugehen. Es ruft mich nicht wie in der Jugend in die Diskothek, sondern in eine Bar zu einem gemütlichen Drink, vielleicht ein Konzert oder irgendwas. Immer mal wieder sehe ich Anzeigen oder Werbetafeln, bei denen ich denke, da könnte ich mal hingehen. Es würde mir sicher gefallen, aber wenn es dann so weit ist, entscheide ich mich doch dagegen und gehe früh schlafen.
Meine Samstage verbringe ich mit Haushalt, was eben sein muss, und die Sonntage meist mit Nichts auf der Couch. Ein Buch, der Fernseher, eine DVD – das ist alles, was ich in meiner freien Zeit zustande bringe.
Wann hatte ich das letzte Mal Urlaub? Ist gar nicht so lange her, aber weggefahren bin ich nicht. Wohin auch? Allein! Ich war zu Hause, hab es immerhin mal bis in den Park zur Eisdiele geschafft, das war dann der Höhepunkt. Ich habe einfach nichts, worauf ich mich freuen könnte. Niemand, der mich erwarten und im Herzen nach Hause rufen würde, aber auch niemanden, der mit mir die Freuden des Lebens genießt. Meine Kleidung und alles, was sonst noch nötig ist, bestelle ich im Internet. Neben den Lebensmitteln, Toilettenpapier und Waschmittel kaufe ich nichts mehr im Laden. Das heißt, meine letzte Shoppingtour dürfte einige Jahre her sein. Und wieso? Weil ich mir blöd vorkomme, allein loszugehen.
Das Gute ist, dass ich tief und fest schlafe. Und lange.
Dass mein Wecker zum Samstagmorgen schon um acht Uhr klingelt, ist wirklich eine Seltenheit. Wieso zeitig aufstehen, wenn nichts und niemand auf einen wartet? Das macht es schwer, wenn dann doch mal etwas ansteht.
Wie ich befürchtet hatte, löst das metallische Rasseln des zweiten Weckers in mir den Wunsch aus, das Klassentreffen sausen zu lassen. Ich hätte nichts dagegen, den Wecker auszumachen, mich umzudrehen und weiterzuschlafen bis zum Montagmorgen.
Aber!!! Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, genau das nicht zuzulassen!
Mein erster Wecker spielt eine leise und süße Melodie. Die baue ich manchmal unbewusst in meine Träume ein und wache nicht auf davon, deshalb war ein zweiter Wecker unumgänglich, der so penetrant und laut klingelt, dass ich auf jeden Fall davon wach werde. Henry mag den überhaupt nicht und faucht jedes Mal beim ersten Ton. Schiebe ich dann den Kopf unters Kissen und versuche, das Rasseln zu überhören, klettert Henry auf mir herum, bis ich wach bin und den Wecker ausstelle. Bisher hat das immer wunderbar funktioniert. So auch an diesem Samstag, der mich aus meiner Einsiedelei befreien soll. Wenigstens mal für ein Wochenende.
Ein gutes Frühstück besteht für mich aus zwei Tassen Kaffee, einem Glas Fruchtsaft und der Zeitung. Marcus, der Junge aus der Wohnung nebenan, muss seinen Eltern am Wochenende immer die Zeitung hochholen und bringt meine gleich mit. Sie liegt vor meiner Wohnungstür auf der Fußmatte. Dafür helfe ich ihm, wenn er in der Schule Schwierigkeiten hat. Seit er neben mir wohnt, hat sich sein Notendurchschnitt von Vier, Tendenz zur Fünf, auf eine gute Drei verbessert. Da geht noch mehr, das weiß ich, aber es ist besser, langsam aufzuarbeiten, damit er es versteht und verinnerlicht. Das sieht auch seine Mutter ein und wollte mir Geld für die Nachhilfe andrehen. Ich habe damals abgelehnt und werde immer wieder ablehnen. Samstagnachmittags gehöre ich Marcus – der einzige soziale Kontakt abseits des Büros. Außer diese Woche, denn da bin ich schon weg.
Zumindest habe ich vor, dann schon weg zu sein, aber wenn ich nicht bald fertigwerde, verpasse ich meinen Zug.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass das absoluter Unsinn ist. Mein Zug fährt zehn Minuten nach zehn Uhr. Von meiner Wohnung zur Straßenbahn sind es fünf Minuten. Die Straßenbahn fährt zehn Minuten bis zum Bahnhof. Zwischen Straßenbahn und Bahnhof liegen auch nur knapp fünf Minuten Fußweg. Daraus ergibt sich für mich, dass ich spätestens neun Uhr die Tür meiner Wohnung verschließe. Eigentlich bin ich gut in Mathematik und im allgemeinen Umgang mit Zahlen. Aber wenn ich irgendwohin will, dann runde ich sehr großzügig. Rund zehn Uhr fährt der Zug (zehn Minuten zur Sicherheit), eine Viertelstunde bis zur Straßenbahn (zehn Minuten zur Sicherheit), eine Viertelstunde Fahrt (fünf Minuten zur Sicherheit), eine Viertelstunde Fußweg zum Bahnhof (noch mal zehn Minuten zur Sicherheit). Und dann noch eine Viertelstunde als offizielle Sicherheit, falls die Straßenbahn ausfällt oder Verspätung hat oder ich noch mal auf Toilette muss oder oder oder. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Da nehme ich lieber in Kauf, auf dem Bahnhof eine dreiviertel Stunde rumzustehen und einen Kaffee im Pappbecher zu trinken.
Es ist kalt. Sehr kalt. Der März zeigt seine winterliche Seite. Auf den langen Bahnsteigen pfeift der eisige Wind und treibt die Menschen ins Innere des Bahnhofgebäudes. Oder in ihre Betten. Meines ruft mit kuscheligen Federkissen nach mir. Aber nun stehe ich einmal hier, die Fahrkarte ist bezahlt und ich habe keine Lust, im Nachhinein zu sagen, ich sei umsonst – für gar nichts – überhaupt erst mal aufgestanden.
Der Zug fährt knapp zehn Minuten vor der geplanten Abfahrt ein. Die Strecke endet hier und der Zug fährt wieder zurück. Das heißt, alle Fahrgäste steigen an dieser Stelle aus, sonst würden sie ja wieder zu ihrem Startpunkt zurückfahren. Da zeigt sich dann, wie dämlich die Menschheit doch sein kann. Die neuen Passagiere drängen sich an den Türen des Zugs und lassen den Aussteigenden keine Möglichkeit, den Zug zu verlassen und sich von der Tür zu entfernen. Was für ein Unsinn. Würden die alle etwas mehr Platz lassen, würde das Aussteigen schneller gehen und demzufolge könnten wir auch eher einsteigen. Na ja, ich beobachte es, schüttele den Kopf und versuche, es zu ignorieren und zu vergessen. Ich bin nicht in der Stellung, irgendetwas an diesem Irrsinn zu ändern.
Ich selbst gebe mich dem Gedränge aber nicht hin. Gemütlich stehe ich abseits der Türen, schlürfe den letzten Rest Kaffee aus meinem Becher und werfe ihn weg. Erst wenn alle anderen Fahrgäste eingestiegen sind, steige ich in Ruhe nach. Dann habe ich immer noch genügend Zeit, meinen Platz zu suchen und mich hinzusetzen, ehe die Fahrt beginnt.
Ich reserviere generell einen Sitzplatz, wenn ich längere Strecken zurücklegen möchte. Die Gefahr, drei oder vier Stunden stehen zu müssen, ist mir einfach zu hoch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann hoffe ich jedes Mal aufs Neue, dass sich jemand auf meinen reservierten Platz gesetzt hat. Die Reservierungen stehen ja an den Sitzen, damit genau das eben nicht passiert, aber über die Dummheit vieler Menschen rege ich mich nicht mehr auf. Ich versuche es wenigstens. Außerdem werden die Reservierungen der neuen Strecke erst aufgezeigt, während der Zug schon im Bahnhof steht und die Meute sich in die Abteile drängt. Wer also zu hastig einsteigt, übersieht die Reservierungen. Als ich den langen Gang entlanglaufe und meine Platznummer suche, leuchten die Reservierungen bereits auf.
Meistens klappt es. Auf meinem Platz sitzt ein Mann, um die Fünfzig, und daneben vermutlich seine Frau. Sie richten sich gerade ein, die Jacken hängen schon an den Haken, die Frau packt ein Buch aus, der Mann ein Handy und eine kleine Flasche Wasser. Ich bleibe neben ihnen stehen, prüfe noch einmal gemächlich die Platznummer und setze dann ein äußerlich freundliches Lächeln auf. Innerlich ist es ein Triumph für mich, denn diese beiden standen ganz vorn an der Tür und sind schon eingestiegen, während noch nicht mal alle Fahrgäste ausgestiegen waren. Hätten die sich dazu hinreißen lassen, das Einsteigen mit Geduld und Rücksicht ablaufen zu lassen, hätten sie die Reservierung gesehen.
„Entschuldigung?“, bitte ich und die beiden sehen zu mir auf. Ich zeige direkt auf den Mann am Fenster. „Diesen Platz habe ich reserviert.“
„Da steht nichts dran.“, bekomme ich nur knapp zur Antwort und freue mich, ihm widersprechen zu dürfen.
„Doch. Reserviert.“ Mein Finger tippt genau an die leuchtende Schrift, die mich bestätigt. Das kann der Mann natürlich nicht sehen.
„Alles andere ist voll.“, stellt die Frau erschrocken fest.
„Genau deshalb habe ich reserviert.“ Mir war von vornherein bewusst, dass zum Samstagvormittag der Zug überfüllt sein würde. Wer unbedingt sitzen will, wird sich die Reservierung erlauben müssen.
Gerade schiebt sich aus der anderen Richtung eine Frau durch den Gang. Wenn die jetzt gleich hier an mir vorbei will, werde ich mich vermutlich auf den Schoß des alten Mannes auf der anderen Seite des schmalen Ganges setzen müssen, um sie durchzulassen.
Auch die Fremde sucht an den Sitzzahlen, also hat sie ebenso reserviert, denke ich mir. Es dauert nur noch wenige Sekunden, während ich warte, dass mein Platz geräumt wird, da ist die Fremde auch schon bei mir. Sie ignoriert mich allerdings und funkelt die Frau auf dem Sitz neben meinem herausfordernd an.
„Sie sitzen auf meinem Platz.“, stellt sie fest. Nicht barsch oder kaltherzig, aber entschlossen. Ich hatte einen überfreundlichen Ton angeschlagen, um meinen Triumph auszukosten. Die Fremde macht das etwas anders und bekommt prompt die Retourkutsche.
„Wir sind ja schon dabei!“, raunzt der Mann auf meinem Platz. Die beiden müssen erst mal alles wieder einpacken.
Als sie es endlich geschafft haben, prüft der Mann noch mal, ob die Plätze wirklich reserviert sind, doch die Leuchtschrift der Anzeigetafel bestätigt uns. Murrend und fluchend ziehen sie von dannen und ich kann es nicht vermeiden, mir liegt ein Grinsen auf den Lippen. Jetzt, da alle Passagiere eingestiegen sind und der Zug just in diesem Moment losfährt, dürfte es schwer werden, überhaupt noch Sitzplätze zu finden. Zwei nebeneinander wären ein Wunder.
Die Fremde, die da eben gekommen ist, wirft ihre Umhängetasche auf die Ablage über den Sitzen und will sich setzen, doch ich halte sie auf.
„Darf ich?“, bitte ich immer noch sehr freundlich. „Ich habe den Fensterplatz reserviert.“
„Den will ich ihnen auch nicht streitig machen.“, lächelt sie und klingt auf einmal gar nicht mehr so herausfordernd. Es ist ein freundliches und herzliches Lächeln. Sie drängelt auch nicht, als ich erst noch meine Jacke ausziehe, bevor ich mich in die engen Sitze schiebe.
Ehe sie dann ebenfalls endlich sitzt, wir alles gerichtet haben und uns entspannt zurücklehnen, haben wir das weitläufige Bahnhofsgelände mit den dutzenden parallelen Schienenpaaren schon beinahe verlassen.
„Ach ja ...“, seufzt sie genüsslich. „Wie schön es ist, auf so langen Strecken sitzen zu können.“
Ohne es zu wollen, steigt mir ein leises Glucksen aus der Kehle. „Sehr angenehm.“, bestätige ich amüsiert. Sie hat den Sieg offenbar genauso genossen wie ich, nur auf einem anderen Weg.
Mit einem zauberhaft niedlichen Lächeln reicht sie mir die Hand. „Juliana.“
„Marlene.“, erwidere ich gern. Was sich meine Eltern bei dem Namen gedacht haben, weiß ich nicht. Man spricht bei vollem Namen das letzte E nicht mit. Die meisten nennen mich allerdings Lene oder Lenchen. Und ganz viele eben auch mit vollem Namen inklusive dem letzten E. Nur meine Mutter nennt mich Marle. Ich hasse es, weil es klingt wie eine Partnerin für Henry. Aber na ja, was soll ich machen? Bei neuen Bekanntschaften, wie Juliana, stelle ich mich wenigstens mit der richtigen Aussprache vor und hoffe, sie merken es sich, solange es von Bedeutung ist. Am Ende dieser Zugfahrt ist es für Juliana sowieso egal.
In meiner Handtasche finde ich neben dem allgemein nötigen Inhalt jeder Frauenhandtasche, auch ein Buch. Ich habe vor, dreieinhalb Stunden im Zug zu sitzen, da gehört ein Buch für mich dazu. Und auch heute Abend, wenn ich allein im Hotel sitze, habe ich die Möglichkeit, mir eine Flasche Wein aufzumachen und gemütlich das Buch zu lesen, falls sich keine bessere Alternative bietet.
Ich hätte mir das zusätzliche Gewicht sparen können. Juliana packt eine Tüte Gummibärchen aus und bietet mir eines an. Ich greife gern zu und ehe ich es mich versehe, stecken wir in einer gemütlichen Unterhaltung. Angefangen hat es mit der gestörten Platzreservierung, gefolgt von Gummibärchen und dann ... Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Als wir dreieinhalb Stunden später anfangen, unsere Sachen zusammenzupacken, haben wir die Sinnlosigkeit von Monarchien ebenso gestreift wie die Interpretationen von Kandinskys Bildern und Megabauten wie den Eiffelturm oder die Freiheitsstatue. Warum? Wieso? Woher? Ich werde nie in der Lage sein, es zu beantworten, so sehr ich auch darüber nachdenke. Unterm Strich ist es auch egal, denn eines weiß ich mit absoluter Sicherheit: Ich habe die Fahrt in vollen Zügen genossen. Keine Ahnung, ob es an Juliana selbst liegt oder an der Tatsache, dass sie der erste persönliche Kontakt abseits der Arbeit seit einigen Wochen ist. Letztendlich ist es mir völlig egal. Ich habe viel gelacht während der letzten Stunden und werde mit bombastisch guter Laune zu dem Klassentreffen kommen.
In der Einladung steht, wir werden in einem Hotel erwartet. Im großen Saal findet am frühen Abend das Klassentreffen statt. Es hat aber niemand etwas gegen Gespräche vor diesem Zeitpunkt.
In der Rückmeldung, mit der ich mein Kommen bestätigte, habe ich auch um ein Zimmer im Hotel gebeten. Da der ganze Jahrgang anreisen soll, bekommen wir Vorzugspreise. Antje, eine ehemalige Klassenkameradin von mir, hat sich um alles gekümmert und die Preise mit dem Hotel ausgehandelt. Das Angebot dazu steht mit in der Einladung. Ich weiß jetzt schon, dass ich so spät keine Lust habe, mich noch mal über drei Stunden in den Zug zu setzen, daher habe ich um das Zimmer gebeten und es wurde eines auf meinen Namen reserviert.
Antje hat uns in ein sehr schönes Hotel mitten im Harz eingeladen. Nach der angenehmen Zugfahrt fahre ich noch ein Stück mit einer kleinen Eisenbahn, dann wartet schon ein großes Auto auf mich. Ein Angestellter des Hotels holt die Gäste ab, die mit diesem Zug ankommen. Er hält ein großes Schild über seinen Kopf, auf dem der Name des Hotels steht. Kein handgeschriebenes Papierplakat, es ist ein festes Schild, auf dem auch das Logo des Hotels zu sehen ist.
„Guten Tag.“, lächelt der Mann, nimmt mir die große Tasche ab und packt sie in den Kofferraum. „Es fehlt noch ein Gast. Wir müssen noch einen Moment warten.“
„Kein Problem.“, erwidere ich sofort. Es ist nachvollziehbar, dass das Hotel nicht jeden Gast einzeln vom Bahnhof abholen lässt. Die paar Minuten werde ich verschmerzen und trotzdem nicht zu spät kommen.
Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, um wen es sich bei dem Gast handelt, auf den wir warten. Ich kann nur vermuten, dass es jemand aus meiner Vergangenheit ist. Wenn der ganze Jahrgang in dem Hotel absteigt, dürfte nicht mehr viel Platz für andere Gäste bleiben. Und dass die dann ausgerechnet mit dem gleichen Zug wie ich ankommen, ist doch eher unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, aber auch nicht realistisch.
Ich behalte Recht. Von ganz hinten auf dem Bahnsteig hält ein Mann auf uns zu. Christoph. Um Haaresbreite wäre mir die Kinnlade runtergeklappt. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er einen Kopf kleiner als ich, dafür doppelt so breit. Er hatte extreme Akne und ein Doppelkinn. Seine Haare waren immer fettig, selbst direkt nach dem Duschen. Fünfzehn Jahre später ist er zwanzig Zentimeter größer als ich, sportlich gebaut, hat makellos reine Haut und seidig glänzendes, sehr ordentlich gelegtes Haar. An seinem lecker anmutenden Körper hängt ein teurer Anzug und in seinen Händen hält er einen ledernen Aktenkoffer und einen Reisekoffer.
Meine Güte, sieht der gut aus, denke ich so bei mir.
Ich erkenne ihn dennoch einwandfrei. Zweifellos kann ich sagen, dass das der Christoph ist, der mich früher immer schmachtend beobachtet hat, denn eines hat er behalten: die süße Stupsnase. Früher war sie von Pickeln übersät, heute sieht sie einfach niedlich aus.
„Lene!“, strahlt er mir entgegen und breitet die Arme aus. Er kommt direkt auf mich zu und ich habe mich zum Glück schnell genug wieder unter Kontrolle, dass ich die Einladung lachend annehmen kann.
„Meine Güte, du siehst klasse aus.“, kann ich mir aber nicht verkneifen. Es rollte über meine Zunge, ehe ich über eventuelle Konsequenzen auch nur nachdenken kann.
Rosa Flecken malen sich auf seine Wangen und für einen Moment schlägt er die Augen nieder. „Danke. In den Sommerferien damals hab ich so viel abgenommen, dass ich in der neuen Schule keine Probleme mehr hatte. Und daran habe ich festgehalten.“
In unserer Schulzeit war er immer gehänselt worden. Logisch irgendwie und trotzdem nicht schön. Ich habe mit ihm auch nicht viel zu tun gehabt, aber geärgert hab ich ihn nie. In den letzten Sommerferien vorm Abitur war sein Vater in eine andere Stadt versetzt worden und Christoph natürlich mit ihm und seiner Mutter gezogen. Der Wechsel hat ihm offenbar gutgetan.
Er übergibt den einen Koffer dem Mann vom Hotel und nimmt den Aktenkoffer auf den Schoß, genau wie ich meine Handtasche. Christoph bleibt offenbar ebenso über Nacht.
Ich setze mich hinten im Auto neben ihn und strenge mich an, ihn nicht anzustarren. Vor meinem geistigen Auge setzt sich das Bild des dicken, pickligen Jungen daneben und ich kann partout nicht begreifen, dass das ein und dieselbe Person sein soll.
„Erzähl.“, fordert er aufgeregt. „Was hast du gemacht?“
Wie oft ich diese Frage wohl noch beantworten würde? Worüber redet man sonst bei einem Klassentreffen?
„Ich hab Finanzwirtschaft studiert und arbeite jetzt im Finanzamt.“
Ich weiß schon vorher, wie die Reaktion ausfallen wird. Christoph verdreht die Augen. „Dann nimm mir nicht übel, wenn ich nichts weiter dazu wissen will. Wenigstens heute will ich nichts von Buchhaltung und Steuern hören.“
Das habe ich geahnt und lache laut auf. „Ich weiß. Niemand will mit mir über meine Arbeit reden. Was hast du seither gemacht?“
„Ich bin Anwalt. Steuerfachanwalt.“
Das Grinsen ist der Kracher. Wir beschäftigen uns beide tagtäglich mit Steuern und allem, was noch daran hängt. Da verstehe ich nur zu gut, wieso er dieses Thema nicht vertiefen mag. Mir geht es genauso. Eigentlich absurd, fällt mir auf einmal auf. Wir kommen alle zum Klassentreffen, um anderen zu erzählen, was wir arbeiten, obwohl wir an genau diesem Tag nicht an unsere Arbeit denken wollen.
Christoph trägt keinen Ring an der Hand, also kann ich ihn nicht nach seiner Frau fragen. Aber was dann? Die Arbeit hatten wir ausgeschlossen, an meiner Hand prangt leider auch kein Ring ... Über was sollen wir uns dann unterhalten?
Ich schaue einige Sekunden zum Fenster hinaus. „Es ist schön hier.“ Etwas Besseres fällt mir nicht ein.
„Und so ruhig.“, bestätigt Christoph. „Deshalb hat es Antje ausgesucht.“
„Du hast Kontakt zu ihr?“, staune ich. Das wundert mich aus Gründen, die ich nicht benennen kann. Vielleicht weil ich selbst zu niemandem von damals in irgendeinem Kontakt stehe. Die Einladung von Antje kam überraschend.
„Nein, eigentlich nicht.“, gesteht auch Christoph. „Ich hab sie nur angerufen, weil ich lange nicht zu Hause war und die Einladung erst vorgestern bekommen habe. Ich wusste nicht, ob noch ein Zimmer frei ist.“
„Und? Hattest du Glück?“
„Ja. Genau eines war noch frei.“
„Glück gehabt. Darf ich fragen, wo du warst?“ Steuerfachanwälte sind ja nicht unbedingt permanent auf Geschäftsreise. Ich hoffe auf einen Urlaub, aus dem er mir erzählen könnte. Es wurmt mich, dass ich nichts zu erzählen habe.
„Bei meinen Großeltern.“ Ein sehr müdes Lächeln verdunkelt seine Miene. „Mein Großvater ist gestorben und meine Oma war so mit den Nerven am Ende, dass sie aus Versehen ihr Haus in Brand gesteckt hat.“
„Um Gottes willen!“, hauche ich entsetzt. „Wie geht es ihr jetzt?“
„Besser. Ich bin bei ihr geblieben. Ich konnte sie nicht allein lassen. Zum Glück haben die Nachbarn ein Auge auf sie gehabt und das Feuer gelöscht, ehe es sich ausbreiten konnte. Danach haben sie mich angerufen und meine Oma ins Krankenhaus verfrachtet. Ich hab sie abgeholt und wieder in ihren Alltag ohne meinen Opa geführt. Es war keine schöne Reise, aber jetzt ist sie wieder bei sich und kommt allein klar.“
Ich traue mich kaum zu fragen. „Was ist mit deinen Eltern?“
Ein noch schwächeres Lächeln kündigt kein Happy End an. „Sind vor zwei Jahren bei einem Autounfall gestorben. Es gibt nur noch meine Oma und mich.“
„Oh Gott.“, flüstere ich schon wieder. „Das tut mir leid, Chris.“
Er zuckt kurz mit den Schultern, aber ich glaube, er will sich nur einreden, er hätte alles unter Kontrolle. Auch sein Herz. „Ist eben so. Ich kann es nicht ändern. Was ist mit dir? Nervt dich deine Schwester immer noch so?“
Ich senke amüsiert den Blick auf meine Handtasche. Meine Schwester Tina ist vier Jahre jünger als ich. Mit Sechzehn ist es der absolute Horror, wenn einem die zwölfjährige Schwester an den Sohlen klebt wie angetretenes Klopapier. Inzwischen bin ich aus dem Alter raus und genieße es, mit ihr Kaffee zu trinken und zu schnattern.
„Nein.“, antworte ich Christoph. „Sie kann noch immer so aufgedreht und nervtötend sein, aber sie läuft mir nicht mehr hinterher.“
Gerade biegen wir in die Einfahrt des Hotels ein und dürfen feststellen: Es sieht aus wie eine Hütte, nur größer. Aber die Optik stimmt mit einer Berghütte überein. Ringsherum stehen hohe Tannen, mit einem dünnen, weißen Schleier überzogen. Einige Vögel zwitschern dem Frühling schon entgegen, ansonsten ist es absolut still. Traumhaft. Ich sollte mir eine Karte des Hotels mitnehmen und hierher doch mal in den Urlaub fahren.
Als wäre es in meinem Leben nicht schon still genug ...
Eine Viertelstunde später stehe ich in meinem Nachtquartier. Christoph hat meine Tasche bis vor meine Zimmertür getragen. Ich hätte das allein geschafft, aber er hat darauf bestanden. Das war mir auf angenehme Weise unangenehm.
Das Zimmer sieht gemütlich aus. Ohne karierte Bettwäsche, aber mit einem Holzbett wie auf Heidis Alm. Dazwischen finde ich aber Steckdosen und einen Informationszettel zum WLAN inklusive Passwort, einen Fernseher und ein Telefon. Und ein schönes Badezimmer. Zwar ohne Fenster, aber dafür mit großer Badewanne. Ich glaube, mein Abendprogramm mit Wein und Buch werde ich dorthinein verlegen.
Aber nicht jetzt gleich. Ich richte mich ein bisschen ein, gehe duschen und ziehe mich um. Für den Abend habe ich mich entschieden, auf einen Hosenanzug zurückzugreifen. Wäre es Sommer und wärmer, hätte ich vielleicht ein Kleid angezogen, aber dafür ist es mir draußen zu ungemütlich. Schneefall hat eingesetzt und der Wind wiegt die Bäume in weit ausschweifenden Bögen hin und her. Draußen will ich jetzt nicht sein.
Das Abendessen ist im Preis inbegriffen. Für das Klassentreffen sollte ein Buffet aufgebaut sein, steht in der Einladung. Und bis dahin? In einer Stunde geht es erst los. Ich könnte ein wenig fernsehen oder meinen Laptop einschalten oder das Buch zur Hand nehmen. Aber ich fürchte, ich könnte etwas verpassen. In dem gleichen Haus wie ich halten sich all meine alten Klassenkameraden auf. Wegen denen bin ich schließlich hierher gekommen und freue mich auf sie. Andererseits werde ich die den ganzen Abend um mich haben. Was spricht gegen eine ruhige Einleitung des Abends? Ich will ja auch nicht die Erste sein, die dann dumm herumsteht und auf den Rest wartet.
Ich weiß ... Da spricht die altbekannte Faulheit aus mir, die ich doch eigentlich zu Hause lassen wollte. Sie scheint sich heimlich in meine Tasche geschlichen zu haben und überfällt mich jetzt unverhofft.
Ein Klopfen an meiner Tür reißt mich aus den Grübeleien und ich hoffe inständig, es wäre jemand, der mir einen Ausweg aus meiner Unentschlossenheit zeigt.
Es ist eine echte Überraschung. Christoph. Er sieht nervös aus. „Hey. Hast du Lust auf ein Glas Wein?“
So sehr er sich auch bemüht, ich erkenne seine Absicht. „Du willst nicht als Erster unten stehen?“
Schon zum zweiten Mal treibe ich ihm die roten Flecken auf die Wangen. „Na ja ...“, fängt er an, doch ich weiß: Nichts, das er sagt, würde mich vom Gegenteil überzeugen, weil ich hundertprozentig punktgenau getroffen habe.
„Schon gut.“, lache ich und nehme das Jackett vom Kleiderhaken. „Ich habe auch eben überlegt, ob ich schon runtergehen soll.“
„Gott sei Dank.“, schmunzelt er verlegen.
Damit hat er mir tatsächlich die Hand aus der Unentschlossenheit und Faulheit gereicht. Es fällt mir erstaunlich leicht, mit ihm die Stufen hinabzusteigen. Nur ein Gesprächsthema kenne ich immer noch nicht.
Er dafür schon. „Auf wen freust du dich am meisten?“
Oh je ... Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. „Keine Ahnung. Eigentlich auf alle. Die meisten.“, korrigiere ich schnell, denn nicht an jeden habe ich positive Erinnerungen. Das ist aber normal, denke ich. Inzwischen sind wir erwachsen und stehen über den Zwistigkeiten von damals. Hoffe ich wenigstens.
Auf Tafeln des Hotels wird uns der Weg zum Saal gewiesen. Direkt davor wurde ein Tisch aufgestellt, an dem Antje steht und neben ihr ein Mann, den ich nicht erkenne. Christoph und ich gehen zu ihnen.
„Hallo.“, freut sich Antje. Sie hat noch genauso viele und auffällige Sommersprossen wie damals. Nur die Zahnspange fehlt. Als wir vor ihr ankommen, legt sie den Kopf leicht schief und mustert mich einen Moment. „Ich tippe mal auf Lene.“
Habe ich mich wirklich so sehr verändert? An ihr und Christoph fallen mir tausende Veränderungen auf, wenn es bei Antje auch nicht so gravierend ist wie bei Christoph. Aber ich? Wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich manchmal das Gefühl, ich sehe noch genauso aus wie damals, nur eben älter. Wenn ich mir allerdings Fotos von früher ansehe, dann sehe ich das Alter und die Veränderung doch etwas deutlicher.
„Ja.“, lache ich leicht. Wie oft sie dieses Spiel wohl heute noch spielen wird?
„Und bei dir hab ich keine Ahnung.“, lacht sie nun Christoph an.
„Christoph Bergmann.“, grinst er und ergötzt sich regelrecht an dem Schreck in ihrem Gesicht. Ob er das bei mir auch so deutlich gesehen hat? Ich hatte mir ja alle Mühe gegeben, eben nicht so auszusehen wie Antje jetzt gerade.
„Entschuldige. Dich hätte ich nie im Leben erkannt.“
„Ich sehe das mal als Kompliment.“, feixt er und offenbart zwei Grübchen in den Wangen, die er früher nicht hatte, soweit ich mich erinnere.
Antje gibt uns jedem ein Namensschild, das wir uns vorn an die Schulter kleben können. Das dürfte viele peinliche Moment ausschließen, hoffe ich.
Der Mann, der ihr zur Seite steht, ist jemand, den ich gar nicht erkennen konnte. Ihr Ehemann. Er ist nur hier, um ihr zu helfen. Die Einladung schließt die Partner ein. Ich bin schon mal nicht die Einzige, die allein da ist, das beruhigt mich. Wenigstens Christoph ist ebenso unverheiratet wie ich.
Christoph und ich sind nicht die Ersten im Saal. Einige wenige sind schon da und stehen in kleinen Grüppchen zusammen. Wie beim ersten Schulball.
„Ich hatte dir ein Glas Wein versprochen.“, lächelt Christoph und lotst mich zum Buffet, um seine Schuld zu begleichen.
Zu uns am Ausschank gesellt sich ein Mann, den ich ebenfalls kaum wiedererkenne. Thomas! Der Schwarm meiner Jugend! Der Schwarm der ganzen Schule! Der Schönling! Ein Junge, dem jedes Mädchen erlegen war! Und jetzt? Ein zusammengefallenes Gesicht mit deutlich roter Färbung. Ein aufgedunsener Körper und der weithin verströmende Geruch von Alkohol. Er trägt eine Jeans mit einem Fleck am rechten Oberschenkel, darüber ein graues Hemd. Ein Zipfel ist ihm aus dem Hosenbund gerutscht und hängt schlaff an seiner Hüfte herunter. Die Schuhe sehen aus, als wäre er damit durch das matschige Winterwetter bis hierher gelaufen. Klar ... Fahren kann er in dem Zustand sicher nicht mehr.
„Lene!“, ruft er mir schon von Weitem herüber. Mein Blick huscht zu dem Namensschild, doch ich habe mich nicht getäuscht. Das ist tatsächlich der Kerl, der mich damals so hart getroffen hat. Bin ich froh, den nicht abgekriegt zu haben.
„Thomas.“ Ich empfange ihn mit einem halbwegs freundlichen Lächeln. Hoffentlich sieht man mir die Enttäuschung nicht so deutlich an wie die Verwunderung über Christophs Veränderung.
„Wie geht´s dir?“, erkundigt sich Christoph. Seine Stimme verrät mir, dass es ihn eigentlich gar nicht interessiert.
„Ich bin nur wegen der Getränke hier.“, entgegnet Thomas unverwandt. Er macht nicht mal ein Geheimnis daraus. Dieses Stadium, in dem man versucht, den Alkoholismus zu verbergen, hat er offenbar schon überwunden. Ihm ist einfach egal, was andere denken. Er trinkt, weil er es so will, alles andere ist nicht von Bedeutung. Und so einer trägt einen Ehering.
Thomas brabbelt noch weiter vor sich hin, während er sich großzügig selbst einschenkt. Christoph und ich suchen lieber das Weite und entscheiden uns zu einem Spaziergang an den Fotowänden entlang. Um den ganzen Saal herum hat Antje Tafeln mit Fotos aus der Schulzeit aufgehängt.
„Die Klassenfahrt.“, lacht Christoph plötzlich und zeigt auf ein Gruppenfoto vor unserer damaligen Unterkunft. „Da gab es die verdorbenen Spaghetti.“
„Ach ja!“ Mir fällt es schlagartig wieder ein. „Wir waren alle krank und mussten drei Tage länger bleiben.“
„Und Herr Böttcher musste alle Eltern anrufen und beruhigen.“
Ich weiß noch, wie meine Mutter mich empfangen hat, als ich endlich wieder zu Hause war. Sie war mit den Nerven am Ende gewesen und schon so gut wie bei der Klassenfahrt aufgetaucht. Sie mag es nicht, wenn uns Kindern etwas fehlt. Aber wenn wir mal krank sind, dann muss Mama wenigstens dabei sein. Das ist heute noch genauso, deshalb erzähle ich ihr, wenn überhaupt, erst hinterher, wenn ich erkältet war oder mir den Magen verdorben habe oder was auch immer.
„Auf der Klassenfahrt hab ich meinen ersten Kuss bekommen.“, fällt mir auch noch ein. „Am Abend vor den Spaghetti.“
„Von Christian Pape.“, kichert Christoph. „Er kam danach in unser Zimmer und hat uns alles haarklein berichtet.“
Ist das peinlich! Ich schlage mir eine Hand vor die Augen und wünsche mir, das nicht gehört zu haben.
Lachend stößt Christoph mich an. „Komm schon. Lache darüber. Christian war Feuer und Flamme für dich. Er war so aufgeregt deshalb, dass er nicht schlafen konnte und uns auch noch wachgehalten hat.“
„Hey!“, lacht plötzlich jemand hinter uns. „Ihr habt mir versprochen, es ihr nicht zu erzählen!“
Breit grinsend steht Christian Pape hinter mir. Er wartet auf eine Reaktion von mir. Aber was soll ich sagen? Die Wahrheit!
„Ich wollte es eigentlich auch gar nicht wissen.“, gestehe ich und umarme ihn freudig.
„Dann ist Christoph Schuld an allem.“, legt er fest und begrüßt Christoph mit einer ebenso freudigen Umarmung. Inzwischen bin ich mir sicher, ich hätte bereut, wenn ich mir die Chance hätte entgehen lassen.
„Immer ich.“, seufzt Christoph tief getroffen. „Es hat sich nichts geändert. Ich musste früher schon immer den Kopf hinhalten.“
Daran erinnere ich mich dunkel. Christoph hat bei vielen Streichen oder simplem Blödsinn die Schuld auf sich genommen. Er wollte sich damit die Anerkennung der anderen Jungen verdienen. Freundschaften waren das wahrlich nicht, aber sie hatten eine gewisse Achtung vor ihm. Christoph stand trotz seines Daseins als äußerlicher Looser stets bei den beliebten Jungen unserer Klasse. Viele Gespräche gab es nicht, aber er fühlte sich dazugehörig.
Oh je ... Erst hier in diesem Rahmen fällt mir wieder ein, wie fies Kinder sein können. Hinter seinem Rücken haben sie sich über Christoph lustig gemacht, aber im direkten Kontakt waren sie nett zu ihm. Sie brauchten den Sündenbock.
Christophs Pendant unter den Mädchen war Antje, ganz eindeutig. Sie war eine Streberin und warb ständig um die Gunst der Lehrer. Sie sorgte immer in der Pause vor dem Unterricht für Kreide, überwachte das Klassenbuch und brachte ihnen hin und wieder Kekse mit. Außerdem entsprach die Zahnspange nicht dem, was wir als cool betrachteten. Dennoch hielten wir sie in unserer Nähe. Nicht als Sündenbock, aber neben jemandem mit einem so offensichtlichen Makel wie einer Zahnspange, fühlt man sich selbst hübscher. Kaum zu glauben, wie ich einmal war. Andererseits denke ich mir, gibt es solche Geschichten in jeder Schule und in jeder Generation. Wir sind erwachsen und lachen heute gemeinsam darüber.
Christian begleitet uns auf der Reise durch die Vergangenheit. Es ist wirklich schön, sie wiederzusehen. Im Laufe des Abends schwatze ich mit jedem wenigstens kurz. Bei einigen bleibe ich länger hängen und lache viel über die gute alte Zeit. Mir wird von Minute zu Minute bewusster, dass wir alt geworden sind. Die Kinder von damals gibt es nicht mehr.
Und wie ich prophezeit hatte, will niemand etwas über meine Arbeit wissen. Sobald ich nur das Wort Finanzamt ausspreche, verdrehen sie die Augen und fragen nicht weiter. Damit muss ich leben. Christoph und ich sind die Einzigen, die nicht andauernd erzählen, was sie arbeiten.
Ich lerne viele Ehepartner kennen. Die meisten meiner alten Klassenkameraden sind verheiratet, manche sogar schon wieder geschieden. Da wird mir die Zeitspanne nur umso deutlicher vor Augen geführt. Das Mädchen von damals schlummert vielleicht noch irgendwo in mir, aber ich fühle mich nicht mehr so unbeschwert wie damals. Als würde ich permanent auf eine Wand zulaufen. Umso näher sie kommt, desto mehr fürchte ich mich vor ihr. In der Jugend war die Mauer fern, doch jetzt ist sie in Sichtweite. Nur was diese Wand ist, was sie symbolisiert, das kann ich nicht greifen. Die Zukunft allgemein? Das Alter? Oder das einsame Altwerden? Der Tod? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin ihr deutlich näher als damals bei meinem ersten Kuss.
Die zweite Erkenntnis des Abends: Die wenigstens Ehen halten. Viele sind geschieden, andere leben unzufrieden miteinander weiter. Welches der bessere Weg ist, muss jeder für sich allein entscheiden. Mir kommt es falsch vor, mein Leben mit jemandem zu teilen, den ich eigentlich nicht bei mir haben möchte. Verachtung und Abneigung steigen doch von Tag zu Tag nur an. Dann lieber einen geraden Schnitt und vernünftig auseinandergehen.
Andererseits habe ich Verständnis für diejenigen, die sich gegen die Trennung entscheiden, denn sie können bis ans Ende ihres Lebens sagen: Sie sind nicht allein. Einsam vielleicht, aber nicht allein. Diese Furcht, irgendwann im hohen Alter, wenn die Gebrechen zunehmen wie die zu erwartende Restdauer auf der Erde abnimmt, auf sein Leben zurückzublicken und zu erkennen, dass man nie zu irgendjemandem gehörte. Wenn man sich vom Sterbebett aus, in dem man vielleicht schon seit Monaten oder Jahren gefangen ist, umsieht und niemand da ist. Eine Pflegekraft sieht hin und wieder mal nach, ob das Bett wieder frei geworden ist. Der letzte Besuch von entfernten Verwandten oder Bekannten ist ewig her. Es gibt niemanden mehr auf der Welt, der an einen denkt. Nirgends wird mein Name noch genannt, wenn ich gegangen bin.
Davor fürchte ich mich!
Und ja, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann würde ich sie wählen. Auch wenn es bedeutet, sich aus dem Weg zu gehen oder ständig zu streiten. Aber dafür müsste erst einmal jemand in mein Leben treten, mit dem ich mich streiten könnte.
Noch ein Punkt fällt mir auf: Viele der Leute, die genauso alt sind wie ich, haben Kinder. Antje hat schon das Dritte bekommen, bei Monika ist das Zweite unterwegs, Christian, dem ich meinen ersten Kuss geschenkt hatte, ist auch schon Vater und Katharina hat aus Versehen Vierlinge bekommen. Die sind nun auch schon acht Jahre alt. Und was hab ich? Einen Kater!!!
Ich genieße es trotzdem in vollen Zügen. Christoph und ich sind aus Versehen unzertrennlich. Wie konnte das denn passieren? Wir verstehen uns blendend. Die anderen Gesprächspartner wechseln immer mal wieder um uns herum, doch wir beide – wir bleiben und reden und reden und reden und ... Sehr angenehm.
Antje hat das traumhaft schön gemacht, finde ich. Das Buffet ist ellenlang und bietet für jeden Geschmack die passende Mahlzeit. Fleisch, Fisch, Salate, Brote und und und. Das Beste daran ist, dass das Hotel von allem kleine Portionen zur Verfügung stellt. Verschiedene Steaks werden angeboten. Sie sind so klein, dass man sich nicht für eine Sorte entscheiden muss. Ich habe drei Stück gegessen und das soll schon was heißen.
Später, sehr viel später, liege ich in meinem Hotelbett (allein!) und lächle mit geschlossenen Augen. Es ist nach vier Uhr morgens und ich fühle mich erschöpft nach so einer aufregenden Nacht. Ich bin sogar heiser, weil ich nicht mehr gewohnt bin, so viel zu reden und so viel zu lachen. Meine letzte durchzechte Nacht liegt auch schon meilenweit hinter mir. Ich bin körperlich ausgelaugt, aber leider nicht müde genug, um einzuschlafen.