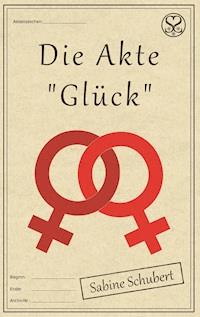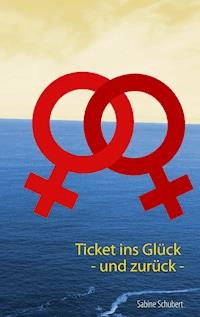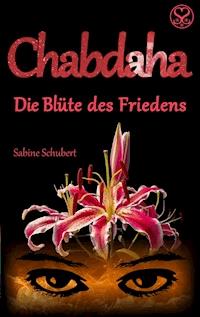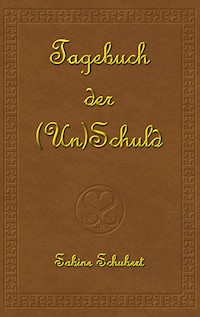12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lange wusste die Autorin nicht, woher ihre Symptome wie Depression, Angstzustände, Apathie und Verzweiflung kamen. Ihr Leidensdruck hat sie immer weiter forschen lassen, bis sie auf die Ursache stieß: Frühkindliche traumatische Erfahrungen – zu der Zeit, als die Autorin ein Säugling und Kleinkind war und noch nicht sprechen konnte – haben ihr Leben umfassend und nachhaltig beeinträchtigt. Die Täter waren vor allem ihre Eltern – und damit gleichzeitig ihre wichtigsten Bezugspersonen. Sabine Schubert reflektiert aus ihrem heutigen Traumawissen heraus, welche Kindheitserlebnisse prägend waren und wie bei ihr daraus unbewusste Verhaltensweisen auch und vor allem auf sexueller Ebene – resultierten. Zu Beginn des Buches findet sich eine kurze Wissensvermittlung über Trauma und mögliche Behandlungswege. Dann beschreibt die Autorin ihr Leben von der Geburt im Jahr 1960 bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie 53 Jahre alt war. Dabei erzählt sie ehrlich und abgrundtief von ihrer damals ganz normalen, wohlbehütet-grausamen Kindheit in den 60er-Jahren, wie sie vielleicht viele erleben mussten, und schlussfolgert, welche erschreckenden Auswirkungen das Aufwachsen bei durch das Dritte Reich (kriegs)traumatisierten Eltern auf die Kinder haben kann. Sie schildert ihren Weg Richtung Heilung – und Heilung bedeutet für die Autorin nicht, dass alle Symptome für immer verschwinden. Sie meint damit den Weg, nach und nach die Selbstverurteilung hinter sich zu lassen, das Gefühl, falsch zu sein, die Überzeugung, kein Recht auf Leben zu haben. Platzhalter hierfür sind immer wieder auftauchende, kleine aber wesentliche Heilungsgeschichten. Die Botschaft dieses Buches möchte sein: Es ist trotz allem möglich, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Für das Leben
Da war nichts!
… wenn die Erinnerung fehlt
a
Autobiografie über die Auswirkungen sexueller Gewalt im Säuglings- und Kleinkindalter
Ein Buch von Sabine Schubert
© 2024 Sabine Schubert
www.RaumzumAnkommen.de
Lektorat: Janina Erdmann,
www.janne-out-of-box.de
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Sabine Schubert, Schmerwitz 28 14827 Wiesenburg, Germany
ISBN Softcover:
978-3-384-14631-1
ISBN Hardcover:
978-3-384-14632-8
ISBN E-Book:
978-3-384-14633-5
Inhaltsverzeichnis
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorbemerkung
Meine Vermutung
Warum dieses Buch?
Zum Einstieg
Woher weiß ich das alles?
Anonymisierung
Die Heilungsgeschichten
Was ist Trauma?
Natürliche Reaktionen auf ein traumatisches Erlebnis
Überlebensstrategien und Dissoziation
Bin ich traumatisiert?
Bindung mit selbst traumatisierten Eltern
Weitere Begriffsklärung rund um Trauma
Wie funktionierte die Traumatherapie, die ich machte?
Traumasensibel
Triggerwarnung und Selbstfürsorge
Meine Eltern
1. Säugling, Kleinkind und Grundschulzeit
(1960-1970)
2. Die Jugendliche
(1970-1979)
Das Leben ist nichts weiter als eine gute Idee!
3. Studium in Berlin, Mutterschaft, Weltreise
(1979-1992)
4. Wiederanfang in Deutschland, Gemeinschaftserfahrungen
(1992-2001)
5. Umzug ins Waldsanding, Ehe, berufliche Suche
(2001-2012)
6. Traumatherapie, Kontaktabbruch, Tod des Vaters
(2010-2013)
Ende?
Epilog
Ein paar Bücher, die mir gut taten
Dank
Da war nichts! ... wenn die Erinnerung fehlt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorbemerkung
Dank
Da war nichts! ... wenn die Erinnerung fehlt
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Vorbemerkung
Ich wusste über 51 Jahre nicht, woher meine emotionalen Zustände, die immer wiederkehrende Verzweiflung, die schweren Depressionen kamen – trotz jahrelanger Psychotherapie. Ich konnte mich nicht auf mich selbst verlassen, weil meine Zustände mich mehr im Griff hatten als mein eigener Wille. Ich lag in tiefster Verzweiflung in meinem Bett, wollte immer nur sterben, fühlte mich unfähig aufzustehen, in meinem Kopf war Watte, ich konnte mich nicht konzentrieren, war oft innerlich nicht ganz da oder so erschöpft, dass ich kaum eine Aufgabe erledigen konnte. Dadurch hatte ich dann auch immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich es einfach nicht schaffte, die Dinge, die ich zusagte oder mir vornahm, zuverlässig auch wirklich zu tun. Das feuerte meine Selbstverurteilung an und auch den unbewussten Glauben, dass ich nichts wert bin: „Ich habe kein Recht auf ein erfülltes Leben.“
Meine Vermutung
Seit meinem 26. Lebensjahr bemerkte ich eine starke Resonanz, wenn ich Berichte von Frauen las, die sexuelle Gewalt erfahren hatten. Vor allem ihre Symptome, ihr Lebenskampf, ihre Verzweiflung – das fühlte sich sehr vertraut an. Ich schaute mir „Die Farbe Lila“ im Kino an und heulte Rotz und Wasser. Ich las alle Bücher, die ich zu diesem Thema finden konnte. Ich identifizierte mich schnell mit den Opfern und überlegte, ob ich etwas Ähnliches erlebt haben könnte, aber ich hatte keinerlei Erinnerungen dieser Art. Es gab keine Beweise, keine Zeugen – aber ähnliche Symptome und dieses starke Verbundenheitsgefühl mit den Frauen, die darüber berichteten.
Konnte es sein, dass ich als kleines Mädchen so etwas Ähnliches erleben musste? Konnte es sein, dass ich als kleines Mädchen zutiefst beschämt wurde? Konnte es sein, dass meine Grenzen ungefragt überschritten worden waren, dass mein vielleicht auch stummes Nein übergangen wurde, dass ich mit einer absolut nicht kindgerechten Sexualität überfordert worden war? Konnte es sein, dass gierige Bedürftigkeit meine natürliche Entwicklung ausgebremst hatte?
Später beim Sex verhielt ich mich oft widersprüchlich: Ja, ich hatte Lust – und gleichzeitig erlebte ich oft Angst-, Ekel- und starke Abwehrreaktionen. Immer wieder ging mir der Satz durch den Kopf: „Nein, nein, nein, ich will nicht! Lass das.“ Vor dem Orgasmus des Mannes bin ich innerlich oft ausgestiegen und war hinterher fix und fertig. Auch nach seltenen schönen sexuellen Erlebnissen verfiel ich anschließend wieder in Depression.
In verschiedenen Therapien erlebte ich wieder, was eindeutig auf sexuelle Handlungen in frühester Kindheit verwies. Wo kam dieser angeekelte Würgereflex her, woher dieses „Nein, lass mich in Ruhe“? Und immer wieder fühlte ich mich so hoffnungslos, so abgrundtief verzweifelt, als wenn es für mich keine Chance im Leben geben kann. Wo kam das her?
Wieder und wieder zog mich das Thema „Opfer von sexueller Gewalt“ magisch an, ich las darüber und schaute mir Reportagen dazu an. Als die Opfer der Odenwaldschule und der Kirchen die sexuelle Gewalt, die sie erleben mussten, sichtbar machten, war ich zutiefst dankbar, dass es dafür endlich eine Öffentlichkeit gab. Es war ein Anfang, dieses Leiden endlich anzuerkennen. Es half mir – weil ich dabei die Schmerzen fühlen konnte, zu denen ich sonst keinen Zugang hatte. Und ich dachte: „Wenn das Leiden dieser Menschen anerkannt wird, gibt es vielleicht auch die Hoffnung, dass mein Leiden anerkannt wird.“ Ich wollte mehr darüber wissen: Wie hatten andere Menschen ihr Schicksal bewältigt? Ich las viele Bücher, und trotzdem fand ich mich in keiner dieser Geschichten genau wieder. Dann suchte ich auch speziell nach Literatur zu Missbrauch in frühester Kindheit – aber ich fand keine.
Ich hatte keine klaren Erinnerungen, auch keine, die plötzlich wieder auftauchten. Ich hatte nur die Symptome, nur das Leiden. Ich hatte keine Beweise. Wer sollte mich denn in der Kindheit missbraucht haben, wer sollte so was mit mir gemacht haben!? Ich hatte keinen offensichtlich bösen, gewalttätigen Vater, noch konnte ich eine andere Person beschuldigen. Meine Eltern waren grundanständige Leute, alle fanden sie so sympathisch, so gastfreundlich und nett. Ich liebte meinen Vater so sehr, ich war sein Sonnenschein. Er schenkte mir immer wieder schöne Sachen, bedachte mich mit Aufmerksamkeit und herzte mich. Das war so wichtig für mich! Ich wollte meinem Vater gefallen, denn es floss auch viel Liebe von ihm zu mir.
Sexualität war in unserer Familie tabu, darüber sprach man nicht, man tat so, als gäbe es sie nicht. Ich bin niemals mit sexuellen Themen konfrontiert worden – zumindest nicht offensichtlich. Woher kamen aber dann meine Symptome, all die fragmentierten Empfindungen, unerklärlichen Gefühle und (körperlichen) Reaktionen? Hatte mich mein Vater vielleicht nachts, wenn ich schlief, heimlich besucht? Ich hatte als Kind immer große Angst, dass ein Mann unter meinem Bett liegt, der mich umbringen will. Ich getraute mich nie, unter mein Bett zu schauen. Ich wusste einfach: „Da liegt einer!“ War das womöglich gar keine irreale Angst, sondern eine Möglichkeit meiner Seele, mit der realen Bedrohung durch meinen Vater umzugehen? War die kalte Spitze des Messers, die ich ab und zu glaubte auf meiner Haut zu fühlen, kaltes Ejakulat? Ich weiß es nicht.
Es gab Momente, da meinte ich es ganz sicher zu wissen: „Ja, ich muss in meiner Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben!“ – und dann wieder konnte oder wollte ich es einfach nicht glauben. Es ist mir möglich, auf mein inneres Schlachtfeld mit all meinen verwundeten Seiten zu schauen – und gleichzeitig zu denken: „Da war nichts!“ Ich glaube, das ist eine gelungene starke Konditionierung: Ein Teil von mir will es einfach nicht realisieren, nicht wahrhaben. Da sind Anteile abgespalten, im Dunkeln gelandet, damit ich überleben konnte.
Heute weiß ich aus Fachliteratur, dass es in meinem Zuhause ganz typische Merkmale für Familien gab, in denen sexualisierte Gewalt passierte: Die Tabuisierung der Sexualität, die Verdrängung sämtlicher Gefühle, die nicht präsente Mutter, die unfähig ist, ihr Kind emotional zu versorgen, die starke Fokussierung auf die gute Wirkung nach außen und ein Vater, der im Krieg war.
Könnte sexuelle Gewalt in frühester Kindheit die Ursache für meine immer wiederkehrenden Verzweiflungsgefühle sein?
Warum dieses Buch?
Ich bin überzeugt davon, dass meine Geschichte leider überhaupt nicht einzigartig ist. Auch deshalb ist es mir ein Anliegen, sie aufzuschreiben, ein Herzensanliegen, das in den letzten Jahren immer drängender in mir angeklopft hat. Nun ist Sommer 2023 und dieses Buch möchte jetzt – nachdem das Roh-Manuskript zehn Jahre geruht hat – fertig werden. Um die letzten Schritte gut gehen zu können, lasse ich mich von einer Lektorin begleiten. Bei einem unserer ersten Gespräche bittet sie mich, die Absicht dieses Buches in eine Art „Vorwort“ zu fassen: Ich werde also wieder schreiben und an den bereits geschriebenen Worten feilen – das nimmt mich schon im Vorfeld mit. Ich spüre deutlich meine innere Zerrissenheit: Einerseits will ich endlich die Decke des Schweigens („Darüber spricht man nicht!“) lüften, die schon lange über der Familie liegt. Ich kann spüren, wie tief dieses Schweigen sich auch in mich selbst eingegraben hat: Ich mache so gerne gleich wieder die Türe zu vor dem ganzen emotionalen Ballast, der mich jahrelang immer wieder unkontrolliert geflutet hat. Und andererseits spüre ich ganz deutlich, wie unglaublich wichtig es mir ist, dass dieses Buch endlich in die Welt kommt! Ja, ich habe sie in mir, diese klare Absicht. Wenn ich darüber rede, spüre ich das Feuer dahinter.
Es tut so gut, für die letzte Phase der Fertigstellung eine Gegenüber zu haben, die mir aufmerksam zuhört und die meinen Wunsch, mich mit meiner Geschichte mitzuteilen, als bereichernd erlebt. Kann ich mir das beim Schreiben ebenfalls vorstellen – wie ich Menschen mit diesen Worten erreiche und berühre? Menschen, die gern andere Erfahrungswelten als nur ihre eigene begreifen wollen, Menschen, die ähnliche Gefühle und Erfahrungen kennen, die vielleicht ähnlich ticken wie ich, die einen Resonanzraum bekommen und sich gesehen und verstanden fühlen, wenn sie meine Geschichte lesen? Trotz aller Widerstände spüre ich: Ja, es lohnt sich, mich nochmal hinzusetzen und dieses Buch zu einem Abschluss zu bringen – für andere, aber auch für mich selbst: Ich möchte mir meine Geschichte noch einmal anschauen, damit sie zu einem Narrativ wird, das ich lesen kann, ohne dass ich davor wegrennen möchte. Im Moment sind einige Teile des Buchs noch schwer für mich zu lesen – liegen diese auch noch schwer auf meiner Seele? Gibt es da noch Feinheiten, die angeschaut werden möchten? Und ich spüre auch: Es war gut, diese Geschichten die letzten zehn Jahre ruhen zu lassen. So konnte ich mich der Erforschung des Ursprungs widmen, zwar wieder durch Leidensdruck angeregt, aber nun auch mit vielen, vielen neuen Erkenntnissen reicher und um viele Symptome ärmer. Danke für diese Fügungen auf meinem Lebensweg.
Wie kann ich also dieses Buch in eine abschließende Form gießen, sodass es lesbar wird? Dass mir selbst nicht mehr der Atem stockt, wenn ich darüber spreche oder schreibe? Es war etwas Schlimmes, was mir passierte. Ich habe überlebt, zu einem hohen Preis: Meine Seele hat sich viele Male aufgespalten, die Anteile sind tief in die Dunkelheit verschwunden. Nur ein winziger Rest, der mich am Leben gehalten hat, ist geblieben – und auch der wäre am liebsten immer wieder gestorben. Statt meinen Seelenanteilen sind dann Selbstverurteilungen, Schuld-, Scham- und Wertlosigkeitgefühle eingezogen: „Das hast du dir selbst eingebrockt. Daran bist du selbst schuld. Stell dich doch nicht so an!“ Um mit der Tatsache klarzukommen, dass meine Grenzen ignoriert wurden, habe ich mich selbst schlecht, schuldig, unfähig, falsch und nicht lebensberechtigt gefühlt. Und nach außen hin wirkte ich anscheinend normal, angepasst, still, meist weggetreten.
Ich werde dieses Buch veröffentlichen, weil ich mir eine Gesellschaft mit vollständigen Seelen wünsche. Ich wünsche mir Menschen um mich herum und überall, die präsent sein können, die wirklich im Hier und Jetzt anwesend sind. Ich wünsche mir Menschen, die wirklich da sind, die sich selbst wertschätzen und lieben können – und von dieser Basis aus auch gerne andere Menschen lieben können und möchten. Ich wünsche mir Menschen, die sagen können: „Oh, da habe ich einen Fehler gemacht, es tut mir leid“, die den Mut haben, ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten liebevoll anzunehmen und sich damit zu zeigen. Und Menschen, die aufhören, andere zu verurteilen, weil sie dieses oder jenes nicht können oder sind. Ich wünsche mir Menschen, die offen miteinander umgehen, die wagen, zu sagen: „So habe ich das gerade wahrgenommen“, auch wenn der Großteil der Gruppe etwas anderes sagt. Ich wünsche mir, selbst so wahrhaftig zu werden und zu sein – und ich weiß und bin dankbar dafür, dass ich schon jetzt immer mehr dazu in der Lage bin. So fühlt sich das Leben richtig an!
Eigentlich gibt es für das, was mir passiert ist, keine Worte. Und doch: Ich will raus aus der Sprachlosigkeit – dieser Sprachlosigkeit, die nicht nur mein Thema ist, sondern kollektiv auf uns als Gesellschaft lastet. Diese Überlebensstrategie der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen schadet und prägt uns heute noch, auch, wenn sie zur Zeit des Wiederaufbaus sicherlich sinnvoll war und (Über)Leben geschützt hat. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass nicht schreckliche Taten an sich das Schlimmste sind, sondern vor allem diese Sprachlosigkeit: dass das Erleben dieser Taten nicht gesehen und benannt werden darf. Mir wurde meine eigene Wahrnehmung, mein Erleben vollkommen abgesprochen, es wurde ignoriert, totgeschwiegen, weil es einfach nicht sein durfte. Ich fühlte mich damit komplett allein gelassen. Wenn das Schlimme, was ich erleben musste, gesehen, anerkannt und bezeugt worden wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte „Hey Sabine, das war richtig schlimm, was du da erleben musstest, das war falsch und es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist“ – ja, auch dann hätte es auch eine Weile gedauert, bis diese Wunden wieder geheilt wären. Aber vielleicht hätten sie mich nicht in dieser verheerenden Wirkung auf mein ganzes Leben so belastet. Dann hätte ich weinen, zittern, wütend sein können, hätte lauter angemessene Gefühle ausdrücken können, ohne dafür bestraft zu werden. Dann hätte ich meiner Wahrnehmung weiterhin trauen können, hätte mir nicht selbst die Schuld dafür geben müssen, dann hätte ich mich selbst richtig fühlen können: Ich hätte nur etwas erlebt, was falsch war – und nicht so lange Zeit geglaubt, ich sei falsch.
Auch heute noch wird viel zu viel geschwiegen, viel zu viele schreckliche Erlebnisse erfahren keinen Resonanzraum. Wir müssen endlich eine Sprache finden für all das Unausgesprochene – und mit diesem Buch versuche ich tastend, auf eine sehr persönliche Art und Weise dazu beizutragen.
Seit dem Aufschreiben meiner Geschichte habe ich auch immer wieder schwierige, aber auch viel gute Zeiten erlebt. Insgesamt traue ich heute meiner Wahrnehmung, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Meine Selbstliebe wächst und meine Liebesfähigkeit auch. In den schwierigen Zeiten, wenn ich mich schlapp, krank oder antriebsschwach fühle, weiß ich heute, wie und wo ich mir Hilfe holen kann, lasse ich mich begleiten. Und dadurch gewinne ich neue Erkenntnisse und mache Wachstumsschritte. Heilung bedeutet für mich nicht, dass alle meine Symptome einfach verschwinden, sondern ich heile von der Selbstverurteilung, von dem Gefühl, falsch zu sein, von dem Gefühl, kein Recht auf Leben zu haben. Und ja, trotz aller Fortschritte hat das Leben immer wieder Herausforderungen für mich – der Umgang damit wird aber leichter. Ich fühle mich nicht mehr als unwürdiges Opfer, sondern als jemand, die tiefe Einblicke in die Seele des Menschen gewinnen und dadurch auch erfahren durfte, was wirklich wesentlich im Leben ist. Jetzt übe ich mich an der Umsetzung.
Durch dieses Buch möchte ich mehr Bewusstsein und Verständnis schaffen für die eigenen Gefühle, Befindlichkeiten, Zustände, Überlebensstrategien, Gedanken und Verhaltensweisen; für die Befindlichkeiten der Mitmenschen und vor allen Dingen für die Notwendigkeit einer traumasensiblen Welt. Ich möchte diese meine Geschichte als Mut machendes Beispiel verstanden wissen und Zeugnis ablegen: Heilung, Integration und ein gutes Leben sind möglich!
Zum Einstieg
Ich freue mich sehr, dass du dieses Buch zur Hand nimmst! Um die Inhalte gut lesen, verstehen und verarbeiten zu können, ist es mir wichtig, vorab noch einige Hinweise zu geben.
Ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch gelesen wird, das, was ich beschreibe, Sichtbarkeit erfährt, vielleicht anderen Betroffenen Unterstützung bieten kann – und gleichzeitig ist es mir unangenehm, dich in eine so intime Privatsphäre mitzunehmen. Ein Teil von mir schämt sich jetzt schon: Dem wäre am liebsten, du würdest es gar nicht lesen. Aber ich habe mich entschieden, auch diese schambehafteten Inhalte öffentlich zu machen, denn sie sind nicht nur meine individuelle Geschichte, sondern sie sind auch politisch. Und nur, wenn Menschen ihr Schweigen brechen, kann sich etwas ändern. Diese Gratwanderung zwischen Selbstbewusstsein und Scham, zwischen dem Wunsch nach Sichtbar-Werden und Selbstschutz hat mich den ganzen Schreibprozess über begleitet – und sie wird mich auch und vor allen Dingen nach Erscheinen des Buches weiter begleiten.
Die Rohfassung des Manuskriptes ist etwa zwischen 2010 und 2013 entstanden, als ich spürte, dass ich meine Geschichte aufschreiben wollte. 2015 habe ich ein paar Dinge überarbeitet und Probeexemplare drucken lassen, die ich von einigen Menschen lesen ließ und um Rückmeldung bat. Und auch wenn mir von Anfang an eine Veröffentlichung vorschwebte, fehlte mir der Mut, diese Idee weiter zu verfolgen. Der Text hat dann lange geruht. Um mein 60. Lebensjahr wurde dann der Wunsch einer Veröffentlichung wieder drängender, ich beschloss, es wirklich anzugehen – und ich suchte mir dafür Unterstützung. Vor Herausgabe im Jahr 2024 haben dann meine Lektorin und ich miteinander gefeilt, Anpassungen vorgenommen, den Text sprachlich und emotional miteinander durchbewegt und immer wieder – sofern nötig und von mir gewollt – auch die zeitliche Lücke ins „Heute“ geschlossen.
Als ich die erste Textversion aufschrieb, war das für mich eine Reaktivierung: Beim Schreiben und dem erneuten Durchleben der Geschichte geriet ich – noch oder wieder – emotional in Not und in heftigen Stress. Trotzdem war es mir ein großes Anliegen, Worte zu finden und es einfach erst einmal niederzuschreiben. Dann lag es zehn Jahre herum – und diese Zeit war scheinbar nötig. Da wollte etwas reifen. Erst jetzt, vor der Veröffentlichung, konnte ein weiterer wesentlicher Schritt stattfinden: Vieles wurde beim gemeinsamen Durchgehen und Feilen der vorliegenden Roh-Texte mit meiner Lektorin emotional noch einmal neu bearbeitet, integriert, „verdaut“. Nach und nach durfte das Erlebte, das Trauma zu einer „Geschichte“ – zu einem Buch – werden, die zwar zu meinem Leben dazugehört und ein Teil von mir ist, in die ich aber nicht mehr versinken oder hineinkollabieren muss.
Woher weiß ich das alles?
Die ersten Jahre waren am schwierigsten zu rekonstruieren. Die Erinnerung verläuft bis zum Alter von etwa zehn Jahren nicht chronologisch, das Gehirn ist noch nicht fertig entwickelt. Abgesehen davon sorgt Trauma dafür, dass Erinnerungen fragmentiert werden, traumatische Inhalte abgespalten werden, damit der betroffene Mensch überleben kann. Es war außerdem belastend, mich während des Schreibens immer wieder mit der erlebten Ohnmacht, der Angst, dem Schmerz und der Hoffnungslosigkeit zu konfrontieren. Deswegen fiel es mir schwer, von dieser Zeit wirklich in der tatsächlichen Reihenfolge zu berichten.
Meine Lebensgeschichte ist nicht chronologisch in mir abgespeichert. Manche Bilder oder Geschichten sind in meinem Gedächtnis schon immer abrufbereit gewesen. Andere Fragmente habe ich in unterschiedlichen Altersstufen und Situationen erinnert: So kamen besonders die frühen Erlebnisse, bis ich zehn Jahre alt war, in verschiedenen Therapien in unterschiedlichen Lebensaltern als Erinnerung oder inneres Erleben wieder zu mir zurück. Es war dann heilsam, das zu fühlen, neu zu bewerten, zu bewegen und anzuschauen. Je älter ich werde, desto mehr wird es zu einer fortlaufenden Geschichte.
Auf welche Informationen greife ich zurück, um meine Geschichte zu erzählen? Für die Erlebnisse, die ich hier schildere, habe ich keine vorzeigbaren Beweise, recherchierte klare Fakten oder Zeugenaussagen. Vieler dieser verschiedenen Puzzleteile tauchten erst während meines Lebens wieder in mir auf und ich setzte mit ihnen mein Leben neu zusammen. Ich konnte gar nicht anders: Meine extremen Gefühlszustände veranlassten mich immer wieder, mir therapeutische Hilfe zu holen. Dabei tauchten durch die unterschiedlichsten, vor allem regressiven – also zurückblickenden – Methoden (z.B. Primärtherapie, Bonding-Psychotherapie, holotropes Atmen…) Bilder und Gefühle auf, die ich dann mit Unterstützung der Therapeuten und Therapeutinnen verarbeiten und integrieren konnte. Wenn mir Bilder kamen, dann prüfte ich sehr genau: Kann das stimmen? Passt das mit meinem realen Leben zusammen? Macht das Sinn? Wird dadurch mein inneres Erleben für mich logischer, nachvollziehbarer? Gibt es eine körperliche Resonanz auf dieses Bild? Ich traute immer mehr meinem Bauchgefühl, was sich für mich stimmig anfühlte.
Anonymisierung
Einige Menschen, die in meinem Leben eine wesentliche Rolle spielen, kann und wollte ich nicht anonymisieren: Mein Mann (Gerd) bleibt mein Mann – er weiß davon und findet das völlig in Ordnung–, und meine Eltern bleiben meine Eltern.
Menschen, die bereits verstorben sind, haben meist ihre Namen behalten. Für alle weiteren Menschen habe ich andere Namen und Verortungen gefunden, um sie zu schützen.
Zwei Regionen spielen in meinem Leben eine wesentliche Rolle. Diese haben neue Phantasienamen erhalten. Diese Namen konnte ich nicht in der Internet-Suchmaschine finden – es gibt sie nicht –, und sie könnten irgendwo im Süden Deutschlands bzw. in den ehemaligen Ost-Bundesländern sein.
Im Kapitel 4 geht es um meine Gemeinschaftserfahrungen. Ich habe auch die Namen dieser Gemeinschaften neu erfunden und sie sind in den oben erwähnten Phantasie-Gegenden verortet. Eindeutige Beschreibungen dieser Gemeinschaften habe ich weggelassen.
Jede Gemeinschaft, die ich kennenlernen durfte, ist einzigartig und es ist möglich, dass Menschen diese Gemeinschaften vielleicht identifizieren können, obwohl ich vieles anders beschrieben habe. Das Risiko gehe ich ein. Aber deswegen ist es mir noch einmal ganz besonders wichtig, dass ich diese Beschreibungen meiner persönlichen Erfahrungen keinesfalls als Verallgemeinerungen verstanden wissen möchte.
Gemeinschaften und kollektive Lebensorte geben einen neuen Rahmen, um spezifische Erfahrungen zu sammeln – und das ist gut so! All diese Erfahrungen habe ich freiwillig gesammelt und ich bin dankbar für die vielen Erkenntnisse, die ich in diesem Kontext erlangen durfte. Ich habe mehrmals ein mir zuerst unbekanntes Weltbild kennengelernt, und zwar nicht nur theoretisch, sondern konnte dieses auch über ein paar Jahre ganz praktisch erleben und vieles davon sehr schätzen lernen. Bis heute empfinde ich die Gemeinschaftsbewegung als ein insgesamt wunderbares und mutiges Forschungslabor für die – für uns Menschheit essentielle – Frage: Wie ist verbundenes, enkeltaugliches und gutes Leben möglich!?
Die Heilungsgeschichten
Die Heilungsgeschichten in diesem Buch – in kursiv gedruckt – sind neue innere Bilder und Geschichten, die ich in meiner Trauma-Therapie erarbeitet habe. Diese Geschichten habe ich nicht real erlebt, aber zum Glück konnte ich sie während meiner Therapiesitzungen selber erschaffen. Sie entstanden, während ich innerlich Kontakt mit dem traumatisierten Anteil von damals aufnahm. Wir sind dabei nicht in das traumatisierende Erlebnis eingetaucht, sondern haben Geschichten erfunden, die meiner Seele von damals genau das gegeben haben, was sie gebraucht hätte. Durch viele Wiederholungen in Gedanken, das bewusste Hineinspüren in mir erst fremde, dann immer vertrautere neue Gefühle von Sicherheit und Vertrauen, durch Aufschreiben, Malen oder das Gestalten von z.B. Collagen wurden neue neuronale Verbindungen im Gehirn geschaffen – eine Art Neukonditionierung. Wenn ich durch bestimmte Auslöser getriggert werde, hat mein Gehirn dadurch jetzt mittlerweile neue Möglichkeiten, vermeintlich gefährliche Situationen einzuschätzen: Es kann das Erleben im Jetzt anderes bewerten, weil es neue, sichere Erfahrungsreferenzen in mir gibt.
Ein Beispiel – ich dachte immer: „Ich bin schlecht.“ Dieser Glaubenssatz war eine meiner gewohnten neuronalen Autobahnen. Ich bewertete alles durch diese Brille. Die Heilungsgeschichten hatten die Botschaft: „Ich bin gut.“ Die Geschichten habe ich mir selbst ausgedacht oder empfangen, immer in Kontakt mit meinem früheren, kindlichen Ich. In den Momenten, in denen der alte Glaubenssatz damals entstanden war, hakte ich ein und mein erwachsenes Ich von heute fragte nach, was das jüngere Ich stattdessen gebraucht hätte. In diesen Heilungsgeschichten sind dann meine Bedürfnisse von damals erfüllt worden. Ich stellte mir immer wieder vor, dass meine inneren Kinder jetzt geschützt und behütet sind. Dadurch konnten sich diese Anteile in mir immer mehr entspannen.
Um eine wirkliche Veränderung zu bewirken, reicht es nicht, Glaubenssätze einfach zu überschreiben. Es bringt nicht viel, „Ich bin schlecht“ einfach im Heute, in der Gegenwart durch eine positive Affirmation zu ersetzen, da das Erlebte in der Vergangenheit – und damit im Körpergedächtnis – eingefroren festhängt. Es ist also wichtig, in die Zeit zurückzugehen, in der dieser Satz entstanden ist. Das Nachempfinden der Anspannung (Angst, Stress, Schmerz …) des kleinen Mädchens und das Spüren der anschließenden Entspannung, wenn es durch die neue Heilungsgeschichte optimal versorgt wurde, das braucht es – auf ganz körperlicher Ebene –, damit der Lernprozess auch im Stammhirn ankommen kann, damit wirklich nachhaltig Veränderungen im Gehirn möglich werden.
Neue Nervenbahnen im Stammhirn zu etablieren braucht Zeit und viele Wiederholungen, und genauso habe ich es mit den Geschichten gemacht: Immer und immer wieder bin ich in diese wohltuenden Bilder eingetaucht. Die neuen zarten neuronalen Verbindungen sollten zu breiten Straßen werden! Der Lesbarkeit halber habe ich in diesem Buch Wiederholungen reduziert – und auch, wenn sie dir als Lesendem vielleicht trotzdem manchmal wie überflüssige Schleifen vorkommen, bräuchte es für eine wirkliche Veränderung im Gehirn tatsächlich noch viele Wiederholungen mehr.
Um diese neue Qualität, die neue Realität, die ich mir selbst dadurch erschaffen habe, deutlich zu machen, sind die Heilungsgeschichten im Präsens, also in der Gegenwart formuliert. Wenn eine Heilungsgeschichte entsteht, wird sie im aktuellen Moment ganz körperlich erlebt: Der im Trauma eingefrorene Selbstanteil von damals wird heute versorgt und erlebt es im Hier und Jetzt.
Vielleicht kannst und willst du beim Lesen dieser Heilungsgeschichten auch eigene, in deiner Kindheit unversorgt gebliebene Anteile mitversorgen? Identifiziere dich gerne mit meinen jetzt nachgenährten, gut versorgten Anteilen oder erfinde deine eigenen Heilungsgeschichten!
Was ist Trauma?
Trauma ist ein lebensbedrohliches Ereignis, dass so überfordernd ist, dass es nicht verkraftet werden kann. Dabei ist es unerheblich, ob das Leben wirklich bedroht ist oder ob es nur als lebensbedrohlich wahrgenommen wird, ob es gestern passiert ist oder vor 50 Jahren, ob es erinnert werden kann oder nicht. Trauma ist Todesangst – ohne Verarbeitung und Integration dieser Erfahrung. Das Erlebnis wird durch diese Überforderung fragmentiert, also aufgesplittert und „zeitstabil eingefroren“ – quasi schockgefrostet. Das heißt: Ich kann durch bestimmte Auslöser („Trigger“) meine Gefühle von damals im Hier und Jetzt wieder erleben – auch ohne den Zusammenhang zu kennen, ohne zu wissen, wo sie plötzlich herkommen. Die in der Vergangenheit zeitstabil eingefrorenen Gefühle von Todesangst empfinde ich auch in der Gegenwart als real und echt, auch wenn die Gefahr jetzt nicht (mehr) dieselbe ist oder ich als Erwachsener damit eigentlich souverän umgehen könnte. Wenn ich die Auslöser dieser Gefühle nicht kenne oder identifizieren kann, kann diese Todesangst für mich vollkommen unerwartet quasi aus dem Nichts kommen.
Das Erlebnis oder die Erlebnisse können durch die Fragmentierung nicht mehr als Ganzes erinnert werden. Entweder kann auf Teile gar nicht mehr zugegriffen werden, oder die Gefühle und das Geschehen können nicht in Verbindung gebracht, nicht gemeinsam erinnert werden. Das Erlebnis bleibt im Heute, fühlt sich genau jetzt real an, kann nicht der Vergangenheit zugeordnet werden.
Es wird in der Psychologie zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma unterschieden. Ein Schocktrauma ist ein einmaliges Erlebnis, ausgelöst zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Unfälle. Auch ein Erlebnis von körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch Unbekannte kann ein Schocktrauma auslösen – wobei dann ja immerhin die Sicherheit des Elternhauses, der Rückhalt durch vertraute Bezugspersonen erhalten bleibt. Und dann gibt es noch den Fall, dass dieser einmalige Gewaltakt durch die Bezugspersonen selbst ausgeübt wird – meistens durch direkte oder etwas entferntere Verwandte, aber vielleicht auch den Babysitter –, von denen der betroffene Mensch, vor allem als Säugling oder Kind, abhängig ist.
Ein Entwicklungstrauma dagegen entsteht nicht durch ein einmaliges, sondern durch wiederholte traumatisierende Erlebnisse mit Bezugspersonen über einen längeren Zeitraum hinweg (z.B. Verwahrlosung, sexuelle Gewalt, Suchtabhängigkeit der Eltern, Übergriffe durch Betreuer*innen, Lehrer*innen …).
Natürliche Reaktionen auf ein traumatisches Erlebnis
Der Körper reagiert auf ein lebensbedrohliches Ereignis mit Kampf, Flucht oder – wenn das beides nicht möglich ist – mit einem Totstell-Reflex, auch „Freeze“ genannt. Der Körper stellt dafür alle notwendige Energie und Hormone bereit: Adrenalin wird ausgeschüttet, die Verdauung wird eingestellt, die gesamte Energie des Körpers wird fokussiert, um das Leben vor dem Tod zu bewahren. Diese Reflexe laufen durch unser autonomes Nervensystem blitzschnell ab – wir können gar nicht darüber nachdenken. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass wir viel schneller laufen konnten, um vor dem Raubtier zu fliehen, dass wir mehr Kraft zur Verfügung haben, um zu kämpfen, oder dass – wenn weder fliehen noch kämpfen möglich ist – unsere Muskeln vollkommen starr werden, um uns tot zu stellen. Diese Körperreflexe sind eine sinnvolle biologische Überlebensstrategie.
Wenn die Gefahr vorbei ist, das Lebewesen nach der Todesangst wieder sicher ist, dann entlädt sich der Körper vom Stress, er zittert und schüttelt sich – falls das nicht, wie bei uns Menschen, durch innere und äußere Verbote („Stell dich nicht so an!“) unterbunden wird oder, wie bei einem Entwicklungstrauma, sich das Gefährliche immer wiederholt und zum Alltäglichen wird. Bei allen anderen Säugetieren ist das Entladen durch Zittern ein normaler, gut zu beobachtender Reflex, denn die Körperreaktionen auf eine Bedrohung sind sehr anstrengend, und wenn die Gefahr vorbei ist, braucht es Zeit für Erholung. Dann ist man vielleicht erst mal erschöpft, müde und schlaff oder wird krank. Das ist ganz normal und schafft Zeit für Regeneration.
Überlebensstrategien und Dissoziation
Manchmal sind die traumatischen Erlebnisse so stark oder wiederholten sich so oft, dass die Seele keinen anderen Weg mehr weiß, als sich aufzuspalten. Ein Teil lebt dann irgendwie einfach weiter, funktioniert scheinbar normal, und ein Teil der Seele, die Schmerz, Schreck, Angst erlebt hat, wird verdrängt, verschwindet in der Dunkelheit, wird zum Schatten. Dadurch kann der Mensch überleben. Das ist eine gesunde Reaktion auf krankmachende Erfahrungen. Dieser Aufspaltungsprozess kann mehrfach geschehen. Der betroffene Mensch kann dann sogenannte dissoziative Störungen entwickeln, beispielhaft Sehstörungen, taube Gefühle in Armen oder Beinen, oder er fühlt sich wie weggetreten, nicht ganz bei sich, wie neben sich stehend. Auch eine multiple Persönlichkeitsstörung kann dadurch entstehen, das heißt, ein Mensch entwickelt zwei oder mehrere autonome, anscheinend normale Persönlichkeiten. Er spaltet sich auf.
Bin ich traumatisiert?
Traumatisierte Menschen werden oft durch einen Auslöser, einen Trigger wieder an ein nicht integriertes lebensbedrohliches Ereignis erinnert. Das kann ganz unbewusst geschehen, zum Beispiel durch eine Farbe, einen Klang, einen bestimmten Satz, einen bestimmten Blick. Dann reagiert der Körper genauso wie oben beschrieben: Adrenalin wird ausgeschüttet, die Darmtätigkeit wird heruntergefahren, das Gefühl von „Es geht um Leben und Tod!“ entsteht, auch wenn real gar keine Gefahr besteht. Das ist oft unverständlich, sowohl für die betroffene Person selbst als auch für die Menschen um sie herum. Dabei ist diese Reaktion einmal ein ganz sinnvolles Überlebensprogramm auf eine Gefahr gewesen. Der Körper reagiert jetzt wie damals, als das Trauma passierte – er weiß noch nicht, dass diese Situation heute nicht mehr lebensgefährlich ist. Der betroffene Mensch ist dann erst furchtbar gestresst – und dann sehr erschöpft. Der Stress entsteht durch das wiederholte Hochfahren des Überlebensprogrammes im Alltag, und die Erschöpfung, Kraftlosigkeit oder Depression ist einfach die notwendige Regeneration danach. Oft kennen diese Menschen gar keinen Zustand dazwischen. Trauma kann auch die Ursache für viele psychosomatische Krankheiten sein: Depression, Ängste, Panik, Burnout, Schmerzzustände aller Art und vieles andere mehr. Jeder Mensch ist anders, jede lebensbedrohliche Erfahrung ist anders, und so sind die Bewältigungsstrategien auch sehr vielfältig. Der Körper hilft oft, die Erfahrungen mitzutragen, wenn die Seele es nicht schafft.
Bindung mit selbst traumatisierten Eltern
In den ersten Jahren ist Bindung absolut überlebenswichtig für das Baby und Kleinkind. Sie brauchen Nahrung, Körperkontakt, Pflege, Aufmerksamkeit und Ansprache. Deshalb belohnt der Körper nicht traumatisierte Mütter und Vater mit Hormonen, die glücklich machen, wenn Bindung zum Baby aufgenommen wird. Das heißt, diese Eltern nehmen ihr Baby gerne auf den Arm, auch wenn es schreit. Das Baby macht wiederum alles, um die Bindung zu den Eltern zu stärken.
Bei Eltern, die selbst frühkindlich traumatisiert worden sind und diese Traumata nicht aufgearbeitet haben, kann das Schreien ihres Babys ein Trigger sein, also als lebensbedrohliche Situation erlebt werden. Diese Eltern reagieren mit Flucht, Kampf oder dem Totstell-Reflex, das heißt, sie gehen aus dem Raum oder schalten innerlich ab. Vielleicht schreien sie ihr Kind an, schütteln oder schlagen es – oder würden es am liebsten tun –; oder sie ignorieren es, erstarren, werden handlungsunfähig und fühlen sich total überfordert. So werden Traumata auch an die nächste Generation weitergegeben. Das Schreien des Babys wird vor allem dann als belastend und nicht aushaltbar erlebt, wenn die eigenen inneren Babys, diese kindlichen Selbstanteile selbst noch schreien und immer noch glauben, sie seien in dieser Not von damals.
Weitere Begriffsklärung rund um Trauma
Täterintrojekt: Ein Täterintrojekt entsteht, wenn ein Kind die Botschaften des Täters als eigene übernimmt. Es tut das, um die Bindung und ein Rest Autonomiegefühl zu behalten, damit es überleben kann. Dem Kind wird zum Beispiel die Botschaft vermittelt: „Du bist nichts wert!“ Das Kind denkt dann von sich selbst: „Ich bin nichts wert, denn sonst würde ja Vater oder Mutter nicht so mit mir umgehen – ich bin selber schuld.“
Täterloyalität: Um als Baby, Kleinkind und Kind zu überleben, braucht es Bindung. Das ganze Sein ist darauf ausgerichtet. Um diese Bindung herzustellen und aufrechtzuerhalten, braucht das Kind mindestens die Illusion von liebender Mutter, Vater und/oder anderen Bezugspersonen. Kinder übernehmen auch gerne die Last der Eltern, um dadurch ihre Bindung zu sichern. Für Heilung ist es aber wichtig, beim Erwachsenwerden nach und nach zu erkennen und zu realisieren, dass der eigene Vater, die eigene Mutter nicht nur gut mit einem umgegangen sind. „Das war doch nicht so schlimm, die hat es doch nicht so gemeint, sie hatte es ja auch schwer“ – das sind typische täterloyale Sätze, um das eigene Leid nicht anerkennen zu müssen und solidarisch mit denen zu sein, die einem das Leid zufügten. Diese Loyalität hilft, wenn ich Umgang mit den Tätern haben, irgendwie mit ihnen zurechtkommen muss – zum Beispiel in einem Abhängigkeitsverhältnis. Aber wenn ich mich außerhalb des Spielfeldes begebe, um nach Heilung zu suchen und dann durch diese Täterloyalität immer wieder in das Spiel hineingezogen werde, blockieren sie einen nachhaltigen Heilungsweg.
Selbstanteile: Dieser Begriff hilft, verschiedene Zustände des Selbst, der Persönlichkeit zu identifizieren: z.B. die funktionierende Alltagspersönlichkeit, die Wütende, die Anhängliche, die Eingefrorene, die Depressive, die ganz Kleine, das Schulkind, die Jugendliche, die junge Erwachsene … Diese Selbstanteile sind – mehr oder weniger – miteinander verbunden. Jeder Mensch hat verschiedene Anteile und Rollen. Je mehr Fragmentierung durch Trauma stattfindet, desto unverbundener sind diese Selbstanteile, manchmal sind sie sogar diametral entgegengesetzt. Oft wissen die verschiedenen Selbstanteile nichts voneinander, sie bleiben unbewusst, unverbunden. So lebt ein und dieselbe Person manchmal sehr unterschiedliche, unvereinbar scheinende Anteile aus, was für andere schwer nachvollziehbar sein und einen Umgang mit diesem Menschen erschweren kann.
Double Bind: So bezeichnet die Psychologie eine Aussage mit zeitgleich zwei widersprüchlichen Inhalten. Wenn jemand zum Beispiel sagt „Lass mal, ich kann das alleine“ und sich kurz darauf beschwert „Ist ja wieder typisch, niemand hilft mir!“, dann scheinen da zwei diametral entgegengesetzte Botschaften hinterzustecken: „Lass mich in Ruhe!“ und „Bitte hilf mir!“ Eine mögliche Ursache dafür ist, dass zwei verschieden gepolte Selbstanteile gleichzeitig gehört werden wollen – vielleicht der Anteil, der sich nach Unterstützung sehnt, und der, der seine Autonomie gefährdet sieht. Double-Bind-Botschaften können eine Traumafolgestörung sein, da die beiden widersprüchlichen Selbstanteile nicht miteinander verbunden sind.
Wie funktionierte die Traumatherapie, die ich machte?
Meine Therapeutin und ich als Klientin waren auf gleicher Augenhöhe, das heißt, zwei Erwachsene kümmerten sich gemeinsam um meine abgespaltenen Seelenanteile oder inneren Kinder. Wir nahmen Kontakt zu diesen Anteilen auf, fragten nach, was sie brauchen und gebraucht hätten und entwickelten Bilder, die meine inneren Kinder retteten, ihnen genau das gaben, was sie damals nicht bekommen hatten. Dabei haben wir die verschiedenen Selbstanteile ernstgenommen und gewürdigt, wir gaben ihnen das Gefühl, gesehen und gehört zu werden, wir fühlten, was sie gerade erlebt hatten (auch wenn es über 50 Jahre zurück lag) – und meine Therapeutin bestätigte es: „Das, was da geschehen ist, war überhaupt nicht gut, das war nicht richtig! Das war furchtbar schlimm und es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist!“
Ich wurde von meiner Therapeutin dabei unterstützt, mir meine eigenen Ressourcen, Stärken und schönen Erlebnisse immer wieder bewusst zu machen, damit meine neuronalen Autobahnen nicht immer automatisch in die Schreckenserwartungen einrasteten. Ein neuer Selbstanteil wurde ins Leben gerufen: die innere Beobachterin. Dieser Anteil lernte, sich nicht gleich mit allem zu identifizieren, sondern erst einmal ganz unbeteiligt die Lage zu sondieren, herauszufinden, um was genau es gerade eigentlich geht.
Die positiven Bilder und Geschichten brauchte ich, damit ich die Schrecken der Vergangenheit nach und nach verarbeiten und integrieren konnte. Ich lernte, mich an den neuen Bildern zu orientieren, ich lernte zu pendeln: Wenn die Schrecken in meinem Leben auftauchten, konnte ich bewusst an die sicheren Orte gehen, sodass ich mehr Kontrolle über mein Gefühlsleben bekam. Ich konnte nach und nach die alte Konditionierung durch neue Erfahrungen und Bilder überschreiben. Die Hirnforschung hat herausgefunden, dass es kaum einen Unterschied macht, ob wir uns etwas vorstellen oder ob es real geschieht: In beiden Fällen sind die gleichen Hirnregionen aktiviert. Das nutzten wir in der Traumatherapie. Positive auch ganz körperlich gefühlte Vorstellungen schaffen neue neuronale Verbindungen – und dadurch verlieren alte Trigger nach und nach an Kraft.
Wenn du nach dem Lesen dieser Informationen über Trauma oder des ganzen Buches neugierig bist und weiterforschen möchtest: Ich habe im Anhang nach dem Epilog ein paar Bücher aufgelistet, die für mich persönlich damals sehr wichtig gewesen sind.
Traumasensibel
Je mehr wir unsere eigenen Traumata und deren Überlebensstrategien kennen, darüber Bescheid wissen und sie würdigen, je mehr wir uns damit selbst annehmen und lieben können, desto leichter fällt uns das auch bei anderen Menschen. Wenn wir wissen, welchen Reaktionsautomatismus Trigger auslösen können, dann kommen uns Sätze wie „Stell dich nicht so an!“, „Reiß dich mal zusammen!“ oder „Das ist doch jetzt echt nicht so schlimm.“ nicht mehr so leicht über die Lippen. Wenn ein anderer Mensch für uns unverständliche, überzogene oder extreme Reaktionen zeigt, dann können wir das besser einsortieren, auch wenn wir nicht gleich wissen, woher genau diese Reaktion bei diesem Menschen kommt oder was sie hervorgerufen hat.
Traumasensibel zu sein bedeutet für mich vor allem, wohlwollend zu sein, sich bewusst zu machen, dass wir fast alle auf die eine oder andere Art extreme Erlebnisse hatten und erst einmal sinnvolle Überlebensstrategien dafür entwickelt haben, die nicht einfach so ausgeschaltet werden können. Traumasensibel zu sein bedeutet für mich, beobachten zu lernen – anstatt gleich in eine Reaktion zu gehen. Und vielleicht zu fragen: „Was brauchst du?“
Wir können lernen, uns selbst so, wie wir sind, immer besser anzunehmen und zu lieben – und das dann auch bei unseren Mitmenschen tun. Es bedeutetet, auszusteigen aus der Trigger-Spirale – aus Eskalationssituationen, bei denen wir uns hocherregt verbal oder gar körperlich gegenseitig fertigmachen – und einander wohlwollend in der Andersartigkeit wertschätzen zu lernen.
Triggerwarnung und Selbstfürsorge
Natürlich will ich das erwähnen, denn es geht in diesem Buch um Themen, die ich lange von mir abgespalten hatte, weil sie zu schrecklich waren, um damit leben zu können: Mir war zwar wichtig, meine Worte möglichst achtsam zu wählen – aber ich wollte auch das Verschwiegene endlich benennen und habe an vielen Stellen bewusst der Wahrhaftigkeit in meinem Ausdruck und Stil die Priorität gegeben. Welcher Lesende durch welche Worte oder Inhalte getriggert wird, das kann und will ich nicht vorweg nehmen. Ich glaube, du kannst selbstverantwortlich mit dem Inhalt des Buches umgehen.
Und ja: Die Inhalte des Buches könnten dich an einigen Stellen überfordern. Wenn du beim Lesen starke emotionale Reaktionen erlebst, dann nimm dir Zeit für dich. Würdige diese Emotionen. Mache eine Pause beim Lesen, Beobachte, welche Aussage welche Reaktion bei dir ausgelöst hat, erlaube dir, deine Empfindungen zu Ende zu fühlen oder/und zu zittern – ohne tiefer in den damaligen Schrecken hineinzugehen. Du musst den Schrecken nicht wiederholen. Sei mitfühlend mir dir. Vielleicht gibt es auch einen vertrauten Menschen in deiner Nähe, mit dem du nährenden Körperkontakt teilen kannst oder der dir zuhört. Mir persönlich tat es immer gut, wenn ich durch ein Buch auf meine traumatischen Themen gestoßen wurde. Es hat mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen, es fühlte sich an wie Zeugenschaft: „Oh, ich bin nicht alleine mit dieser Erfahrung!“ Das hat mich getröstet. Und vielleicht hilft es, wenn du anschließend eine Heilungsgeschichte liest. Oder hast du Lust, für dich selbst eine Heilungsgeschichte zu entwerfen? Was hätte dir gut getan, damals, als du noch klein warst, was hättest du gebraucht? Vielleicht hätte dir etwas ganz anderes gut getan als mir. Wenn der Schmerz, die Angst, die Panik kommt, dann visualisiere eine rettende Person, einen sicheren Ort, erinnere dich an etwas, was gut in deinem Leben war.
Und natürlich, wenn du dich allein (noch) nicht (ausreichend) regulieren kannst, hole dir Hilfe! Suche dir eine Traumatherapie. Zum Beispiel auf www.therapie.de kannst du schauen, ob dich jemand anspricht. Für mich hat sich gute therapeutische Begleitung immer wieder gelohnt und mir geholfen.
Meine Eltern
Meine Eltern heiraten am Valentinstag, den 14.2.1945, einen Tag nach dem 18. Geburtstag meines Vaters, an dem Tag, als Dresden in Flammen lag. Den Feuerschein konnte man bis in das kleine Dorf – etwa 130 km von Dresden entfernt – sehen. Mein Vater war einberufen und meine Mutter schwanger, und sobald mein Vater für seine Hochzeit beurlaubt worden war, konnte geheiratet werden. Zwei Tage später zog mein Vater wieder in den Krieg und geriet später dann in amerikanische Gefangenschaft. Mein Bruder Volker wurde im April 1945 während eines Bombenalarms im Elternhaus meiner Mutter geboren. Anfang 1946 kam mein Vater aus der Gefangenschaft wieder zurück. Ein Jahr später bewarb er sich für einen Studienplatz, aber als Unternehmersohn war ihm in der sowjetischen Zone das Studieren untersagt. Stattdessen folgte die Einberufung ins Uranbergwerk. Direkt in der darauffolgenden Nacht floh mein Vater mit Unterstützung seines Schwiegervaters sofort in den Westen, wo er dann in Mannheim Betriebswirtschaft studierte. Dort fand er Ende 1951 eine Anstellung, und meine Mutter folgte ihm 1952 nach Wiesbaden. In der Zeit davor besuchte sie ihn ab und zu – sie musste dazu mehrmals schwarz über die Grenze, was immer mit einer sehr großen und berechtigten Angst verbunden war. 1953 wurde mein Bruder Volker in den Westen geholt und meine Oma Anna, die Mutter meines Vaters, kam einen Monat später nach. Im Oktober 1954 machte mein Vater sich mit einer Bindfaden- und Seilerwarengroßhandlung selbstständig. 1960 kam ich zur Welt. Im August 1961 wurde die Mauer gebaut und schloss alle Türen zur Vergangenheit. Die Heimat, die Verwandtschaft und die Freundschaften – alles war jetzt hinter dem Eisernen Vorhang. Aber man blickte nach vorne, ein schöneres und besseres Leben wurde aufgebaut und es durfte nie wieder Krieg geben. Weihnachten 1964 konnten meine Eltern schon im eigenen neuen Haus feiern.
In diesem Buch erzähle ich meine Geschichte, wie ich sie erlebt habe. Ich weiß, dass meine Eltern grundsätzlich eine gute Absicht hatten und das Beste für mich wollten. Sie wollten nicht böse oder schlecht sein – und sahen sich selbst auch nicht so. Trotzdem: In dieser, meiner Geschichte, in diesem Buch sind meine Eltern die Täter! Auch wenn sie ihr Bestes gegeben haben mögen.
Mein Aufwachsen wurde von ihren eigenen Traumatisierungen, unterdrückten Gefühlen, Verlusten, Geheimnissen, Intrigen, Tabus, Überlebensstrategien und von ihrem Schweigen darüber bestimmt.
Weil ich auf meine Eltern angewiesen war – als Säugling, als Kleinkind, als Schulkind –, musste ich täterloyale Anteile entwickeln, um zu überleben. Das heißt, ich habe mein eigenes Leid oft negiert und war in einer Art Schonhaltung meinen Eltern gegenüber, rechtfertigte ihr Verhalten durch Sätze wie „Meine Mutter, mein Vater hat es ja nur gut gemeint.“ oder „Ich muss doch für meine Eltern da sein, die brauchen mich doch!“ oder „Ich bin schuld, falsch, schlecht – aber meine Eltern sind richtig und gut.“ Das war eine sinnvolle Überlebensstrategie, solange ich mit ihnen zusammenlebte.
Und ja, natürlich könnte man bei jeder Interaktion, jeder Handlung meiner Eltern dahinter eine gute Absicht sehen und „nur“ Unvermögen interpretieren. Aber darum geht es mir hier nicht. Es geht um mein ganz persönliches Erleben: Mit diesem Buch beziehe ich ganz klar Stellung für mich als traumatisierte Tochter.
Bevor Verständnis für meine Eltern, das systemische Verstehen größerer Zusammenhänge und vielleicht das Verzeihen kommen kann, braucht es erst einmal mein persönliches Anerkennen, dass ich etwas Furchtbares erlebt habe, muss die ehrliche Feststellung Platz haben: Ja, das war so. Das war mein Erleben, meine Wahrnehmung, das und das habe ich gefühlt und das und das bedeutet es für mich. Durch das Niederschreiben erkenne ich das an – und mit dem Lesen dieses Buches schenkst du mir deine Zeugenschaft.
Ich beabsichtige, einen Folgeband herausbringen, in dem es um die Traumata meiner Eltern gehen wird. Ich habe weitergeforscht und bin auf ganz „normale“ Ungeheuerlichkeiten im Leben meiner Eltern gestoßen. Ich verstehe jetzt, dass mein Leid seinen Ursprung viel, viel früher hatte. Und wahrscheinlich liegt der Ursprung für das Leid meiner Eltern wieder eine oder mehrere Generationen weiter zurück.
Mir wird immer verständlicher, warum meine Mutter mich so abweisend behandelt hat und warum mein Vater bei mir sexuell übergriffig geworden ist. Mein Verstehen rechtfertigt nichts davon. Auf gar keinen Fall! Aber es macht für mich deutlich, dass meine Eltern nicht alleine die „Täter“ waren, sondern mit ihnen ein ganzes Familiensystem – oder vielleicht auch ein ganzes Gesellschaftssystem mit dem Gedankengut des Dritten Reichs.
Es ist möglich und notwendig, auch transgenerative, also an nachfolgende Generationen weitergegebene Traumata zu bearbeiten. So entwickelte ich auch für das Leben meiner Eltern Heilungsgeschichten – was wiederum direkte heilende Auswirkungen auf mein Leben hatte. Aber bevor ein Trauma „heilen“, also sich integrieren kann, ist Anerkennung und Würdigung nötig für das, was war.
Für meinen ganz persönlichen Heilungsweg heißt das: Die schonungslose Aufdeckung der Täterschaft meiner Eltern mir gegenüber ist ein wesentlicher Schritt.
1. Säugling, Kleinkind und Grundschulzeit
(1960-1970)
Ich wurde an einem wunderschönen Sonntag im September 1960 als Wunschkind in Wiesbaden geboren. Meine Mutter war stolz, dass die Leute ihre Schwangerschaft erst gar nicht bemerkten. Sie trug ein Korsett und daher war es für mich als Embryo nicht wirklich kuschelig in ihrem Bauch. Bei meiner Geburt schrie sie nicht, im Gegensatz zu den anderen Mitgebärenden. Das weiß ich aus erster Hand, da sie mir das mal stolz erzählt hat. Meine Eltern, mein Bruder – damals 15 Jahre alt – und meine Oma waren meine Familie, wir lebten bis 1964 im 4. Stock eines Mietshauses in der Wiesbadener Innenstadt.
Meine Mutter war Hausfrau, sie putzte und kochte, half meinem Vater im Geschäft mit Ablage und Telefondiensten und nähte für Kunden. Sie konnte sich rein zeitlich also gut um mich kümmern. Materiell gesehen machte sie das auch perfekt: Ich hatte immer genug gutes Essen und feine Kleidung. Mir mangelte es an nichts, außer an menschlicher Wärme. Denn meine Mutter war innerlich meist gar nicht anwesend. Sie funktionierte, aber Nähe konnte ich mit ihr nicht erfahren. Wahrscheinlich redete sie kaum mit mir. Kuscheln, einander herzen, Blödsinn machen, sich miteinander wohl fühlen, kitzeln, gemeinsam spielen – das gab es nicht mit meiner Mutter.
Wenn ich als kleiner Säugling zu lange und zu laut im Schlafzimmer – in dem sowohl meine Eltern als auch mein Bruder schliefen – schrie, wurde ich in die kalte Küche gestellt. Die schmale, längliche Küche hatte einen dunkelroten Linoleumfußboden und eine Türe, die auf einen Balkon führte.
Schon in früheren Therapiesitzungen (seit ich 21 bin, bin ich immer wieder in therapeutischen Behandlungen) tauchten immer wieder körperliche Erinnerungen an einen Saugreflex und anschließend an Ekel, Würgereflexe, Abwehr, Angst und ans Alleinsein auf. Warum wohl weinten Säuglinge, die in der Nachkriegszeit – so wie ich eben 1960 – geboren wurden? Die Kinder, die sofort von der Mutter getrennt und noch immer nach den Grundsätzen des Dritten Reichs behandelt worden sind? Natürlich weinen sie wie alle Babys, weil sie die Nähe zur Mama und Körperkontakt suchten, Angst, Hunger oder Durst hatten, Aufmerksamkeit brauchten oder ihnen etwas wehtat – aber damals sagte man, sie weinen, um die Stimme zu kräftigen.
Krankenhausgeburten waren in der Nachkriegszeit alleine wegen der gängigen Praxis höchst traumatisierend und sind es leider auch heute noch sehr oft. Damals war die sofortige Trennung von der Mutter üblich und wurde als medizinisch notwendig angesehen. Die Nabelschnur wurde sogleich durchgeschnitten, das Kind konnte nicht entscheiden, wann es seinen ersten Atemzug nehmen wollte, sondern da gab es den Klaps auf den Po in grellem Licht. Das Kind wurde gleich untersucht, gewogen, gewaschen, anstatt dass es sich auf dem Bauch der Mutter erst einmal ausruhen und in der Welt landen konnte. Es gab keine Atmosphäre von „Oh, da bist du ja – herzlich Willkommen!“ – stattdessen lag der Säugling die erste Woche alleine in einem Bettchen auf der Säuglingsstation und wurde der Mutter nur alle vier Stunden zum Stillen gebracht. Dieses Prozedere haben hunderttausende von Menschen erlitten – ganze Generationen lang. „Ein Klaps auf den Po hat noch niemandem geschadet!“
Das Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ war das Erziehungsbuch damals. Als ich vor vielleicht 25 Jahren das erste Mal davon hörte, war ich entsetzt und richtig schockiert. Dieses Buch von Johanna Haarer war ein Ratgeber für Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus über Schwangerschaft und Entbindung, das Wochenbett sowie die Säuglingspflege im ersten Lebensjahr des Kindes. Es wurde 1934 in erster Auflage veröffentlicht und prägte die Vorstellungen von Erziehung im Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Haarers Bücher von den Alliierten verboten. Unter dem Titel „Die Mutter und ihr erstes Kind“ wurde das Buch allerdings – in überarbeiteter Fassung und ohne Hinweis auf die Erstausgabe – später erneut herausgegeben, 1987 (!!!) in letzter Auflage. Mit der Frage, wie diese Ratgeber noch heute Einfluss auf die Kriegskinder und deren Kinder nehmen, haben sich zahlreiche Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen befasst.
Meine Mutter machte jedenfalls alles genau nach Anleitung: Sie stillte mich alle vier Stunden, nicht öfter und nicht seltener. Und sie achtete darauf, dass ich ihr dabei nicht zu nahe kam. Das wäre wahrscheinlich unschicklich oder unanständig gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich einmal drückte, freudig in den Arm nahm. Ich forschte wirklich intensiv. Da ist nichts und da wird auch nichts kommen. Wie schön wäre eine solche Erinnerung für mich, wie sehr könnte sie mir das Herz wärmen, wäre da auch nur eine einzige.
Aber ich hatte ja meinen Papi. Den liebte ich. Ich war seine Püppi, sein Sonnenschein, ich wartete darauf, dass er abends nach Hause kam. Mein Vater nahm mich voller Freude in den Arm, er herzte mich, er war stolz auf mich. Meine ersten Worte waren: „Papi – Arm“. Mein Vater nahm mich dann hoch, bei ihm war ich sicher, bei ihm durfte ich sein, auf seinem Arm hatte ich Lust, die Welt zu entdecken. Er war auch nicht dafür, mich so oft in die kalte Küche zu stellen. Ich glaube, er hätte mich einfach mit ins elterliche Bett genommen, damit ich ruhig werde. Aber meine Mutter wollte das bestimmt nicht: „Kinder dürfen nicht verweichlicht werden, sie werden sonst verzogen!“ Andeutungen, dass es so gewesen sein könnte, fand ich viel später in einem speziell für mich geschriebenen Tagebuch meines 15 Jahre älteren Bruders: Er hat über die ersten drei Jahre meines Lebens als Säugling und Kleinkind darin berichtet.
So fing mein Leben in einer richtigen Wirtschaftswunderfamilie an. Der Bausparvertrag war schon abgeschlossen, mein Bruder Volker, der noch während den letzten Kriegsmonate geboren wurde, war in den Westen geholt worden und die Mutter meines Vaters ebenfalls. Die kleine Mietwohnung war schon ein richtiger Luxus, aber es sollte noch besser werden, jetzt sollte alles gut werden! Ich wurde als Wunschkind gezeugt – ich war kein Unfall oder Mittel zum Zweck, wie das vielleicht bei Volker, meinem Bruder gewesen war – und ein Haus wurde gebaut. Jetzt sollte die kleine Familie doch noch eine richtige Familie werden, nach so vielen Trennungen, Entbehrungen, Heimatverlust und Unsicherheiten! Jetzt begann das gute Leben! Nach dem stillen Motto: Wir sind wer, und wir können was. Wir werden es beweisen.
Ja, mir wurde immer wieder gesagt, dass ich ein Wunschkind sei. Ich sollte es mal besser haben. Ich war der Motor für meine Eltern. Ich sollte der Beweis sein, dass jetzt alles gut ist, dass alles richtig ist. Für mich rackerten sie sich ab – so sagten sie es jedenfalls und wahrscheinlich dachten sie das auch.
Meine Mutter konnte mir keine Liebe geben. Bis heute weiß ich nicht, welche Traumata sie in ihrem Leben erleiden musste. Sie wird welche erlebt haben, denn ihr Verhalten ist vergleichbar mit denen von Frauen aus vielen Familiengeschichten, die ich gelesen habe, Frauen, deren Leben auf das Verschweigen traumatischer Ereignisse ausgerichtet war. Meine Mutter schwieg, sie wich aus, konnte Fragen nicht ertragen, bekam einen hysterischen Anfall, wenn sie es nicht schaffte, die Frage im Vorfeld abzuwehren. Sie hörte nicht zu. Sie antwortete nicht auf die Fragen, die ihr gestellt worden waren. Sie überschüttete mich ständig mit Vorwürfen, ohne es zu merken. Wenn ich sie darauf ansprach, sagte sie in einem sehr beleidigten Ton, der keine Widerrede zuließ: „Ich werde doch noch mal meine Meinung äußern dürfen!“
In Therapien und Sitzungen konnte ich, wenn ich in trance-ähnliche Zustände kam, immer wieder verschiedene Traumata meiner Mutter erspüren. Sie hatten mit Sex zu tun, mit Abtreibung, mit Schuld und Scham. Ich vermute, nein, ich bin ziemlich sicher: Es gab in ihrer Familie auch schon an sie weitergereichte, generationsübergreifende Traumata. Meine Mutter streitet bis heute ab, jemals mit einem anderen Mann etwas gehabt zu haben, geschweige denn missbraucht worden zu sein. Vielleicht ist das so – aber vielleicht musste auch sie ihre Erinnerungen abspalten, um zu überleben.
Trotz meiner fast 30-jährigen Therapiegeschichte, in der ich mir ein sicheres Umfeld schaffen konnte, traute ich es mich lange nicht, zu denken, geschweige denn zu sagen: „Mein Vater hat mich sexuell missbraucht.“ Denn was tue ich damit meinem Vater an – dem einzigen Menschen, der mich liebte, mit dem ich menschliche Nähe erfuhr!? Das kann doch gar nicht stimmen! Entweder bilde ich mir das ein, oder es war jemand anderes. Mein Bruder vielleicht. Das wäre doch einfach. Der lebt nicht mehr. Dem könnte ich doch meine frühkindlichen Bilder in die Schuhe schieben, oder?
Ich würde gerne die Wahrheit von einer wissenden Zeugin, von meiner Mutter wissen. Bin ich überhaupt die Tochter meines Vaters? Vielleicht hatte meine Mutter ja mal einen Silvesterrausch, vielleicht tanzte endlich mal ein anderer Mann mit ihr. (Mein Vater tanzte nicht und meine Mutter wollte es immer so gerne!) Vielleicht war sie einmal kurz beschwipst und ich bin in irgendeiner Toilettenkabine gezeugt worden. War ihr schlechtes Gewissen so groß, dass sie nie irgendwas bemerkte, z.B. Spermaflecken auf meinem Strampelanzug? Das muss eine Mutter doch merken, oder? Mir wäre so geholfen, wenn sie mir meine Erlebnisse bestätigen könnte. Ich weiß, dass sie das nie tun wird, es nicht tun kann. Und so suche ich weiter nach Erklärungen, weil ich das, was in mir ist, nicht greifen kann. Ich behaupte nicht, dass es auf jeden Fall so war, trotzdem helfen mir diese möglichen Erklärungen, mich und mein Leben heute besser anzunehmen.
Eins meiner Hauptprobleme war, dass ich immer wieder an meiner Wahrnehmung zweifelte, nicht nur in Bezug auf meine Missbrauchs-Vermutung, sondern generell. Ach, Sabine, da war doch nichts, das bildest du dir doch nur ein! Du hast schlecht geträumt. Immer wieder war und bin ich von mir überzeugt und will etwas tun, aber dann kommen die Zweifel: Ach Sabine, das ist doch nicht so, wie du denkst. So kannst du das doch nicht machen, so geht das nicht!
Ich weiß, wie süß die Haut eines Babys duftet, wie sanft die Berührung einer kleinen Patschhand ist, wie zart. Wo konnte mein Vater das sonst erleben? Ich weiß, welche Sinnlichkeit Babys mitbringen, sie sind noch so zerbrechlich und angeschlossen an das heilige Mysterium. Wo sonst im Leben eines Mannes, der aus dem Krieg kam, hätte er diese Qualität erleben können? Berührung gab es in unserer Familie nicht, Sexualität war absolutes Tabu, es gab sie einfach nicht. Aber Babys brauchen Berührung – und löste Berührung bei meinem Vater dann zwangsläufig sexuelle Erregung aus? Und war da die Hypothese: „Die ist ja noch so klein, die merkt ja noch nichts“? Und außerdem war da sowieso nichts, denn es kann nicht gewesen sein, was nicht gewesen sein darf.
Da war die unendliche Einsamkeit dieses kleinen Mädchens. Alle meine Gefühlsäußerungen wurden nicht adäquat beantwortet. Wenn ich schrie, wurde ich weggebracht, anstatt auf den Arm genommen zu werden. Während einer Therapiesitzung tauchte einmal die starke Körpererinnerung von Atemnot und von Druck auf dem Kopf auf. Wurde mir vielleicht sogar in Überforderungssituationen ein Kissen auf mein kleines Gesicht gedrückt, bis ich fast erstickte? Das allein schon würde die Angst vor meiner Mutter erklären. Ich konnte ihr