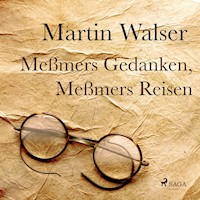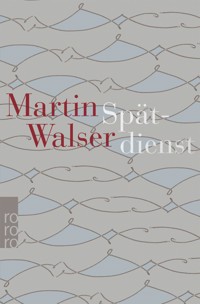14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Unser Auschwitz – so hat Martin Walser im Jahr 1965 einen Aufsatz überschrieben, in dem er festhält, was er als Beobachter beim Auschwitz-Prozess erlebt hat. Seitdem hat er sich mit der deutschen Schuld immer wieder auseinandergesetzt. Dabei gab es – etwa als Reaktion auf seine sogenannte Paulskirchenrede – Kontroversen, in denen seine Haltung zur deutschen Vergangenheit mitunter heftig in Frage gestellt wurde. Dieses Buch zeigt, wie vielfältig und kontinuierlich sich Martin Walser seit seinen schriftstellerischen Anfängen mit der deutschen Schuld beschäftigt hat – als Erzähler, Stückeschreiber, Essayist und Redner, in Artikeln und Interviews.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Ähnliche
Martin Walser
Unser Auschwitz
Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Andreas Meier
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Unser Auschwitz – so hat Martin Walser im Jahr 1965 einen Aufsatz überschrieben, in dem er festhält, was er als Beobachter beim Auschwitz-Prozess erlebt hat. Seitdem hat er sich mit der deutschen Schuld immer wieder auseinandergesetzt. Dabei gab es – etwa als Reaktion auf seine sogenannte Paulskirchenrede – Kontroversen, in denen seine Haltung zur deutschen Vergangenheit mitunter heftig in Frage gestellt wurde. Dieses Buch zeigt, wie vielfältig und kontinuierlich sich Martin Walser seit seinen schriftstellerischen Anfängen mit der deutschen Schuld beschäftigt hat – als Erzähler, Stückeschreiber, Essayist und Redner, in Artikeln und Interviews.
Über Martin Walser
Martin Walser, 1927 in Wasserburg geboren, lebt in Überlingen am Bodensee. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis und 1988 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Seine jüngsten Veröffentlichungen sind «Schreiben und Leben. Tagebücher 1979–1981» und «Shmekendike blumen», ein Lesebuch über den jiddischen Autor Sholem Yankev Abramovitsh.
Der Herausgeber Andreas Meier, 1957 geboren, ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Bergischen Universität Wuppertal. 2015 erscheint sein «Martin Walser Werkverzeichnis (1949–2009)».
Inhaltsübersicht
Ehen in Philippsburg
(Auszug)
Professor Mirkenreuth bot Kaffee an und Cognac und Zigaretten, sorgte für Bequemlichkeit und breitete behaglich seine Biographie vor Hans’ Bleistift aus. Hans lernte einen musterhaften Mann mit einer musterhaften Biographie kennen. Der Professor war früher selbst Journalist gewesen, sogar beim Rundfunk hatte er schon gearbeitet, Schulfunk, ja, und dann war der Krieg gekommen, den er als Kriegsberichterstatter an allen Fronten kennengelernt hatte. Bis auf den heutigen Tag existierten noch seine berühmt gewordenen Schilderungen von Luftkämpfen auf Tonband. Er spielte Hans eines davon vor. Er selbst war in einem «Jäger» mitgeflogen, hatte den ganzen Kampf aufgenommen, auch das, was über die Kehlkopfmikrophone laut wurde: die Atemzüge der Flugzeugführer, der feindlichen und der eigenen, die Beschimpfungen, in die sie während des Kampfes ausbrachen, die Flüche, die Warnungen, die sie den Staffelkameraden zuriefen, wenn ein Gegner sich von rückwärts aus dem toten Winkel heranpirschte, und schließlich sogar noch die letzten Schreie der abgeschossenen Flugzeugführer, der tonlose Schrei: ich brenne; der gurgelnde Fluch: damned; das Röcheln, das in Geprassel unterging, bis zu dem Klick, dem Geräusch, das den Augenblick festhielt, in dem Mirkenreuth sein Aufnahmegerät wieder abgeschaltet hatte. Gegen Ende des Krieges waren seine Reportagen verboten worden, er hatte Innendienst tun müssen, dafür aber hatte ihn die Besatzungsmacht sofort rehabilitiert, er war beauftragt worden, die Volkshochschulen im Lande aufzubauen, für Verbreitung demokratischer Gesinnung zu sorgen, und schließlich hatte er sogar an der Technischen Hochschule einen Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie erhalten; nie aber war in all der Zeit seine Sorge für den Rundfunk eingeschlafen, als Angehöriger des Rundfunkrates hatte er Einfluß genommen und gebessert, was er zu bessern vermochte.
Ja, und dann seine Programmkonzeption: der Rundfunk müsse zum Herzen sprechen und dürfe nicht dem Intellekt oder niederen Instinkten dienen! Mancher Verantwortliche sei darüber schon gestolpert. Nicht Instinkt, nicht Intellekt, sondern Herz! Denn der Rundfunk sei die Sonne des Familienlebens in der heutigen Zeit. In den Ameisenwohnungen der Großstadt, in dieser Zeit, in der alles der Zerstreuung oder der Spezialisierung diene, da die Familie den zersetzenden Kräften geschäftstüchtiger Libertinisten ausgesetzt sei, da müsse der Rundfunk Erbauung und Belehrung so verbinden, daß die Familie einen neuen Schwerpunkt erhalte … Hans stenographierte mit klopfenden Schläfen. Dieser Bekanntgabeton öffentlicher Männer erregte ihn immer wieder. Er verschmerzte den Sturz des alten Intendanten jetzt leichter. Hier war ja doch wieder ein Mann, der es gut meinte. Hans bedankte sich und trug seine Notizen ins Büro.
Halbzeit
(Auszug)
Es muß schön sein, wenn man sich’s leisten kann, sich vor einem Beruf zu drücken, sagte Susanne.
Das kann sich jeder leisten, sagte ich großspurig.
Meinen Sie, sagte Susanne und sah mich feindselig an. Sie habe einen Onkel in Breslau gehabt, sagte sie, Onkel Herbert, bei dem konnte man Vogelfutter und Hundekuchen und Wellensittiche kaufen. Der hat 1936 einen großen Käfig ins Schaufenster gestellt. In dem Käfig lebten eine Katze und eine Blaumeise. Onkel Herbert hatte die beiden so aneinander gewöhnt, daß sie aus einem Tiegel fraßen. Aber sein Ladengehilfe, der HJ-Führer war, wechselte eines Morgens die Katze aus, als mein Onkel gerade nicht im Laden war, und als der Onkel zurückkam, war die Blaumeise tot. Außen am Schaufenster klebte ein großer Zettel, auf dem stand: So geht es, Herr Schwedenser, wenn die Rasse sich rührt.
Schon wollte ich einwenden, daß die Idee des Onkels, falls er mit seinem Käfig etwas Symbolisches im Auge hatte, eine sehr unglückliche Idee gewesen sei, aber Susanne, die jetzt Gott sei Dank viel leiser geworden war, sprach sofort weiter. Um diese Zeit sei sie in Kolumbien gewesen. Onkel Herbert habe einen Brief um den anderen geschrieben, aber ihre Eltern hätten immer zurückgeschrieben, wovon denn er, der zoologische Händler, in Bogotá leben wolle? Onkel Herbert fuhr dann nach Budapest, wurde Lotterieeinnehmer. Ein paar Jahre später brachte man ihn nach Auschwitz, wo er, Sie wissen ja.
Mhm.
Sie hob ihre Stimme an und leierte rasch herunter, was sonst noch passiert war. Sie sprach, als stünde sie unter einem ihr widerlichen Zwang, als erzähle sie gegen ihren Willen die Geschichte eines langweiligen Sonntagsausflugs. Und weil sie so hastig sprach, so, als sei es sinnlos, bei irgendeinem Punkt länger zu verweilen, wirkte alles wie ein Trickfilm, der zu schnell läuft, ein Trickfilm, in dem Bewegungen von Heeren dargestellt werden mit Männchen, Pfeilen und gestrichelten Linien, der Globus drehte sich, Breslau ein roter Punkt, Jahreszahlen schossen auf, begannen zu glimmen, zu brennen. Herr Schmolka griff seine Frau an der Hand, sie hielt es noch für eine alltägliche Zärtlichkeit, er aber zog sie über den Globus hinüber, hinab nach Kolumbien. Wievielmal fliegt einem da Ruß ins Auge, daß es tränt? Die Münder der Direktoren in Bogota straffen sich unter den Bärtchen, öffnen sich dann aber wieder, als Herr Schmolka aus der gerade in Hamburg gekauften Offenbacher Mappe die Papiere hervorholt. Dies ist zwar eine Zementfabrik, mein Herr. Aber immerhin ein deutscher Chemiker. Bereut er alles? Oder warum sonst sagt er seiner Frau ins Gesicht, daß sie ohne ihn in Dachau säße? Was jetzt geschieht, hätte auch in Breslau geschehen können. Dann hätte aber Frau Schmolka keine so weite Reise gehabt, bis sie mit der zweijährigen Susanne wieder bei ihrer Mutter war. Die führt sie gleich wieder auf den Breslauer Bahnhof und fährt selbst mit. Vorsichtig über die Perrons des Schlesischen äugend, zieht sie Tochter und Enkelin hinter sich in die U-Bahn. Zum Anhalter. Und nach Genua. Das kleine Schiff hastet wieder über das Meer. Herr Schmolka ist überrascht. Er stellt seine Frau vor, Lissi, geborene Spiegel, aus Köln. Die Schwiegermutter bietet ihm allen Schmuck an. Aber was soll er mit zwei Frauen? Das geht doch nicht. Also kann er auch den Schmuck nicht nehmen. Zurück nach Breslau. Die Großmutter in Gedanken an der Reling. Die Mutter mit Augen ohne Regung im Liegestuhl, wahrscheinlich hält sie ein Buch vors Gesicht. Auch ein solches Schiff kommt an. Die Großmutter legt vielleicht sogar Wert darauf. Sie rennt zum Postamt, telegraphiert nach Budapest und schickt Tochter und Enkelin hinter dem Telegramm her, als sollten sie’s einholen. Der Onkel Lotterieeinnehmer, der sich zu helfen gewußt hat, empfängt sie und küßt, darf man annehmen, von Susannes kleinem Gesicht die vielen tausend Kilometer.
Oma selbst kann nur in Breslau leben. Mir passiert nichts, schreibt sie in jedem Brief. Schließlich ist er Offizier gewesen, sollen sie nur die Tür aufreißen, sein Eisernes erster Klasse liegt unter Zellophan auf staubfreiem Kissen, und beim Freikorps noch ein Bein verloren. Sorgt euch nicht um mich, schreibt sie bis sie, nach Bautzen transportiert, das nicht mehr und auch sonst nichts mehr schreiben kann, weil sie, Sie wissen ja.
Ihren Fohlenmantel hat sie denen mit nach Budapest gegeben und den ganzen Schmuck.
Folgt ein kurzes Kapitel, überschrieben: gut, daß die beiden katholisch sind. Susanne seh’ ich im Bergkloster unter Magyarenmädchen sitzen, als wäre sie selbst eins. Die Nonnen lehren zwar die Kleinen, alle Juden seien Menschenfresser, aber Susanne weiß ja nicht, daß sie eine Jüdin ist. Mitten in den Gesang rennt Mutti hinein. Susanne geniert sich. Endlich fährt der Omnibus. Der Onkel bleibt zurück und weint, als wisse er schon, daß ihn einer verraten und nach Auschwitz bringen wird. Der Zuschauer folgert: solang einer Abschied nimmt, weiß er mehr, als er selbst ahnt. Insbesondere der, der zurückbleibt. Warum bleibt er dann zurück? Weil er nicht ahnt, was er weiß. Einer Ahnung gehorcht er blind, gegen das, was er weiß, gibt es Argumente.
Vom vereisten Laufsteg, zwischen Rumänien und dem türkischen Schiff, fällt Mutti ins Wasser, wird aber gerettet. In Istanbul ist es eine Zeit lang, wie es in Istanbul sein soll. Bis hierher kommen die Landsleute wohl nicht. Ein richtig reicher Mann, der einfach Geld genug hat und Häuser und Diener, ein Landsmann sogar, Susanne darf ihn Onkel nennen, der sorgt für sie. Im Hotel braucht Susanne, wenn die Mutter in der Stadt ist, nur an der grünen Quaste mit den goldenen Troddeln zu ziehen, dann kommt Achmed und fragt, was sie will, sogar ans Bett setzt er sich und erzählt Märchen in einer lustigen Sprache, die sie zur Hälfte versteht. Es geht in Achmeds Märchen ganz anders zu als in ihrem Märchenbuch. Wenn sie starr vor Angst ist, streichelt er sie. Plötzlich prasselt Regen herab und verjagt das Geschrei von der Straße. Susanne erschrickt, und erschrickt gleich noch einmal, denn Achmed legt sich zu ihr. Sie schreit, obwohl sie nicht recht weiß, warum. Wie vom Schutzengel selbst geschickt, es gibt ihn also doch, kommt Mutti. Achmed grinst, erklärt, zieht sein Gesicht in die Breite und in die Länge und Mutti lacht und gibt ihm ein Trinkgeld, da lacht er noch mehr, und immer noch lachend, geht er rückwärts und sich verbeugend hinaus. In der nächsten Szene gehen beide, die ich, wie es zur Zeit ähnlicher, wenn auch milderer Schicksale üblich war, unsere Reisenden nennen dürfte, gehen also jetzt beide durch eine Istanbuler Straße. Die Szene könnte prächtig sein, verziert mit Gewändern, gebogenem Kupfer, Perlvorhängen, Bilderbuchgesichtern, aber auf dem Marktplatz von Saloniki werden schon Transporte zusammengetrieben, und plötzlich greifen noch vier Hände durch den hellichten Tag, die beiden werden wie Fische, die man ins Bassin bringen will, in den steinernen Hof geschleppt, an den Wänden stehen zwanzig schöne Gestalten und lachen. Mutti zahlt in bar, was denen ihr Vergnügen wert wäre, da läßt man sie laufen.
Ein Schiff wird gerüstet, nach Haifa zu fahren. Susanne liegt mit Fieber im Hotel. Der Arzt hat in München studiert und rät ab. Das Schiff fährt ohne die beiden und geht unter, denn was die Landsleute nicht mit dem Brandstempel versehen und dann sorgfältig vergasen können, das wollen sie wenigstens en gros ersäufen.
Aber in den zweiundzwanzig Omnibussen, die über den Libanon holpern, bis Tel Aviv, da sind sie drin. Landschaft gilt nichts momentan, nichts die Zedern, aus denen Vorfahr Salomo die Sänfte bauen ließ, nichts der Geruch des Libanon, nichts Narde, Safran, Kalmus, Zimt, Myrrhe und Aloe, nur Entfernung gilt und die Frage, ob man am Ende noch Rommel entgegenfährt.
Jetzt beginnt das Kapitel: daß Susanne und ihre Mutter katholisch sind, ist kein Vorteil mehr. Mutti sucht Anschluß bei den Engländern. Bei Leschnitzers wohnen sie. Frau Leschnitzer hat man sich klein vorzustellen. Ihre Sorge ist, Teddy könnte klein bleiben. Wenn man doch bloß einen hat. Susanne wird endlich ausgebildet: Gepäckmärsche, Gänge durch arabische Dörfer, das komische Gefühl im Rücken, plötzlich schaut man um, aber kein Gewehrlauf blinkt, die Gadna legt Wert auf derlei Mutproben. Dazu Hebräisch, Althebräisch, Talmudübungen, Baruch ta adonai, und warum dann Jehováh gesagt werden muß. Eine neue Muttersprache, die die Mutter zwar nicht spricht, soll Susanne bekommen. Wenn jemand am schönen Strand von Tel Aviv – ist das da draußen ein Schnorchel? da, der Strich? – etwas fragt, muß sie antworten: hier spricht man hebräisch. Immer häufiger fällt ihr auf, daß viele Kinder einen Vater haben. Der ist tot, sagt Mutti, gestorben in Bogotá. Plötzlich rennt Frau Leschnitzer herein und ruft: die Araber, Krieg. Die Mutter näht Kunstblumen aus Velours. Über den Häusern summt es. Susanne zieht die Mutter vom Fenster weg. Die Bombe krepiert, ein Splitter schlägt durchs Fenster. Susanne wird eine Autorität. Mutti schenkt ihr den Fohlenmantel. Aber sie sind immer noch katholisch, und Mutti kann die neue Muttersprache nicht. Überhaupt gehören sie nach Breslau. Leschnitzers sind schon fort. Also fahren sie hinter Leschnitzers her nach Berlin. Breslau haben die Landsleute verscherzt. Ein für allemal. Tante Maria ist angeblich nach Moskau geflohen und in Rußland verschwunden, Onkel Herbert und Oma, Sie wissen ja, und wo sind die Brüder des Vaters? Es könnte sein, in Amerika. Muttis Cousine ist in Rio, das weiß man. Und Sophie war immer besorgt. Was soll man auch in Berlin, wenn man doch nicht mehr nach Breslau kann. Also nach Rio. Der Globus läßt sich zwar drehen, die Route ist bekannt, aber im Jahr fünfzig ist es nicht günstig, Kolumbierin zu sein, wenn man von Berlin aus nach Brasilien will, auch nicht, wenn man’s von München, von Zürich, von Genua – die Tante dort zählt nicht – vom Schiff aus probiert, man landet zwangsläufig mit einer Vierwochengenehmigung in Buenos Aires und sitzt dort in der Barackenvorstadt ohne Klo und wird mit jedem Tag noch illegaler.
Helmut Preiß geht mit Susanne aus. Sein Chef, Herr Kuhn, früher Cohn, sieht das nicht gern, warum denn eine Jüdin, Helmut, sagt Herr Kuhn. Aber Helmut, vom VW-Werk gerade herübergeschickt, ein offener Karosserieschlosser, der weiß, was er wert ist in einem Land ohne viel Karosserieschlosser, aber mit viel Karambolagen, Helmut rast gegen die Intrige, wie er es kürzlich im Deutschunterricht gelernt hat, und geht mit Susanne aus. Wolfgang Deutelmoser geht mit Susanne aus. Er fährt sie sogar aus. Sein Vater verkauft deutsche Werkzeugmaschinen und sieht vorerst noch zu.
Franz Hohwein geht mit Susanne aus. Zu Fuß. Franz, ein Kürschner aus Linz. Er schneidert ihr aus dem Fohlenmantel eine Jacke für die paar kühleren Tage.
Wolfgang und Franz und Herr Kuhn machen Helmut ganz nervös. Man sieht ihn mit Susanne in irgendeiner Calle gehen, eine Zeitung kaufen, bloß um sie zu zerreißen. Die Fetzen wirft er in die Luft. Verächtlich, eine Geste gegen Wolfgang wahrscheinlich, streut er alles Kleingeld, das er bei sich trägt, in den Straßendreck. Plötzlich sagt er: Ich komme mir vor wie ein Wurm, der die Steilwand von der Straße zum Trottoir hinaufklettern will und immer wieder herunterfällt. Susanne weiß nicht, was Pubertät ist. Sie findet Helmuts Launen abscheulich. Trotzdem ist sie dankbar, daß er nicht zu den Parties geht, zu denen sie nicht eingeladen ist. Das sind die Parties bei Kuhn und bei Dr. Wagner, der ein hoher SS-Arzt war und in Buenos Aires als Frauenarzt rasch großen Zulauf fand. Man erzählt, er habe nicht nur Leute umgebracht, sondern auch die Kinder der Allerhöchsten aus den erlauchten Leibern ans Licht der Welt gezogen. Der Führer selbst habe sich von ihm diesen und jenen gynäkologischen Tip geben lassen, bloß daß er es ein bißchen leichter hätte. Mathilde Wagner ist so alt wie Susanne. Mathilde liebt Wolfgang Deutelmoser, der Susanne liebt, die eigentlich Helmut liebt, der sie eigentlich auch liebt, aber nicht lieben soll, denn er soll Mathilde Wagner lieben, sagt Herr Kuhn. Im Ausland sorgt man füreinander. Eine Party nach der anderen gibt Herr Kuhn, um Mathilde und Helmut viel Gelegenheit zu geben.
Helmut nimmt, jetzt schon heimlich, Susanne mit ins Stadion. Es fällt nicht das richtige Tor. Ein Tumult entsteht, eine Tribüne bricht zusammen, und Helmut werden drei Rippen eingedrückt, und ein Körperteil, den Susanne vorher noch nicht bei ihm gesehen hat, wird verletzt. Mit dem Judenmädel wenn du noch einmal gehst, dann fliegst du, sagt Herr Kuhn. Andererseits hat man also im Ausland auch eine gewisse Macht über die, für die man sorgt.
Mutti näht in der Baracke Kunstblumen aus Velours. Einen Herrn sieht man besonders oft vorbeigehen. Schließlich tritt er ein und stellt sich vor: Schweizer ist er, Kaufmann ist er und heißt Bruno de Summer. Seine Geschichte ist die Geschichte seiner Methode. Aus Chile ausgewiesen, erfolgreicher Geschäfte wegen. Schlechtes argentinisches Baumwolltuch verkauft er teuer als englischen Stoff. Natürlich kann er andere Verkäufer englischen Stoffs immer noch beliebig unterbieten. Sein Musterballen übrigens ist tatsächlich beste englische Ware. Soviel hat er investiert. Nun mietet er sich ein Taxi, immer gleich für einen ganzen Monat, fährt vor bei Waisenhäusern, Pfarrämtern, Klöstern, gibt sich katholisch, vielleicht ist er es auch, und wenn er abfährt, sind Waisen, Pfarrer und Nonnen wieder für lange Zeit mit schwarzem Tuch versehen. Ihm bleibe, sagt er und weist damit auf das Ausgetüftelte seiner Methode hin, jedesmal gerade noch Zeit genug, bis zum Taxi zu kommen, bevor seine Kunden den Unterschied merkten.
Jetzt also zieht er, auch hier erfolgreich, mit einigen Koffern in die Baracke. Ob er zuerst Susanne haßte, ob Susanne mit dem Haß begann, ist unter diesen Umständen unerheblich. Sicher ist, daß das Zusammenleben in einer solchen argentinischen Vorstadtbaracke das Verheimlichen von Abneigung, das wortlose Hinunterschlucken von immer wieder hochkommendem Ekel nicht befördert. Die Katastrophe wird vorbereitet durch einen Gang Susannes zum Arzt. Natürlich nicht zu Dr. Wagner, sondern zu einem Arzt, der sich nicht nur mangels anderer Gelegenheit aufs Heilen umgestellt hat. Während ihrer Tage soll sie nicht schwer arbeiten, sagt der Arzt, vor allem nicht mit Wasser. Susanne mag das der Mutter nicht sagen. Die erzählt ja doch alles dem Ekel. Der Knoten wird geschürzt durch Frau Schmolkas Anordnung, Susanne solle den Boden wischen. Susanne hat ihre Tage. Also weigert sie sich. Und weil Herr de Summer grinsend dasteht und sich bereitmacht, ihr beim Putzen zuzuschauen, weigert sie sich heftig, und sie gibt nicht den wahren Grund an, sondern sagt, daß sie sich nicht mit dem Dreck dieses Schwindlers abgeben werde. Dieser Satz war längst fällig gewesen. Aber auch der Wutschrei des Herrn de Summer war gut und lange vorbereitet. Für ihn war ihr Satz der oft herbeigesehnte Grund, sozusagen den Kopf verlieren zu dürfen, sich spontan zu gebärden, und das tat er denn auch: sprang auf sie zu und schlug und würgte sie. Sie trat ihn, wohin sie ihn treten konnte, entkam, denn ein Kämpfer war er nicht, und lief schreiend auf die Straße. Kam mit einem Polizisten zurück und dachte: jetzt kann ich ihn kriegen, jetzt wird alles aufgedeckt. Aber als sie den Blick ihrer Mutter sah, fiel ihr ein, daß es nichts gab, was sie so sehr zu meiden hatte wie Berührung mit Polizei und Behörden. Also schwieg sie und überließ es Herrn de Summer, dem Polizisten einen Drink anzubieten und eine Zigarette und ihm unterdessen zu erklären, was für ein schwer erziehbares, nervöses, ja leider immer mehr zur Hysterie neigendes Mädchen Susanne sei. Mutti nickte. Da nickte auch der Polizist und ging. Der Polizist aber vergißt Susanne nicht. Mitten auf der Straße sieht man ihn auf Susanne zugehen. Wenn der Kerl wieder was will, sagt er, holst du mich.
Deutelmosers fahren ans Meer. Wolfgang steckt Susanne Geld zu, daß sie nachfahren kann. Sie wohnt im Hotel nebenan. Wenigstens mit seiner verheirateten Schwester bringt Wolfgang sie zusammen. Wenn die Eltern im Schatten dösen, liegt Susanne mit Inge am Strand und unterhält sich mit ihr über den Orgasmus. Sicher liegen beide auf dem Rücken, daß sie einander nicht sehen. Das Getöse der Brandung erlaubt die Illusion, es handle sich um zwei Selbstgespräche. Wolfgang läßt ihnen Zeit. Es ist möglich, daß die Schwester den Auftrag hat, Susanne kennenzulernen. Vielleicht ist Inges Bericht so gut ausgefallen, daß Wolfgang unvorsichtig wird, zuviel Zeit mit Susanne verbringt und den Vater so reizt, daß der nicht mehr ruhig zusehen kann, sondern ein Verbot erlassen muß. Aber Wolfgang trotzt noch. Wir dürfen uns eben vorerst nicht sehen lassen. Susannes Illegalität ist um eine Nuance bereichert.
Helmut, das war wohl einer, der rasch zu schreien anfing, sich rot färbte, aber es hielt nicht an. Und schließlich kann man nicht leben, wie man’s in den Aufsätzen schreiben mußte. Schule und Leben, hat vielleicht Herr Kuhn gesagt und ihm diesen Zahn gezogen. Es ist möglich, daß bei Mathilde Wagner die Überlegung eine Rolle gespielt hat: ich nehme Helmut, um ihn Susanne wegzunehmen. Solche Gedanken hatte sie natürlich erst, als Wolfgang klipp und klar gesagt hatte, daß mit ihm nicht zu rechnen sei. Und hatte Mathilde, als sie nun Helmut heimführte, nicht einen Ersatz für Wolfgang, wie er intimer gar nicht gedacht werden kann?, da sie doch Helmut genau von dem Mund zurückholte, an dem Wolfgang noch hing.
Susanne aber, die jetzt nur noch einen halben Freund hatte, denn was ist ein Freund, den man nicht zeigen darf?, und Franz Hohwein war nur ein Trabant, Susanne wurde vom Schicksal ein Onkel zurückerstattet, den sie noch nie gesehen hatte; trotzdem sage ich: zurückerstattet, denn man hat ein Anrecht auf einen Onkel. Onkel Bernhard ist plötzlich leibhaftig in der Welt, in Buenos Aires sogar, man kann ihn besuchen, ihm die Hand reichen über den Ladentisch, an dem er Uhren verkauft. Hilf dir selbst, Gott hat zu tun, sagt Onkel Bernhard. Das Geschäft geht so lala. Es muß ja nicht immer eine echte Schweizer sein, sagt er und lächelt. Die Frau ist ihm allerdings wegen eines Herdenbesitzers von der bolivianischen Grenze sang- und klanglos, und er pfeift mit breiten Lippen zwischen Sch und Ui und macht eine Bewegung, die den raschen Start eines Vogels imitiert. Hatte nicht Flintrop sich dieser Geste bedient, um mir das Verschwinden Melittas mitzuteilen? Männer wissen offensichtlich, daß man den Sachverhalt nur mit dem Wort futsch ausdrücken könnte; ihre momentane Stimmung aber verbietet ihnen dieses Wort, also begnügen sie sich mit der Andeutung und beweisen dadurch viel Schamhaftigkeit und Zartgefühl. Frauen würden entweder einen heftigen Satz herausstoßen, der gipfelt in abgehauen, oder sie säßen ungekämmt und gäben kaum hörbar von sich: er hat mich verlassen.
Onkel Bernhard steckt Susanne jedesmal kleine Briefchen zu, die er mit violetten Rosen bemalt hat und mit Gedichten in schlesischer Mundart. Die Gedichte sind sozusagen lustig. Auch so gemeint. Aber Susanne wird rot, wenn sie sie liest. Es gibt da Stellen. Beim nächsten, mit Beklemmung unternommenen Besuch setzt sich Onkel Bernhard ans Klavier und sagt: komm, wir singen. Quien canta sus males espanta. Sie muß sich neben ihn setzen, und dann singt er die Lieder, die sie von Leschnitzers kennt. Reegentropfen, die ann mein Fennster klopfen und Wiien, Wiien nur Duu alllein. Onkel Bernhard singt immer lauter, Susanne summt mit, soweit sie kann. Dann ruft Onkel Bernhard: ausgerechnet Bananen, und lehnt seinen Kopf gegen ihre Schulter und weint. Susanne wagt kaum mehr zu atmen. Gott sei Dank erholt sich Onkel Bernhard wieder und spielt und singt zum Abschluß: Klaine Mööve, flieg nach Hellgoland. Zweistimmig gelingt das nächste Mal: Du Du liegst mir im Hää-erzen. Susanne singt, als ginge sie durch den Wald. Sie fragt sogar: kannst du O Donna Clara? Das war Frau Leschnitzers Lieblingslied! So bringt denn Onkel Bernhard Anfang der fünfziger Jahre seiner Nichte O Donna Clara bei, und da wird auch Susanne ganz anders zumute. Onkel Bernhard stürzt zur Schublade hin und sagt: das sind die Photos dazu.
Susanne lernt die ihr vorenthaltene Familie kennen. Auf dem Eisbärenfell, Grübchen links und rechts, später: aufgewölbte Locken, später: linkisch an die Lehne des Sessels gepreßt, auf dem der Opa sitzt, später: aufrecht alle, Armgirlanden über viele Nacken geflochten, das ist deine Tante Maria, nach Moskau, ja, der arme Herbert, Opa als Einjähriger, schneidig, was, Breslau, Blücherstraße, ja, Cousine Berta, Dachau, Moritz, Friedrich, Kanada, Sophie, Emil, Rio, Genua, Olga, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, Bautzen, Hans, Jakob, Josef, Theresienstadt, Brasilien, wahrscheinlich Warschau, Kattowitz, ja, der auch, nein, nichts mehr gehört. Susanne sucht und sucht in den Gesichtern. Du hast Jakobs Augen, ganz auf Tante Olga kommst du heraus. Damit hatte sie nie was anfangen können. Jetzt forschte sie nach ihrem Mund, nach ihren Augen in den Photomündern, Photoaugen. War es überhaupt notwendig, daß die Photographie erfunden wurde, dann um dieses Augenblickes willen, in dem Susanne aus zwanzig Stücken vergilbten Photopapiers sich eine Art Heimat zusammensucht, die es aufnehmen soll mit irgendeinem grünen Tal, in dem andere jede Weide beim Namen kennen. Und der mit herausforderndem Lächeln das Mädchen umfaßt, frech sogar dieses Lächeln, unsympathisch, das ist Vater?
Ach was, sagt Onkel Bernhard, Eberhard ist doch nicht tot, er lebt, lebt ganz gut in Guayaquil, der Gauner, und hat eine Apotheke. Sie bekommt die Anschrift und schreibt. Ja, sie soll nur kommen. Onkel Bernhard meldet sie an beim Konsul von Ecuador. Für Samstagnachmittag, denn es fehlt ihr an Unterlagen. Der Konsul ist so fett, wie man ihn sich vorzustellen hat, er schließt die Tür und schätzt sie ab. Die Jalousien sind dicht. Schließlich jagt er ihr um alle Sessel nach und schnauft und lacht und quiekst noch dazu, verstellt ihr den Weg hinterm Schreibtisch und lacht jetzt ganz tief. Hinterm Rauchtisch bleibt sie zitternd stehen. Es sei doch nur ein Spaß, sagt er und küßt ihr die Hand. Das Visum bekommt sie. Und als sie dankt, da küßt er ihr noch einmal die Hand und sagt: gracias igualmente.
Bruno de Summer ist wirklich ein gütiger Mensch. Reisegeld gibt er ihr. Wolfgang rechnet nach und sagt: das reicht nicht. Hast du nicht noch alte Kleider. Sie holt die Jacke, die Franz mit Linzer Händen im Geiste Wiens aus dem Breslauer Fohlenmantel geschneidert hat. Aber mehr als vierzig Pesos bekommt sie nicht auf dem Trödelmarkt. In der letzten Nacht nimmt Wolfgang sie noch mit in seinem Wagen. Am Morgen weckt Mama. Susanne kann sie nicht anschauen. Susanne ist so erstaunt, daß Mama nichts bemerkt. Wolfgang ist nicht am Zug. Er hat es ihr gesagt, daß er nicht kommen kann. Was hätte er seinem Vater sagen sollen. Sie haben sich also gleich danach verabschiedet. Hasta pronto, hat er gesagt. Hasta luego, hat Susanne gesagt und hat die Wagentür leise zugemacht.
Das Geld reicht nur bis Valparaiso. Hat sie nicht aufgepaßt, oder hat auch Wolfgang nicht richtig gerechnet? In einem Reisebüro steht Enrico, ein Spanier, steht zwar nur, um Auskunft zu geben, aber da Susanne damit nicht geholfen ist, gibt er auch Geld. Acht Tage bleibt sie. Aber sie wird erwartet in Guayaquil. Versteh doch, Enrico, mein Vater.
Am Lächeln erkennt sie ihn. Er schaut sie an und sagt: ta, ta, una taza de plata. Er küßt sie. Mein Gott, sein Mund!, ist der weich. Die neue Mutter. Eine Kölnerin. Susanne soll sie auch Lissi nennen. Und plötzlich hat Susanne einen Bruder, fast so alt wie sie selbst. Maurice. Die Photos kennt sie fast alle. Die Wohnung kostet 2000 Sucres, aber man sieht über ganz Guayaquil und hat nicht soviel Insekten wie die Chulos drunten. Ja, die Apotheke ist auch drunten. Natürlich.
Kay zeigt ihr die vielen kleinen Töpfe. Der Vater beobachtet. Maurice kommt nie ins Geschäft. Susanne reinigt Gläser und macht Pakete auf. Abends werden die Sucres gezählt. Maurice hat also zeit seines Lebens einen Vater gehabt. Lissi weint zuweilen. Der Vater lächelt wie auf dem Bild und geht zum Hafen hinab. Immer treibe er sich bei den Chulos herum, deshalb sei er bei den Gringos nicht beliebt. Wir könnten eine viel bessere Kundschaft haben. Das also ist eine Familie.
Kay Johns geht mit Susanne aus. Kauft ihr ein Coca auf der Promenade. Er will nach New York zu seiner Mutter und richtig studieren. Susanne lernt Englisch mit ihm. In New York werden sie heiraten. Bei ihm weiß sie sicher, daß er sie braucht.
Mr. Swobe fragt nach den Unterlagen. Einen Geburtsschein, nein, hat sie nicht. Eine Röntgenbescheinigung, o ja, die beschafft sie. Sofort. Einen Taufschein hat sie noch. Gilt der nichts? Solche Papiere, sagt Mr. Swobe, können gefälscht sein. Sie soll wiederkommen, wenn er Marken und Stempel mit den Marken und Stempeln in seinem Katalog verglichen hat. Und wie ist es mit polizeilichen Führungszeugnissen? Alle Länder, in denen Susanne seit ihrem vierzehnten Jahr war, möchten bitte solche Zeugnisse ausstellen. Aber an wen sich wenden in Israel? Wenn Leschnitzers noch dort wären, aber so? Deutschland ist kein Problem. Argentinien, tja, da war ich doch eigentlich gar nicht. Mr. Swobe verspricht, alles auf dem Konsulatsweg zu besorgen. Als Mr. Swobe alles auf dem Konsulatsweg besorgt hat, ist die Röntgenbescheinigung abgelaufen, denn sie gilt nur vier Wochen, also eine neue, und die kostet wieder. Aber Mr. Swobe drückt noch ein Auge zu. Und er will nichts dafür. Amerika ist eine Hoffnung wert. Mr. Swobe, I thank you so much, sagt sie und bemüht sich, die Worte so unbeschädigt als eben möglich über die Lippen zu bringen.
Wenn es um New York geht, kann man eigentlich gar nicht übertreiben. Hat nicht die Heirat geklappt? War nicht gleich die Wohnung in Brooklyn bereit?, und auch schon ein Job bei PAA? Zum ersten Mal weiß sie sicher, daß sie dann und dann soundso viel Geld bekommt. Und während sie die Nummern der Zollscheine einträgt, fliegen draußen die großen Tiere ein, rasen auf das Gebäude zu, fangen sich aber rechtzeitig und stehen nun, als trauten sie sich nicht weiter, als müsse Susanne das Fenster aufkippen und ihnen Mut machen, näher zu kommen. Kay, bitte, auch Kay kann gleich anfangen in der Apotheke, und am Abend studiert er Chemie. Kays Mutter kocht. Kays Mutter schenkt ihr eine Marabujacke, immer schon bestimmt für Kays Frau. Bloß, Kay ist fahrig, zerschlägt leicht etwas und kann einen nicht richtig anschauen. Gäbe er nicht besser das Studieren auf? Man sieht sich ja kaum. In Guayaquil hat er doch überhaupt nicht getrunken. Und jetzt gleich diesen Burban. Sie öffnet Briefe, die aus Ecuador kommen. Man verweigert ihm etwas, weist ihn ab. Nun gesteht er, daß es das Morphium ist, das ihm fehlt. Sie will gehen. Er bettelt, bereut, bessert sich. Bevor er Susanne hatte, glaubte er, bei ihm sei nicht alles in Ordnung. Das hat ihm eine beigebracht. Jetzt hat er Angst. Susanne bleibt. Aber manchmal kommt sie mit einem geschwollenen Auge nach Idlewild. Sie ist unter all den hübschen Dingern die einzige, die mit einem geschwollenen Auge kommt. Der Neuseeländer, der sie eingestellt hat, wird mißtrauisch. Der Personalchef aber verteidigt sie.
Am 7. September 1954 verzögert sie den Abflug einer Maschine um drei Minuten. Sie hat die Papiere am Zollschalter stempeln zu lassen und stellt sich immer rechtzeitig an. Am 7. September 1954 aber hat sie geträumt, hat sich am falschen Zollschalter angestellt, bis der schottische stationofficer hereinlief und brüllte und sie vor allen Leuten herabkanzelte. Sie weint. Er reißt ihr die Papiere aus der Hand. Rennt hinaus. Dann kommt er und schreit: Was soll ich jetzt ins Journal schreiben? Drei Minuten Verspätung, weil Missis Johns schlief, ja?, soll ich das hineinschreiben? Dann sind Sie dran, das wissen Sie.
Sie geht zum Chef. Gibt alles zu. Beschwert sich aber über den Schotten. Und sie bekommt recht. Man sieht den Schotten hinter ihr herlaufen. Kuchen bringt er ihr jetzt und Blumen. Einmal sogar Whisky.
Doris bekommt ein Kind von Elvis, dem Kanadier, und will sich scheiden lassen. Susanne rät ab. Nicht, bevor du sicher weißt, daß Elvis dich nimmt.
In Brooklyn tanzen Kay und Susanne. Kay wütend, weil er die südamerikanischen Tänze nicht kann. Schließlich schaut er bloß zu und trinkt. Zu Hause schlägt er sie. Nicht ganz zu Unrecht, sagt sie, denn sie liebte ihn nicht. Bloß weil sie glaubte, es sei schon alles vorbei, hat sie ihn genommen; aus Mutlosigkeit.
Nachzuholen wäre: Lissi ist mit Maurice nach Peru geflohen. Weiß Gott zu wem. Der Vater gibt die Apotheke auf, kommt nach New York und ergattert einen Job bei der Union Carbide. Wohnt in Bronx.
Kay schlägt wieder. Der Anwalt sagt: 500 Dollar an mich, 200 Dollar an meinen Kollegen in Chauvava, 500 die Reise, und Sie sind geschieden. Kays Mutter ist es nur darum zu tun, daß ihr Sohn ohne finanzielle Verpflichtung davonkommt. Immer wenn Susanne es nicht verstehen soll, spricht sie schwedisch mit Kay. Susanne sitzt solange da und wartet, bis man wieder mit ihr spricht. Ihr Vater gibt die 1200 Dollar. Susanne fliegt nach Mexiko und ist noch vor Weihnachten geschieden. Der Vater, der damit nicht gerechnet hat, ist an Weihnachten schon besetzt. Die Marabujacke hat ihr Mutter Johns wieder abgenommen. Die ist für Kays Frau, sagt sie.
Aber am 26. hat der Vater Zeit. Sie fährt bis Woodlawnstation. Es war ihm wichtig, sie abzuholen. Auf dem Weg in die Oneida Avenue macht er Geständnisse. Man sieht ihn auf sie einreden. Die Hände nimmt er aus den Manteltaschen. Mr. Elliot, bei dem er wohnt, erzählt ihm immer jüdische Witze. Aber Herr Schmolka lacht nicht. Was Jiddisches und Hebräisches vorkommt in den Witzen, verstehe er nicht. Susanne, bitte, wenn er Anspielungen macht oder Witze erzählt, lach nicht, so far vermutet der nur, aber wissen tut er gar nichts! Susanne verachtet ihren Vater zum ersten Mal von ganzem Herzen. Und schließlich, sagt Herr Schmolka, als er Susannes Gesicht sieht, sind wir doch tatsächlich Deutsche. Susanne bleibt stehen, es schneit, schneit, schneit, da sagt Herr Schmolka: oder wenigstens Kolumbier.
Durch einen Brief von Enrico aus Valparaiso erfährt Susanne einen Monat später, daß ein älterer Herr im Reisebüro gewesen sei, den er zuerst für Susannes Vater gehalten habe, er habe sich dann aber als Señor Bürger oder so ähnlich vorgestellt, habe Grüße von Susanne ausgerichtet: er sagt, er kenne dich seit langem, schrieb Enrico. Susanne hatte ihren Vater, als er in Geschäften nach Valparaiso flog, gebeten, Enrico Grüße zu bestellen. Der Vater aber hat es vorgezogen, nicht ihr Vater zu sein.
Kay ruft jeden Tag in Idlewild an. Ich beobachte dich, sagt er. Wenn du einen anderen hast, passiert was. Plötzlich steht er vor der Haustür und heult und verspricht alles und droht gleich wieder.
Ihr Vater sagt: jemand sollte nach Deutschland fahren. Ich kann nicht. Ich fahre da nicht mehr hin. Ich kann einfach nicht. Aber wir müssen uns um unsere Entschädigung kümmern. Du hast Anspruch auf mindestens 1500 Dollar für Ausbildungsverlust, und mir werden sie wohl oder übel 20000 Dollar zahlen müssen. Willst du?
Susanne landet in Berlin. Große Freude bei Leschnitzers. Teddy ist zwar kein Riese geworden, aber Frau Leschnitzer ist zufrieden. Er hat ein Atelier für Graphik und den Mund voller Projekte. Als er hört, daß Susanne sich hat scheiden lassen, ohne Abfindung, sagt er: Susanne, was ham se bloß mit dir gemacht? Haste denn gar nischt übrig von deine Vorfahren? Leschnitzers wollen Susanne nicht mehr gehen lassen. Teddy begleitet sie in den Ostsektor. Sie muß Tante Maria besuchen wegen der Unterlagen. Tante Maria, die dreiunddreißig nach Moskau floh. Sie hat eine Tochter mitgebracht. Anja studiert jetzt Jus, spezialisiert sich auf Jugendkriminalität. Ein alter Mann würde ihr nichts ausmachen, sagt sie. Sonst erfährt man nicht viel. Sehr hilfsbereit seien die Russen gewesen, ja. In Sibirien, ja, da war Tante Maria auch. Jetzt ist sie Redakteurin. Teddy sagt: Sie könnten mit uns in die Internationale Buchhandlung gehen. Am Alex. Da gibt’s dolle Platten, Susanne, kosten so gut wie nischt. Die Tante geht mit. Susanne bekommt eine Menge russischer Chöre, herb und schummrig, und ein Beethoven-Violinkonzert à la David Oistrach. Die Tante hat eine graue Haut und Augen, die immer zu Boden schauen, wenn sie sich nicht zusammennimmt. Sie haßt Amerika. Sie will mit den Brüdern, die im Westen sind, nichts mehr zu tun haben. Von wem leben die denn? Ein Offizier kommt überraschend zu Besuch und bringt Kognak mit, von dem es Susanne sofort schlecht wird. Die Unterhaltung wird böse, weil die Tante und der Offizier alles besser wissen. Nur was die Neger angeht, da sind sich alle einig. Sie wird wütend, wenn sie daran denkt. Vielleicht weil ich Jüdin bin, sagt sie. Ich mache kein Geheimnis daraus wie mein Vater. Entweder es macht einem Mann nichts aus, oder es macht ihm was aus, dann kommt er sowieso nicht in Frage.
Susanne sah auf das Tischtuch, ackerte mit dem langen Zeigefingernagel eine Furche ins Tischtuch und sah mich dann an, eine Art besänftigendes Lächeln im Gesicht, als sei ich es, den man beruhigen müsse. Ich konnte nichts sagen. Ihr letzter Satz. Als leide sie an einer Krankheit, als sei sie ein Krüppel! Wie lange humanisieren wir eigentlich die Bestie schon? Und mit welchem Ergebnis? O Susanne. Wie ist das Leben doch so. Ja, aber, ach so, und dann sind Sie hierhergekommen, ins Reisebüro, na ja, bei Ihren Sprachkenntnissen, und Sie bleiben jetzt hier, natürlich, entschuldigen Sie, Sie heiraten im September, aber dann werden Sie doch nicht mehr arbeiten, oder?
Wir müssen gehen, sagte Susanne.
Ja, natürlich.
Ob Josef-Heinrich sie so gut kannte wie ich? Wenn er sie nicht heiratet, bringe ich ihn um. Und wenn er sie heiratet? Bring’ ich ihn auch um.
Es machte mir nichts aus, daß die vier Ober nun alles wußten. Und die paar Gäste auch. Hoffentlich dachten die alle, daß ich heimginge mit ihr. Bestimmt dachten sie das. Ich hatte es doch auch oft genug gedacht, wenn zwei miteinander lachend das Lokal verließen.
Internationale der Überlebenden
Die Überlebenden betrachten einander mit Mißtrauen. Wer selber davongekommen ist, sagt doch noch vom anderen: Charakter kann der nicht gehabt haben.
Ilja Ehrenburg ist für viele ein Anlaß zu so selbstlosen Äußerungen.
Glücklicherweise ist da auch noch Ehrenburgs sagenhafter Deutschenhaß. Er soll sogar die Rote Armee zur schlimmsten Grausamkeit gegen die Deutschen angestiftet haben. Ob das eine Erfindung des Goebbelsministeriums ist oder Wahrheit, ist immer noch fraglich. Daß Ehrenburg uns haßt, dürfte allerdings ebenso wahr wie begründet sein. Und übrigens: die Rote Armee mußte nicht von einem Literaten aufgehetzt werden. Es genügte wohl, den Rotarmisten mitzuteilen, wie sich unsere Spezial-Einheiten in der Sowjetunion vorwärtsmordeten.
Aber zweifellos: ein Deutschenhasser ist er. Soll ich ihn deshalb mit weniger Interesse lesen? Bin ich verpflichtet, zurückzuhassen? Deutschenhasser! Ich höre so ein Wort, sehe die große Phrase flattern und spüre nichts von jenem Haß, obwohl ich doch wirklich auch ein Deutscher bin. Ich hoffe sogar, daß das, was Ehrenburg als das Deutsche haßt, gar nicht existiert. Ehrenburg reagiert auf eine furchtbare Erfahrung. Ihm, dem Betroffenen, kann man den Kurzschluß, Faschismus ist gleich deutsch, nicht verübeln. Wir können jetzt ruhiger unterscheiden und sind deshalb weniger berechtigt, einfach zurückzuhassen und etwa zu sagen: das Buch eines solchen Mannes darf bei uns nicht erscheinen.
Warum eigentlich sollen wir nicht erfahren, wie jemand über uns denkt, der sich in eine Feindschaft gegen uns hineingelebt hat? Der Unterschied zwischen dem, was Ehrenburg haßt, und uns kann durch nichts so deutlich werden wie durch eine halbwegs souveräne Aufnahme dieses Buches bei uns. Schließlich sollten wir uns gerade Ehrenburg gegenüber nicht von irgendeiner Soldatenzeitung vertreten lassen. So leicht dürfen wir es ihm einfach nicht machen. Vielleicht wird er, dem Revisionen so wenig erspart bleiben wie uns, auch seine Beziehungen zu uns noch einmal revidieren. Und hierzulande wäre eine natürliche Neugier auf Ehrenburg wirklich angemessener als borniertes Fahnenschwenken. Wie man den Stalinismus überleben konnte, das müßte alle interessieren, die den Hitlerstaat überlebten. Als Überlebender ist Ehrenburg ein Schicksalsgefährte von ehrenwerten Herren im Staat und von uns allen. Warum also die Feindseligkeit der Überlebenden untereinander? Die Überlebenden aller Länder wären eine Internationale wert. (Um einem Mißverständnis vorzubeugen: Ein Überlebender ist nur, wer auch hätte ein Opfer sein können.)
Der Schwarze Schwan
Deutsche Chronik 2
Personen
Rudi Goothein
Professor Liberé
Irm, Liberés Tochter
Frau Liberé
Professor Goothein, Rudis Vater
Dr. Harald von Trutz
Tinchen, Adoptiv-Tochter Liberés
Gerold
Figilister
Seelschopp
Bruno
Bühnenbild
Der Rundhorizont zeigt die vollkommen realistische Ansicht einer Nervenheilanstalt in Waldumgebung. Gebaut um die Jahrhundertwende und seitdem nicht verändert. Vor diesem Hintergrund werden so sparsam wie möglich die einzelnen Schauplätze angedeutet: Liberés Arbeitszimmer. Anstaltsgarten. Wohnzimmer und Terrasse der Familie Liberé. Wäscheplatz. Zimmer 104.
Erster Akt
1
Professor Liberés Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch. Zwei Stühle. Professor Goothein, Rudi, Liberé.
Liberé im weißen Mantel. Goothein und Rudi im Straßenanzug. Rudi ist elegant, aber fast zu formbeflissen angezogen. Abituranzug. Er sieht ein bißchen eingesperrt aus in diesem Anzug. Der Kragen reicht weit am Hals hinauf und ist sehr gestärkt. Auf dem Boden spielt Tinchen. Während der ganzen Szene ist Liberé damit beschäftigt, Sahnebesen zusammenzubiegen. Er hat fertige Griffe neben sich liegen. Goothein reagiert zuweilen mit ärgerlichen Blicken auf Liberés Arbeit. Liberés Beschäftigung macht ihn nervös.
Goothein Was Rudi braucht, ist nicht Sizilien. Hier in Karwang wird er sich erholen. Sie braucht er, Liberé, und schon ist er gesund.
Rudi Das heißt, Herr Professor, mein Vater glaubt, ich sei krank.
Goothein Nein, nein, nein. Krank nicht. Entschuldige. Aber die Nerven, Liberé, zuerst das aufreibende Abitur, und dann mach ich noch den Fehler und sage, da feiern wir doch die Verlobung gleich mit. Doch, doch, Rudi, das war ein Fehler. Ich will bei Gott nicht den Unfehlbaren spielen. Ist doch denkbar, du wolltest gar nicht mehr. Da hast du endlich dein Maturum, wärst ein freier Mann. Nu hängt dir aber die Verlobung am Hals. Weil du vorher was versprochen hast. In all dem Druck. Wie’n Gelübde. Wenn ich’s Maturum schaffe, verloben wir uns. Das hatt’ ich nicht bedacht. Also arrangier ich die Feier zu früh und da geht ihm der Gaul durch. Ist doch nur zu verständlich, Junge. Nur, wie er das dann abmacht, Liberé, daran seh ich, er braucht Erholung. Weigert er sich doch öffentlich, sein Reifezeugnis entgegenzunehmen. Öffentlich, Liberé, weist er sein Maturum glatt zurück. Wie mir das peinlich war, Liberé, ich sitz da unten, festtäglich, und er geht rauf und sagt nein. Verstehen Sie, weil er glaubt, daß die Verlobung jetzt …
Rudi Laß doch die Verlobung aus dem Spiel, Papa. Es geht um den Prozeß, Herr Professor, zuerst will ich meinen Prozeß hinter mir haben …
Goothein So redet er seitdem. Hält Reden, Liberé, Reden!
Rudi Zuerst in den Gerichtssaal, Papa, dann nehm ich das Zeugnis.
Goothein Schon gut, Junge. Das erzählst du alles dem Herrn Professor und dabei erholst du dich.
Rudi Ich bin nicht besonders mutig, Herr Professor. Ich brauch ein günstiges Klima für den Prozeß, eine Nachricht über mich, die die Richter betört, eine Nachricht, die die Richter mit geschlossenen Augen einatmen, so schön ist sie. Ich könnte, zum Beispiel, das Volkswagenwerk belagern.
Goothein Hören Sie, Liberé, das Volkswagenwerk!
Rudi Ich könnte verlangen, daß das Werk dem Staat Israel übereignet wird. Daß das nicht geht, weiß ich auch. Aber ist es nicht rührend, ein Zeichen der Einsicht, der Umkehr? Der Angeklagte will das große Werk dem Staat Israel vermachen. Verstehen Sie, ich will mich gut stellen mit allen Verwandten meiner Opfer. Dann, meine Herren Richter, bin ich bereit.
Goothein Rudi, mein Junge, nu laß dir doch Zeit. Liberé, Herrgott, es könnte doch jemand kommen jetzt, und Rudi den Garten zeigen. Mein Freund Liberé ist ein großer Gärtner, Rudi. Und du hast doch was übrig, Rudi, für Blumen. Das hat er von meiner Frau, Liberé. Sie kannten sie ja. Das war auch eine große Gärtnerin.
Liberé Ich hab mich spezialisiert, Goothein. Auf Thujen.
Goothein Auf Thujen, Rudi, hörst du. Thujen.
Liberé Vielleicht mag er Thujen nicht.
Goothein Ach, das glaub ich nicht. Er muß sich das alles zuerst einmal ansehen. Nicht wahr, Rudi.
Rudi Herr Professor, mein Vater will mich los sein. Aber bedenken Sie, wem Sie Unterschlupf gewähren, wenn Sie mich aufnehmen.
Goothein Rudi, Dr. von Trutz wird dir die Thujen zeigen.
Rudi Ja, Papa. Ich gehe schon. Zu den Thujen. Rudi geht.
Tinchen Onkel?
Liberé Ja, Tinchen?
Tinchen Die Thuja heißt auch Lebensbaum.
Liberé Obwohl sie … Er bietet zur Fortsetzung an.
Tinchen … vor allem auf Friedhöfen vorkommt.
Liberé Sehr gut, Tinchen. Wissen Sie, Goothein, wie meine schönste Thuja gewachsen ist?
Goothein Nu hören Se doch endlich mit Ihren Thujen auf, Liberé. Un’ daß Se da andauernd wie’n Sträfling so Zeug flechten, find ich, entschuldigen Se schon, das find ich nicht gerade sehr taktvoll.
Liberé Das hab ich angefangen, als ich nach Karwang kam, Goothein. Es beruhigt.
Goothein Mich erinnert es. Gerade Sie hätten keinen Grund. Jetzt hören Sie doch endlich auf damit.
Liberé Entschuldigen Sie. Das ist wahr. Hört auf.Rudi rasch von rechts.
Rudi Schlimmstenfalls, Herr Professor, könnten Sie, die Kapazität, mir ein Gutachten austüfteln, wenn Sie das vor Ihrem Gewissen, ich meine nicht aus Mitleid sollen Sie, das nicht, aber wenn Sie’s verantworten könnten, zu schreiben: dem Rudolph Goothein ist kein Prozeß zu machen, der kommt nicht in Frage wegen unvollständiger Zurechnungsfähigkeit. Und gegen Juden hat er sowieso nichts. Er bringt um, wie es sich grad gibt. Bitte, Herr Professor, sagen Sie nichts. Was Sie denken, weiß ich auch so. Ich sehe es doch selber ein, jetzt, daß Ihnen das nicht zugemutet werden kann, bloß weil ich vor Feigheit im Kreis herum denk. Kein Gutachten, ich habe Sie um nichts gebeten, Herr Professor. Um nichts und wieder nichts. Entschuldigen Sie, bitte. Er geht rasch ab.
Goothein So redet er, Liberé. So schrecklich durcheinander. Liberé, jetzt fangen Sie schon wieder an mit dieser Drahtflechterei. Das ist eine ganz gemeine Taktlosigkeit. Sie ham sich entzogen damals. Ich hab meine vier Jahre abgemacht. Sozusagen auch für Sie. Jawohl. Ich bin nicht nachtragend. Ich hab ja meinen Vorteil davon. Erst in der Haft ist es mir nämlich aufgegangen, daß ich kein Nervenarzt bin. So von sieben bis zwölf operieren, da wissen Se dann eben, was Se getan haben. Na ja, vier Jahre Gelegenheit zum Nägelkauen, wer da nicht draufkommt, was los is’ mit ihm. Aber daß jetzt ausgerechnet Sie, Leibniz …Liberé schaut auf. Nicht heftig. Eher erstaunt. Entschuldigen Sie, Liberé, alter Freund. Jetzt werd ich auch noch taktlos. War nicht meine Absicht. ’ne Fehlleistung, Liberé. Für mich heißen Se nu wirklich Liberé. Ich trag Ihnen nischt nach. Ich bin froh, daß ich meine vier Jährchen gleich abgemacht habe. War ja außerhalb auch nischt los. Keine Kohlen. Nischt zum Beißen. Dafür die blühendste Hexenverfolgung. Das war nicht die schlechteste Zeit für’n Happen Sühne. War einfach ’ne Art Kriegsverlängerung. Aber Sie waren ja immer schon ’n bißchen introvertiert. Jede Wette, Sie ham sich mehr aufgebrummt als vier Jahre. Un’ die machen Se jetzt brav hier ab. Das Dumme ist bloß, so ’ne selbstgebastelte Verurteilung, das kauft Ihnen draußen keiner ab. Wenn Se mal wieder raus wollen aus dem finsteren Karwang, das stell ich mir herb vor, Liberé, etwa noch nachträglich in ’n Knast, so direkt weg von Tisch und Bett.
Liberé Das Zuchthaus fürcht ich nicht, Goothein. Ich habe trainiert. Fragen Sie meine Frau. Meine Schlafzimmertür hat Beschläge wie eine Zellentür. Ich esse aus Blechgeschirr. Ich flechte soviel wie kaum ein Gefangener. Und ich weiß, das alles gilt nicht. Die Richter und die Zuschauer wollen sich mästen an dir. Mit jedem Geständnis werden sie fetter. Vor lauter Anständigkeit. Die Richter, abends zu Hause, und vormittags stellen sie sich hin, von Schuld keine Ahnung. Das ist es, Goothein, daß sie von der Schuld keine Ahnung haben, dafür ein Kostüm und ein auswendig gelerntes Gesicht. Und das ist die Strafe. Der ausgeliehene Ernst, mit dem sie dich behandeln. Vor Zuschauern, die sich gütlich tun. Am liebsten wär ihnen der Galgen. Auf jeden Fall wollen sie sich sauber vorkommen. Dazu soll ich ihnen dienen. Das vermag ich nicht. Obwohl ich weiß, ohne diese Demütigung, ohne Zuschauer ist alles, was ich hier tu, keine Bestrafung.
Goothein Sie rackern sich ja ganz schön ab, mein Lieber. Aber von mir ist nichts zu befürchten. Wenn ich schon mal einen von früher treff und der fragt mich nach’m Leibniz, da sag ich sofort: der ist in Südamerika, bei den andern, kuriert Kastrationskomplexe von Rindermillionären. Lacht. Aber jetzt sagen Se bloß, was machen wir mit dem Jungen.
Liberé Es wär besser, Sie nähmen ihn wieder mit.
Goothein So wie er jetzt ist. Unmöglich. Rennt herum, spielt ’ne fürchterliche SS-Charge. Wie mir das peinlich ist, Liberé! Jetzt wo die Leute allmählich vergessen. Wenn jetzt der Junge solchen Tinneff macht, werden die alten Geschichten wieder aufgewärmt. Und der arme Junge, Liberé. Der hat sich da was aufgeladen, und ich kann ihm nicht helfen. Ich bin heraus aus der Praxis.
Liberé Ich hab eine Tochter, Goothein. Für die hab ich eine Vergangenheit erfunden. Ein Kind frägt viel. Jahr für Jahr hab ich aufgebaut. Ein ganzes Indien. Tage in Madras erfunden. Reisen nach Bangalore. Kleine Abenteuer am Ozean. Den Strand bevölkert mit Erinnerungen. In jedem Augenblick bin ich gefaßt auf neue Fragen. Rudi ist eine Gefahr für Irm. Was, wenn er sich an Irm erinnert? An Hedi, ihren früheren Namen, den ich ausradierte aus ihrem Gedächtnis? Wenn alles plötzlich aufbricht und sie Rosenwang vor sich sieht. Das ist in Indien nicht unterzubringen.
Goothein Das ist doch abgesackt und weg. Wissen Sie noch, mit wem Sie spielten als Sie drei waren? Nee, Liberé, nee, nee, das laß ich nicht gelten.
Liberé Goothein, nehmen Sie ihn wieder mit. Ich bitte Sie. Um seinetwillen. Ich bin nicht der Richtige für seinen Fall. Liberé nimmt hastig seine Drahtarbeit auf.
Goothein Sie sind der Richtige, Leibniz. Sie ham doch eine Kraft, das weiß ich doch, Sie brauchen bloß hinzuschauen, da schmelzen ei’m doch glatt die Fingernägel von der Hand. Sieht Liberés Arbeit. Liberé, nu fangen Se nicht schon wieder damit an, ja!
Liberé Ach. Entschuldigen Sie, bitte.
Goothein Wenn Sie’s wenigstens könnten. Das kann man ja nicht mitansehen. Er greift zu. Allein geht das eben nicht. Sehen Sie, der Nebenmann hat die Drähte gebogen. Aber, nicht freihändig, mein Lieber, sondern am Dorn, den er vor sich hat, so, übers Kreuz, das hält. Er führt das an seinem Spazierstock vor. Und erst wenn alle sechs Drähte gebogen sind, die Einführung ins Lochblatt. Jeder Draht führt genau seinem Ausgangspunkt gegenüber zurück in das Lochblatt. Jetzt die Fixierung. Das untere Ende des längsten Drahtes, des sogenannten Kuppeldrahtes, wird zurückgebogen in die Öffnung des Griffs. Sie sind einfach ein Dilettant, Liberé. Ein ganz rosiger Dilettant sind Sie. Als Häftling.
Liberé Ja, ich weiß.Es wird dunkel.
2
Liberé im Anstaltsgarten: Im Hintergrund Anstaltsfassaden. Vorne links eine vielstämmige Thuja. Man kann die Stämme nicht gleich zählen. Sie sind keinesfalls so ebenmäßig gewachsen, wie Liberé sie sieht. Vor der Thuja eine Bank.
Auftritt Dr. von Trutz und Rudi von rechts: Liberé geht auf Rudi und Trutz zu.
Rudi Herr Professor, der Doktor hört und hört nicht auf, mich mit Maturum und Verlobung zu traktieren. Ich denke, ich soll mich erholen hier.
Dr. von Trutz Herr Goothein meint, ich …
Rudi Nicht diesen Namen, bitte. Mein armer Vater kann nichts dafür. Jetzt allerdings, da er mich, anstatt mich anzuzeigen, hier verbirgt, macht er sich mitschuldig. Jetzt läuft der Prozeß ohne mich.
Dr. von Trutz Welcher Prozeß.
Rudi Lieber Doktor von Trutz, jeden Tag, in jeder Zeitung können Sie’s lesen.
Dr. von Trutz Hier gibt’s keine Zeitung.
Rudi Eine Maßnahme meines Vaters. Er hat Angst, ich lese, daß meine Kameraden verurteilt werden, und les ich das, fürchtet er, dann stell ich mich doch noch.
Dr. von Trutz Herr Goothein …
Rudi Herr Doktor!
Dr. von Trutz Rudi, gehen wir noch einmal zurück. Nach der Abiturfeier …
Rudi Herr Professor!
Liberé Danke, von Trutz. Wir sehen uns nachher beim Essen.Dr. von Trutz verbeugt sich knapp und geht.
Liberé Gefällt dir mein Garten?
Rudi Sie wollten den Brief. Hier ist er.
Liberégeht auf seine Thuja zu: Eigentlich unsinnig, die Bank so zu stellen, daß man die schöne Thuja im Rücken hat, findest du nicht.Rudi zuckt mit den Schultern. Du zählst die Stämme? Gib zu, du hast die Stämme gezählt. Da, die Stämme dieser Thuja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ausgerechnet sieben Stämme. Ohne daß ich was tat an dem Baum.
Rudi Der Brief, Herr Professor.
Liberé Lies ihn vor.
Rudi Ich soll den Brief laut vorlesen.
Liberé Du hast ihn doch geschrieben, sagst du.
Rudi Ich sag, ich muß ihn geschrieben haben.
Liberé Dann mußt du ihn auch vorlesen können.
Rudi Ich kann ihn auswendig, so ist es nicht. Bloß, laut hab ich ihn noch nicht gelesen. Verzeihen Sie also, wenn der Vortrag noch Mängel hat.
Liberé Bitte.
Rudi Rosenwang, zweiter März, zweiundvierzig. Bitte nicht unterbrechen, Herr Professor. Rosenwang, zweiter März, zweiundvierzig. Betreff Aktion 14f 13 in den Konzentrationslagern, Bezug Verfügung Amtsgruppenchef Dora, Strich Dora-Ida, Strich eins, Strich a-zet, Punkt, Doppelpunkt, 14f 13, Strich, O, te, Strich S, Strich Geheim …
Liberé Bitte, Rudi, laß das doch weg.
Rudi Tagesbefehl-Nummer Drei-vier-Strich-vier-drei. An die Lagerkommandantur Groß-Rosen. Uns erscheint der 24. März 1942 als Ankunftstag der geeignetste, da wir in der Zwischenzeit von anderen Konzentrationslagern beliefert werden und für uns arbeitstechnisch ein Zwischenraum notwendig ist. Sollte es Ihnen möglich sein, die Häftlinge in Omnibussen anzuliefern, so schlagen wir Ihnen die Anlieferung in zwei Transporten zu je 107 Häftlingen und zwar am Dienstag, den 24. März und Donnerstag, den 26. März vor. Die Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft wäre Ihrerseits termingerecht zu verständigen. Wir bitten Sie, zu unseren Vorschlägen Stellung zu nehmen und uns den endgültigen Bescheid zukommen zu lassen, damit wir dementsprechend weiter disponieren können. Gezeichnet Rudolf Goothein. Gibt ihm den Brief. So. Jetzt. Der Herr Professor schweigt.
Liberé Wie alt bist du?
Rudi Das ist schon meinem Vater eingefallen, mich danach zu fragen.
Liberé Du hast ihm den Brief gezeigt?
Rudi Nein.
Liberé Warum nicht?
Rudi Ich weiß nicht. Ich traute mich nicht. Mein Vater ist, verstehen Sie, er ist sehr gütig. Aber nachdem ich den Brief gefunden hatte, als alles wieder auftauchte, plötzlich wimmelte es mir im Kopf, das Gedächtnis liefert mir, was ich nicht will, läßt aufmarschieren Figur um Figur, ich könnte jetzt schon einen Film danach drehen, so genau seh ich wieder, wie es war, das wirkte sich wohl aus, Papa jedenfalls sorgte sich. Was ist, fragt er, hast du Pilze gegessen. Nein, sag ich, ich bilde mir bloß was ein, mein Gedächtnis wird auf einmal so hell, sag ich, und ich such zu Hause nach dem Koppel, das muß doch noch da sein, sag ich, aber da greift Papa ein, kommt wie der Lehrer mit dem Schwamm, der die Sauerei wegwischen will von der Tafel, und er schafft es nicht. Der Brief, da hilft kein Schwamm, auch nicht der Geburtsschein, den er mir vorhält, der Brief trägt meinen Namen und der Brief ist echt.
Liberé Der Geburtsschein wohl auch.
Rudi Gefälscht um mich zu decken. Mein Vater liebt mich, verhätschelt mich, verstehen Sie.
Liberé Du mußt ihm den Brief zeigen.
Rudi Nein. Niemals. Herr Professor, bitte. Mein Vater und ich, wir sind nicht so gegeneinander, wie man das oft hört. Vielleicht weil ich von meiner Mutter nicht mehr kenne als ein paar Fotos, die nicht zusammenpassen. Auf jedem Foto eine andere Person. Einen solchen Brief, Herr Professor, den meinem Vater zeigen, ich könnte nie mehr sprechen mit ihm.
Liberé Also hast du ihn geschrieben.
Rudi Zuerst hab ich mich natürlich gewehrt. Vorsicht, sagte ich mir, Vorsicht, Rudi. Du hättest diesen Brief geschrieben. Und vergessen. Das Koppel getragen, und vergessen. So was einfach vergessen. Mein Gott, Vorsicht, dann kann jetzt jeder kommen, mir in die Schuhe schieben, was er will. Ich kann es vergessen haben. Aus Kellern, Dachböden, Hunde können kommen, solche Briefe in der Schnauze. Kinder Schiffchen falten aus dem Papier, das den Mord mit meinem Namen besiegelt. Also Vorsicht, sagte ich. Es ist auch Papas Name. Da ist die Schuld, Herr Professor, ein ungeheurer Kittel. Jetzt, wem paßt er? Also frag ich Papa. Womit, Papa, hast du dein Leben so verbracht? Imitiert: Ach Junge, was tut ein Chirurg von einem Schlamassel zum anderen. Ein Chirurg operiert eben. Daneben hat er noch seinen Goldfisch. Und sein Klavier. Wieder als Rudi: Plötzlich wußte ich: es ist ein Glück, einen schrulligen Vater zu haben. Lächelnd seh ich, daß er älter wird. Und ich weiß, er muß schon immer ein bißchen so gewesen sein. Besorgt um den Goldfisch. Und in der Klinik immer pünktlich. Du warst also immer Chirurg, Papa? Imitierend: Aber ja, Junge. Schon in früher Jugend hab ich immer gern was zerlegt. Als Rudi: Und dann hat er’s eilig, Herr Professor. Imitierend: Junge, ich hab heut vier Mägen und ein Herz. Erhol dich, Junge, dein Vater muß in die Klinik. Rudi schlägt nach einer Schnake auf seinem Handrücken.
Liberé Was … was tust du da.
Rudi Eine Schnake.
Liberé Du tötest Schnaken?
Rudi Sie wollen mich ablenken, Herr Professor. Schnaken! Bitte, sagen Sie meinem Vater nichts von dem Brief.
Liberé Du mußt es ihm sagen.
Rudi Schonen wir den armen Mann vor dem Detail. Mörder, das ist schön allgemein. Daß sein Sohn ein Mörder ist, daran wird er sich gewöhnen.
Liberé Du spielst dich auf, Rudi.
Rudi Stimmt.
Liberé Spielst den Täter.
Rudi Ich üb die Rolle wieder, die ich früher spielte, dann vergaß.
Liberé Das prickelt angenehm, solang man weiß, man hat sich das selber ausgedacht. Hat man aber wirklich was getan, Rudi, dann hat man Blei im Nacken. Der Kopf dreht sich nicht mehr. Du kannst nicht mehr nach hinten schauen. Du aber mischst dich einfach ein. Päppelst dir Erinnyen auf. Stopfst sie aus mit Stroh. Damit du was zum Gruseln hast. Hochmut ist das. Du spielst mit der Schuld. Lädst dir Morde auf, die dich nichts angehen. Und dabei schaust du dir zu.
Rudi Muß ich doch, Herr Professor. War ich’s, war ich’s nicht. Könnte ich’s gewesen sein? Sie waren damals in Indien, sagt Papa. Ich weiß nicht, wie ich mit Ihnen reden soll. Wer nicht hier war zu der Zeit, weiß nicht, wozu er imstand gewesen wäre.
Liberé Ich weiß es, Rudi.
Rudi Möglich, Sie haben mal ein Krokodil gequält, Mosquitos vergiftet, was! Bitte, Herr Professor, zündet einer vor Ihnen eine Zigarette an und beim ersten Zug qualmt ihm der Rauch so blaugelb dick aus dem Mund, woran denken Sie da? An Nikotin, Teerprodukt, Kranzgefäße oder Verbrennung indischer Witwen? Ja? Ich seh sofort Kamine, besonders plump-breit-rechteckige Kamine. Und es riecht so.
Liberé Rudi, ich hab das Rauchen verboten in Karwang.
Rudi Oh, schön. Also doch eine passable Anstalt für mich.
Liberé Eine solche Thuja, zum Beispiel, findest du nicht so schnell wieder. Es wundert mich, daß du nicht siehst, wie eigenartig sie gewachsen ist. Falls du bemerkt hast, wie sie aussieht mit ihren sieben Stämmen, sag es ruhig. Mich erschreckst du nicht damit. Von hier, Rudi, vielleicht siehst du’s von hier aus. Er führt ihn so, daß Rudi die Thuja von der Seite sieht.
Rudi Besser, Sie sagen gleich, was Sie damit auskundschaften wollen. Ich bin nicht aufgelegt, über Gewächse zu plaudern.
Liberé Merkwürdig, Rudi, manchmal friere ich unter deiner Verachtung, aber manchmal tut es mir richtig wohl, daß du mich so scharf verachtest.
Rudi Ich, Sie verachten, Herr Professor! Ich mache mir höchstens Sorgen um Sie. Es könnte ja sein, Sie ruinieren an mir, wenn Sie mich nicht gradekriegen, Ihren guten Namen.
Liberé Ein guter Name, Rudi, ist ein Pseudonym.
Rudi Also ist der Name meines Vaters mein Pseudonym. Also brauch ich endlich meinen wahren Namen. Sagen Sie’s meinem Vater, sein Name bleibt unversehrt, ich bin getauft durch mein Handwerk von damals. Sagen Sie’s meinem Vater: ich habe gestanden. Sagen Sie ihm, es ist so: sein Sohn ist der