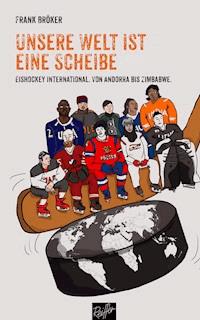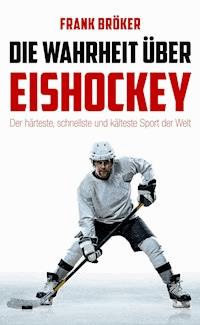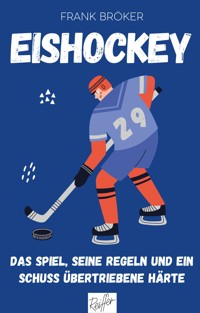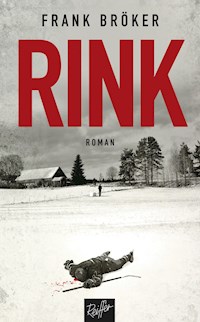Eishockey international. Von Andorra bis Zimbabwe.
Umschlagillustration und -gestaltung: Roberta Bergmann (www.robertabergmann.de)
Satz/Layout: Andreas Reiffer
Lektorat: Lektorat-Lupenrein.de
1. Auflage 2017, identisch mit der Printversion
© Verlag Andreas Reiffer
ISBN 978-3-945715-55-0
Verlag Andreas Reiffer, Hauptstr. 16 b, D-38527 Meine
www.verlag-reiffer.de
www.facebook.com/verlagreiffer
»Eishockey bildet das Wesen aller kanadischen Erfahrungen in der Neuen Welt ab. In einem derart unwirtlich kalten Land gibt dieser Sport uns die Gewissheit, dass wir trotz der Todeskälte noch nicht gestorben sind.«
Frei übersetzt nach Stephen Leacock
»Glaube an das Unmögliche, und das Unmögliche wird möglich.«
SMS von Nationaltrainer Ralph Krueger an die Schweizer Mannschaft vor dem alles entscheidenden Gruppenspiel gegen Russland bei der WM 2000 in St. Petersburg. Die Schweizer siegten 3:2, Russland erlebte eine historische WM-Pleite.
»Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Zum Beispiel ein Eishockeystadion.«
Johann Wolfgang von Goethe und Autor Frank Bröker
Warm-up indischer Hockeydamen im Kashmirhochland von Ladakh. (Foto: Adam Sherlip)
Aus der Kälte kommt die Kraft
Als amtierender Präsident der IIHF freue ich mich ganz besonders darüber, dass ein Buch über die vermeintlich »Kleinen« geschrieben wurde, denn der Internationale Eishockeyverband (IIHF) entwickelt und fördert weltweit Programme, um auch den Fans in nicht-traditionellen Eishockey-Ländern eine Plattform bieten zu können. So steht zum Beispiel die Weiterentwicklung und Etablierung unseres Sports in Asien auf meiner Prioritätenliste sehr weit oben – auch wenn ich mir bewusst bin, dass bis zu einer Weltmeisterschaft auf diesem Kontinent noch ein langer Weg vor uns liegt.
Das vorliegende Buch kann ein informativer, spannender und nicht selten amüsanter Reisebegleiter auf diesem Weg sein. Frank Bröker recherchierte fast ein Jahr lang, führte zahlreiche Interviews und trug Eishockeyfakten und -anekdoten aus allen möglichen Ländern zusammen. Und immer trieb ihn eine Frage an:
Wo auf der Welt wird Eishockey gespielt? Natürlich hauptsächlich in Nordamerika, Russland und Europa. Aber mittlerweile auch auf Breitengraden, die sich eher für den Wassersport eignen und die eine kalte Jahreszeit nach unseren Maßstäben gar nicht kennen. Bereits in den 1920er-Jahren überbrückte das Spiel mit dem Puck Kontinente und hat inzwischen ganz erstaunliche Winkel erreicht. Ohne kanadische oder schwedische Hockeymissionare, die es aus irgendwelchen Gründen in solche exotischen Länder verschlug, oder die als Stiftungsarbeiter etwa in der »Hockey Foundation« aktiv sind, und die in ihrer neuen Heimat Pionierarbeit leisten, wäre so manches Land heute um eine Sportart ärmer. Sicher, von großer Kunst sind die Spiele auf einem Stausee im Himalaya noch weit entfernt, doch auch dort rasen die Cracks mit derselben Euphorie übers Eis und ist die Spannung bei einem Penaltyschießen dieselbe wie bei einem europäischen Spitzenspiel.
Wie so oft, ist es eine Frage des Anspruchs. Wer gemeinsam mit 300 anderen Zuschauern im Ice Rink einer Shopping Mall in Hongkong Spin-O-Ramas, Toe Drags und andere Schnörkel erwartet, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enttäuscht. Dort spielt ein Sidney Crosby höchstens zu Charity-Zwecken, wenn die Karriere in der NHL lange vorbei ist. Ob Eishockey in Städten wie Hongkong jemals zur großen Show wird, darf aktuell bezweifelt werden. Die IIHF ist jedoch überzeugt, dass mit einer guten Portion Willen und Enthusiasmus das nächste Level erreicht werden kann, um den kältesten und schnellsten Mannschaftssport der Welt selbst im cricketverrückten Indien oder in einer Basketball-Nation wie China eines Tages fest zu etablieren.
Eishockey ist an sich ja schon eine reichlich verrückte Sportart, und je ungeeigneter die Bedingungen dafür sind, umso mehr Leidenschaft und manchmal auch Opfer braucht es, ein einzelnes Spiel oder sogar eine Liga auf die Beine zu stellen. Bisweilen fühlt man sich nostalgisch an die ersten europäischen Ausläufer erinnert, als Eishockey auf vom Schnee befreiten Seen und präparierten Tennisplätzen gespielt wurde – falls es überhaupt ausreichend kalt war: Die 1928er-Tauwetterspiele von St. Moritz lassen grüßen, als die Spritzfläche so dünn war, dass man die Löcher mit Fruchtresten stopfte und den Goalies die Orangenschalen um die Ohren flogen; oder die Eishockey-WM 1930, als das Eis in Chamonix schmolz und die Weltmeisterschaft in Berlin und Wien fortgesetzt werden musste. Als Konsequenz vergab der Weltverband die Spiele fortan nur noch an Kunsteis-Eldorados. Zambonis gab es noch nicht, und die Eisflächen waren knüppelhart. Länder wie die Mongolei oder Nepal kennen bis heute kaum anderes, und selbst um solche, nach unseren verwöhnten Standards katastrophalen Bedingungen zu schaffen, bedarf es größter Kraftakte. Auf Teufel komm raus wird improvisiert: Ausrüstungen müssen besorgt, Trainer ins Land geholt, Reisespesen gesammelt werden. »Alle Momente, in Ulaanbaatar Eishockey zu erleben, sind viel größer als man selbst. Fängst du an, Eishockey zu spielen, leuchtet die ganze Welt.« Das sagen jene, die es wissen müssen: die Spieler der mongolischen Nationalmannschaft. Eine verschworene Truppe mit großen Träumen und nur ein kleiner Teil unserer großen Eishockey-Gemeinschaft, die über die ganze Welt verteilt ist.
René Fasel, Präsident des Internationalen Eishockeyverbandes
Über dieses Buch
Viel geschrieben wurde bereits über die großen Eishockeytitanen, allen voran über unsere einstigen Lehrmeister aus Nordamerika. Wer anführt, dort sei der Sport zum Unterhaltungsgeschäft verkommen, war nie in Kanada, wo Eishockey in der Verfassung als Nationalsport verankert ist. Was neben all dem Tempo und der Körperlichkeit wirklich fasziniert, ist die geschichtliche Prägung des Eishockeys als kultureller Teil eines Landes.
Der in Québec aufgewachsene Luis de Almeida Johansson formuliert es so: »Kanada ist ein Land, in dem es völlig unmöglich ist, kein Hockey zu spielen. Darin liegt etwas Religiöses.« Und Kanada ist die Eishockeymutter. Sie gebar im Laufe der Zeit viele Kinder, und wie gute Mütter so sind, kümmern sie sich um jedes einzelne. Ganz egal, ob die Kids in Asien oder Afrika mit Kufen an den Schuhen aufwachsen: Die Hockey-Mom besorgt ihnen Trainer, Ausrüstungen, fährt sie zu den Spielen, um ihnen auf gefrorenen Seen oder in Shopping Malls bei der Puckjagd zuzusehen. Manche Kinder wurden früh zu Klassenbesten. Russland, Schweden oder die Tschechen seien hier genannt. Andere, wie Deutschland, sorgen nur dann für gute Schulnoten, wenn an kongenialen Spieltagen alles Glück am Schläger zusammenkommt.
Zurück zu Luis de Almeida Johansson. Der hütet ab und zu das Tor der portugiesischen Eishockeynationalmannschaft. Ich war überrascht, dass in einem fußballverrückten Land überhaupt jemand diese frappierende Möglichkeit in Betracht zieht. Auch Wüstenländern wie Turkmenistan oder Kuwait hätte ich vor meinen Recherchen für dieses Buch jegliches Kufenkönnen abgesprochen. Die Blogs und Bilder von Groundhoppern wie Adrian Mizzi und Dave Bidini bewiesen aber das eisglatte Gegenteil.
Da saß ich vor einer Weltkarte und ließ den Puck zwischen Mexiko und Japan, Grönland und Australien hin und her rollen. Im Frühjahr 2016 begrub er Guangdong, Hongkong und Macau unter sich. Ich schrieb Emails an die dort ansässigen Eishockeyverbände: »Hallo, ich bin ein deutscher Autor und habe ein paar Fragen über die Hockeysituation in eurer Gegend.« Ungläubig fielen die Reaktionen aus. Ein gewisser Tony Tang antwortete, ich solle meinen Rucksack schnüren und mir selbst ein Bild machen. Wir vertagten es auf später. Kurz darauf fiel der Puck über der Mongolei um. Jetzt hatte ich Purevdavaa »Pujee« Choijiljav am Wickel, der Fotos schickte und mich zur Landesmeisterschaft und einer Eselsmilch einlud. Im Iran fand ich Christian Müller, in Weißrussland einen Journalisten, der aus Angst, seine Arbeit zu verlieren, anonym bleiben möchte. Den Kontakt zum Luxemburger Autor Francis Kirps stellte mein Verleger Andreas Reiffer her. Der Puck fiel auf dem nächsten Land um, und so ging es munter weiter bis in den Spätsommer 2017. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus Platzgründen war es mir leider nicht möglich, ausnahmslos alle Länder, in denen Hockey gespielt wird, so ausführlich zu behandeln, wie ich es gerne getan hätte. Gemeinsam mit Verleger und Lektor musste deshalb eine Auswahl getroffen werden. Insgesamt war es ein spannender Austausch mit Hockeyanern aus der ganzen Welt, der so manches hausgemachte deutsche Eishockeyproblem als lächerliche Banalität entlarvte.
Zum Glück ist unsere Welt eine Scheibe, denn das erlaubt uns einen Blick weit über den Tellerrand hinaus. Wir kauften sie eines Tages im Fanshop unseres Lieblingsvereins und kamen nie mehr von ihr los. Seither sind wir Teil einer einzigartigen, wenn auch etwas durchgeknallten Familie.
Die Geschichte eines Weltverbandes
Der Eishockey-Weltverband wurde am 15. Mai 1908 in Paris als Ligue internationale de hockey sur glace (LIHG) im Beisein belgischer, englischer, schweizerischer und französischer Abgesandter gegründet. Die Amtssprache war Französisch, Mitte der 1950er-Jahre adoptierte man die englische Schreibweise, und die Rede war fortan von der International Ice Hockey Federation (IIHF). Ein Jahr nach der illustren Versammlung von 1908 stieß die kaiserliche Sportnation Deutschland hinzu und konnte somit an Europameisterschaften teilnehmen. 1911 folgte dem LIHG-Ruf für kurze Zeit Russland, vertreten durch den Petersburger Eislauf-Verein. Mangels erkennbarer Entwicklungen wurde das Zarenreich, in dem wie überall sonst in Europa auch vornehmlich Bandy mit Ball und Krummstock gespielt wurde, kurz darauf wieder ausgeschlossen. Schrittweise übernahm die LIHG die im kanadischen Mutterland des Pucksports erdachte Regelkunde. Im Jahr 1920, während Kanada und die USA wohlgemerkt zu den Olympischen Sommerspielen nach Antwerpen angereist waren, überredete der Verband beide Verbände zum Beitritt.
So waren es 1920 die Ahornblätter des Amateur-Champions Winnipeg Falcons, die aus allen Rohren feuerten und beim Showdown gegen Schweden 12:1 siegten. Kurzum: Die Macht aus Übersee, in der gebürtige Isländer den Ton angaben, spielte Europas Vertreter an die Wand. Besonders das Orchester um den pfeilschnellen Vorgeiger Frank Fredrickson avancierte zum Novum. Nachträglich legte die LIHG fest, dass der Frühling von Antwerpen das Debütturnier aller Weltmeisterschaften war. Bis 1928 fanden diese ausschließlich auf olympischem Terrain statt. Zwei Jahre später schlug man den bis heute bekannten, jährlichen Modus mit Ausnahmen ein: Während des Zweiten Weltkrieges ruhte der Puck, bis 1968 galten die Ringespiele gleichermaßen als WM-Tournament. Ein Dorn im Auge des amtierenden Verbandspräsidenten John Francis »Bunny« Ahearne. »Durch Olympia und den WM-Ausfall gehen uns jedes Jahr 400.000 Dollar durch die Lappen«, rechnete er vor und setzte durch, dass fortan alle vier Jahre zusätzlich eine Weltmeisterschaft zu spielen sei. Nur hinsichtlich der »Olympischen Eishockeyturniere« von 1980, 1984 und 1988 verzichtete der Verband später noch auf die Austragung einer WM. Eingeflochten war bis 1991 die Medaillenvergabe an die besten drei europäischen Teams, dann strich man den Titel Europameister und verwies stattdessen auf die seit den 1960er-Jahren organisierten Teamwettbewerbe. Der IIHF-Continental Cup und die Champions Hockey League (CHL) gehören zum aktuellen Layout.
In den 1930er-Jahren kam es zu einem ersten Run auf die LIHG. Jeder Verband, der bespielbare Eisflächen nachweisen konnte, wollte gegen den Lehrmeister Kanada antreten. Kriegstreiber behandelte man nach den Statuten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und verbannte Nationen wie Österreich, Deutschland und Japan für Jahre von der Eishockeykarte. In Friedenszeiten nahm man sie dann mit allerlei Querelen wieder auf. Das Fabelhockey aus der Neuen Welt war dem der meisten Europäer noch bis Ende der 1940er-Jahre um Lichtjahre voraus. Erst vermochten die mit Exilkanadiern bestückten Briten Paroli zu bieten, dann die Schweizer, die mit dem Ni-Paradesturm des HC Davos, in Persona Bibi Torriani, Hans und Pic Cattini, der Inbegriff für ausgefeiltes Kombinationsspiel wurden. In den Nachkriegsjahren reihte sich das wiedererstarkte Schweden mit Gösta »Lill-Lulle« und Sven »Tumba« Johansson vom Serienmeister Djurgårdens IF ein. Auch die Tschechoslowaken um die LTC-Prag-Eisheiligen Vladimír Zábrodský und Bohumil Modrý streckten ihre Fühler nach Gold aus. Bei den Olympischen Spielen 1948 in St. Moritz gewann Kanada so knapp wie nie zuvor die fest eingeplante Goldmedaille und tat sich danach immer schwerer, schlagkräftige Amateurmannschaften ins Rennen zu schicken.
Mit Aufnahme der UdSSR im Jahr 1952 veränderte sich alles. Wie aus dem Nichts tauchte eine neue Großmacht des Welteishockeys auf, die bisher lediglich in Testspielen aufhorchen ließ. Einst waren es Bandy- und Fußballspieler, die nun zur militärisch gedrillten Roten Maschine reiften, in die Schlachten geführt von Bandengenerälen wie Arkadi Tschernyschov, Vladimir Jegorov und besonders Anatoli Tarasov. Dieser oberste Eishockeyentwickler hatte nach Ende des Zweiten Weltkriegs dafür gesorgt, dass die talentierten Sowjetspieler zum Paradeclub CSKA Moskau delegiert oder besser einberufen wurden. Wer für Mütterchen Russland spielen wollte, zog mit militärischem Rang in die Sportkaserne und schoss fortan mit Puckmunition. 1954 wurden die Russen erstmals Weltmeister. Für kurze Zeit konnten die Abordnungen der Canadian Amateur Hockey Association (CAHA) noch gegenhalten, dann war der Wachwechsel endgültig vollzogen. Um überhaupt aufs Podest zu kommen, setzten die Kanadier bald auf ein vom legendären David »Father« Bauer trainiertes, heißblütiges Juniorenteam. Seinerzeit war der Amateurstatus, der Spielern vorschrieb, ihr täglich Brot nicht mit dem Eishockeyspielen verdienen zu dürfen, noch in Stein gemeißelt. Den NHL-Pro’s der Bobby-Orr-Ära blieb der Olympia- und WM-Zugang somit verwehrt. Bereits seit 1908 unterschied man in Nordamerika zwischen Hobbyspielern und Geldverdienern. Olympisch durften letztere erst seit dem 1981er-Beschluss zur Lockerung des IOC-Amateurparagraphen mitmischen. Bei Weltmeisterschaften wollte die IIHF-Mehrheit diesen Passus bereits 1969 mit der Teilnahme von bis zu neun Profis pro Team ermöglichen, was die IOC-Weisen um Präsident Avery Brundage aus dem Land Absurdistan so beantworteten: »Wer gegen Profis antritt, verliert seine Amateureigenschaft und ist automatisch für Olympiaden gesperrt.« Bunny Ahearne intervenierte nicht, der Ostblock applaudierte. Gegen eine Horde NHL-Profis sah man sich im Kampf um Gold wohl im Nachteil. Zum Dank für die konservative Linie des IIHF-Chefs gab es Wiederwahlstimmen. Grund genug für die Kanadier, sich bis auf weiteres aus den WM-Stadien zu verabschieden. Dortselbst setzte die Phalanx der UdSSR, gefolgt von Tschechoslowaken und Schweden, alle Maßstäbe des damaligen Eishockeys.
Trafen Kanada und Russland in Ausnahmeturnieren trotzdem aufeinander, erlebte man Sternstunden des Eishockeys. Die Summit Serie 1972 sprengte alles bisher Dagewesene: NHL vs. Rote Armee. Viermal wurden Kanadas Eishockeyhochburgen in Montreal, Toronto, Winnipeg und Vancouver Zeugen des Dramas, viermal kreuzten die Meister der feinen Klinge in Moskau die Schläger. Im Ranking der 100 brillantesten Eishockeygeschichten rangiert der 28. September 1972 auf dem Eis des Luzhniki-Palastes ganz vorne: Das alles entscheidende Match, nach Drittel zwei führt die Sowjetunion 5:3, Phil Esposito und Yvan Cournoyer stellen auf Gleichstand. 19 Minuten und 25 Sekunden sind im letzten Abschnitt absolviert, Kanada trifft zum 6:5 – der Gamewinner. Am Mikro zittert Foster Hewitts Stimme, brandet auf, sein legendärer Ruf »Henderson has scored for Canada!« war die einfachste Zusammenfassung des größten kanadischen Tores, das je geschossen wurde.
Gold-Mission erfüllt bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver: 3:2-Triumph der Kanadier im hochdramatischen Finale gegen die USA. (Foto: s.yume)
1975 endete die Ära Ahearne. Dr. Günther Sabetzki rückte an die Verbandsspitze und krempelte die Föderation gründlich um. Gleich zu Anfang gelang der größte Paukenschlag. Das Kriegsbeil zwischen dem IOC und der IIHF wurde begraben, bei der 1976er-WM in Polen trat die USA bereits mit Profis aus der World Hockey Association (WHA) an. Ein Jahr später in Wien kehrte auch Kanada mit den Esposito-Brüdern Tony und Phil zurück. Im Gegenzug handelte Sabetzki die Möglichkeit aus, Europas Elite am renommierten Canada Cup teilnehmen zu lassen. Der Düsseldorfer erkannte früh das, was unter dem 1994 gewählten Nachfolger René Fasel weiterhin beherzigt wird: »Das NHL-Eishockey in Übersee ist ein Machtfaktor, der nicht ignoriert und schon gar nicht bekämpft werden darf.« In die Ära Sabetzki fiel das Ende des Kalten Krieges, verbunden mit so mancher russisch-kanadischer Schlacht, die beim »Punch-Out in Piestany« 1987 zur größten Prügelei aller Zeiten kulminierte. In einem Spiel während der U20-WM in der ČSSR traute der norwegische Referee Hans Ronning seinen Augen nicht. Minuten vor der Schlusssirene kam es beim Stand von 4:2 für Kanada zu einem Bench-clearing brawl, einer Massenschlägerei zwischen beiden Teams, an der sich auch Trainer und Betreuer beteiligten. Ronning, im Hauptberuf Kindergärtner, blickte flehentlich zur VIP-Tribüne und suchte das Weite. Dort saß Sabetzki, der das Hallenlicht dimmen ließ. Es nützte nichts. Sergej Fedorov, Brendan Shanahan, Vladimir Konstantinov, Theo Fleury und all die anderen künftigen NHL-Rockstars droschen auch im Dunkeln munter weiter aufeinander ein. Das Treiben musste unter massivem Polizeiaufgebot beendet werden, die Delegationen hatten das Land sofort zu verlassen, Sperren folgten.
Mehr Freude bereitete dem IIHF-Chef die Geburtsstunde des Damenhockeys im Jahr 1990. Eine Herzensangelegenheit, der wenig später die Eingliederung unabhängig gewordener Sowjet-Staaten in den Verband folgte. Der Weltverband wuchs von bisher 31 auf 50 Mitglieder an, den bisherigen WM-Gruppen A bis C wurden weitere Leistungslevel hinzugefügt.
Leidenschaftliche Strukturen
2008 feierte die Föderation ihr 100-jähriges Bestehen. Unter René Fasel war die Anzahl der Verbände nochmal auf knapp 80 gestiegen. Teil der IIHF-Familie zu sein, erhöht die Chancen, das nötige Rüstzeug für den Aufbau einer eigenen Eishockeykultur zu erhalten. Jeder Landesverband ist herzlich eingeladen, sofern sich die Staatsführung sportlich-fair benimmt und keine Rassentrennungen befürwortet. Für WM-Teilnahmen sollten eine Eisfläche olympischen Ausmaßes und ein kontinuierlicher nationaler Ligabetrieb vorzeigbar sein. Um all dies zu erreichen, kann u.a. die Teilnahme an Camps angeboten werden. Als Konvents dienen abseits der großen Bühnen Entwicklungsturniere, in denen selbst die kleinsten Mitglieder, möglichst im Dreigestirn aus Herren, Damen und Junioren, um Zählbares fighten können. Drei Kategorien umfasst eine IIHF-Mitgliedschaft. 1: Die derzeit 54 Vollmitglieder begreifen sich als Nationen mit eigens agierenden Föderationen, regelmäßige WM-Teilnahmen sind wünschenswert. Auf jährlichen Kongressen besteht Mitspracherecht, alle vier Jahre darf über die Zusammensetzung des »Council« genannten Vorstandes samt Präsident auf Generalkongressebene abgestimmt werden. 2: Die assoziierten, sprich angeschlossenen Verbände verfügen über keinen separaten Eishockeyverband und sehen sich außerstande, regelmäßige WM-Auftritte zu gewährleisten. 3: Diese Kategorie betrifft angegliederte Verbände, deren Fokus auf Engagements bei den Inline-Turnieren der Männer beschränkt ist.
Bereits zur WM 1951 in Paris teilte der Weltverband seine Mitglieder in leistungsgerechte Gruppen ein. Kanonenfutterteams wie die Niederlande, Frankreich oder Belgien, das im Vorjahr gegen die Schweiz und Kanada mit 3:57 Toren nach der Vorrunde die Segel streichen musste, fanden sich fortan am unteren Ende der Fahnenstange wieder. Heutzutage wird der Herren-Weltmeister in der Top-Division (A-Gruppe) der 16 besten Nationen ausgefochten. Aus zwei 8er-Gruppen trennt sich nach der Vorrunde die Spreu vom Weizen. Die besten acht Teams qualifizieren sich fürs Viertelfinale, die jeweils beiden Letzten ihrer Gruppe steigen direkt ab in die Division IA (B). Auf dem Weg nach unten folgen die Division IB (C), dann die Divisionen IIA (D) und IIB (E). Die Division III (F) spielt zumeist in nur einer Staffel. Neu einsteigende Verbände beginnen an diesem Rockzipfel oder müssen sich je nach Größe des Teilnehmerfelds dafür in Ausscheidungen qualifizieren. Genauso verhält es sich im Ranking der U20-/U18-Junioren: in den Top-Divisionen gastieren je zehn Teams. Im Damenfeld reicht der Weg von der zuletzt auf zehn Nationen aufgestockten Spitzengruppe abwärts bis in die Division IIB. Basierend auf allen WM-Resultaten und den Platzierungen bei den Olympischen Spielen bilden sich die 1933 eingeführten Weltranglisten ab. Vor jedem Ringeturnier wird entschieden, wie viele der Topteams nebst Gastgeber gesetzt sind und wer die Fahrtkarte ins olympische Dorf in der Qualifikation erst noch lösen muss.
Das alljährliche WM-Topfestival der Herren ist der einzige wirklich rentable Stein im IIHF-Mosaik. Der Gewinn daraus wird auf 30 Millionen Schweizer Franken beziffert. Knapp 40 weitere unprofitable Turniere hängen an diesem Tropf. Ohne diesen finanziellen Lebensnerv fiele die Wettbewerbsstruktur wie ein Kartenhaus in sich zusammen, ließen sich kaum Förderprogramme subventionieren. Dass man auf Austragungen der ersten Garde in Nordamerika seit Jahren verzichtet, gehört zu den kleinen Merkwürdigkeiten. Aber so läuft er eben, der Deal zwischen der allmächtigen NHL und der IIHF: Man kommt sich im Mai eines WM-Jahres nicht in die Quere, wenn gleichzeitig die heißeste Phase in den Play-offs um die dekorative Punsch-Schüssel eines Londoner Silberschmiedes beginnt. Und der Stanley Cup ist nun mal das Größte, was es im Eishockey zu gewinnen gibt. Nie werden somit die größten Koryphäen bei einer Weltmeisterschaft gemeinsam aufs Eis fahren. Allein diese Verkettung einem kognitiv einfach strukturierten Sportfreund zu erklären, ist eine Herausforderung. Wer die Titanen sehen will, muss alle Jubeljahre zum World Cup of Hockey reisen, dem Nachfolgeturnier des Canada Cups. Jenes Spektakel scharrte zuletzt im September 2016 die Top 6 der Weltrangliste, Kanada, Russland, Finnland, die USA, Schweden und Tschechien in Toronto zusammen. Hinzu gesellten sich eine nordamerikanische Youngster-Auswahl und das Lückenfüller-Team Europa mit immerhin fünf deutschen NHL-Stars. Leon Draisaitl, Tobias Rieder und Co. landeten am Ende völlig überraschend im Best-of-Three-Finale und scheiterten knapp am Favoriten Kanada.
Volle Halle beim WM-Championat der Top-Division 2015 in Prag. (Foto: Artis Rams)
Auf höchster musealer Ebene sitzt die NHL mit der IIHF in einem Boot. Die internationale Hockey Hall of Fame (HHOF) ist eine Ruhmesstätte in Toronto und wurde 1943 gegründet, um bedeutende Eishockey-Persönlichkeiten zu ehren. 54 Jahre später zog die IIHF Hall of Fame nach und verfügt dortselbst über einen separaten Personenkult.
Dass nicht alle Klassenbesten eine vergoldete Olympia-Teilnahme vorweisen können, ist schade. Zumal nur ein Dreifachgewinn aus Stanley Cup, Olympia und Weltmeisterschaft in den Triple Gold Club (TGC) führt. Wayne Gretzky im TGC? Fehlanzeige. Die NHL lässt sich eben für Turniere schwer bitten, an denen sie nichts verdienen kann.
Heben die NHL-Spielergewerkschaft und der durch die Clubbosse eingesetzte Commissioner die Daumen, lässt die beste Liga der Welt ihre Profis für drei Wochen zu den Ringefesten ziehen. Seit Nagano 1998, dem »Jahrhundertturnier«, so genannt, weil nach Ende des Kalten Krieges erstmals alle verfügbaren NHL-Stars teilnahmen, klappte das hervorragend. Mehr als 700 Puckkünstler verzauberten bisher die Hallen. Für Transport- und Versicherungskosten kamen die Veranstalter auf. Dafür dürfte alle vier Jahre ein zweistelliger Millionenbetrag fällig gewesen sein. Für Südkorea 2018 zeigte der Daumen des amtierenden Commissioners Gary Bettman jedoch nach unten, und er rief im Frühjahr einen NOlympic-Beschluss aus. Was war geschehen?
Bettman, Herrscher über eine Liga, die pro Jahr vier Milliarden Dollar umsetzt, hatte zu hoch gepokert. Südkorea verfüge über keinen wichtigen Markt, unter Beteiligung an den TV-Einnahmen würden die Spieler anreisen, hieß es aus Insiderkreisen. IOC und IIHF wiegelten ab, erklärten zudem, dass Kosten wie bisher für die Hege und Pflege der Entourage nicht mehr zu eigenen Lasten getragen werden. Die Antwort kam prompt: »Dann nehmt Eishockey eben ins Programm der Sommerolympiade.« Nun ja, 1920 gab es das in Antwerpen auch schon mal.
Eishockey in Europa
Europas Hockeygeschichte beginnt mit dem Bandy. Doch der Reihe nach. Um 1850 waren es in Kanada stationierte Soldaten des Britischen Königshauses, die aufgrund des rauen Klimas ihre Landhockeyspielereien aufs Eis verlegten. Mit Korkbällen wurde darauf auch Bandy gespielt. Zurück in der Heimat zelebrierten die Briten das Spiel auf fußballplatzgroßen Überschwemmungsgebieten, wo winters das Nass gefror. Um die Jahrhundertwende erreichte das Outdoor-Rennen die Metropolen Stockport und Edinburgh; in Londonöffnete der Prince’s Skating Club seine Tore, Zehntausende strömten hin. Der Funke sprang über den Ärmelkanal und ließ Bandy in Europa zum Breitensport gedeihen. Auch heute wird er noch vornehmlich dort gespielt, wo die Witterung übers Jahr knackige Kälte verspricht: in Skandinavien, Russland und den Coldspots Asiens.
In der Neuen Welt hatte man derweil die britischen Bälle in Scheiben zerschnitten und sie Pucks genannt. Puck ist Englisch und bedeutet Kobold, siehe auch Shakespeares Figur des Puck in: »Ein Sommernachtstraum«.
Eishockey in England (Großbritannien)
IIHF-Vollmitglied seit: 19. November 1908
World Ranking Männer: 24, Frauen: 21
Spielerpool: 12.500, Einwohner: 64 Mio.
Indoor-Rink: 63, Outdoor-Rinks: 0
Von Peter Patton bis Two point Tony
Der Ruf »Schlag den Kobold!« drang um die Jahrhundertwende von Kanada nach Großbritannien, als die Nachfahren britischer Auswanderer Québec in Richtung der Universitätsstädte Oxford und Cambridge verließen. Noch war Bandy Trumpf und der Clinch zwischen den beiden Uni-Teams legendär. Doch bereits 1885, während eines Turnierausfluges nach St. Moritz, wurde der Spielball kurzfristig durch einen kanadischen Puck ersetzt. Das älteste und bis heute ausgespielte Eishockeyderby war geboren. Zur selben Zeit bestaunte ein junger Mann namens Peter Patton die für ihn in marsianisch verfassten Hockeyregeln seiner kanadischen Kommilitonen. Der Sohn eines Brigadegenerals war des Bandys überdrüssig geworden. Einem schlecht springenden Korkball hinterhersprinten, kam für ihn nicht mehr infrage. Der Koboldzauber wirkte. Ausrüstungen wurden angefertigt, Verbündete gefunden. Harald Duden war einer von ihnen. Nach Ende seiner Jurastudien an der New Yorker Columbia-Universität zog der US-Belgier nach London und war als ehemaliger College-Spieler auf der damals den besten Allroundern vorbehaltenen Rover-Position tonangebend. Auch der Heimat blieb Duden verbunden, in Brüssel stand er zeitweise in Belgiens Liga auf dem Eis. Das Londoner Skating-Gelände kam nicht mehr zur Ruhe. Fünf Teams zelebrierten dort ab 1903 Eishockey. Patton, in Personalunion Ligachef, Spieler und Präsident des Prince’s Ice Hockey Clubs (PIHC), übergab nach dem Endspiel die Trophäe an die London Canadians. 1904 reisten die Prinzen nach Lyon und schlugen im ersten reinen Eishockeymatch zweier europäischer Clubs am 24. Januar den Gastgeber 2:0. Bis dahin war es an der Tagesordnung gewesen, je eine Halbzeit Bandy und eine Halbzeit Hockey zu spielen, doch damit war bald Schluss.
Neben London und Lyon blühten weitere Eishockey-Metropolen auf. In Berlin hatte sich nach der Premiere auf dem Halensee im Februar 1897 eine Stadtliga gebildet. 1908 stellte Promoter Hermann Kleeberg den ersten multinationalen Event auf die Kufen. Nachdem u.a. das künftige Aushängeschild des deutschen Hockeys, der Berliner Schlittschuh-Club (BSchC), in der Vorrunde patzte, siegte Londons Prince’s Skating Club im Eispalast-Finale gegen den Club des Patineurs de Paris. Im selben Jahr war Peter Patton, inzwischen Berufssoldat im Stande eines Majors, maßgeblich an der LIHG-Gründung beteiligt.
Regelkunde in Englands National Ice Hockey League (NIHL). (Foto: Gary Cheeseman)
Die Weihen des englischen Meisters wurden ab 1907 fast regelmäßig den Oxford Canadians zuteil, dem härtesten Expat-Rudel Europas. Das Team setzte sich aus kanadischen Stipendiaten zusammen. In petto hatten sie einen neuen exotischen Hockeystil, der in den nächsten Jahren fleißig kopiert werden sollte. Überfallartige Pässe aus der Verteidigung heraus waren nur eine Augenweide von vielen. Das Spiel wurde temporeicher und verdrängte den geruhsamen, bandylastigen Stil aus grauer Vorzeit. Auch waren die Import-Stöcker furchterregend länger, was dazu führte, dass verängstigte Trainer sportliche Vergleiche mit den»Waffenträgern« ablehnten. Im Januar 1910 sorgte Peter Patton dafür, dass die Canadians bei der Debüt-Europameisterschaft mitmischten. Außerhalb der Wertung rückten sie für das indisponierte Frankreich nach.
In den Ring stellten sich die gastgebenden Schweizer, Deutschland und Belgien. Nur der spätere Champion Großbritannien kniff am Ende. Ob Patton eine Demütigung scheute oder ob der Weiher vor den Toren Montreuxs taute, ist nicht überliefert. Ehrfürchtig blickten die Zuschauer auf das charismatische Spiel der neuen Hockeygötter mit dem roten Ahornblatt auf dem Jersey. Zu verteidigen war es nicht, die Deutschen vom BSchC kamen beim 0:4 noch am glimpflichsten davon. Sichtlich unwohl war auch den an ihren schwarzen Krawatten zu erkennenden Schiedsrichtern zu Mute. Mit Behaglichkeit und der gewohnten Zigarre auf dem Eis war es vorbei, wenn Ernest Munro, Gustave Lanctot und John Higgins zum Angriff bliesen. Die Canadians wurden mittels Sonderstatus in den Weltverband eingegliedert, und erst als nach Ende des Ersten Weltkrieges der kanadische Hockeyverband auf den Plan trat, verschwand das Team von der großen Bühne.
In London hieß man weiterhin jeden hockeyaffinen Gast aus Übersee willkommen, wenn er denn nur fürs Nationalteam auflaufen wollte. Ein goldenes LIHG-Ruhmesblatt sollte her, doch von den »echten« Kanadiern war bisher noch jedes Team der Britischen Inseln auf die Plätze verwiesen worden. Auch bei den Olympischen Winterspielen 1936 kreuzten so zum wiederholten Mal eigentlich zwei kanadische Mannschaften die Schläger. Der Überseevertreter, die Halifax Wolverines, traf auf die London-Exilanten unter UK-Flagge. Was keiner wusste oder wissen wollte: es waren Halbprofis, die nach IOC-Statut gar nicht hätten teilnehmen dürfen. Dem frischgebackenen Manager und späteren Weltverbandschef Bunny Ahearne war es recht. Beide Teams marschierten durchs Turnier, den direkten Vergleich gewann Großbritannien mit 2:1 und holte Gold. Die Mannschaft um James Foster, Robert Wyman und John Darey hatte für die erste olympische Niederlage des kanadischen Titelhamsters gesorgt. Großbritannien ließ sich nach dem siegestrunkenen Showdown dreifach schmücken: als Olympiasieger, Welt- und Europameister. Mehr Ruhm erntete bisher kein anderes britisches Sportkollektiv. Und dass sich Bunny Ahearne später als Verfechter des Amateursports einen Namen machte, sei der Vollständigkeit halber nur am Rande erwähnt.
Von den Pucknationen der Britischen Inseln stellt England, beheimatet in der WM-Division IA, das erfolgreichste Team. Derzeit muss man schon Optimist sein, um an einen Durchmarsch nach ganz oben zu glauben. Zwischen 1962 bis 1994 brauchten die Mannen der British Ice Hockey Association (heute: Ice Hockey UK) dafür 32 Jahre, um im Anschluss direkt wieder in die Versenkung zu verschwinden. Ein Held schaffte es dennoch in die Geschichtsbücher: IIHF Hall of Famer Tony Hand, der 2004 als erster Eishockeyspieler überhaupt mit dem Order of the British Empire durch Queen Elizabeth II. ausgezeichnet wurde. Anfang der 1980er-Jahre warfen die Edmonton Oilers ein Auge auf den Youngster der Murrayfield Racers aus der British Hockey League (BHL) und zogen »The Scottish Gretzky« an 252. Stelle im 1986er-Draft. Von allen in Großbritannien ausgebildeten Spielern wurde bis heute nur Center Colin Shields 14 Jahre später diese Ehre zuteil. Doch keiner der beiden Schotten sollte je ein NHL-Spiel absolvieren. Shields wurde in Farmteams gewogen und für die große Karriere als zu leicht befunden. Tony Hand hätte es schaffen können, doch nach kurzen, von Heimweh geplagten Camp-Intermezzos ging es zurück auf die Insel. Lukrative Angebote aus renommierten Euro-Ligen schlug er aus, und so mischte »Two point Tony« weiterhin das britische Hockey auf. Aus dem Sturmgenius wurde ein Spielertrainer, der zuletzt u.a. in der English Premier Ice Hockey League (EPIHL), einem Unterbau der Elite Ice Hockey League (EIHL), Coach in Manchester war. Als Torfabrik ist er unvergessen und als Rekordhalter auch. Vergleiche mit Wayne Gretzky, auf den sich sagenhafte 2.857 NHL-Punkte vereinen, mögen gewaltig hinken, doch als Hands letzter Puck übers Eis tanzte, hinterließ die #9 eine unüberwindbare 4.000er-Scoringmarke. Und wer last but not least einen Spieler sucht, der in seiner Karriere in allen WM-Divisionen wirbelte, findet nur einen: Tony Hand.
Von West nach Ost
Dominierte Kanada unangefochten die frühen Jahre der internationalen Eishockeyszene, so waren die Plätze dahinter hart umkämpft. Briten, Schweizer, Österreicher, Böhmen, Deutsche und die zeitweise unpässlichen Mannschaften der USA und Schweden mühten sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges redlich. Europas Teams hatten alle eines gemein: Der Zufall bescherte ihnen Hockeylehrer aus Übersee. Ohne einen Mike Buckna, der Anfang der 1930er-Jahre die Heimat seiner Eltern besuchte, hätte das Prager Eishockey niemals so früh von sich reden machen können. In Paris tischte der Eiskunstprofi George Meagher kanadisches Regelwerk auf. Den Berlinern und Wienern fiel der Medizinstudent und spätere Fußdoktor Blake Watson, den Stockholmern der Filmemacher Raoul Le Mat zu. Und dass Davos seit mehr als 90 Jahren eine Eishockey-Hauptstadt ist, nach dem Ersten Weltkrieg untrennbar mit dem völkerversöhnenden Spengler Cup verbunden, hat seinen Ursprung in London. 1905 reisten Peter Pattons Canadians hockeyspielend durch die Schweizer Bergwelt. Folge: Kaum jemand wollte hinterher noch Bandybälle jagen, Pucks zogen ins Hochtal ein. 23 Jahre später gelang einem jungen Hotelangestellten eine Sensation. Das frischgebackene kanadische Olympia-Goldteam geruhte am 20. Februar 1928 im Kanton Graubünden Station zu machen und trat gegen den HC Davos an. 1:6 hieß es zwar am Ende, doch es war jener Hotelangestellte Toni Morosani, der die Chuzpe besaß, das erste Tor einer Schweizer Mannschaft gegen Kanada zu erzielen. Beim olympischen Turnier von St. Moritz hatte die »Nati« noch mit 0:13 verloren. Und das war schon ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem 0:33 von den Spielen 1924 in Chamonix gewesen.
Bis zur ersten Niederlage der Giganten sollte es jedoch noch dauern. Am Abend des 26. Februar 1933 war sie besiegelt, und die Welt staunte. Im frisch eingeweihten Prager Kunsteisstadion auf der Ostrov Štvanice, einer Moldauinsel nördlich der Karlsbrücke, verloren sichtlich verkaterte Toronto National Sea Fleas das Endspiel der Weltmeisterschaft. Zwei Gegner in einem Spiel waren zu viel gewesen. Nach einem vorabendlichen Altstadtgelage hieß der eine Pilsener Bier, der andere waren die US-Boys der Massachusetts Rangers. Captain Ben Langmaid bescherte den Gamewinner zum 2:1 ausgerechnet beim größten Hockeyturnier, das Europa bis dahin zu sehen bekam. 120.000 Zuschauer besuchten die 31 Begegnungen. Die Böhmische Nationalmannschaft stand nach dem entscheidenden Spiel gegen Österreich auf dem Bronzetreppchen. Dass es im Anschluss zu einem Eishockeyboom in der Goldenen Stadt kam, war der Verbreitung des Radios zu verdanken, und der enthusiastische Sportreporter Josef Laufer hatte großen Anteil daran. Bis dahin war es ein steiler und zu Anfang kurioser Weg gewesen.