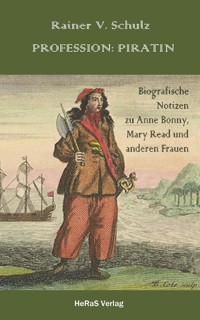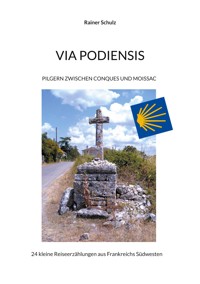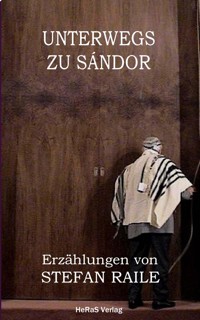
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Jani, der Ich-Erzähler, in Ungarn, Tschechien und Israel allein, mit Carola oder Ines unterwegs ist, um Geschehnissen nachzuspüren, die in einen neuen Roman einfließen könnten, begegnet er an Orten, die ihm magisch erscheinen, wirklich oder vorgestellt Menschen, mit denen sich für ihn Liebe und Hass, Freundschaft und Feindseligkeit, Beglückung und Trauer verbinden. Während er, auf unterschiedliche Weise daran erinnert, vieles von dem, was ihm in zügellosen Zeiten widerfahren ist, noch mal durchlebt, kommt ihm immer öfter Sándor in den Sinn, der sich, wie er im Dorf am Rande der Puszta geboren, im Frühjahr 1944 als Einziger aus dem scharf bewachten Judenzug zu fliehen wagte. Um zu erfahren, was aus ihm geworden ist, besucht er ihn schließlich mit Ines weit über Haifa in seinem auf einem Hang des Karmel erbauten Haus. Wird Sándor, der lange an der nahen Universität gelehrt hat, bereit sein, von sich preiszugeben, was Jani wissen müsste, um über ihn schreiben zu können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Schulz
Unterwegs zu Sándor
Erzählungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
HERBST IN BUDAPEST
DER REGENBOGEN
DIE PLATANE
DAS ALTE GRABMAL
MÄNNERTOD
DER KÖNIG VON MARIENBAD
DER REBELL
WIEDERSEHEN IN HAIFA
GLOSSAR
Impressum neobooks
HERBST IN BUDAPEST
An diesem frühen Oktoberabend wird mir erneut bewusst: Ich bin nie bloß dort, wo ich mich aufhalte. Ausgelöst durch einen unverhofften Reiz, eine jähe Erinnerung, ein Bild, ein Foto, einen Geruch oder einst gehörte Worte, entführen mich meine Gedanken in andre Gegenden, Zeiten und Verhältnisse.
Während der Zug, nur noch ein Stück vom Keleti-Bahnhof entfernt, aus unersichtlichen Gründen hält, verspüre ich Durst wie Carola. Doch wir haben schon lange alles ausgetrunken. Auch an jenem fernen Tag, als der Güterwaggon, in dem ich zwischen Großmutter und meinen Eltern auf unsren Bündeln hockte, mit den übrigen Wagen unweit auf ein Abstellgleis geschoben wurde, waren sämtliche Flaschen, in die Mutter Wasser oder Tee gefüllt hatte, bereits geleert.
Mir ist, als sei es gestern geschehen: Morgens hatte ich mit Edit vor unsrem Haus gehockt und aus der nahen Cukrászda geholtes Eis gegessen. Die Gendarmen, die straßenabwärts in Häuser gingen, bemerkten wir erst, als die vordersten keinen Steinwurf mehr von uns entfernt waren. Was folgte, gerinnt zu Bildern, die rasch wechseln, als würden sie von fahrigen Fingern bewegt: der ungarische Gendarm, der uns zum Packen zwang, Mutters Ohrringe einsteckte und meine neue Schultasche nahm, die große Wassermelone, die, von mir zum Kühlen hinabgelassen, im Ziehbrunnen zurückblieb, der Lastwagen, auf den wir unsre Bündel hoben, Edits verstörtes Gesicht hinter der Gardine, das im Staub, der beim Anfahren emporstob, versank wie alles ringsum.
Als ich merke, wie der Zug langsam anrollt, erscheint mir meine Kehle trocken wie im stickigen Waggon auf dem Abstellgleis. Ich hatte damals versucht, mich abzulenken, indem ich die Lichter, die zwischen den ein Stück geöffneten Schiebetüren auf dem Bahngelände flimmerten, zu zählen begann. Aber es half nichts, mein Durst verschlimmerte sich und narrte meine Sinne. Während meine pelzige Zunge über die spröden Lippen leckte, glaubte ich, die Melone aus dem Ziehbrunnen aufgeschnitten vor mir zu sehen, und ich malte mir aus, wie erlösend es wäre, in ihr saftiges Fruchtfleisch beißen und die rote Flüssigkeit, die sich in der hohlen Schale sammelte, trinken zu können.
Wenngleich ich nur teilweise aufnahm, worüber sich die zwei Dutzend Leute, die mit im Waggon waren und wie wir auf Bündeln lagerten, gedämpft unterhielten, spürte ich ihre Unruhe. Alle beschäftigte, wohin man uns bringen würde. Nach Bayern, wie den ersten Transport aus unsrem Dorf? Nach Sachsen, weil die Amerikaner, wie gemunkelt wurde, niemand mehr aufnehmen wollten? Oder vielleicht sogar nach Russland? Brauchte man uns dort für „malenkij robot“ wie die Männer und Frauen, die vor mehr als zwei Jahren ins Ungewisse verschleppt worden waren?
Während Carola mich an der Schulter berührt, bin ich rasch wieder in der Gegenwart. Ich helfe ihr in den Mantel und hebe unser Gepäck aus der Ablage. Unterwegs zur Tür empfinde ich meinen Durst schwächer. Ist es, weil ich damit rechne, bald etwas zu trinken?
Kaum sind wir ausgestiegen, erfasse ich, dass es auf dem Bahnsteig anders ist als sonst. Ich sehe weder Frauen, die auf Schildern, die sie beflissen so hoch wie möglich aus der Menge halten, preiswerte Unterkünfte feilbieten, noch werden wir von Taxifahrern bedrängt, die marktschreierisch ihre Dienste antragen wie einst Scherenschleifer, Lumpensammler, Kesselflicker und Besenbinder in unsrem Dorf.
Die Leute, zwischen denen wir den Bahnhof verlassen, reden kaum miteinander. Manche wirken regelrecht bedrückt, und einige verharren auf der Außentreppe, als seien sie sich nicht schlüssig, wohin sie sich wenden sollen. Auch der ältere schmächtige Mann, der neben seinem Taxi steht, kommt mir verunsichert vor. Nachdem ich ihm unser Ziel genannt habe, erwidert er, dass es Probleme gebe. Vielleicht sei ein junger Kollege bereit, uns zu fahren. Der löst sich, sobald er uns bemerkt, aus der Gruppe, wo einer den Übrigen, unterstützt durch häufige Gesten, etwas erzählt, das sie, wie es scheint, noch erregter werden lässt.
Es seien große Umwege notwendig, sagt der Mann, der eine abgeschabte braune Lederjacke trägt. Deshalb koste es fünfunddreißig Euro. Als er merkt, dass es uns zu viel ist, zuckt er mit den Schultern und will sich wieder zur Gruppe begeben. Doch dann dreht er sich um, kommt einen Schritt zurück und rät uns, die Metro zu benutzen. Mit ihr kämen wir am sichersten auf die andre Seite.
Wir können sofort an den Fahrkartenschalter, und auf dem Bahnsteig warten nur wenige Menschen, von denen vier mit uns in einen Wagen steigen. Obwohl sämtliche Sitzplätze frei sind, bleiben die andern stehen, halten sich an den Obergriffen fest, ziehen ihre Köpfe zwischen die Schultern und blicken unstet, als seien sie sich einer Gefahr bewusst, die wir noch nicht kennen. Doch bald befällt auch uns Sorge, weil wir zu ahnen beginnen, dass alles, was uns seit der Ankunft verwundert oder befremdet hat, miteinander zusammenhängt. Vor den Stationen, die folgen, verringert der Zug seine Geschwindigkeit, hält aber nicht, sondern rollt langsam an den gespenstisch leeren Bahnsteigen vorbei, dass sich mühelos die Namen auf den Tafeln lesen lassen: Blaha Lujza tér, Astoria, Deák Ferenc tér, Kossuth Lajos tér.
Ich merke, dass Carola näher an mich heranrückt. Es ist, denke ich, ähnlich wie in jener Augustnacht. Damals saß dicht neben mir Anke, und die S-Bahn fuhr vom Bahnhof Zoo nach Osten. Wir waren, vom Zelten an einem mecklenburgischen See heimwärts unterwegs, für ein paar Stunden in der geteilten Stadt geblieben, hatten den demokratischen Sektor verlassen und in einem Kino am Kudamm für das eins zu fünf getauschte Geld den Film gesehen, in dem amerikanische Jugendliche, von ihren Eltern unverstanden, nicht so recht wissen, was sie mit sich und ihrem Leben anfangen sollen. Ihre innere Leere weckt Sehnsüchte, die sich nicht erfüllen. Die Unzufriedenheit, die daraus erwächst, löst Gedanken aus, die zu gefährlichen Handlungen werden: In einer Szene rollten zwei von ihnen ganz, ganz langsam, damit sich der Nervenkitzel bis zum Äußersten steigerte, in gestohlenen Autos an einen Abgrund heran, um Mann gegen Mann den als Sieger zu ermitteln, der, ehe die Fahrzeuge unrettbar in eine Schlucht sausten, als Letzter heraussprang.
Obwohl die Spätvorstellung bis ein Uhr gedauert hatte, waren wir, durch den Film aufgewühlt, noch hellwach. Deshalb spürten wir rasch, dass fast alle, die im Wagen saßen, angespannt wirkten. Sahen sie etwas durchs Fenster, das sie verstörte? Als auch ich mein Gesicht an die Scheibe presste, meinte ich, im ungewissen Licht, das da und dort aus matten Lampen sickerte, verschwommene Gestalten zu erkennen, die sich geschäftig bewegten.
Morgens in Görlitz angekommen, erfuhr ich aus dem Radio, dass meine Sinne mich nicht getäuscht hatten. Es sei, wurde gemeldet, um uns zu schützen, damit begonnen worden, einen Wall zu errichten, der hinter vorgehaltener Hand bald Mauer heißen würde. Ich begriff sofort, dass plötzlich alles anders war, wir eine Gelegenheit verpasst hatten, die vielleicht lange nicht wiederkehrte.
Als die Bahn zum ersten Mal hält, schrecke ich auf. Wir sind, erfasse ich, unter der Donau hindurch, wie vom Taxifahrer vorausgesagt, ungehindert bis Buda gelangt. Wenig später steigen wir am Moskva tér in eine Straßenbahn um und erreichen nach zwei Haltestellen unser Hotel. An der Rezeption dauert es nicht lange, der Lift bringt uns schnell nach oben, und im Zimmer erfahren wir aus dem Fernseher, weshalb von der Polizei so viele U-Bahn-Stationen gesperrt worden sind. Durch wiederholte Vorkommnisse in den letzten Wochen erschreckt, hat man befürchtet, es könne auch während der Veranstaltung, in der an den Beginn des Volksaufstands vor fünfzig Jahren erinnert werden soll, zu Ausschreitungen kommen. Doch keiner hat wohl geahnt, dass sie so rüde sein würden, wie es die ausgestrahlten Bilder zeigen. Ich bin froh, dass wir nicht in der aufgebrachten Menge sind. An dem Junitag jedoch, als wir den sechsten Sommer in Görlitz erlebten, war ich mitten hineingeraten. Schon im Klassenzimmer, wo wir an einem Aufsatz schrieben, hörte ich den Rumor, der von irgendwo draußen zu uns drang. Als wir später, neugierig darauf, was sich ereignete, aus der Schule eilten, flutete eine Unzahl erregter Menschen durch die Straßen. In ihren Strom geraten, und mit Tom von den andren getrennt, wurden wir gestoßen und gerempelt, schnappten Satzfetzen auf: „Fast alle streiken.“ – „Das kann nicht gut gehen.“ – „In der Kreisleitung hat man sich verschanzt.“ – „Nun wird abgerechnet!“
Als wir einen Durchgang passierten, bemerkte ich, wie drei Männer einen Polizisten in eine Wandnische drückten. Sie rissen ihm die Schulterstücke ab, drehten seine Arme auf den Rücken, zerrten ihm die Mütze übers Gesicht und schlugen darauf.
Geschlagen, gestoßen, getreten wird auch auf dem Bildschirm. Carola beobachtet es, scheint mir, befremdet wie ich. In den Gesichtern, die im Schwenk der Kamera auftauchen, meine ich, flüchtig zu erkennen, was die empfinden, die Gewalt ausüben, und jene, die sich wehren, sich und andre zu schützen versuchen. Fünfzig Jahre vorher wurde an gleicher Stelle geschossen, rollten russische Panzer durch die Straßen, erstickten sämtliche Freiheitsrufe, brachen jeglichen Widerstand. Es gab auf beiden Seiten zahlreiche Opfer. Insgesamt über fünftausend. Und vierzig Mal so viel verließen über Österreich oder Jugoslawien das Land, in dem sie nicht bleiben wollten. Von denen, die ich im Dorf gekannt hatte, gehörten Ildikó und Sebastian dazu. Sie flüchtete zu Sándor nach Haifa, er noch weiter bis zu den Blauen Bergen.
Schon im Bett, umgeben von Stille und Dunkelheit, denke ich: Warum es seinerzeit – hier wie in Görlitz – zum Aufruhr kam, ist leicht nachzuvollziehen. Weshalb man eine Gedenkveranstaltung, die dazu dienen sollte, frühe Vorkämpfer für inzwischen Erreichtes zu ehren, entweiht und missbraucht hat, ist schwer zu verstehen. Was sind das für Leute, die begonnen haben zu schlagen, zu treten, zu stoßen? Sind sie von welchen, die selbst nach Macht streben, verhetzt und aufgewiegelt worden, um sie für die eigenen Ziele auszunutzen? Oder ergeht es ihnen wie den amerikanischen Jugendlichen aus dem Film? Vermögen sie nichts Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen, weil sie die Chancen, die sich ihnen bieten, nicht wahrnehmen wollen? Suchen sie die Schuld für ihre innere Leere, aus der früher oder später Unzufriedenheit erwächst, die oft zu unüberlegtem Verhalten führt, ausschließlich bei andern?
Ehe ich eine Antwort finde, überwältigt mich, erschöpft durch die vielen Eindrücke, der Schlaf.
Am Morgen erwache ich erst, als Carola schon im Bad ist. Ich stehe auf, schiebe die Übergardine beiseite und öffne das Fenster. Die Sonne scheint von einem hellblauen, fast wolkenlosen Himmel, der auch an den folgenden Tagen so bleiben wird.
Was in mein Gesichtsfeld rückt, erinnert mich an Haifa. Hier erheben sich unweit die Ofner Berge, dort sah ich vom 14. Geschoss unsres Hotels, das im Stadtteil Hadar Hacarmel steht und mich an einen aztekischen Teocalli erinnerte, die mit Pinien bewachsenen Hänge des Karmel. Weit oben, nur wenige Steinwürfe von der Universität entfernt, an der Sándor gelehrt hat, fanden wir das Haus, in dem er mit Ildikó wohnt. Wir hatten weder ihn noch sonst etwas zielgerichtet gesucht, sondern waren, abseits von den Stellen, wohin Fremde gewöhnlich geführt werden, unsren Eingebungen gefolgt, mal meinen, mal denen, die Ines hatte, weil wir glaubten, auf diese Weise am ehesten unverfälschte Einsichten zu gewinnen.
So wollen wir es auch jetzt halten. Carola denkt wie ich, dass sich, was andre im Gefolge bezahlter Begleiter auf überfüllten Plätzen suchen, zu zweit in abgelegenen Straßen eher finden lässt.
Nach dem Frühstück, das reichlich, aber einfallslos ist, verlassen wir das Hotel. Wir schlendern durch einen nahen Park in Richtung Moskva tér. Aus den Baumkronen tröpfelt Nässe, von Zweigen, die im leichten Wind zittern, lösen sich welke, vergilbte Blätter und trudeln lautlos herab. Als wir einen großen runden Platz überqueren, sehen wir auf mehreren Bänken Stadtstreicher liegen. Mit Folie oder Zeitungen zugedeckt, scheinen die meisten noch zu schlafen. Nur nahe der Stelle, wo unser Weg weiterführt, hat sich einer aufgesetzt. Ohne uns zu beachten, zieht er eine kleine, flache Flasche aus seinem arg verschlissenen Jackett, öffnet ihren Verschluss, trinkt genussvoll zwei Schlucke und wischt sich mit dem Handrücken über die Lippen, ehe er in die nahe an seinen Körper gerückte Plastiktüte blickt. Während er nach etwas kramt, beginnt er, erregt zu brabbeln. Es klingt, als schimpfe er auf Gott und die Welt.
Mit seinem wirren Haar und dem dichten, struppigen Bart ähnelt er dem Obdachlosen, der in Jena öfter durch unser Wohngebiet stromert und die Deckel der Mülltonnen hebt. Niemand kümmert sich um ihn. Jeder ist bestrebt, an dem zerlumpten Mann, der gewöhnlich, als schäme er sich, seinen Blick abwendet, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Es scheint fast, als fürchte man, sein Elend könne anstecken. „Oder will man“, hat Carola mal gefragt, „nur nicht sehen, was in großen Städten traurige Wirklichkeit ist?“
Auch jetzt fühlen wir uns besser, als der brabbelnde Mensch, der sich schon morgens mit Palinka tröstet, auf seiner Bank zurückbleibt. Ohne uns abzusprechen, wenden wir uns, sobald der Park endet, nach rechts, gehen unterhalb der Burg durch Straßen und Gassen, gelangen neben dem Donauufer, ohne es zu beabsichtigen, an den Fuß des Gellért-Bergs und stehen unvermittelt vor der Felsenkapelle, die zum nahe gelegenen Kloster der Pauliner gehört. Die Stille darin ist angenehm. Während wir es empfinden, kommt mir in den Sinn, dass wir vielleicht auf der Budaer Seite geblieben sind, um nicht in die Nähe des Parlaments zu gelangen, wo man sich gestern Abend so erbittert geschlagen hat.
Wieder im Freien, schauen wir eine Weile zu dem im Jugendstil errichteten Gebäude des Gellért-Bads, in das wir an einem der nächsten Tage, wie von Ines empfohlen, gehen wollen. Dann wenden wir uns nach rechts und laufen über gepflegte Wege und steile Treppen aufwärts. Es ist, denke ich, ein bisschen wie in Görlitz, als Großmutter Gertrud mit mir vor langer Zeit zum ersten Mal die Landeskrone bestieg. Dort bewegten wir uns unter alten Buchen, deren dichte Kronen sich wie Schirme über uns breiteten und nur selten eine Lücke ließen, durch die wir ins Tal sehen konnten. Hier wird unsre Sicht lediglich von einzelnen Bäumen und Ziersträuchern, die auf den steinigen Hängen wachsen, für kurze Zeit beeinträchtigt. Wenn der Weg nahe zur schroffen Felswand führt, die an manchen Stellen fast senkrecht abfällt, können wir ungehindert die tief unter uns liegende großflächige, vielgestaltige Stadt betrachten, und Carola bemüht sich, Örtlichkeiten zu erkennen, die wir bei früheren Aufenthalten besucht haben. Mein Blick, wird mir bewusst, reicht weiter als in Haifa, wo sich Tag für Tag eine bläuliche, aus Auspuffgasen gewobene Dunstglocke über Straßen, Plätze, Parkanlagen und den Hafen legte.
Auch von der Landeskrone, denke ich, hatten wir eine gute Aussicht. Ich stand neben Großmutter und stützte mich auf die brusthohe, vielfach von schmalen Schießscharten unterbrochene Umfassung des einstigen Wachtturms. Wir versuchten zu bestimmen, wo wir wohnten, ohne dass es uns sicher gelang. Nur die Kirche, in der wir vormittags gewesen waren, entdeckten wir mühelos, ebenso das Rathaus, den Bahnhof und die Waggonbaufabrik, wo Vater arbeitete.
Als mehrere Leute hochkamen und sich neben uns drängten, stiegen wir hinab und setzten uns auf eine versteckte Bank, die ich von oben erspäht hatte. Vor und neben ihr wucherte dorniges Gestrüpp. Aber wenn wir die Köpfe reckten, sahen wir fast so viel wie vom Turm.
Vor langer Zeit, sagte Großmutter nach einer Weile, habe sie, fern von hier, auf einem ähnlichen Felsen gesessen. Die Stadt unter ihr habe sich bis zum Horizont gedehnt. Auf dem breiten Strom, der sie durchfließe, seien unsre Vorfahren auf plumpen, Ulmer Schachteln genannten, Schiffen ins dünn besiedelte Land gekommen, um Siedlungen zu gründen, Wälder zu roden und Felder anzulegen. Sicher errate ich nun, wo sie gewesen sei.
„Du warst in Budapest?“, fragte ich.
„Nur drei Tage“, erwiderte sie, als sie Eva, eine mit ihrem Mann in die Hauptstadt gezogene Cousine besucht habe. Sie sei mit der U-Bahn und auf der Donau gefahren sowie an vielen Stellen gewesen: im Burgviertel, im Zoo, auf dem Heldenplatz, der Margareteninsel, dem Gellért-Berg. In drei, vier Jahren habe sie von unsrem Dorf aus mit mir hingewollt, um mir zu zeigen, was ihr einst gezeigt worden sei. Nun müsse ich später, falls sich die Verhältnisse ändern, ohne sie hin. Doch vielleicht werde ich sie in meinen Gedanken mitnehmen.
Sie wird uns, denke ich, wie bereits früher, wenn wir mit Ines oder zu zweit wie jetzt in der Stadt waren, überallhin begleiten. Diesmal jedoch wohl nicht allein. Wahrscheinlich gesellen sich, einmal in meine Überlegungen geraten, Ildikó und Sebastian hinzu, durch die wir, wären sie tatsächlich anwesend, viel über die Stadt und das, was sie hier erlebt haben, erfahren könnten. Aber dann sind sie, mal einzeln, mal gemeinsam, nur stumm und unsichtbar dabei, wenn wir im „Gerbeaud“, im „Ruszwurm“ oder im „Bagolyvár“ sitzen, von der Fischerbastei zwischen Deutschen, Franzosen, Japanern, Briten, Russen und Italienern aufs gegenüberliegende Parlament blicken, durchs malerische Szentendre bummeln, Galerien betreten und in Läden, in die uns ungewöhnlich gestaltete Schaufenster locken, nach Geschenken Ausschau halten, von einer Bank, die im Hof der märchenhaften Burg Vajdahunyad unter einer uralten Platane steht, zum Denkmal des Anonymus sehen, während wir einem ganz in sich und sein Tun versunkenen Harfenspieler zuhören, uns durch die Oper mit ihrem prächtigen Vestibül führen lassen und die Loge der Kaiserin Sissi besichtigen, neben der Donau auf dem Belgrád rakpart spazieren und verfolgen, wie wendige Schiffe übers glitzernde Wasser gleiten, in der großen, nahe der Szabadság hid gelegenen Markthalle die Fülle von Früchten, Gemüse, Fleisch, Fisch, Honig und Gewürzen bestaunen, irgendwo Lángos, Palacsinta, Halászlé, Pörkölt, Krémes, Dobostorta oder Somlói galuska essen, uns im prallen Sonnenschein, der die Quecksilbersäulen fast täglich bis 25 Grad Celsius klettern lässt, auf eine Bank am Rande des Stadtwäldchens setzen und zusehen, wie Jugendliche auf einer beschatteten künstlichen Eisfläche Schlittschuh laufen, durch die Váci utca schlendern, von Kellnern in Restaurants gebeten werden oder im Passantenstrom verheißungsvolle Werbezettel zugesteckt bekommen, auf dem Vörösmarty tér lange inmitten zahlreicher Neugieriger stehen und dem jungen Künstler zuschauen, der mit zwei Schlägeln, die er unablässig wirbeln lässt, übereinander gestapelten Trinkgläsern Töne entlockt, die sich mit Musik aus einem Rekorder zu wundersamen Melodien mischen, in muffigen Straßenunterführungen schwarzhaarigen, dunkeläugigen, armselig gekleideten Müttern begegnen, die auf schmutzigen Treppenstufen hocken, ihre müden, ergebenen Kleinkinder im Arm halten und aufdringlich betteln, die schmale, steile, mit buckligem Pflaster bedeckte Gasse zur hoch gelegenen Plattform auf dem Rózsadomb emporsteigen, wo Gül Baba, ein charismatischer türkischer Derwisch, über den Carola in einer Broschüre gelesen hat, vor fast fünfhundert Jahren in seinem Rosengarten zur letzten Ruhe gebettet wurde, das kleine, im Souterrain gelegene, Eckgeschäft aufsuchen, in dem wir bei einer grauhaarigen, stets freundlichen Frau auch spätabends noch kleinbeerige, schillernde Weintrauben kaufen können, die wie unsre daheim in Vaskút schmecken, vom Hotelzimmer die Sonne beobachten, wenn sie, ehe sie glutrot hinter den Bergen versinkt, kupfrigen Glanz über die Gipfel streut.
Als wir nach dem Abstieg vom Gellért-Berg mit der alten U-Bahn fahren – die Strecke, die Vörösmarty tér und Stadtwäldchen verbindet, war 1896 als erste auf dem europäischen Festland vollendet worden -, muss ich hintereinander an alle drei, die ich weiter in unsrer Nähe wähne, denken, weil auch sie wahrscheinlich, wie jetzt Carola und ich, in einem der kleinen, niedrigen Wagen gesessen haben: zuerst Großmutter während ihres Besuchs bei der Cousine, lange danach Ildikó, als sie studierte oder später für einen Verlag als Übersetzerin arbeitete, und zuletzt Sebastian, sobald er, ein Jahr vor dem Volksaufstand, an der Technischen Universität immatrikuliert worden war.
Wir verlassen die Bahn an der Station Oktogon. Auf der Andrássy út, die uns mit ihren hohen, breitkronigen Alleebäumen sowie den prachtvollen Bauten noch schöner als beim letzten Aufenthalt erscheint und mich ein wenig an die Sederot Ben Gurion in Haifa erinnert, merken wir, dass es ringsum ruhig wirkt, nirgends Polizisten zu entdecken sind, und die Menschen sich zwanglos bewegen, als hätte es gestern Abend keine Auseinandersetzungen vor dem Parlament gegeben.
Da es bis zu unsrer Abreise friedlich bleiben wird, ließe sich vermuten, sämtliche Spannungen seien bei den Zusammenstößen, die im Fernsehen so heftig gewirkt haben, dauerhaft abgebaut worden. Doch am Haus des Terrors, das wir wenig später erreichen, empfinde ich, dass nichts, was geschieht, spurlos vergeht, sondern im Gedächtnis der Beteiligten bleibt und zu Handlungen führen kann, deren Ausmaß sich nicht berechnen lässt. Vor dem Gebäude, das Ausstellungen beherbergt, die sowohl an Opfer der Kommunisten als auch der Pfeilkreuzler erinnern, brennen zwischen niedergelegten Blumen zahlreiche Lichter, die auf Fenstersimse, Wandvorsprünge und aufs Pflaster gestellt worden sind. In Augenhöhe bemerke ich durch Glasplatten geschützte Fotos. Sie zeigen die Gesichter von meist jungen Männern, die, während des Volksaufstands gefasst, als gefährliche Aufrührer verurteilt und hingerichtet wurden. Ihre Geburts- und Todestage stehen unter den Namen. Ob Sebastian wie sie mit der Waffe gekämpft hat? Oder ist er vielleicht weiter von den Gefechten entfernt gewesen als ich an jenem Junitag in Görlitz?
Verwirrt durch das Geschehen, wurde ich mit Tom vom Durchgang, wo man weiter den Polizisten schlug, auf den Markt gedrängt. Ich hörte, wie aus mehreren Lautsprechern das Deutschlandlied erklang. Nachdem es verstummt war, trat ein älterer Mann mit blassem Gesicht auf der Tribüne ans Mikrofon. Er hatte eine heisere, aber sehr eindringliche Stimme, der ich gebannt lauschte. Nun, da das Maß voll sei, sagte er, beginne eine neue Zeit, in der Freiheit für jedermann herrsche, die Macht der Bonzen endgültig gebrochen werde, überall Gerechtigkeit einkehre.
Danach hörte ich nicht mehr, was er sprach. Eingekeilt in die Menge, die oft klatschte, hatte ich plötzlich die Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht in unser Dorf zurückkehren dürften. Ich stellte mir unser lindgrünes Haus vor, den blühenden Maulbeerbaum, die Sommerküche mit dem Backofen, meinte, Betyár und Schneewittchen zu sehen, mit Großmutter über die Hutweide zu gehen, neben Edit am Teich zu stehen, bis ich Toms Hand an der Schulter spürte und das dumpfe Dröhnen vernahm, das rasch anschwoll. Der Platz bebte, Ketten rasselten, Schreie gellten, die Masse wogte auseinander.
Ich begriff noch nicht, was geschah, als Tom mich dorthin zog, wo sich, genau in Richtung der Panzer, die unaufhaltsam heranrollten, eine breite Gasse öffnete. Vorbei an Leuten, die umgerissen, überrannt und niedergetrampelt wurden, liefen wir scheinbar schnurstracks ins Verderben.
Was hatte Tom vor? War er von Sinnen?
Als sich die Panzer keinen Steinwurf mehr von uns entfernt befanden, drängte er mich nach links, und wir erreichten, geschickt die vorhandenen Lücken ausnutzend, atemlos einen Hausflur. Wir hetzten die Treppen hoch, erkletterten vom offenen Boden das flache Dach und traten so nahe an den Rand, dass wir auf den Platz blicken konnten. Dort waren noch zahlreiche Leute, die, auf der Flucht durch eigenes Unvermögen oder fremde Schuld zurückgeblieben, verzweifelt versuchten, Seitenstraßen, Geschäfte oder die nahe Kirche zu erreichen. Die ersten Panzer walzten die Tribüne nieder und fuhren den Fliehenden hinterher. Ich beobachtete, wie eine alte Frau wenige Meter vor einer Haustür strauchelte, als Tom mich zu Boden riss. Kaum lagen wir, krachten Schüsse, und die Kugeln surrten dicht über uns hinweg.
Ich spüre, wie mein Puls in den Schläfen pocht, und als ich schlucken will, gelingt es mir nicht, weil mein Gaumen trocken ist. An Carolas Blick erkenne ich, dass sie ahnt, was in mir vorgeht. Mir gefällt, dass sie nichts sagt.
Hier war es, wie die Bilder der Hingerichteten belegen, gefährlicher als in Görlitz, denke ich. Viele wagten das Äußerste, um ihre Ziele zu erreichen. Der Aufstand brach erst zusammen, als der ungleiche Kampf gegen die russischen Panzer aussichtslos geworden war.
Ildikó und Sebastian kamen körperlich unversehrt davon. Beide begriffen, dass sie sich entscheiden mussten, wie und wo ihr Leben weitergehen sollte. Sebastian floh ins Ungewisse. Ildikó hingegen wusste, wohin sie wollte, als sie die Grenze überschritt.
Seit Sándor nicht weit von unsrem Dorf aus dem Judentransport geflohen war und sich bis Haifa durchgeschlagen hatte, trennten sie nicht nur Tausende von Kilometern, sondern auch zweierlei Ordnungen. Als der Aufstand begonnen habe, erzählte er mir auf ihrer Terrasse, sei er voll fiebriger Erwartung gewesen. Abend für Abend habe er am Radio gesessen, um zu erfahren, was sich in Budapest abspiele. Als die Niederlage absehbar geworden sei, habe er sich gewünscht, dass Ildikó die plötzliche Gelegenheit, das Land zu verlassen, nutzen möge, sei andrerseits aber voller Sorge gewesen, dass sie sich einer zu großen Gefahr aussetzen könne. Später, als er erfahren habe, unter welchen Schwierigkeiten sie zu ihm gelangt sei, habe er in Gedanken nahe der Grenze neben ihr unterm dornigen Gestrüpp gelegen, in die Dunkelheit gespäht, die Schritte der Posten gehört und gefürchtet, es würden Schüsse fallen wie an jenem späten Nachmittag, als er aus der Reihe gesprungen und mit jagendem Puls zum Moor gehetzt sei.
Wie es Sebastian bis zu den Blauen Bergen verschlug, ist mir nicht genau bekannt, begreife ich, als wir schon in Richtung Heldenplatz weitergehen. Aber er kommt mir oft in den Sinn, seit ich in Vaskút von seiner Mutter erfahren habe, wo er lebt. Vielleicht, denke ich, wäre ich in seine Nähe gelangt, wenn uns die Verhältnisse wie ihn zu einer raschen Entscheidung gezwungen hätten. Aber so fehlte uns wohl der letzte Schneid, zu viert auszuwandern, wie Wolf, Manfred, Norbert und ich es in den Sommerferien nach der achten Klasse abgesprochen hatten. Außerdem waren unsre Vorstellungen, von heute aus betrachtet, ziemlich versponnen: Unter hohen, alten Eukalyptusbäumen ein Blockhaus, fest gezimmert, nicht weit davon ein See, am Steg ein Kanu... Trotzdem versuchten wir, uns zielstrebig auf das geplante Unternehmen vorzubereiten. Zwei-, dreimal in der Woche liefen wir auf dem Rundkurs am Stadtrand, führten penibel Buch über Zeiten und Platzierungen, freuten uns über jeden Fortschritt. Doch später weckten die unterschiedlichen Berufe, die wir erlernten, bei jedem neue Ziele. Das Bestreben, sie zu erreichen, zwang uns, in andre Orte zu gehen. Bis zu den Blauen Bergen kam niemand. Aber Wolf und Manfred wechselten vor jener Nacht, in der ich mit Anke vom Bahnhof Zoo nach Osten fuhr, über die innerdeutsche Grenze.
Vom Heldenplatz, wo Carola länger als ich das Millenniumsdenkmal betrachtet, biegen wir in eine schmale Straße ein. An der übernächsten Kreuzung finden wir ein kleines, verstecktes Restaurant und setzen uns auf die von Bäumen beschattete Terrasse. In den folgenden Tagen werden wir noch zweimal hier einkehren, weil das Essen gut ist, die Kellner flink bedienen und nicht versuchen, gleich ein Trinkgeld von fünfzehn Prozent oder mehr auf die Rechnung zu schreiben, wie es in andren Lokalen öfter bei unbedarften Ausländern geschieht. Am meisten jedoch zieht uns, glaube ich, ein graugetigerter Kater an, der immer lautlos von irgendwo auftaucht und uns um die Beine schmeichelt. Wenn Carola ihn füttert, erinnere ich mich an seinen fuchsroten Artgenossen, der in Haifa, als wir im weit oben gelegenen Stadtteil Central Carmel Abendbrot aßen, an unsren Tisch kam, sich ein Stück entfernt hinsetzte und mit den Augen bettelte, bis er von Ines die erwarteten Häppchen erhielt. Auch an die schwarz-weiße Katze mit dem glanzlosen Fell denke ich, die in Jena durch unsre Siedlung streunt und oft hungrig an unsrem Sitzplatz erscheint, weil ihre arbeitslosen Besitzer sie anscheinend nicht mehr ausreichend versorgen. Und einmal meine ich, unsre Macska Schneewittchen zu sehen, die wir an dem Tag, als der Gendarm gekommen war, wie die Kuh Rosi, die zwei Schweine, das Geflügel und Betyár, unsren Hund, zurücklassen mussten.
Schon auf der Güterzugfahrt, die uns nach drei Tagen und vier Nächten in die sächsische Stadt Pirna brachte, versuchte ich, mir vorzustellen, wie es der Katze, die unsre Anwesenheit gewöhnt war, allein ergehen mochte. Meine Sorge hielt auch im Lager an und verlor sich erst in Görlitz, als ich von Edit den ersten Brief erhielt. Sie hatte ihm ein Foto beigelegt, das zeigte, wie sich Schneewittchen auf ihrem Schoß rekelte. Ihre Eltern, schrieb sie, seien sofort einverstanden gewesen, als sie darum gebeten habe, die ihr vertraute Katze aufnehmen zu dürfen.
Die Sonne scheint warm wie an den übrigen Tagen, während wir auf dem Schiffsdeck sitzen, nordwärts fahren und aus den Kopfhörern deutsche Erklärungen zu Brücken, Gebäuden und wichtigen Ereignissen vernehmen. Ich lausche nur mit halbem Ohr, schließe die Augen, halte mein Gesicht wie Carola ein wenig schräg nach oben, damit die Sonnenstrahlen es berühren, und genieße das Lüftchen, das meine Haut streichelt. Wir fahren auch mit, weil das Schiff an der Margitsziget anlegt, und uns Zeit für einen größeren Rundgang bleibt.
Während wir über die sauber geharkten Wege laufen, erinnere ich mich an das, was ich während der Bahnfahrt gelesen habe: Die Insel bestand einst aus drei selbstständigen Teilen, die erst im 19. Jahrhundert miteinander verbunden und zu einem öffentlichen Park erklärt wurden. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs mussten Besucher Eintrittsgeld zahlen. Seitdem darf das weitläufige Gelände kostenlos betreten werden. Großmutter konnte sich also wahrscheinlich schon überall ungehindert bewegen. Sie wird, denke ich, öfter stehen geblieben sein und die Bäume betrachtet haben, die wohl damals bereits eine beachtliche Höhe aufwiesen. Ich bin fast sicher, dass sie nicht weit von der Bank, auf die wir uns gesetzt haben, gewesen ist, um die Platane mit der gewaltigen Krone zu betrachten, weil sie der ähnelt, die unweit von Vaskút einzeln auf einer Brache steht. Wenn Großmutter mich zu unsrem Krautacker mitnahm, kamen wir auf einem sandigen, keinen Steinwurf entfernten, Weg an dem Baum vorbei. Fast immer verharrte sie eine Weile und blickte in die dicht belaubte Krone, wo meist Vögel von Zweig zu Zweig hüpften und lauthals zwitscherten. Manchmal liefen wir durch das hohe, verfilzte Gras, und ich durfte von einem weit ausladenden Ast, den Großmutter herunterzog, einige der runden, stachligen Früchte abzupfen, die ich in meine Hosentasche steckte.
Den Baum, weiß ich, seit wir in Haifa gewesen sind, kannten auch Ildikó und Sándor. Sie hockten dort, durch einige dornige Büsche vor unerwünschter Sicht geschützt, nahe nebeneinander, lehnten ihre Rücken gegen den schrundigen Stamm und träumten sich fort in ein andres Land, wo Sándor keinen Davidstern mehr tragen müsste und nicht täglich von Mitschülern angefeindet würde.
Erst am letzten Nachmittag schaffen wir es, in die St.-Stephan-Basilika zu gehen. Ihr Bau hat über ein halbes Jahrhundert gedauert und wurde 1905 vollendet. Die Kuppel ragt 96 Meter in den türkisfarbenen Himmel, an dem sich ein paar weißgraue Wolken plustern.
Innen empfängt uns wie in der Felsenkapelle am Gellért-Berg die Gotteshäusern eigene Stille. Ich spüre, dass Carola beeindruckt ist wie ich. Obwohl Großmutter es nicht erwähnt hat, nehme ich an, dass auch sie in der Kirche gewesen ist. Sie wird, denke ich, in einer Bankreihe niedergekniet sein, um mit gesenktem Kopf, geschlossenen Augen und gefalteten Händen zu beten, wie sie es später, in Görlitz, Tag für Tag in ihrem schmalen, lichtarmen Zimmer getan hat. Der Raum, in dem sie ihr entschwindendes Leben verdämmerte, bot nichts mehr, was sie noch zum Hinschauen gereizt hätte, und auch ein Blick durchs Fenster auf den Hinterhof wäre kaum tröstlicher gewesen. Von den grauen Wänden bröckelte der Putz, die Linde, deren Grün Großmutter früher erfreut hatte, schien zu verdorren, und ihre Sehnsucht, anfangs von den Federwölkchen, die südwärts segelten, immer aufs Neue entfacht, glomm kaum noch.
Während ich neben Carola niederknie und meinen Blick nach unten richte, fühle ich mich ganz in meine Erinnerung entrückt. Die gedämpften Schrittgeräusche der andren Besucher verstummen, und mir ist, als höre ich von fern Gesang. Er scheint sich zu nähern, und ich meine, dort zu sein, wo ich nie wirklich gewesen bin. Aber das, was ich aus Großmutters Erzählungen, aus dem Buch, das Sándor seinem Freund Joschi einst mit ungewöhnlicher Absicht gab, und aus Titeln, die ich später ganz gezielt las, erfahren habe, ist so tief in mich gedrungen, dass ich manchmal glaube, ich selbst wäre José gewesen, der in meinem Roman als Ich-Erzähler mit Hernán Cortés ins Reich der Mexica einfiel und auf dem großen Teocalli von Tenochtitlán jene denkwürdige Messe erlebte.
Ich habe die Stelle mehrmals umgearbeitet, so dass sie mir Wort für Wort im Gedächtnis geblieben ist: Nachdem Montezuma unsren Wunsch mit seinen Priestern beraten hatte, erfuhren wir, dass eingetreten war, was wohl selbst Cortés ein wenig verblüffte: Die Azteken überließen uns tatsächlich einen Turm für unsre Gottesdienste.
Um die erhaltene Erlaubnis so schnell wie möglich nutzen zu können, säuberten wir den Raum, schmückten die Wände mit frischen Blumengewinden und errichteten einen Altar, über dem ein Kruzifix und das Bildnis der Heiligen Jungfrau angebracht wurden.
Die erste, von allen mit Spannung erwartete Messe werde ich, da sie unter recht merkwürdigen Umständen stattfand, nie vergessen. Während wir dicht gedrängt im Innern des Heiligtums oder auf der angrenzenden Tempelplattform knieten und nachPater Olmedos Predigt mit rauen Kehlen das Tedeum anstimmten, scholl aus dem zweiten Heiligtum wilder Gesang, den die aztekischen Priester zu Ehren Huitzilopochtlis erhoben. Die dunkelhäutigen Krieger, die nur wenige Schritte von uns entfernt in ihre Andacht versunken waren, hörten beides wie wir, und da sich in diesem Augenblick niemand an dem doppelten Ritual zu stören schien, kam mir in den Sinn, dass eins das andre nicht ausschließen müsste, wenngleich ich, noch ehe sich der Gedanke verfestigen konnte, zu bezweifeln begann, dass ihn jemand verstehen würde.
Als wir ins Freie treten, werde ich von der schon tief stehenden Sonne geblendet, dass ich die Augen schließen muss. Mir ist immer noch, als höre ich von fern das Tedeum, aber nun klingt es, wie es mir aus unsrer Stadtkirche vertraut ist. Meine leichte Benommenheit weicht erst, als wir schon in der U-Bahn sitzen. Am Heldenplatz steigen wir aus, gehen in den Hof der Burg Vajdahunyad, entdecken wieder den Harfenspieler, setzen uns auf die Bank unter der Platane und hören ihm zu, während mein Blick öfter zum Denkmal des Anonymus gleitet, der durch seine weit ins Gesicht gezogene Kapuze rätselhaft wirkt, wie er zu Lebzeiten gewesen ist. Er konnte sein Geheimnis so gut bewahren, dass bis heute umstritten ist, wer sich hinter dem Autor der vor über achthundert Jahren entstandenen „Gesta Hungarorum“ verbirgt. Vielleicht, denke ich, hätte ich, solange die Mauer noch stand, die man in jener Augustnacht zu errichten begann, als ich vom Bahnhof Zoo mit Anke in der S-Bahn ostwärts fuhr, manche Texte als Namenloser veröffentlichen sollen, wenn es unter den gegebenen Umständen möglich gewesen wäre.
Als in der Nähe einige Raben krächzen, schrecke ich aus meinen Überlegungen. Ich entdecke sie im Geäst eines Baums. Sie sind grau wie jene, die wir zwei Tage vorher im Burgviertel gesehen haben. Früher, in unsrem Dorf, kannte ich nur welche mit pechschwarzem Gefieder. Im Winter sah ich oft durchs Küchenfenster, wie sie sich gegenüber, hinter Lackners Gehöft, zu zehnt oder mehr auf den kahlen, erstarrten Ästen der drei mächtigen Eichen niederließen. Ich hörte die hungrigen Vögel krächzen und beobachtete sie durch eine kleine Sichtfläche, die ich immer wieder ins Eis hauchen musste, weil es sich rasch auf der Scheibe nachbildete. Im Sonnenschein, der ihr Gefieder versilberte, wirkten die Raben groß und schön. Doch trübte es sich ein, schrumpften sie zu winzigen schwarzen Flecken auf einem düsteren Aquarell, das vom Schnee, wenn er dichtflockig zu fallen begann, verwischt wurde.