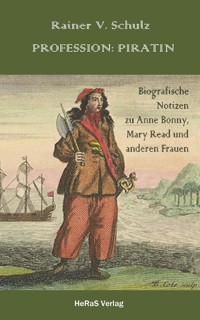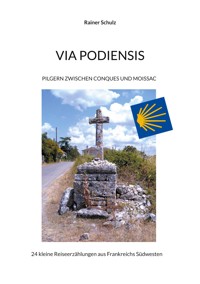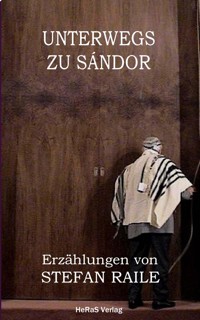5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Autor seine Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswelt für sich skizziert, da diese Unmittelbarkeit es schwer hatte, in der DDR veröffentlicht zu werden. Seit dem Ende seiner beruflichen Laufbahn greift er in den vorliegenden Erzählungen und Skizzen wie schon in seinen vorangegangenen Erzählungsbänden "Lied der Grasmücke", "Du hoffst, und ich gehe", "Aus den Notizen eines Ange-passten", "Immer den Fluss entlang", "Der Kuckuck lebt noch", "In der Herberge zum Steppenwolf" auf diese Notizen zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rainer Schulz
Des Schicksals leiser Tanzschritt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Major
Du bist nicht so einer
Durst
Identität – Ein Traum
Kneipengespräch
Der Junge auf dem Bahnsteig
Der Pförtner
Die Angst
Die Bank in der Sonne
Die Geschichte meines heutigen Tages
Früher hatte ich auch so herzhaft gelacht
Die Jugend hat’s leicht
Und manchmal fühle ich mich klein
Wiedersehen an der Grenze
Der neunzigste Geburtstag der Tante
Nachträglicher Grenzdurchbruch Pfingsten 1990
Der Fensterplatz
Gewöhnlich ging er ins Café
Porträt in Kohle
Des Schicksals leiser Tanzschritt
Nach drüben
Der Friseur
Blaue Schatten
Im Palasthotel
Der unerschrockene Häuptling
Herr Lindström schaut aus dem Fenster
„Weshalb schreibst du?“,
Angaben zu einem Sachverhalt
Zwischenzeiten
Impressum neobooks
Der Major
Fritz Leverenz
Des Schicksals leiser Tanzschritt
Für Jacqueline und Georg
©HeRaS Verlag, Rainer Schulz, Berlin 2024
www.herasverlag.de
Layout Buchdeckel Fritz Leverenz
ISBN 978-3-95914-096-6
„… und nun, da ich an eine Arbeit geraten bin, die sogar noch herrlicher ist als das Amlebensein selbst, möchte ich nicht ein einziges unwahres Wort äußern.“
William Saroyan in: „Mein Ich auf Erden“
1934
„ Es steht zu keiner Zeit ein Glück so fest, dass es nicht von einem Windhauch oder dem Hauch eines Kindes umgestürzt werden könnte; wieviel weniger jetzt!“
Wilhelm Raabe, „Chronik der Sperlingsgasse“, „Pro Domo“, 1864
Die Puppenspielerin
In den aufwühlenden Monaten nach dem Fall der Berliner Mauer warb die Puppenspielerin, Frau Mosel, an der unverputzten Ziegelwand eines Hauses im Prenzlauer Berg mit einem Plakat für ihr kleines Theater:
„Jetzt N E U !“
Koffertheater
Frau Mosel
Berlin, DDR-xxxx Tel. xxx
spielt „S C H N E E W I T T C H E N“
Dieses bekannte Märchen der Brüder Grimm wird bei uns als
Puppenspiel aufgeführt.
Weiterhin ist ein Kasperspiel im Repertoire:
„D E R G O L D S A C K“
Gretel wird vom Teufel überlistet, aber mit Hilfe der Kinder bekommt der Kasper den Goldsack wieder zurück.
Ausstattung: B. und G. W.
Demnächst kommt ein orientalisches Märchen ins Programm.
Figuren: Paul Z.
Wir spielen für die Altersstufe 4 – 12 Jahre
Wir empfehlen unser Programm für Kulturhäuser, Schulen, zur Feriengestaltung,
in Betrieben, zu Kinderfesten usw.
Technische Bedingungen: Für die Bühne wird ein Spielraum von 3x4 m benötigt. Zur Stromversorgung genügt eine Steckdose 220 V.
Programmkosten ca. 150,- M (zuzüglich Transportkosten)
Zulassungsnummer: xxxx/ April 91
Ein Klapptransparent auf dem Gehweg führte zum Eingang ihrer kleinen Parterrewohnung um die Ecke, denn die Wohnung war das Puppentheater. Die Jalousien der Fenster waren hochgezogen, und stellte man sich auf die Zehenspitzen, konnte man hineinschauen. Die Fensterscheiben waren beschlagen, doch man konnte erkennen, dass es drinnen recht gemütlich eingerichtet war. Die mit bunten Girlanden geschmückte Wohnungstür, die ja jetzt eine ehrwürdige Theatertür darstellte, stand in Erwartung der Besucher offen. Frau Mosel stand bekleidet mit einer Jacke aus bunten Flicken und einem schwarzen Hut mit weiter Krempe hinter einem kleinen Tresen, auf dem eine Pinocchiopuppe mit einem Werbezettel in der Hand saß, und begrüßte freundlich jeden Besucher persönlich.
Das kleine Puppentheater schaute ganz verlegen auf die Kreuzung mehrerer Straßen, denn noch vor wenigen Monaten fungierte es als „konspirative Wohnung“ für die heimliche Polizei. Frau Mosel hatte sie nach einer Bewerbung bei der Abteilung Kultur des Rates des Stadtbezirks von den Mitgliedern des „Runden Tisches“ zugewiesen bekommen.
Die Wohnungen in den oberen Stockwerken tratschten über die kleine Wohnung. „Das haben wir gern“, sprach die zweite Etage, „sich erst bei den Mächtigen hochdienen wollen und jetzt den dicken Kulturmaxen spielen.“
„Weit ist sie ja nicht gekommen“, spöttelte die dritte Etage, „parterre bleibt eben parterre!“ Die vierte Etage trug die Nase jetzt noch höher als früher und sagte zu den Spatzen in der Dachrinne: „Dieses Getratsche der unteren Ränge muss ich mir nun zu jedem neuen Puppenspiel anhören. Da unterhalte ich mich doch lieber mit gebildeten Leuten wie euch und dem Schornstein.“
Das Haus aber redete ja schon immer so, und die kleine Parterrewohnung war es nicht anders gewohnt. Insgeheim aber wünschten sich die oberen Etagen, auch ein Puppentheater zu sein. Und fühlten sie sich unbeobachtet, schauten sie neugierig auf sie herab.
Das „Theater“ besaß lange nicht so viel Platz wie ihre oberen Nachbarn, machte sich aber mit seinen drei Räumlichkeiten so hübsch und weit wie es nur konnte. Eine Kammer links neben der Eingangstür diente als Garderobe, und hatte immer tagelang zu erzählen von den Leuten, die ihre Mäntel und Jacken bei ihr abhängten. Die Küche dahinter hatte eine Nebentätigkeit angenommen, und wenn der Kaffee gekocht war oder hin und wieder das Mittagessen für Frau Mosel, dann wirkte sie als Kasse und Kiosk für Werbeschriften und Süßigkeiten und wurde gern von Kindern besucht. Der größere Raum rechts, das ehemalige Wohn- und Schlafzimmer, musste seine Bequemlichkeit aufgeben und als Bühne und Zuschauerraum herhalten. Das fiel ihm sichtlich schwer: er gähnte den halben Tag und wurde erst munter, wenn der kleine Vorhang sich hob. Dann aber brüstete er sich vor Kammer und Küche mit seinem blanken frisch versiegelten Fußboden aus Fichtenholz und den vier klarlackierten Holzstufen, auf denen karierte Kissen lagen. Sie waren vorgesehen als Sitzflächen für kleinere und größere Zuschauer.
Das eine Fenster war halb verhängt mit einer Gardine, davor stand auf hohem Stativ ein Bühnenscheinwerfer. Im Hintergrund des Zimmers neben dem schwarz verdunkelten zweiten Fenster aber stand der Zweck des ganzen Hauses das eigentliche „Theater“, ein riesiger aufgeklappter Seemannskoffer auf zwei Handwagenrädern. Der Deckel zeigte innen eine bunte bewaldete Bergkulisse und außen die hübschen Zimmerchen des Zwergenhäuschens. Davor breitete sich das Unterteil des Koffers als Bühne, verhangen mit braunem Sacktuch. Sie war die kleinste aber lauteste Person in der Wohnung, denn Frau Mosel ließ hinter ihr mit heller Stimme die Marionetten als Märchenfiguren sprechen. Da kam es mitunter zu derben Streitigkeiten.
„Das eigentliche Puppentheater“, sagte die Kofferbühne, „bin ich. Was wisst ihr schon von der Welt. Mit mir und dem Scheinwerfer und dem sprechenden Dingsda“, und sie zeigte auf ein Holzstativ mit einem nachgebildetem Spiegel aus Silberfolie, „geht unsere Meisterin zwölf Mal jährlich auf Tournee.“
„Hach, wie übermütig“, sprach der Kofferdeckel, „dass ich nicht lache, „sobald ich mich zur Ruhe lege, siehst du mich – und die Berglandschaft bei Nacht.“ Die Kofferbühne schwieg kleinlaut, diese Tatsache hatte sie übersehen, da der Deckel oft tagelang durcharbeitete und offenstand. Während der Vorführung, wendete Frau Mosel mehrmals den Kofferwagen, und die Kulisse wechselte zwischen den Bergen und dem Inneren des Zwergenhäuschens.
An Ruhetagen hingen die Marionetten an Leisten aufgereiht an den Wänden. Darunter wurden sie auf einem Plakat, „als Muster der Verkaufsausstellung des Puppenbauers Herrn Wegner, handgeschnitzt nach Plänen unserer Puppenspieler, Verkaufswert von etwa fünfhundert bis siebenhundert Mark“, auch zum Kauf angeboten.
Als Kindergärtnerinnen mit zwei Gruppen Vierjähriger eintrafen, half der Sohn der Puppenspielerin, ein schlanker schwarzhaariger junger Mann, mit einem Freund, Anoraks und Jacken abzunehmen. Frau Mosel verkaufte indessen die Eintrittskarten, und die Kinder mit ihren Betreuerinnen nahmen auf den Stufen Platz.
Schließlich hielt jeder Besucher eine Eintrittskarte in der Hand, und Frau Mosel kam und eröffnete die Vorstellung. „Am heutigen Vormittagsprogramm spielen wir ‚Schneewittchen‘, und am Nachmittag: ‚Fatima‘ – Ein orientalisches Märchen.“
Sie war Anfang vierzig, mittelgroß, wirkte jugendlich frisch, und sah mit ihrem braunem gekräuselten langen Haar aus, als käme sie eben aus dem Regen. Sie trug jetzt ein tailliertes schwarzes seidenes Kleid mit rundem Ausschnitt und schwarze Ballettschuhe und sah recht hübsch und feierlich aus.
Eine Kindergärtnerin flüsterte zu den Kindern: „Gleich kommen die Kasperlepuppen. Ein Mädchen begann zu weinen, als sie das hörte. „Aber sie sollen nicht kommen. Ich war doch gar nicht unartig.“ „Ach, was!“, sagte die Kindergärtnerin, „weißt du das denn nicht? Die Kasperlepuppen kommen nur zu artigen Kindern.“ Sie nahm die Kleine auf den Schoß und trocknete ihre Tränen, bis sie aufhörte zu schluchzen.
Frau Mosel schaltete das Deckenlicht aus, den Scheinwerfer ein, gab sich eine bös schmeichelnde kratzige Stimme, verwandelte sich in eine Puppenspielerin und begann als die Königin Stiefmutter das Märchen zu erzählen.
„Was ist los?“, fragte das große Zimmer und gähnte. Es war eben durch die kratzige Stimme aufgewacht. „Was höre ich dafür unangenehme Töne? Ich dachte, man hätte mich nach dem Mauerfall schon ordentlich durchgelüftet. Aber mir scheint, es geistern noch immer finstere Hinterlassenschaften, unerfüllte konspirative Aufträge in mir herum. Das möchte ich durchaus nicht dulden. Ich protestiere!“
„Ich habe von all dem nichts gewusst“, sagte die vierte Etage. Sie hatte ein gutes Gedächtnis, und kannte diesen Satz schon seit dem letzten Weltkrieg. Da sie aber keine menschliche Stimme besaßen, hörte sie auch niemand der Anwesenden.
So spielte Frau Mosel die böse Frau auch selbst und sprach zu den Kindern, wie sie möglichst heimtückisch den Apfel vergiftet, so sehr das große Zimmer sich auch aufregte.
„Nicht mehr lange wird Schneewittchen die Schönste sein“, sprach sie, „hier seht!, den Korb voller schmackhafter Äpfel werde ich ihr bringen. Diesen hübschen Apfel aber lege ich obenauf, ihn werde ich ihr schenken. Und damit er ihr besonders süß schmeckt, habe ich hier drinnen etwas Hübsches. - Hi, hi, hi.“
Die Puppenspielerin senkte den Kopf, blickte durch Augenschlitze auf die Kinder und lachte in hohen spitzen Tönen. Dabei öffnete sie ihr schwarzes Handtäschchen, entnahm eine schwarze Dose und einen buschigen Pinsel, griff den hübschen rotbäckigen Apfel, öffnete die Dose und betupfte seine rote Seite mit Puder.
„Nein, nein!“, rief das große Zimmer, „das kann ich nicht dulden.
Was tut sie denn jetzt? - So viel Bosheit habe selbst ich noch nicht erlebt“, doch niemand hörte es, und das war sehr schade.
„So, seht ihr?, die hübsche rote Seite ist jetzt vergiftet. Ich werde den Apfel teilen. Die grüne Hälfte nehme ich, und Schneewittchen wird die rote Seite essen. Und dann wird sie in einen tiefen, langen Schlaf fallen, hi, hi, hi, - in einen TOO - DES - SCHLAAF!!! - Dann werde ICH im ganzen Land die Schönste sein.“
„Wie soll ich das nur aushalten“, seufzte das große Zimmer. „Frau Mosel macht die Kinder zu bösen Stiefmütterchen. Ich glaubte, das Böse hätte sich aus dem Staub gemacht. - Nur gut, dass ich nicht mit auf Tournee gehe.“
„Warte nur ab!“, sagte der Koffer, der von Kunst und Kindern nicht viel verstand und das letzte Mal auf weiten Reisen war, als Bismarck Reichskanzler wurde, „vielleicht setzt man dich auch auf zwei Räder, und dann rollen wir beide durch Berlin.“
Das Zimmer wollte dieses Thema umgehen damit Frau Mosel diesen Vorschlag nicht hörte und wurde mucksmäuschenstill. Und auch die Kinder hielten den Atem an. Einige versteckten sich gar hinter den Rücken ihrer Kindergärtnerinnen oder ihrer Alterskameraden. Ängstlich und misstrauisch beobachteten sie den starren Gesichtsausdruck der Marionetten, nahmen die Hände auf den Rücken oder drehten sich zur Seite, sobald eine Puppe sich näherte. Die schwarzen Zwirnsfäden schienen sie gar nicht zu sehen, blickten meist nur fasziniert in die hölzernen Gesichter, auf die Bewegungen des Kopfes und der Gliedmaßen und auf die klappernden kurzen Schritte ihrer Holzfüße. Die Marionetten waren für sie nicht einfach nur „Puppen“, sondern vielmehr ihre Vorstellung von sich selbst und von anderen, denn die Puppen spielten zwar das Stück, ihnen aber nichts vor; sie schauspielerten nicht, verstellten sich nicht, sondern ließen sie ehrlich mit ihren eigenen Bildern von der Geschichte zurück.
Die Erzieherinnen schienen die Stimme des großen Zimmers zu hören, sie verzogen unwillig ihr Gesicht, schwiegen aber zu den Machenschaften der Königin Stiefmutter. Wollten aber aus Höflichkeit die Vorstellung nicht stören. Das hätten sie aber ruhig tun sollen, zumindest mit einem hörbaren Murren. Kindern genügt nämlich ein leiser Hinweis, ähnlich dem Text des Märchens der Brüder Grimm. Denn sie nehmen das Böse mit ihrem Urvertrauen auf das Leben und besiegen es mit ihrer kindlichen Unerfahrenheit. Die tieferen Tiefen menschlicher Abgründe, erfahren und verkraften sie mit den Jahren immer nur so weit, wie ihr kindliches Gemüt es erlaubt.
1991
Ort: Potsdam Hauptbahnhof. Wetter: Warmer Mairegen.
Auf dem Vorplatz stehen zahlreiche Militärtransportfahrzeuge, und es wimmelt von jungen Männern mit Koffern, Taschen oder Pappkartons. Die einen hasten zu den Fahrzeugen, von Offizieren und Unteroffizieren begleitet, die anderen auf den Bahnsteig zu einem Sonderzug. Einige der jungen Männer torkeln mit von Schnaps und Bier verklärten Augen. Alkoholdunst. Laute Witze. Gegröle. Sarkastische und ironische Sprüche wabern über den Platz. Jemand ruft mir zu: „Kommst du mit nach Eggesin?“ Er meint diesen riesigen berüchtigten Standort der 9. Panzerdivision der NVA in Mecklenburg.
Ich bewege mich durch eine Ansammlung an Resignation, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Das Wort „Ehrendienst“ wirkt an diesem Platz zynisch. Ich wage es nicht auszusprechen („Sprache dichtet für dich.“)
Die LKWs fahren ab, der Vorplatz leert sich, und auch der Sonderzug setzt sich in Bewegung. Zurück bleiben leere Schnaps- und Bierflaschen in Regenpfützen und Eltern, die still dem Zug hinterhersehen, sowie ein einzelner Major, der mir unangenehm auffällt. Schon, wie er die Menschen mustert auf dem Bahnsteig, schmallippig mit kaltem zynischen Blick, spaltäugig. Er hat offenbar den Transport herbegleitet und seinen Auftrag erfüllt und wartet wie ich auf den Zug Richtung Berlin: Gedrungen, breithüftig, Halbglatze mit spinnwebhaarigem Haarkranz und wulstigem Hals. Die Hände hinter sich, als habe er Mühe, sich aufrecht zu halten.
Im Zug legt er mit Mütze und Mantel seine wichtigsten Würdenzeichen zur Seite, und seine wirkliche Gestalt dringt deutlicher nach außen. Und das Erste, was er tut, man ahnte es: er schlägt das „Neue Deutschland“ auf (die Zeitung, dieses „Zentralorgan“, soll hier nicht bewertet sein.). Wie auffallend dies wirkt, weil man schon gar nichts anderes erwartet; weil man erschrocken ist, dem lebenden Klischee zu begegnen: geistig beengt, ohne eine brüchige Meinungskrücke unfähig, freihändig laufen zu können.
Ich weiß nicht, was er sonst noch an geistiger Nahrung zu sich nimmt. Wäre eine interessante Frage. Leider komme ich nicht dazu, ihn anzusprechen, da ich auf dem Weg zu einem Freund in „Genshagener Heide“ aussteige.
1985
Du bist nicht so einer
Auf einem S-Bahnsteig am Vorweihnachtstag.
Raureif hängt in den Zweigen des Feldahorns am Bahndamm. Es ist Mittag. Ein fremdartiges schleifendes Geräusch ist zu hören, schurrende schlurfende Schritte, die sich nähern, bei denen es den Leuten fröstelt. Ihre Gespräche verstummen.
Er geht mit hängenden Armen suchend den Bahnsteig entlang - in schmuddeliger zerrissener Hose und eingerissener brauner Kunstlederjacke. Ein blasses hageres Gesicht gezeichnet von tiefer Hoffnungslosigkeit, mit müden rot entzündeten Augen, deren Blick niemanden finden, die hierhin und dorthin schauen, als schauten sie in ein Nichts. Sein angegrautes Haar steckt unter einem schwarzen Basecap, das er der jugendlichen Mode nach mit dem Schirm im Nacken trägt. Was bei Jugendlichen verwegen oder forsch aussieht, wirkt bei ihm, da er gebeugt geht, mitleiderregend. Seine Jacke passt ebenso wenig zu seinem Äußeren wie die beiden ehemals weißen Leinenbeutel, die er erwartungsvoll in der Hand trägt. Das Geräusch verursacht sein Schuhwerk, das, was davon noch übrig ist. Denn er geht auf Socken. Die Sohlen schlurfen hinter den Schuhresten den Betonboden.
Er geht von Abfallkorb zu Abfallkorb. Immer wieder sind seine kaum wahrnehmbaren demütig bittenden Worte zu vernehmen, die wie „helfen“ klingen oder „Hilfe!“. Er hinterlässt einen unangenehmen beißenden Geruch. Die Leute wenden sich ab oder rücken weg von ihm.
Von der Kippenschale des Abfallbehälters nimmt er lange Zigarettenstummel, durchwühlt die Reste; geht umher zwischen den Leuten, scheinbar ohne sie zu beachten, alle Aufmerksamkeit auf den Boden gerichtet. Hebt Kippen vom Bahnsteig auf; steckt die längeren in die linke Jackentasche, die kürzeren in die rechte Hosentasche. Die Leute haben sich so allmählich an den Anblick tiefster Armut gewöhnt. Ohne das Schlurfen seiner Sohlen fiele er kaum auf in seiner Selbstverständlichkeit.
Ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern an der Hand schaut ihm verstohlen zu. Die Kinder interessieren sich für ein durch einen niedrigen Drahtzaun eingegrenztes Stück Bahnsteig. Darin steht auf einem Fetzen Kunstrasen ein Weihnachtsbaum mit Lichterkette. Vor dem Baum ein Weihnachtsmännlein aus Stoff, das wie in unendlicher Geduld mit seinen Betrachtern, beinahe schläfrig den Kopf und eine Hand mit einer leuchtenden Kerze bewegt. Auch zwei Fahrgastbetreuer in ihren gelben Westen über den Anoraks betrachten ihn versonnen. Der Kippensammler hält inne in seiner Beschäftigung, stellt sich zu ihnen. „Es gibt viele Weihnachtsmänner dies Jahr“, sagt er kaum hörbar. Sie blicken flüchtig zu ihm und wenden sich ab.
Die Frau mit den beiden Kindern sagt lächelnd etwas zu ihrem Mann und küsst ihn auf die Wange. „Du bist nicht so einer“, mag ihre Geste ausdrücken, „du bist stark, sorgst für die Familie.“ Der Mann nickt kaum merklich, wendet sich dem bittenden Kippensammler zu. In seinen Augen stehen Tränen.
1993
Durst
Der Kleine, eineinhalb Jahre alt, ist ganz und gar Bitte, sein Gesicht kläglich verzogen. Er jammert lallend bittend. Die Mutter, sie hat ihn auf dem Schoß, und der Vater reden ihm abwechselnd zu: „Nun, sei endlich still! Habe Geduld! Wir sind ja bald zu Hause.“ Der Kleine schreit jetzt durchdringend, dass jeder in der Straßenbahn sich umsieht. Er weint laut. Es nützt nichts. Er weint wieder leiser. So geht es die ganze Fahrt über, eine halbe Stunde lang.
Der Vater breitschultrig, derb, wohlgenährt, in dunkelgrauem Anzug, am Kragen das Parteiabzeichen. Die Mutter, dunkelhaarig, mit dunklen Augen, auffällig dunkel geschminkt, die Lippen kirschrot gefärbt. Ihre Augen, blicken umher, wie auf lüsterner Suche nach Spiegeln. Hin und wieder redet sie unkonzentriert auf den Kleinen ein: “Sei still, endlich!“
Der Kleine brüllt wieder aus voller Kehle. „Jetzt gibt es nichts zu trinken!“, sagt der Vater barsch mit flüchtigem Blick auf den Kleinen. „Warte, bis wir zu Hause sind! - Wir sind bald zu Hause.“
Die Mutter stellt das schwarze Köfferchen zur Seite, damit der Junge sich nicht erinnere, dass die Flasche sich in seiner Nähe befinde. „Guck aus dem Fenster! Da gibt es viel zu sehen“, redet der Vater wie zu einem Haltegriff. „Du wirst dich doch wohl ein wenig gedulden können.“ Der Junge brüllt lauter, dann wimmernd.
Wüsste er nur die Worte, die der Vater da zu ihm spricht. Doch er kennt die Worte nicht, weiß nicht die Zeit, kann sich nicht sagen, aus dem Fenster blickend: „Nun sind wir ja schon am Fahrradladen. Bis nach Hause also bloß noch zwei Stationen, zehn bis fünfzehn Minuten.“ Er fühlt nur Durst. Jetzt. Einfach nur Durst, den er mit keiner Erfahrung befehlen kann, geduldig zu schweigen.
1981
Identität – Ein Traum
Er wollte mit mir den Kopf tauschen. Meinen wohlproportionierten Kopf gegen seinen lächerlich länglichen mit den vielen Kerben um den Mund und hellem blondem glattem Haar. Er ist mir nicht einmal sympathisch. Weiß der Kuckuck, weshalb wir auf diese Tauschidee kamen.
Ich stand bei uns in der Wohnung auf dem Flur, und ein mir fremder kleinerer untersetzter junger Mann sollte mir mit einem großen Holzhammer auf den Kopf schlagen. Es geschah, und dann spazierte ich mit einem anderen Kopf auf meinen Schultern herum. Es waren viele Leute um mich. Auf der Treppe – die Wohnungstür stand offen – in den Zimmern. Eine Wohnung. Offenbar alles Verwandte und Bekannte. Ich konnte niemanden erkennen und mich an niemanden erinnern. Nur an mein Gesicht, an meinem Kopf, den ich in einem langen Wandspiegel wiedertraf, und der mir sehr verfremdet erschien. Ich sah ihn im Profil, als scheute er sich, mich anzusehen – und mit dunklerem Haar als ich es von meinem Kopf gewohnt war.
Ich spazierte zwischen den Verwandten herum und niemand grüßte mich, niemand schien mich zu kennen. Ich fühlte mich wie unter einer Maske. Am Hals jedoch kein Ansatz, sie abzuheben, keine Narbe, die auf die Abtrennung, auf den Tausch der Köpfe hinwies. Fremd fühlte ich mich, und an den Spiegeln, an denen ich vorüber kam, blickte ich in ein fremdes unsympathisches gelangweiltes Gesicht. Wie sollte ich je mit diesem Gesicht meine Heiterkeit, mein Wesen ausdrücken, wie je wieder Ich sein …
Wieder standen wir auf dem Flur. Ich, ein großer junger Mann und der kleinere Untersetzte. Wir wollten den Tausch rückgängig machen. Doch ich zweifelte, ob eine derart komplizierte Operation gelänge. Der Große wollte den Holzhammer nehmen. „Du bist den Schlag nicht geübt“, sagte ich und übergab dem Kleineren den Hammer. Aber träfe der Kleine so von unten den richtigen Punkt? „Schlage nicht zu grob!“, sagte ich, „so, dass ich wieder aufwache.“
Und dann erwachte ich und atmete erleichtert durch, mich mit meinem eigenen Kopf vorzufinden.
2002
Kneipengespräch
In der Gaststätte „Rennsteig“ in der Schönhauser Allee. Eine Sitzecke mit Bank und Tisch vor Butzenscheibenfenster. Drei junge Männer in lautem Gespräch miteinander über Freiheit und Unfreiheit. Das Thema: „Reisemöglichkeiten“ dominierte.
Zwei schütteten ihr Herz gegenüber einem Dritten aus, der sich als „Ökonom“ ausgab. Der eine pockennarbig mit dunklen Augen, Schnauzbart und Halbglatze; der andere kleiner und rundlich mit vergnügtem Gesicht.
Sie erwähnten Solschenizyn und diskutierten lebhaft über dessen Glaubwürdigkeit, und wer wohl das Recht hätte, ihn zu verurteilen, ohne seine Werke gelesen zu haben. Der Ökonom, der am wenigsten von allen getrunken zu haben schien, sprach wohlartikuliert: „Es gibt doch viele Autoritäten, die Solschenizyn und ähnliche Werke für die Allgemeinheit interpretieren. Was muss die Masse des Volkes diese Werke lesen.“
„Nein!“, empörte sich der Schnauzbärtige, „mit dieser Arroganz dürfen Sie mir nicht kommen. - So einfach hätten Sie’s wohl gern. - Wer sind denn jene ‚Autoritäten‘? - Doch nur Professoren oder andere Staatsbeamte. Und Staatsbeamte sind als ‚Autoritäten‘ wenig glaubwürdig, bestenfalls als Staatsbeamte. Die geben doch bloß von sich, was sie müssen und weniger ihre wahre Meinung.“
Ein vierter Gast, ein großer junger Mann mit glattem schwarzen Haar schob sich mit seinem Stuhl an den Tisch und mischte sich alsbald ins Gespräch, als es um Reisemöglichkeiten ging.
„Seit vier Jahren wird mir eine Reise zu Freunden nach Litauen verweigert“, sagte der Kleine vergnügt, „und siehe da, jetzt endlich habe ich eine Reisegenehmigung erhalten. Man muss hartnäckig bleiben.“
Der vierte Gast meinte: „Da hatten Sie Glück. Jeder kann sich doch hier im Lande ein Bild machen vom Kapitalismus in den westlichen Ländern.“
„Ich weiß nicht, wie du darauf kommst: ‚Ein Bild machen‘“, sagte der Ökonom empört.
„Richtig! Das ist es!“, sagte der Schnauzbärtige, „wer kann sich denn ein gültiges Bild machen, wenn er noch in keinem westlichen Land gewesen ist?“
Unklugerweise, oder weil er sich mit dem Seltenheitswert hervortun wollte, goss der vierte Gast Öl aufs Feuer der Entrüstung: „Sie können mir glauben, ich bin sechs Mal in der SU gewesen, in Litauen und anderen Sowjetrepubliken.“
„Sechsmal!? - aha! - Und da kannst du dir ein Bild machen!? Ein richtiges wohlproportioniertes Bild von dem Land? - Wie lange warst du denn dort?“
„Na, lange genug.“
„Ach, rede doch nicht! Ich kenne doch die kurzen Dienstreisen. Was dabei an Bildern herauskommt, ähnelt doch den Klischees, die wir hier im ‚Schwarzen Kanal‘ von den Ländern erhalten.“
Der Vierte spielte weitere Trümpfe aus: „Bin in Zypern gewesen, Ägypten, Frankreich, Italien, Finnland und Schweden und mache mir selbst ein Bild mit meinem beschränkten Aufnahmevermögen.“
Nun hatte er sich als Reiseprivilegierter entpuppt und die anderen umso mehr gegen sich. Da er jedoch weniger Biere intus hatte, war er den anderen Dreien in ihrer undisziplinierten Aggressivität unterlegen und hielt sich in der Diskussion nur mühsam mit gängigen Zeitungsfloskeln über Wasser, bis er schließlich aufstand, seine Jacke vom Kleiderhaken griff, der verblüfften Kellnerin einen Geldschein in die Hand drückte und wortlos das Lokal verließ.
1977
Der Junge auf dem Bahnsteig
Der Pannonia-Express Richtung Berlin hat zwei Stunden Verspätung, und der Mann sitzt schon den halben Nachmittag bei großer Wärme im Warteraum auf dem Bahnhof in Decin.
An seinem Tisch eine Familie – wie er heraushört – auf dem Weg von Prag nach Dresden. Die drei Jungen der Familie, im Alter von etwa fünf bis acht Jahren, sehen gepflegt aus, sind gut gekleidet, offenbar auch wohlerzogen und sprechen sauber artikulierend. Sie spielen mit Blechautos, die sie in Prag gekauft haben.
Ein etwa fünfjähriger Junge schlendert heran, rabenschwarze Hände, schmutzige Ärmchen, ein dunkles verschmutztes Gesicht. Unter einer ehemals hellblauen Latzhose trägt er ein fleckiges buntkariertes Hemd. Er sieht die Jungen mit ihren Autos spielen, geht neugierig zu ihnen. Fasst eines der Autos an, schiebt es lächelnd über den Tisch. Seine braunen Augen strahlen. Er redet zu den Jungen auf Tschechisch. Die Jungen verstehen den Kleinen nicht, starren ihn an, schweigen, sind sich unsicher, wagen sich kaum zu rühren. Der Kleine sieht ihre bunten Uhren an den Armen, betrachtet sie staunend. Dem Jüngsten der Drei steht der Armbandverschluss offen. Der Kleine spricht zu ihm, fasst seinen Arm, schließt das Armband – freut sich darüber, wie ihm das geglückt ist.
Die Mutter der Jungen blickt herüber und sagt finster: „Lass dir die Uhr nicht abnehmen!“
„Nein“, antwortet ihr Sohn, „er bindet sie mir um“, und hebt seinen Arm der Mutter hin.
Der Kleine sieht den größeren Jungen Plastilin formen. Sagt etwas, deutet an, dass er gern mitspielen würde. Er müsste ins Bad und gewaschen werden, denkt der Mann. Die Leute sitzen miteinander zwischen ihren Gepäckstücken, reden, lesen Zeitung, trinken Bier und beachten den Kleinen nicht anders als einen Gegenstand, der zu diesem Bahnhof gehört, wie der Abfallkorb in der Ecke, der einem nichts angeht. Aber man muss etwas tun, wenigstens etwas. Der Mann ist jetzt nicht mehr müde vom Wandern, von der Wärme, nur unruhig. Möchte den Kleinen nehmen, ihm über den Kopf streichen, ihm zulächeln. Aber er ist hier fremd. Man könnte ihn missverstehen. Er erhebt sich, geht hinaus zum Kiosk, möchte ein Päckchen Plastilin kaufen, oder Spielzeug, doch es gibt nur Kinderbücher mit derben Pappseiten. Er wählt eine bunte Geschichte über Tiere auf dem Bauernhof und bringt sie dem Jungen. Der starrt ihn an, lacht, kramt aus seiner Hosentasche Sand und einige Hellermünzen, reicht sie ihm. „Danke“, sagt der Mann, nimmt die Münzen, legt einige Münzen aus seiner Tasche hinzu und steckt sie dem Jungen zurück in das Latztäschchen. Der Junge setzt sich neben ihn an den Tisch, blättert in dem Buch und erzählt ihm die Bilder, nennt die Namen der Tiere auf Tschechisch: den Igel, Gänse, Hühner, Schafe. Wie oft mag der Kleine wohl in ein Buch geschaut haben? Und der Mann hofft, er möge zumindest einige gute Empfindungen an diesen Nachmittag zurückbehalten. Dann erhebt er sich, winkt den Jungen zu sich. Sie gehen im Gewühl der Reisenden hinaus zur Wasserleitung vor dem Bahnhof und er erklärt ihm, sich Gesicht und Hände zu waschen, reicht ihm ein Päckchen Papiertaschentücher. Der Kleine wäscht sich, trocknet Gesicht und Hände, lacht ihn an. Sein Gesicht ist jetzt hell und die Hände sauber. Am Kiosk kauft er für beide ein Würstchen mit Brot. Der Kleine steht mit Buch und Würstchen. Sie essen beide. Der Zug kommt. Sie winken sich zu, und der Mann steigt ein.
1982
Der Pförtner
Ich komme mit einer Gruppe Jugendlicher vom Wohnheim gegenüber zum „Pionierpark“ in der Wuhlheide, um mit ihnen Tischtennis zu spielen. Den Schlüssel zum Tischtennisraum hole ich vom Pförtner am Schlagbaum. Er sitzt im Steinhäuschen und muss jeden kontrollieren, der mit einem Kraftfahrzeug das Gelände befährt.
Er sitzt drinnen am Tisch vor dem Fenster, raucht, löst Kreuzworträtsel und, sobald jemand in einem Wagen kommt, erhebt er sich, hinkt hinaus, drückt auf das Gewicht aus in Stahl eingefassten Ziegelsteinen den Schlagbaum in die Höhe, grüßt, oder betrachtet den aus dem Autofenster gehaltenen Passierschein. „Nein, eine Automatik brauche ich nicht. So komme ich wenigstens in Bewegung.“
Mitunter fährt er mit dem Fahrrad, das im Häuschen an der Wand neben der Tür lehnt, zur Hauptwache am anderen Ende des Parks, oder zum Gebäude mit den Turnräumen und der Schwimmhalle und dem Sportstadion davor.
Er trägt einen abgetragenen dunklen Nadelstreifenanzug, darunter ein kariertes Hemd. Seine Gesichtshaut ist schlaff, rotdurchädert, und die Wangen zittern, wenn er lacht – mit rauchig-heiserer Stimme. Im schmalen Vorraum stehen Besen, Eimer und Schaufel. Die Wände sind geschmückt mit Farbfotos von Tieren und mit einem Telefonverzeichnis.
„Seit drei Jahren sitze ich hier. Noch zwei Jahre bis zur Rente, zur Invalidenrente. Habe noch als Installateur am Bau des Pionierpalastes mitgearbeitet. - Vor drei Jahren war es passiert, an der Freilichtbühne, auf einer Leiter. Unten die Kollegen, sie hatten riesige Plakatwände abgenommen, aus Holz. Ich holte so ein Brett und rufe noch: ‚Vorsicht! Lange Nägel!‘, hebe das Brett über den Kopf nach hinten, um mich nicht an den Nägeln zu reißen, da falle ich runter. Beide Beine gebrochen. Das rechte stand zur Seite ab. Neun Monate hatte es gedauert, ehe ich wieder arbeiten konnte. Hab’s jedenfalls versucht, aber es wurde nicht mehr so richtig. Blieb zu Hause, doch dort wurde es mir zu langweilig. Und so bin ich hier. Vier Stunden täglich.
Als sie den Pionierpalast bauten, waren die Bauleute ratlos. Sie wussten nicht, wo sie gefahrlos buddeln konnten, ohne Kabel oder Rohre zu zerstören. Sie holten mich. Ich sollte ihnen zeigen, wo die Wasser-, Gas- und Stromleitungen liegen. Ich hatte mal davon geredet, dass ich mich ein wenig mit der Wünschelrute auskenne.
Oft bin ich mit zwei Schweißdrähten unterwegs gewesen, als Wünschelrute. Ich hielt die beiden Enden mit geringem Abstand aneinander, schritt die vermuteten Wege der Kabel und Rohre ab, und die Drähte führten an den richtigen Stellen zueinander, als führte sie ein Magnetismus.
Auf diese Kräfte war ich während meiner Lehrzeit vor dem Krieg gestoßen, da war ich neunzehn. Da fragte mich der Lehrmeister: ‚Wann bist du geboren? Im November? Komm! Nimm die Rute und spaziere mal dort entlang!‘ Ich marschierte los und die Rute schlug nach unten aus, hatte das Wasserrohr gefunden. Seit dem gehe ich mit der Wünschelrute, meistens mit einer Haselnussgabel. - Werde noch oft geholt, wenn im Park gebaut wird. Es existieren ja kaum noch Zeichnungen von den Leitungen. - Beim Palastbau fragten die Baggerleute mich. ‚Hier nicht,‘, sagte ich, ‚hier liegt ein Gasrohr.‘ Doch sie baggerten und - zerknackten mit dem Greifer so ein dickes Hauptrohr. Da war gleich der Staatssicherheitsdienst da. Der Meister: ‚Oh, wir haben vergessen, wo das Rohr liegt.‘“
1985
Die Angst
Des nachts fürchtete der Junge in der Gartenlaube für sich und seine beiden jüngeren Geschwister. Sie blieb ihm dunkel und fremd mit ihrem düsteren lila Anstrich. Die Eltern schliefen im festeren Häuschen im Garten nebenan. Dort fühlten die Kinder sich sicherer, aber zu fünft war es für sie in den zwei winzigen Räumen zu beengt.
Nach dem Krieg hatten die Eltern den Garten mit der Holzlaube von ihren Nachbarn, einem Musiker und seiner Frau, die nach Westdeutschland zu ihrem Sohn gezogen waren, zur Pflege übernommen.
Immer wieder war in der Gegend von Einbrechern die Rede. Und der Junge malte sich aus, bei Gefahr mit dem Bruder und der Schwester aus dem winzigen Fenster zu steigen, und sich in der Dunkelheit zu verstecken. Um sich wehren zu können, versteckte er einen faustgroßen Stein in der Astgabel des kurzstämmigen Apfelbaumes. Ab jetzt schlief er ruhiger. Den Stein musste er nie verwenden. Und mit den Jahren vergaß er ihn und seine Angst.
Später lebten und arbeiteten er und die Geschwister in anderen Städten. Indessen trennte eine Mauer das Land, und den Garten ihrer Kindheit am Rande Berlins betrachteten die Eltern jetzt als ihr eigen und verpachteten ihn an Freunde, denn der Musiker und seine Frau, die einst nach Westdeutschland gezogen waren, und deren Sohn, so erfuhren sie, lebten nicht mehr.
Als die Eltern des Jungen, der inzwischen selbst ein älterer Mann war, starben, gaben die Pächter den Gartens auf, und er übernahm ihn und kehrte auf das heimatliche Stück Erde zurück. Jetzt nahm er auch wieder den kleinen Apfelbaum wahr. Der war nur wenig in die Höhe und in die Breite gewachsen, und ein Aststumpf ragte inmitten seiner blühenden Zweige grau und kahl wie eine stille Mahnung an die Vergänglichkeit. Der Mann freute sich über die reichlichen Früchte, die der Baum noch immer trug.
Die Zeit indessen tat, was sie seit je her getan hatte, sie floss unaufhaltsam dahin, und ihr Strom spülte endlich die Grenzbefestigungen zwischen den beiden deutschen Landesteilen fort. Frieden schien einzukehren in ihrer aller Leben. Und der Mann glaubte beinahe, die Zeit hätte ihre nie endende Aufgabe erfüllt und wäre zur Ruhe gegangen. Er begann die einst düstere und inzwischen baufällige Gartenlaube innen und außen von Grund auf zu erneuern und mit einem freundlich gelben Anstrich zu versehen. Er liebte diese Farbe. Sie erinnerte ihn an stille friedliche Sommerabende. -
Da saß er nun eines Tages und spielte mit seinen zwei Enkeln am Gartentisch „Mensch ärgere dich nicht“, als seine Frau kam, ihm einen Brief reichte, der ihn recht grob daran erinnerte, dass der unaufhaltsame Strom der Zeit keineswegs ruhte, sondern über die Ufer zu treten drohte.
Den Brief hatte eine alte Dame in Hessen geschrieben. Sie teilte ihnen mit, sie wäre die Erbin des Grundstücks und hätte die Absicht es zu verkaufen. Sie nannte auch gleich einen möglichen Preis.
Diese Veränderungen kamen zu plötzlich. So rasch brachte der Mann das Geld nicht auf. Noch fast zwei Jahre zog sich diese Angelegenheit in die Länge, da sie einen Rechtsanwalt zu Rate zogen. Außer einer stattlichen Rechnung konnte ihnen dieser kein anderes Ergebnis präsentieren. Sie hatten den Garten an die neue Eigentümerin abzutreten. Für einen großen Kredit fehlte ihm in seinem Alter der Mut. Und als bald darauf ein Schreiben mit dem Räumungstermin eintraf, machten er und seine Frau sich schweren Herzens daran, die eben fertiggestellte Gartenlaube und den gepflegten Garten für die Übergabe an die Erbin zu räumen. Ihnen blieb nicht viel Zeit, um sich von ihrem liebgewonnenen Fleckchen Heimat zu verabschieden.
Nach schweren Monaten, in denen sie kaum noch wussten, wo ihnen der Kopf stand, waren schließlich alle juristischen Formalitäten und praktischen Besorgungen getan, und morgen würde er den Garten an die Erbin übergeben.
Bei Einbruch der Dämmerung schritt der Mann noch einmal durch den Garten, verabschiedete sich persönlich von jeder Blume, von jedem Strauch und von der Hecke. Bei der alten Fichte verharrte er. Auch sie kannten sich seit seiner Kinderzeit. Er entfernte ihr mit einer Zange einen dicken Nagel, den er schon seit langem hatte herausziehen wollen und versorgte die Wunde mit Baumharz. Dann umarmte er ihren Stamm: „Lebe wohl, mein alter Freund. Nun kann ich leider nichts mehr für dich tun. Halte dich aufrecht!“
Und als er zum Apfelbaum kam, fühlte er mit einem Mal wieder diese kindliche Angst. Seine Finger strichen über die glatte Rinde, ertasteten eine Astgabel an den trockenen Stumpf – und - plötzlich spürte er die Kühle eines Steins und - erinnerte sich. Er wollte ihn herausnehmen als Andenken an den Garten, doch er war eingewachsen.
Am anderen Morgen, ehe die Erben eintrafen, nahm er einen Fuchsschwanz und sägte das Stück Astgabel mit dem Stein heraus. Als Andenken an den Garten stellte er sie in seiner Berliner Wohnung auf das Fensterbrett. -
2010