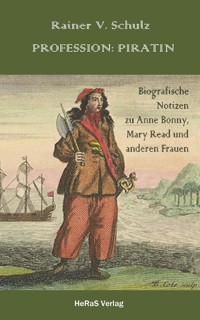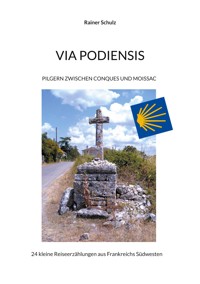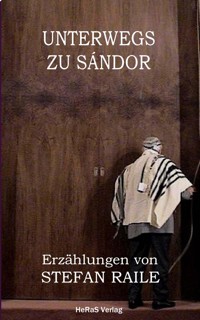Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Buch zu Wort kommenden Autoren lebten und schrieben in der DDR, in der sie bis 1990 den Wirkungsraum ihrer literarischen Arbeit und auch ihre Leser fanden. Die Auswahl ist ganz und gar zufällig. Sie gehörten in der Mehrzahl weder zur ersten Reihe der DDR-Autoren, noch fiel jemand von ihnen durch ausdrückliche Dissidenz auf, daher werden Namen und Werke der hier befragten Autoren im Westen nur wenigen Lesern bekannt geworden sein. Mit dem Ende des Staatswesens DDR standen sie nun auch dem grundlegenden Wandel des Verlagswesens gegenüber, mussten sich auf neue Literaturverhältnisse einstellen. Der aus dem Jahre 1995 stammende Beitrag von Martin Westkott "Eine Kultur verlässt den Raum" führt diese Situation noch einmal eindringlich vor Augen. Auch einige der hier vertretenen Autoren traf das Schicksal, eigene Bücher vernichtet zu sehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Schulz
Wer schreibt der bleibt?
DDR-Autoren nach ihrem Leben befragt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUR ENTSTEHUNG
ZU DIESEM BUCH
E.R. GREULICH
ERHARD SCHERNER
HELGA SCHERNER
HANS MÜNCHEBERG
HELMUT H. SCHULZ
CHRISTA MÜLLER
PETER GOSSE
GUNTER PREUß
FRITZ LEVERENZ
BEATE MORGENSTERN
EINE KULTUR VERLÄSST DEN RAUM
NACHTRAG
Impressum neobooks
ZUR ENTSTEHUNG
1953 wurde ich in Ostberlin, genauer Friedrichshain, geboren. Sechs Monate, nachdem sowjetische Panzer den Aufstand der Arbeiter gegen die Normerhöhung, das SED-Regime oder beides, erstickt haben. Am 17. Juni 53 übrigens, machte mein späterer Onkel, damals 23 Jahre alt, aus dem Fenster unserer Wohnung in der Langenbeckstraße dieses Foto:
Die Bildqualität ist nicht deshalb so schlecht, weil der Mann nicht fotografieren konnte; das konnte er sehr wohl. Aus Angst entdeckt zu werden, fotografierte er durch das geschlossene Fenster. Was mag damals wohl in ihm vorgegangen sein?
Einige Jahre später, 1956, ließen sich meine Eltern scheiden. Meine Mutter erhielt das Sorgerecht. Sie ging im Jahr darauf in den Westen, ich blieb bei meinen Großeltern. Die beiden Alten waren immer für mich da, haben mich nie eingeengt und mir Werte vermittelt, typisch preußische, die mir heute noch wichtig sind. Meine Eltern haben auch niemals gegeneinander gehetzt. Sie achteten sich – und gingen sich aus dem Weg.
Dann wurde die Mauer, zu deren Bau noch Tage zuvor niemand die Absicht hatte, trotzdem gebaut. Das war ein schwerer Schlag. Wie sagt heute ein bekannter Fernsehmoderator: „Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft.“
Meine Mutter war nach Westdeutschland, Frankfurt am Main, verzogen. Nachdem Republikflüchtlinge, die vor dem 13. August 1961 die DDR verlassen hatten, amnestiert worden waren, durfte sie uns regelmäßig besuchen. Das waren immer große Ereignisse; freudig die Anreise, tragisch die Abreise. Erste Gedanken, mich „illegal rüber zu holen“ wurden als zu gefährlich verworfen. Parallel dazu lief ein Ausreiseantrag, und noch einer, und noch einer ... Irgendwann war das Unternehmen von Erfolg gekrönt, und das kam so: In dem Haus in dem meine Mutter wohnte, lebte ein Journalist des Hessischen Rundfunks mit seiner Frau. Die beiden hatten zwei Kinder im Osten. Der Mann hatte die Idee, eine Reportage über Eltern im Westen – Kinder im Osten zu machen. Davon erfuhren Behörden der DDR. Der Rest ging recht einfach: Kinder gegen Film. Ich war in diesem Handel sozusagen ein Anhängsel, mit finanzieller Unterstützung des „Ministeriums für Innerdeutsche Angelegenheiten“ (So etwas gab es damals tatsächlich).
Am 17. November 1967, elf Tage vor meinem 14. Geburtstag, reiste ich völlig legal, im Rahmen der Familienzusammenführung, aus.
Der goldene Westen. Es war eine gewaltige Umstellung. Waren vorher meine Großeltern ständig präsent, so war ich mit einem Mal den ganzen Tag allein und auf mich selber gestellt, denn meine Mutter war „Alleinerziehende“ und den ganzen Tag berufstätig. Und dann die neue Welt. Ich erinnere mich noch, dass ich öfter an den Flughafen fuhr, nur um mir die Abflugtafel der Flüge anzuschauen.
Das Warenangebot war erschlagend. Der Nutzen jedoch begrenzt. Gab es in der DDR kaum Waren, aber relativ viel Geld, war das im Westen genau umgekehrt; für uns jedenfalls. Die Grenzen des Wohlstandes zeigten sich.
Aber nach einiger Zeit klappte das, was man wohl Integration nennt. Politisch orientierte ich mich, wie die Meisten in meinem Alter gegen Ende der Sechzigerjahre, links. Die Grenze dieser Einstellung war jedoch scharf: Immer wenn meine Mitstreiter begannen über Marx oder Lenin zu schwadronieren –was ich ohnehin besser konnte als sie, kein Wunder dank der 26. Oberschule in der Ostberliner Straßmannstraße- war diese erreicht. Bis heute habe ich meinen Frieden nicht „mit dem real existierenden Sozialismus“ und seinen Protagonisten gemacht. Das wird wohl auch nichts mehr.
Ich schaffte dann ein leidliches Abitur, eine Lehre als Bankkaufmann, und schließlich eine vorzeigbare berufliche Karriere in der Finanzbranche.
Den Kontakt zu meinem „Ostvater“ nahm ich nach einiger Zeit wieder auf. So wie meine Mutter früher regelmäßig ihren Sohn im Osten besuchte, besuchte ich nun regelmäßig meinen Vater dort. Ich war eben ein richtiges Ost-West-Männchen.
Mein Vater war in den Siebziger- und Achtzigerjahren in der DDR ein recht erfolgreicher Schriftsteller geworden. Nicht in den Sphären von Stefan Heym oder Christa Wolf. Aber er konnte ganz gut davon leben, wie ich beobachtete. Und er hatte Privilegien. Er durfte sogar reisen, so 1986 auf Einladung des Publizisten Armin Mohler, zur Siemensstiftung nach München. Seine Bücher waren schnell verkauft, und von den Schwierigkeiten, die er hatte, bis sie endlich erschienen sind, wusste ich nicht viel.
1987 kam ich berufsbedingt nach Westberlin; unser Kontakt wurde enger.
Am 9. November 1989 meldete sich unser Radiowecker mit dem SFB: „Berliner, macht den Fernseher an, die Mauer ist offen!“ Da hatte das Ost-West-Männchen doch tatsächlich den Mauerfall verpennt.
Die Euphorie war unbeschreiblich, vor allem in Berlin. Je weiter man nach Westen kam, desto mehr nahm diese allerdings ab. 1990 sprach ich mit einem Frankfurter Bankerkollegen, Jahrgang 1950, der sagte mir: „Wissen Sie Herr Schulz. Ich freue mich auch über die schönen Bilder im Fernsehen. Aber eigentlich habe ich keinen Bezug dazu. Meine Sorge ist nur, dass das Ganze verdammt teuer wird.“ Der Mann sollte aus seiner Sicht recht behalten. Die Euphorie wich einer Ernüchterung, die am Ende bei manchen in eine tiefe Ablehnung mündete. Der Besser-Wessi traf auf den Jammer-Ossi. Es gab in dem großen Spiel Gewinner und Verlierer; Gewinner wohl auf beiden Seiten, Verlierer mehr im Osten. Mein Vater gehörte nicht zu den Siegern.
Zwar erschienen noch ein paar Bücher von ihm, weil es noch alte Verträge gab, dann aber stellte ihn der Verlag vor die Frage, ob die noch vorhandenen Bücher entsorgt werden sollen, oder ob er sie abholen möchte.
Als es ihm körperlich und seelisch nicht gut ging, wir schreiben das Jahr 2010, wollte er seinen Nachlass regeln: „Viel habe ich Dir ja nicht zu vererben, aber immerhin die Rechte an meinen Büchern. Die gebe ich Dir jetzt schon. Was Du damit anfangen kannst, musst Du sehen. Es bleibt am Ende immer noch das Literaturarchiv in Marbach.“
Was macht man mit Buchrechten? Logischerweise sucht man einen Verlag; eine für mich komplett andere Welt, denn Bankiers sind anders als Verleger. Nicht besser oder schlechter, aber anders. Allerdings ist der Bankier ehrlicher, denn er gibt zu: Am Ende zählt, was in der Kasse bleibt. Die Welt mögen die anderen verbessern.
Es kam wie es leider kommen musste, wir haben keinen Verlag gefunden. Von einigen erhielten wir Absagen; lapidare zwar, die mir zeigten, dass sie sich die Manuskripte nicht einmal angesehen hatten, aber die haben immerhin reagiert. Die meisten nicht einmal das.
Zwar gab es immer noch die Option mit dem Literaturarchiv. Aber allein das Wort erinnerte mich immer an einen Sketch von dem Berliner Kabarett „Die Stachelschweine“. Darin spielt Wolfgang Gruner den Sachbearbeiter einer Behörde, dessen einzige Aufgabe es ist, Aktennotizen anzufertigen und diese dann eigenhändig ins Archiv zu tragen.
„Wenn wir also keinen Verlag finden, gründen wir eben einen.“ Mein Vater war von der Idee angetan (Später las ich in seinem Tagebuch, das er mir zur Verfügung stellte, dass er durchaus skeptisch an die Sache heranging).
Am 28. November 2012 erfolgte die Gründung des HeRaS Verlages, zunächst als reiner eBook-Verlag, denn für mehr fehlte das Kapital. HeRaS steht für Helmut und Rainer Schulz, eine Idee meiner Frau Claudia. Unser Ziel war, seine Werke vor der Vergessenheit zu bewahren. HeRaS nahm dann eine überraschend positive Entwicklung, allerdings mehr substanziell als materiell. Mein Vater entwickelte Energien, die ich ihm nicht mehr zugetraut hatte: „Wir brauchen mehr Autoren. Ich habe da eine Liste von Kollegen aus alter Zeit. Die spreche ich alle an.“ Das tat er dann auch. Die meisten der Autoren unseres Verlages haben eine ähnliche Entwicklung wie er. Dadurch hat der Verlag ein unverwechselbares Profil (wie ich meine, bei aller Bescheidenheit).
Anlässlich des 85. Geburtstags meines Vaters versuchten wir, bei der Kulturredaktion des rbb eine kurze Sendung über ihn zu erreichen. Daraus wurde leider nichts. Aber der Leiter der Kulturredaktion schrieb: „Eine Sendung über DDR-Autoren, die nach der Wiedervereinigung einen zunehmend schwereren Stand im profitorientierten nunmehr gesamtdeutschen Buchmarkt haben, in der Helmut H. Schulz auch vorkommt, ist eine realistische Idee für eine Sendung.“
Ich weiß nicht, ob diese Sendung jemals zustande kommt. Aber danke dem Herrn trotzdem. Parallel dazu hatte nämlich mein Vater die Idee, ein Buch mit Autorengesprächen zu machen: „Das sind Zeitzeugen, die haben interessante Lebensläufe und alle was zu sagen, das festzuhalten lohnt. Die Chance musst du nutzen und zwar bald, denn die werden alle nicht jünger. Wer wenn nicht du? Außerdem passt das hervorragend zu unserem Verlagsprogramm.“
Da hat er Recht!
Rainer V. Schulz
ZU DIESEM BUCH
Ursula Reinhold, geboren 1938 in Berlin, Fachschule für Bibliothekare, Germanistikstudium, Promotion und Habilitation.
1970-73 Tätigkeit als Redakteurin, 1973 bis 1991 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften der DDR. 1991 bis 1996 Lehrauftrag an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Wissenschaftliche und literaturkritische Veröffentlichungen zur deutschen Literatur seit 1945. Sie hat Sohn und Tochter und sechs Enkel.
Auch das Buch- und Verlagswesen ist in schnelllebiger Zeit von vielfältigen Veränderungen betroffen. Mitunter obwaltet bei Neugründungen der reine Zufall wie bei HeRaS, für dessen Benennung die Namenskürzel von Vater und Sohn, Helmut H. Schulz und Rainer Schulz herhalten müssen. Der Vater, ein in der DDR bekannter und viel gelesener Schriftsteller betraut den Sohn, der nicht vom Fach ist, mit dem Vorlass seines schriftstellerischen Erbes. Ein Koffer voller Manuskripte wurde die Keimzelle für die Neugründung. Zusammen mit seiner Frau Claudia entfaltet der Sohn eine rege Verlagstätigkeit. Dabei wurden aus interessierten Lesern Bücher-Macher, die sich mehr und mehr in die Materie einarbeiteten und nunmehr früheren DDR-Autoren, die im gesamtdeutschen Kontext bisher kaum wahrgenommen wurden, eine verlegerische Plattform bereiten.
In dem vorliegenden Band erhalten diese Autoren eine Stimme. Die Auswahl ist in Bezug auf die DDR-Literatur ganz und gar zufällig. Die Mehrzahl der Autoren gehörte in der Literatur der DDR weder zur ersten Reihe, noch fiel jemand von ihnen durch ausdrückliche Dissidenz auf, daher werden Namen und Werke der hier befragten Autoren im Westen nur wenigen Lesern bekannt geworden sein.
Die hier zu Wort kommenden Autoren lebten und schrieben in der DDR, in der sie bis 1990 den Wirkungsraum ihrer literarischen Arbeit und auch ihre Leser fanden. Mit dem Ende des Staatswesens DDR standen sie nun auch dem grundlegenden Wandel des Verlagswesens gegenüber, mussten sich auf neue Literaturverhältnisse einstellen. Der aus dem Jahre 1995 stammende Beitrag von Martin Weskott „Eine Kultur verlässt den Raum“ führt diese Situation noch einmal eindringlich vor Augen. Auch einige der hier vertretenen Autoren traf das Schicksal, eigene Bücher vernichtet zu sehen. Viele dieser Titel sucht man auch heute in allgemein zugänglichen Bibliotheken vergebens. Ihre Autoren haben weitergeschrieben, andere haben überhaupt erst nach der Wende begonnen, Bücher zu veröffentlichen. Die Publikationen erschienen in Kleinstverlagen, die Schöpfer bezahlten Druckkostenzuschüsse. Der Zugang zu größeren Verlagen gelingt nicht. Christoph Links beschreibt sachkundig die neuen Bedingungen unter denen die früheren DDR-Verlage standen, als sie nach der Vereinigung der Dominanz des westdeutschen Buchmarktes ausgesetzt waren. Er rekonstruiert die Voraussetzungen unter denen einige weiterarbeiten konnten, vermittelt wie sich neue, auf bestimmte Sachgebiete spezialisierte Verlage gründeten, die dazu beitrugen, dass auch im Osten weiterhin Bücher produziert werden konnten.
Die Lebensdaten derer, die hier über sich selbst Auskunft geben, umfassen mehrere Generationen und umschreiben so einen weiten historischen Bogen. Er reicht von Emil Rudolf Greulich (Pseud. Erge), Jahrgang 1909, für den es hier einen Nachruf gibt, bis zu Beate Morgenstern, Jahrgang 1946, die jüngste der hier versammelten Schriftsteller. Sie debütierte 1979 mit Geschichten über den Alltag in der DDR und gab mit dem Romanerstling „Nest im Kopf (1988) die Probe ihres bedeutenden Erzähltalents, das allerdings in den Wirren der Wendejahre wenig Beachtung fand. Sie hat inzwischen ein vielgestaltiges Romanwerk vorgelegt, das in mehreren kleinen Verlagen ediert wurde.
Obwohl biographische Prägungen, soziale Haltungen und Erkenntnisse, künstlerische Inspirationen auch die Erfahrungen in der DDR-Literaturgesellschaft sehr unterschiedlich waren und sind, gibt es für die hier zu Wort kommenden Autoren doch eine Übereinstimmung mit der in der DDR-Gesellschaft allgemein akzeptierten Prämisse, dass die Literatur eine wesentliche gesellschaftliche Funktion innehat. Dabei würden direkte Nachfragen nach Motiv und Sinn eigener Arbeit von jedem Schreibenden auf spezielle Weise beantwortet werden und ein weitgefächertes Feld von Schreibmotivation zu Tage befördern. Manchem Werk ist die Absicht eingeschrieben, Zeugnis abzulegen über Erlebtes und Erlittenes im Wandel der Zeiten. Andere Autoren sind darauf aus, sich schreibend selbst zu vergewissern, sich ihrer Prägungen bewusst zu werden, wollen Verständigung über individuelle Verhaltensweisen und Lebensformen anregen oder wollen Lebenshilfe geben. Erwartungen direkter öffentlicher Einflussnahme auf politisches Geschehen wären dagegen sicherlich seltener anzutreffen, ebenso haben sich Vorstellungen von unmittelbar erzieherischer Wirkung verflüchtigt.
Ein auf humanistische Wirkungen gerichtetes Literaturverständnis ergab sich aus der notwendigen Neubesinnung nach Faschismus und Krieg, denn die 12 Jahre Faschismus hatten nicht nur in materieller Hinsicht ein verheertes Land, sondern auch ein demoralisiertes Volk zurückgelassen. Zunächst waren es die Klassiker und die Werke der Autoren, die ins Exil hatten gehen müssen, die nun veröffentlicht wurden und ihre Leser fanden. Die aus dem Exil in den Osten zurückgekehrten Autoren (Becher, Brecht, Seghers, Hermlin, Renn, u.a.) wurden oftmals zu Lehrmeistern für die Jungen. Über die gesamte Geschichte der DDR blieb diese Überzeugung von der wesentlichen Rolle der neu entstehenden Literatur für die Formung humaner Werte und für die Herausbildung neuer, gesellschaftlicher Verhältnisse unangefochten bestehen. Allerdings modifizierten und wandelten sich unter den geschichtlichen Verläufen der Jahrzehnte die Erwartungen an sie und ihre konkreten Möglichkeiten beträchtlich. Überwogen zunächst direkt erzieherische, auch operativ-politische Vorstellungen von literarischer Wirkung, differenzierten sich seit den Siebzigerjahren diese Ansichten zunehmend. Der lebendige Literaturprozess wurde differenzierter, Autoren und Literaturvermittler schufen und suchten spezifischere Wirkungsmechanismen zu ermitteln und ihnen gerecht zu werden. Daraus ergaben sich vielfältige Spannungsfelder. Ein wesentlicher Diskussionspunkt blieb die Frage nach der kritischen Funktion von Literatur, eine Frage, die von Funktionären selbstverständlich anders beantwortet wurde als von den Schriftstellern und ihren Lesern. Dieses zunehmend kritische Element gegenüber den einengenden Verhältnissen in der DDR ließ die Literatur im letzten Jahrzehnt in vielerlei Hinsicht zum Symptom für den erkennbaren gesellschaftlichen Niedergang der DDR Gesellschaft werden. Zunehmend gab es Befunde, in denen das Auseinanderfallen von emanzipatorischem Anspruch und den alltäglichen Realitäten des Lebens zu Tage trat.
Die Ansichten darüber, wie Literatur wirken soll oder kann, differierten im Einzelnen ganz beträchtlich. Konflikte ergaben sich im Spannungsfeld zwischen dem, was Funktionäre der Staats- und Parteiführung von den Schreibenden erwarteten und dem, was individuell erlebt und als künstlerischer Ausdruck seinen Niederschlag gefunden hatte. Über familiäre und soziale Prägungen, über Schreibmotivationen, über Erfahrungen beim Schreiben und im Literaturbetrieb, über die Art und Folge von Eingriffen und Behinderungen geben die Gespräche reichhaltige Aufschlüsse. Dabei wird deutlich, wie sich die literarischen Verhältnisse und der Umgang mit Literatur über die Jahrzehnte gewandelt hat, obwohl die Organisationsform des literarischen Lebens bis zum Ende der DDR beibehalten wurde.
In den Gesprächen ist mehrfach die Rede von Zensur. Allerdings hat es eine ausdrückliche Zensur, mit der sich der Gesetzgeber festgelegt hätte, nicht gegeben. Dennoch, die Produktion eines jeden Buches, das öffentlich werden sollte, stand unter institutioneller Aufsicht. Dieses System erwies sich als die Kehrseite hoher gesellschaftlicher Wertschätzung, die der Literatur eine bildende, ja erziehende Funktion für den Aufbau einer neuen sozialistischen Gesellschaft zuschrieb. Die Lektorate der Verlage arbeiteten meistens intensiv mit den Autoren an der gestalterischen und sprachlichen Präzisierung der Manuskripte. Sie bildeten die unterste Ebene, die mit Gutachten der Genehmigungsbehörde der Hauptverwaltung Verlage im Ministerium für Kultur zuarbeitete, um eine Druckgenehmigung für die Veröffentlichung des betreffenden Buches zu bekommen. Darüber hinaus konnte es Einsprüche von Parteifunktionären verschiedener Ebenen geben. Es gab unausgesprochene Tabus: man denke an die Veröffentlichungsgeschichte von Erwin Strittmatters „Wundertäter“, in dem er eine durchaus von vielen Frauen erlebte Erfahrung zur Sprache brachte, nämlich die folgenreiche Vergewaltigung durch einen Angehörigen der sowjetischen Armee. Auch die Realität der Mauer und die Konflikte, die sich aus ihrer Existenz ergaben, blieben ein Tabuthema.
Das System der Förderung junger Autoren ist Ausdruck für die hohe Wertschätzung von Literatur und ihren Schöpfern. Es reichte von den Arbeitsgemeinschaften junger Autoren, die der DDR Schriftstellerverband auf verschiedenen Ebenen eingerichtet hatte, über die Unterstützung begabter Autoren durch Stipendien und Verlagsvorschüsse bis zum möglichen Studienplatz am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Alle in diesem Buch zu Wort kommenden Autoren haben an solcher Fördermaßnahmen partizipiert und dabei auch zumutende Grenzerfahrungen gemacht.
Emil Rudolf Greulichs Prägungen und Schreibimpulse waren durch die sozialen und politischen Verhältnisse der Weimarer Republik bestimmt. Aus sozialdemokratischer Familie kommend, schloss sich der Sohn der KPD an, kämpfte gegen das Nazi-Regime, wofür er mehrere Jahre im Zuchthaus saß. Als Schriftsetzer von früh an auch kulturell interessiert, begann er selbst zu schreiben, erlebte als junger Mann um 1930 Sitzungen des BPRS (Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller), in denen Johannes R. Becher, Ludwig Renn u.a. bekannte Größen der sozialistischen Literaturbewegung das Wort ergriffen. Sein literarisches Debüt erfolgte aber erst spät, nachdem er aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Im Osten Deutschlands, der entstehenden DDR sah er für sich das Feld literarischen und politischen Wirkens. Er schrieb Abenteuerbücher für die Jugend, wollte so der westdeutschen Schundliteratur begegnen. Mit historischen Biografien über die Widerstandskämpfer Artur Becker und Anton Saefkow und mit dem Roman über eine Episode im Leben von Karl Liebknecht stellte er sein Schreiben in den Dienst aufklärender Geschichtsbetrachtung. In seinem erst spät erschienenen zweibändigen Romanwerk „Des Kaisers Waisenknabe“ und „Des Kaisers Waisenknaben Sturm und Drang“ verarbeitet er die prägenden Einflüsse seiner proletarischen Herkunft und Entwicklung in den Jahren vor und nach dem 1. Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik. Er dokumentiert hier Berlin-Geschichte aus der Perspektive proletarischer Existenz, erzählt von Wohnungsnot und genossenschaftlichem Siedlungsbau im Südosten der Stadt, von Hungerjahren und von der ersten weltlichen Schule in Adlershof. Anschaulich und humorvoll berichtet er von Lehr- und Arbeitsverhältnissen junger Leute, von ihren selbstorganisierten Freizeitfreuden beim Sport und beim Wandern, lässt so ihr Denken und Fühlen lebendig werden. Dem Erzähler gelingt hier ein differenziertes Bild von den unterschiedlichen politischen Vorstellungen und Wegen der Arbeiterjugend, worin sich nicht zuletzt auch die Uneinigkeit der Arbeiterbewegung spiegelt, die der Machtergreifung der Faschisten im Jahr 1933 nichts entgegenzusetzen hatte. In dem authentischen Erlebnisbericht „Zum Heldentod begnadigt“ legt Greulich Zeugnis ab über den Kriegseinsatz im Strafbataillon 999, zu dem er nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe gezwungen wurde. In der Nähe von Tunis ging er freiwillig in amerikanische Kriegsgefangenschaft, wo er umgehend diesen Bericht niederlegt. Er war dort an der Herausgabe der legendären Gefangenenzeitschrift „Der Ruf“ beteiligt und begegnete seinem Freund Walter Hoffmann wieder, mit dem er gemeinsam Sitzungen des BPRS besucht hatte. Der Freund war bereits mit Geschichten in der KP Zeitung „Rote Fahne“ hervorgetreten. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft wird Walter Hoffmann in München unter dem Namen Walter Kolbenhoff zum Mitbegründer der „Gruppe 47“, einer literarischen Institution, die über Jahrzehnte hinweg den Literaturbetrieb im Westen Deutschlands maßgeblich bestimmte. In dem Roman „Amerikanische Odyssee“ verarbeitet Greulich seine Erfahrungen in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft.
Die Tätigkeiten von Helga und Erhard Scherner bewegten sich im Grenzbereich zwischen Literatur und Kulturpolitik, zwischen historischer Wissenschaft und dem Schreiben über eigene Erfahrungen. Gemeinsamer Arbeit verdanken sich Publikationen, in denen Zeugnisse altchinesischer Dichtung und Philosophie zugänglich gemacht werden. Hierzu gehören u.a. die Gedichte von „Du Fu: Anblick eines Frühlings“, Ho Chi Minhs Gefängnistagebuch und Gedichte. Für beider Lebenswege (Jg.1929) sind die Erfahrungen von Krieg und Nachkrieg prägend. Durch sie und die neuen Bildungsmöglichkeiten, die sich mit dem Besuch der Arbeiter- und Bauernfakultät, dem Studium der Sinologie und der Germanistik eröffnen, bildete sich eine intensive Bindung an die gesellschaftlichen Strukturen, die im Osten Deutschland entstanden. Mit ihren Nachdichtungen, wissenschaftlichen und erzählerischen Publikationen weiteten sie den Blick über die DDR Provinz hinaus. Erhard Scherner hat dem Lebensgefühl großer Erwartung und allmählicher Ernüchterung in Gedichten Ausdruck verliehen. In späten Erzählungen verarbeitete er mannigfache Ansichten aus China, sein Alter Ego, Konstantin Mugele, schaut distanzierend auf die naive Perspektive von früher Erlebtem.
Hans Müncheberg (Jg. 1929) und Helmut H. Schulz (1931) teilen die frühe Prägung durch die militärische Erziehung an einer Napola (Nationalpolitische Erziehungsanstalt) und deren Elitevorstellungen. Dabei ist aufschlussreich, dass sie beim Schreiben erst in späteren Lebensabschnitten auf diese frühen Erfahrungen zurückkommen. Während H.H. Schulz zunächst mit Romanen („Jahre mit Camilla“, „Der Springer“, „Abschied vom Kietz) und mit Erzählungen („Alltag im Paradies“) Stoffe aus der unmittelbaren Gegenwart aufnahm, war Hans Müncheberg als Dramaturg und Autor vor allem mit literarischen Adaptionen für Hörfunk und Fernsehen beschäftigt. Aber auch die Unterschiedlichkeit des Umgangs mit dem prägenden Grunderlebnis fällt ins Auge, das sie von früheren Arbeiten anderer DDR-Autoren am vergleichbaren Stoff unterscheidet. Es gibt keine schnelle Wandlung in ihren Büchern. Hans Müncheberg spannt in seinem Roman „Gelobt sei, was hart macht. Aus dem Leben eines Zöglings der Napola Potsdam“ den historischen Bogen von 1939 bis ins Jahr 1952. Er erzählt in drei Handlungsfäden die Geschichte von Fritz Berger, der als Zehnjähriger in eine NS-Eliteerziehung kommt, das Lagerleben zunächst als mentale Zumutung empfindet und dennoch als willfähriger Gefolgsmann bis zum bitteren Ende auf Hitlers Sieg hofft. Es gelingt eine differenzierte, einfühlsame Nachzeichnung seines Schicksals. Treffend wird der Zerfall des kleinbürgerlichen Milieus der elterlichen Familie und der Verlust heimatlicher Bindungskraft als grundlegende Voraussetzung für den Willen zur Selbstbehauptung in der militärisch - hierarchischen Ordnung der Anstalt erfasst. So entwickelt sich bei dem Jungen ein wachsendes Zugehörigkeitsgefühl, das seine innere Zurichtung zur Folge hat. Er verfällt widerstandslos dem Einfluss rassistischen Elitedenkens und dem Mythos von Heldentum und Kameradschaft, kämpft bis zum bitteren Ende, das er schwer verwundet überlebt. Die authentische Erlebnisebene hinterlässt den intensivsten Leseeindruck. Sie ist verknüpft mit einem zweiten Handlungsfaden, der mit der Rückschau auf das Jahr 1952 einsetzt und von der Frage nach eigener Mitschuld ausgelöst wird. Beim Bewerbungsgespräch in einem Kinderfilmstudio wird der junge Mann mit der Aussage konfrontiert, dass solche, wie er, bei Kriegsende erschossen gehörten. Ein dritter Handlungsfaden setzt mit dem Ende des Krieges ein und erzählt von ersten schwierigen Schritten ins neue Leben.
Auch in Erzählungen erweist sich Münchebergs Talent einfühlsam die komplizierten Wirrnisse im Leben von Jugendlichen nachzuzeichnen.
Helmut H. Schulz geht in den Siebzigerjahren in Erzählungen („Das Leben und das Sterben“ 1975, „Die Festung - die Stadt“ 1975, „Die Gesichte der Blinden“ 1975, „Metamorphosen der Aphrodite“ 1975, (2013) auf Begebenheiten in den letzten Kriegstagen zurück. Die Erzählungen umfassen zeitlich die Monate vom Beginn des Endkampfes um Berlin mit dem Überschreiten der Oder durch die Sowjetischen Truppen und reichen bis zum Beginn der alliierten Kontrolle über die Stadt. Schicksale von Menschen, die nach Gründen fürs Weiterleben suchen, Orientierungsnot von Jugendlichen, die es nicht schaffen, indoktrinierte Glaubenssätze zu verabschieden, sind so gestaltet, dass sie zu existenziellen Gleichnissen werden. In dem Roman „Dame in weiß“ setzt sich der Autor mit den sozialen und mentalen Implikationen eines kleinbürgerlichen, von NS Vorstellungen geprägten Familienmilieus auseinander. Hier verdrängt der familiäre Überlebenskampf der Nachkriegszeit die Bereitschaft zur kritischen Verarbeitung des Erlebten. Die Napola-Erfahrung des Heranwachsenden bildet einen rückschauenden Faden des Handlungsgeflechts. Seinem Bedürfnis nach rückschauender Bilanz verweigert sich das familiäre Umfeld. Das erzählerische Gesamtwerk von Schulz zeichnet sich durch eine breite Palette von Stoffen und Themen aus. In „Das Erbe“ verarbeitet er die Schicksale von drei Generationen einer Architektenfamilie. In Arbeit und Leben der Baumeister spiegeln sich nicht nur Zeitschicksale, sondern es werden baugeschichtliche Traditionen für die aktuellen Fragen des Wohnungsbaues in der DDR der Achtzigerjahre betrachtet. Mit satirischer Vehemenz zeichnet er in „Jakob Ponte. Eine Deutsche Biografie“ die chamäleonhafte Anpassung intellektueller Opportunisten in der DDR nach, denen auch der neueste Umbruch zustatten kommt. Der Roman ist ein farcenhafter Abgesang auf den Zeitgeist, in der DDR und in der Zeit danach. Treffende Porträts gelingen Schulz auch in einer Reihe historischer Biographien. Mit „Briefe aus dem Grand-Hotel“ verwies er schon bald nach der Vereinigung illusionslos und sarkastisch auf die Perspektiven des restaurativen Kapitalismus. Vier Einzelschicksale aus dem Berliner Umland vor dem Hintergrund der Wende erzählt er in dem Band „Der Weg des Ritters“.
Für die Lebensumstände und die Sozialisationen der später geborenen Autoren (Chr. Müller 1936, Peter Gosse 1938, Gunter Preuß 1940, Fritz Leverenz 1941,) spielen die Umstände und Möglichkeiten in der DDR der Fünfziger- und Sechzigerjahre eine entscheidende Rolle. Ihre Schreibimpulse ergeben sich aus diesen Umständen, ihre literarischen Vorstellungen sind davon geformt und ihre Wege als Autoren von den Förderungen, die sie erfahren haben, mitbestimmt. Dabei ergeben sich entscheidende Unterschiede aus dem zeitlichen Beginn ihres Debüts. So war für Peter Gosse vom Beginn seines Schreibens an wesentlich, dass er als Absolvent eines Studiums für Hochfrequenztechnik in Moskau und in späterer Tätigkeit als Diplomingenieur in der Radarindustrie und in der Forschung, Technisch-Naturwissenschaftliches mit moralisch-geistigen Fragestellungen verbunden hat. Er beginnt mit operativen Reportagen über junge Leute in der UdSSR, „Antennendiagramme“ (1967), aus denen große Vertrautheit mit der Physiognomie junger Wissenschaftler in der Sowjetunion spricht. Auch in seinem Beitrag für den Band über den Aufbau von Halle-Neustadt „Städte machen Leute“ (1969), den er zusammen mit Jan Koplowitz, H.J. Steinmann, W. Bräunlich herausgab, geht es ihm um den Zusammenhang von kollektiv organisierten baulich-technischen Prozessen und den gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Leben des Einzelnen. Die zahlreichen Reportagebände, die in diesen Jahren erschienen, sind ein Ergebnis und Beleg dafür, dass von vielen Autoren die Arbeitswelt in der materiellen Produktion in ihrer Rückwirkung auf das gesellschaftliche und individuelle Leben als künstlerischer Stoff aufgenommen und verarbeitet wurde. Damit nahmen sie Fragestellungen des Bitterfelder Weges auf, dessen Anliegen einerseits darin bestand, Arbeiter mit der Sphäre der Kunst in Berührung zu bringen. Andererseits wollte man die Literatur- und Kunstschaffenden enger mit den Vorgängen in der materiellen Produktion verbinden, in der Hoffnung, sie würden die Gestalt von Arbeitern und deren Tätigkeiten als Stoff für künstlerische Auseinandersetzungen entdecken. Dass die Ergebnisse oft nicht so waren, wie sich die Funktionäre das Bild des Arbeiters vorstellten, lässt u.a. das Schicksal von Werner Bräunig (1934-1976) mit seinem Roman „Rummelplatz“ erkennen, dessen Werk unvollendet blieb und erst 1995 aus dem Nachlass veröffentlicht wurde. Während das Erzählwerk von Wolfgang Hilbig unter Beweis stellt welch große ästhetische Produktivität dem Sujet Arbeitswelt innewohnen kann.
Peter Gosse begann mit Gedichten in denen Technik und Kunst in programmatischem Zusammenhang steht. Die lyrische Sprache kreist um Alltagsdinge, die er in einen epochalen Zusammenhang stellt („Antiherbstzeitloses“, 1968). Später entwickelt er, geschult an der Poetik Georg Maurers, in dessen Umkreis er am Literaturinstitut in Leipzig seit 1971 Lehrtätigkeit ausübte, sein poetisches Modell an großen philosophischen Fragestellungen, in die er intimes Erlebnis und Politisches zusammenbringt. („Ausfahrt aus Byzanz“ 1982). Die Bildsprache ist anfangs recht technikaffin, während sich später, in den Achtzigerjahren in den Gedichten zivilisationskritische Bilder finden, in denen sich der DDR-Abstieg spiegelt. In Essaybänden erörtert er philosophisch-ästhetische Fragestellungen, die vom eigenen Schreibantrieb ausgehen. Auch weckt er Interesse für Kunstwerke und sucht so des Lesers Erlebnis- und Denkfähigkeit zu entwickeln. In späteren Gedichten verarbeitet er den gesellschaftlichen Wandel nach dem Ende der DDR, Liebe und Kunsterfahrung werden intensiver thematisiert. „Stabile Saitenlage. Die Liebesgeschichten“ (2007) versammeln Prosa Miniaturen, in denen Augenblicke der Liebe, der zärtlichen Annäherung, wie der erfüllten Sehnsucht, aber auch des Abschieds und des Treuebruchs so gestaltet werden, dass beim Leser der Eindruck entsteht, diese Augenblicke bleiben fürs Empfinden der Beteiligten unauslöschlich. Sprachliche Originalität macht sie zu Momenten der Daseinsfeier. Impressionen von Orten, Umrisse von landschaftlichen Horizonten, floristische Details, tragen zum unverwechselbaren Kolorit bei. In Anhängen vermittelt der Autor Anekdoten. In überlieferten und erlebten Begebenheiten aus sowjetisch/russischem Horizont und aus Leipziger Umkreis scheinen im Erlebten Erwartungen und Ernüchterungen, aber vor allem Widersinnigkeiten auf.
Für Christa Müller blieb das eigene Schreiben der Tätigkeit in der Film- bzw. Fernsehdramaturgie zugeordnet. Dennoch veröffentlichte sie seit den Siebzigerjahren Gedichte in Zeitungen und Anthologien. Mit ihren Erzählungen „Vertreibung aus dem Paradies“ (1979) und „Tochter“ (1987) steht sie im Strome vielfältigen literarischen Ausdrucks von Frauen, die differenzierte Auskünfte über ihr Leben in der DDR geben und sensibel das Spannungsverhältnis zwischen selbstverständlich ausgeübter, gleichberechtigter Berufstätigkeit und alltäglicher Überforderung ausloten. Mit dem Roman „Tango ohne Männer“ (1998), im Untertitel „Roman meiner Mutter“ vergegenwärtigt sie ein Generationsschicksal, schildert in szenisch aufgebauten dialogisch bestimmten Episoden suggestiv den Überlebenskampf von Frauen, die ihre Kinder und sich selbst durch die schweren Jahre des Krieges und der Nachkriegszeit bringen mussten. Die Männer vom Krieg verschlungen, blieben sie auf sich gestellt. In „Die Verwandlung der Liebe“ erzählt die Autorin einfühlsam von einer Mutter-Sohn Beziehung.
Gunter Preuß hat neben Tätigkeiten im Fernmeldebereich früh schon geschrieben, wurde dabei gefördert und konnte ein vierjähriges Studium an Literaturinstitut in Leipzig absolvieren, wo er seit 1986 Oberassistent für Prosa wurde. Die in den Bänden „Grasnelke“ (1973) und „Die großen bunten Wiesen“ (1976) zusammengestellten Geschichten sind charakteristisch für sein Schreiben in dieser Zeit. Es sind Geschichten über den Alltag einfacher Leute, die in vielfältigen erzählerischen Formen vermittelt werden. Der westdeutsche Leser kann viele Details über alltägliches Leben in der DDR erfahren, auch über die Selbstverständlichkeit mit der gelebt wurde. In erzählerischen Momentaufnahmen vergegenwärtigt der Autor individuelle Entscheidungssituationen, die sich in Konflikten bei der Arbeit ergeben. Ein Tagebuch wird zum Austragungsort familiären Widerstreits zwischen gleichberechtigten Partnern, bei denen es um Beruf und Liebe geht, um die beruflichen und familiären Interessen von beiden. Er gestaltet Konflikte, die aus Fremdheit und Ignoranz erwachsen, schildert wie aus Misstrauen zwischen den Jungen und den Alten Vertrauen erwachsen kann. Preuß erzählt über junge Menschen in Bewährungssituationen, über erste Liebe u.v.a.m.
Auch Romane gestalten Selbstfindungsgeschichten und beschäftigen sich mit Fragen der Lebensbewältigung oftmals an autobiographischen Stoffen. Er bevorzugt in den Geschichten Figuren, die sich ihren Lebensproblemen aktiv stellen und sie zu lösen suchen. Sie engagieren sich im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld. Eine Akzentverschiebung bringt der Beitrag „Die großen bunten Wiesen“, den die Herausgeber des Reclam Verlages in die Anthologie „Jetzt“ (1986) aufgenommen haben. Diese Sammlung enthält 50 Geschichten vom Alltag, die in der Zeit seit Beginn der Siebzigerjahre entstanden sind. Sie galten damals als symptomatisch für die Hinwendung der Schriftsteller zur alltäglichen Realität des individuellen und gesellschaftlichen Lebens. Preuss Geschichte hält eine momentane Situation fest, in der ein Mann namens Rosbigalle erlebt, wie die eingefahrenen Muster seiner alltäglichen Abläufe ins Wanken geraten und eine sehnsuchtsvolle irritierende Unruhe hinterlassen.
Die Kinder- und Jugendbücher von Preuß zeichnen sich durch eine einfühlsame Nachzeichnung der Konflikte in der Sozialisation Jugendlicher aus. Die Erzählung „Frau Butzmann und ihre Söhne“ (1987) ist reich an Zwischentönen, hier reflektiert eine alternde Frau über ihre Lebenshaltung und über das Verhältnis zu ihren Söhnen. Detailliert werden Konfliktlinien nachgezeichnet und nach eigenen Unterlassungen gefragt. In dem Roman „Gewalt des Sommers“ (2011) nehmen die Konflikte eines vierzehnjährigen Jungen vor dem Hintergrund deutscher Geschichte einen tragischen Ausgang.
Fritz Leverenz (Jg. 1941) ist in den Achtzigerjahren zunächst vor allem mit Kinderhörspielen, mit „Skizzen aus der Eisengießerei“ und mit reportagehaften Schilderungen von der Erdgastrasse hervorgetreten. Dabei stieß er schnell auf die Kluft zwischen dem Erlebten und dem, was der Verlag bereit war von seinen Berichten zu akzeptieren und zu drucken. Über derlei Einsprüche und Einschränkungen gibt er ausführlich Auskunft. In welchem Maße er die Spaltung und Teilung Berlins als Trauma erlebt hat, können wir erst aus den nach 1990 gedruckten Veröffentlichungen entnehmen. Es ist eine Art nachgetragener Dissidenz, die den Erzählungen des Bandes „Du hoffst und ich gehe“ (2014) zugrunde liegt. „Du hoffst und ich gehe“ sagt der Sohn, der sich von den Eltern verabschiedet, er wird die DDR über Ungarn verlassen. In den gesammelten Geschichten scheinen in unterschiedlichen Situationen die individuellen Folgen deutscher Teilung auf. Sie finden hier vor allem im Schicksal der durch eine Mauer getrennten Berliner ihren Ausdruck. Leverenz erzählt aus der Perspektive von Ostberlinern, die an der Eingeschlossenheit leiden, der bürokratischen Willkür ihres Staatswesens ausgesetzt sind und für die der Weggang von Verwandten, Freunden und Bekannten eine schmerzhafte Lücke reißt. Beschädigungen ihres Selbstwertgefühls waren die Folge, zugleich wuchsen die Erwartungen an das, was ihnen auf der anderen Seite der Mauer begegnen würde. Ernüchterung nach kurzer Euphorie stellte sich ein, Leverenz schildert sie in treffenden Episoden. In der großen Erzählung „Der Kuckuck lebt noch“ (2016) ist es die Perspektive des heranwachsenden Berliner Jungen Willi, der die Übersiedelung der Eltern von Ost nach Westberlin erlebt und aus der Rückschau des fast Erwachsenen darüber erzählt. In seiner Sicht spiegelt sich die Situation der auf Ausreise wartenden Eltern, er erlebt sie als zerstreut, abgehoben und mit sich selbst beschäftigt. Auch sein Ankommen in der Westberliner Fremde bringt ernüchternde Erlebnisse. Erst die Ereignisse der Maueröffnung und das Verschwinden des Grenzregimes bringt für ihn die Wiederbegegnung mit der Freundin und den Orten der Kindheit. Der Autor dokumentiert detailreich und präzis diese Vorgänge. Die Erzählperspektive des Jungen ermöglicht eine insgesamt heitere Sicht auf das Geschehen.
Beate Morgensterns wuchs in einer Pastorenfamilie pietistischer Prägung zunächst in der Lausitz, später in einem Dorf im Mansfelder Raum auf und hat in ihrem Romanerstling auf die sehr speziellen Prägungen im Milieu der Brüdergemeine zurückgegriffen, die sie in den ersten Nachkriegsjahrzehnten der DDR-Geschichte erlebt hat. Vom Beginn ihres Schreibens an hat sie fördernde Anteilnahme in der DDR gefunden. In den fast drei Jahrzehnten seit der deutschen Einheit hat sie inzwischen ein beachtliches erzählerisches Werk vorgelegt. Da die Romane in Kleinverlagen erschienen sind, wurden sie durch die Literaturkritik großer überregionaler Zeitungen bisher nicht wahrgenommen. Christel Berger rezensierte im „Neuen Deutschland“, der sozialistischen Tageszeitung, regelmäßig die neuen Bücher der Autorin. Vom eigenen intensiven Leseeindruck ausgehend, informiert sie über Themen, Stoffe und Erzählformen, macht neugierig, regt zum Lesen an. Beate Morgensterns Romanschaffen zeichnet sich nicht nur durch vielfältige Stoffe und Themen, sondern auch durch kompositorische und stilistische Experimentierfreude und eine sinnlich reiche, mitunter auch satirisch-humoristische Fabulierkunst aus. In „Küsse für Butzemännchen“ (1995) erzählt sie über die Kindheit von Susanne Burkard, im sächsischen Leuba „Burkards-Nannen“ gerufen. Sie wächst hier bei der Betreiberin eines Ladens auf, die das Kind im Unklaren über seine Herkunft belässt. Diese Ungewissheit und die Vaterlosigkeit machen sie zur Außenseiterin. Der Vater an der Front, sie erlebt ihn an Urlaubstagen, Grüße am Ende seiner Briefe gelten ihr. Er kehrt aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück, wird denunziert, abgeholt und verschwindet in einem Lager. Erst 1990 gibt es genauere Informationen über sein Schicksal. Diese Situation bildet den Ausgangspunkt des Erzählens, leitet das Erinnern ein, das mit der Todesnachricht endet.
Über dem ungewissen Schicksal von Menschen, die, schuldig oder auch nicht, durch die Besatzungsmacht interniert worden waren, in Lagern verschwanden, lag zu DDR Zeiten ein Tabu. Die Autorin schafft es erzählerisch, den Vorgang so in den historisch detailreich rekonstruierten Zusammenhang zu stellen, dass keine Revision historischer deutscher Schuld dabei herauskommt. Sie erzählt vom Erleben des Mädchens, das allein mit der Mutter, den abwesenden Vater schmerzlich vermisst. Interesse und Kraft der Mutter ist darauf gerichtet, einen geerbten Kaufmannsladen zu betreiben. Sie ist unausgeglichen und prügelt das Kind, das sich als nirgendwo zugehörig fühlt, Anschluss an eine Kinderbande findet, deren erfindungsreiche Streifzüge zur Lebensmittelbeschaffung beinahe tödlich hätten ausgehen können. Die Erzählerin entfaltet ein reiches Panorama menschlicher Verhaltensweisen in Kriegs-und Nachkriegsjahren, im Horizont des Kindes wird vom Sterben und vom Überleben, vom Organisieren und Tauschen, von egoistischer Gier, von gekaufter oder erzwungener Lust, von Brutalität und Rücksichtlosigkeit gegen andere erzählt. Das Kind erlebt unabweisbar, dass viele Leute nur das eigene Interesse im Auge haben. Lesen und die Begegnung mit Menschen, die anderes wollen, lassen in ihr die Sehnsucht nach einer gerechteren Welt entstehen, obwohl auch Vertreter der neu entstehenden Ordnung nicht ohne die alten Gebrechen, Egoismus und Dummheit sind. Susanne wird aktiv, als Junger Pionier regt sie auch andere Kinder zu Hilfsdiensten für Alte und Gebrechliche an. Der Autorin gelingen treffliche Porträts in einem präzis erfassten Milieu, in denen die sozialen und mentalen Gegebenheiten sächsischen Provinzlebens lebendig werden. Dazu trägt die sächsische Sprachfärbung der Dialoge ebenso bei wie die bildhaften Schilderungen der Auenlandschaft, die sich am Rande des Erzgebirges erstreckt. Voraussetzungen für intensiven Lektüreeindruck.
Acht Jahre später erscheint mit „Villa am Griebnitzsee“ (2008) eine Fortführung der Lebensgeschichte von Susanne Burkard. Hier lässt sie die Protagonistin direkt in Ich-Form erzählen. Der Lebensrückblick erfolgt zur Wendezeit. Die inzwischen invalide Frau berichtet einem Zivi, der mit zunehmendem Interesse dazu beiträgt, dass sich wieder ihre Lebensgeister regen. So erzählt sie über ihre Studienjahre, die sie 1959-63 an der Babelsberger Filmhochschule verbracht hat. Mit der Annahme zum Studium erfüllte sich für sie damals ein Traum. Hier konnte sie ihrer Filmleidenschaft frönen, lernte Analysieren und Diskutieren, hatte nachhaltige Begegnungen, erlebte Freundschaften und Geselligkeiten, aber auch Verrat und Maßregelungen. Es war eine Zeit intensivsten Lebens, voller Erwartung war sie auf das, was kommen würde. Aber sie erlebte nie wieder so erfüllte Jahre, später machte ihre Arbeit sie krank und depressiv, die rückschauende Lebensbilanz fällt bitter aus. Gegenüber der romanhaften Gestaltung des Kindheitsstoffes dokumentiert dieses Buch den fortführenden Lebensstoff als Bericht aus der Perspektive der Betroffenen. Dem Lebensbericht sind erzählte Szenen aus Filmen berühmter Regisseure eingefügt.
Die vielseitige Erzählerin greift ins volle Menschenleben, kennt keine Tabus und hat die Fähigkeit, sich in sehr unterschiedlichen Genres zu bewegen. Auch für Geschichten über Liebe und Mord findet sie angemessene literarische Formen. Jüngst hat sie mit „Eine Frau schon in den Jahren“ einen Band mit Kriminalgeschichten vorgelegt. In „Lieber Liebe“ erzählt sie lakonisch, in leichter, ironischer Färbung die Höhen und Tiefen in einem Dreiecksverhältnis, in dem die freischaffende Künstlerin Lena viel Lust, Liebe und Leidenschaft, aber auch Einsamkeit und Demütigung erlebt. „Tarantella“ ist der Liebesroman einer Lesbe, die ihren Ehemann verlässt und auf der Suche nach der Einzigen ist. Mit humorvoller Distanz wird über verschiedene Lebenssituationen erzählt, auch über Ansprüche und Ansichten der wechselnden Partnerinnen erfährt der Leser manches. Mit Galgenhumor wird über die sich nach der Wende eröffnenden kommerziellen Möglichkeiten spekuliert, die sich als Lösung ihres Problems anbieten.
Der Roman „Huckepack“(1995) vermittelt die Tragödie einer durch Krankheit und Sucht bestimmten Ehegeschichte. Es gelingt ihr auch hier, die im gesellschaftlich sozialen Leben mit den im mentalen und psychischen Bereich liegenden Gründe für die Suchtentwicklung im Handeln ihrer Protagonisten zu verbinden und ihr unauflösbares Zusammenwirken zu verdeutlichen.
Für „Nachrichten aus dem Garten Eden“ (2007) und „Der Gewaltige Herr Natasjan“ (2008) bildet die Wende den Ausgangspunkt für zwei Romane, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Fritz Luther, ein Bauer aus dem Harzer Dorf Sylken erzählt einem früheren Schulfreund über sein Leben im Garten Eden. Der Freund hatte mit den Eltern die DDR verlassen und meldete sich nach der Wende aus Australien zurück. Der Lebensbericht des Bauern wird zur Geschichte seines Dorfes, in dem sein Vater als der einzige trickreich der Genossenschaft fernblieb. Im Erzählen entsteht ein weiter Bogen, in dem sich über 50 Jahre Landwirtschaftsentwicklung spiegelt, die zwar als widerspruchsvoll, aber über die Jahrzehnte als erfolgreich erscheint. Der Bauer erzählt von den Auswirkungen der Politik auf die Landwirtschaft und auf die einzelnen Genossenschaften, vom Einzug der Technik, die eine gewisse Wohlhabenheit der Bauern mit sich brachte. Er berichtet witzig, kenntnisreich und nüchtern auch über die Veränderungen in der Nachwendezeit. Die Autorin lässt ihn im anhaltinischen Dialekt der Gegend sprechen, was mitunter Verständigungshürden aufrichtet.
Wie aus „Nest im Kopf“ bekannt, ist Beate Morgenstern seit frühester Kindheit mit dem Teufel vertraut. Daher nicht überraschend, das er in umstürzenden Zeiten in Erscheinung tritt. Mit der Burleske „Der Gewaltige Herr Natasjan“, entwirft die Autorin eine skurril-fantastische Szenerie, die im Juni 1989 beginnt. Im Club der Kulturschaffenden sitzen 13 Schriftsteller zu einem literarischen Stammtisch zusammen, diskutieren über die Aussichten von Nemezien, dem Staatswesen, dem sie zugehören. Im Disput werden Vorzüge und Schwächen des Landes hin und her gewendet, wobei literarisch Kundige einige der Porträtierten erkennen werden. Um Mitternacht verschwindet der Kellner, dafür erscheint der Gewaltige Herr mit Katzen auf den Schultern und verkündet sein Interesse an der wertvollen Immobilie des früheren Herrenclubs in der Jägerstraße, den er zu erwerben gedenkt. Der schriftstellerischen Elite des Landes kommt er mit dem Angebot, ihnen eine privilegierte Einreise ins andere Deutschland zu verschaffen, er bittet um einen Text, wie sie sich nach dem absehbaren Mauerfall die Verhältnisse in Deutschland vorstellen. Nun ist die Einmütigkeit unter ihnen vorbei, nur einer bleibt standhaft. Das ist nur eine Episode des fantastischen Geschehens im Roman, in dem die Wendezeit als possenhafte Burleske gespiegelt wird, in der der Teufel und seine Gehilfen ihre Hand im Spiel zu haben scheinen. Der Roman vermittelt das Geschehen über eine Rahmenhandlung, die im Jahre 2001 spielt und so einen Rückblick auf damalige Befürchtungen und Erwartungen zulässt. Die Autorin apostrophiert sich dabei als Vermittlerin von Walja Kunze, die Jüngste der damaligen Runde, die es nach der Wende bis nach Amerika verschlagen hatte. Da inzwischen viele Jahre vergangen sind, fühlt sich die Erzählerin legitimiert, Waljas Geschichte über diese und andere traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Der Leser fühlt sich so auch zu eigener kritischer Bestandsaufnahme ermuntert.
Für alle hier zu Worte kommenden Autoren veränderte sich durch den gesellschaftlichen Umbruch von 1990 manches in ihren Leben und Denken. Einige der Bücher, die im E-book und Print Programm des HeRaS Verlages erschienen sind, legen davon Zeugnis ab. Wie sich Wahrnehmung und Schreiben im Einzelnen verändert haben, verdiente eine genauere Untersuchung, die hier nicht geleistet werden konnte.
E.R. GREULICH
Emil Rudolf Greulich (Erge) ist 1909in Berlin geboren. Schriftsetzer. Wegen Beteiligung an der Maifeier von der Reichsdruckerei entlassen. Bald darauf Setzer in der „Roten Fahne“. 1929 Eintritt in die KPD. Nach 1933 illegale politische Tätigkeit. 1939 von der Gestapo gefasst, wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt und kurz vor der Entlassung aus dem Gefängnis Tegel 1942 zur Strafdivision 999 kommandiert. In Amerikanischer Kriegsgefangenschaft. 1946 nach Berlin zurückgekehrt, im Dietz Verlag als Korrektor tätig, später als Redakteur. Ab 1948 freier Schriftsteller.