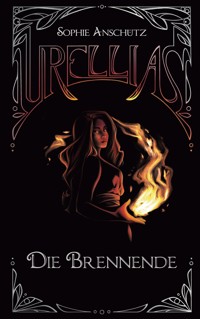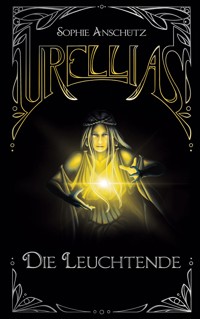
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Urellias
- Sprache: Deutsch
"Es wäre nett, wenn du mich dabei nicht mit deiner Magie einwickelst", murrte sie. "Ich bitte dich. Hast du etwa Angst vor mir?" Nach dem schweren Verrat von Nevin an ihrer Freundin weiß Venedta nicht, wem sie noch trauen kann. Obwohl die Todesfeen immer mehr Boden gewinnen, steht für sie fest: sie wird ihre Schwester nicht aufgeben! Ausgerechnet der charmante Keram bietet den Freundinnen Hilfe an, die Urellia von Manskelie zu finden. Aber kann Venedta sich seiner Loyalität sicher sein? Oder steckt er mit den Rebellen unter einer Decke, die ihrer Familie nach dem Leben trachten? Auf ihrer Suche müssen die fünf Feen sich erneut trennen - und dabei feststellen, dass Caldhra mehr Verbündete hat, als sie es je für möglich gehalten hätten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine liebste Schwester Swantje. Du hast viel mehr Anteil an diesem Buch, als du denkst ...
Von Sophie Anschütz bereits erschienen:
Urellias - die Brennende Urellias - die Tödliche
Altersempfehlung:
ab 14 Jahren
Triggerwarnung:
In diesem Roman gibt es Inhalte, die triggernd auf einige Menschen wirken können:
*Tod (inkl. Tod von Tieren)
*explizite Gewaltdarstellung
*sexueller Missbrauch
*Machtgefälle
DIE LEUCHTENDE PLAYLIST
SEPTIMUS - Ilan Eshkeri
BREATH OF LIFE - Florence + The Machine
BIRDS OF A FEATHER - Lilith Max
QUEEN OF KINGS - Alessandra
I DIDNT KNOW- Sofia Carson
RIVAL - Ruelle
ERLKOENIG - David Garrett
DEAD OF NIGHT - Ruelle
ONE DAY- Hans Zimmer
TROLLABUNDIN - Eivor
LOST WITHOUT YOU -Freya Ridings
KINGDOM FALL - Claire Wyndham
THE HUMMING - Enya
MY HEART IS BROKEN - Evanescence
LOVE AND WAR - Diane Birch
GO DO - Jonsi
VARVINDAR FRISKA - Poeta Magica
BERSERKIR - Danheim
WHOS AFRAID OF LITTLE OLD ME - Taylor Swift
CASTLE - Halsey
SURVIVOR - 2Wei, Edda Hayes
BECOME THE BEAST - Karliene
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
VERZEICHNIS
PROLOG
Sie kamen in der Nacht. Leise, aber nicht so lautlos, als dass sie die Hunde hätten täuschen können. Er war schon wach, als seine Mutter ihn an der Schulter packte, und ihn wachrüttelte. Kein anderer Zwölfjähriger, den er kannte, musste dieselben Ängste durchstehen. Alle Vorsicht der letzten Jahre, seine Kräfte nicht zu offenbaren. All die Lügen, die er seit frühester Kindheit aufrecht erhalten musste, um alle im Dorf zu täuschen. Nichts hatte etwas gebracht.
Sie kamen. Und sie waren schon viel zu nah. Er hörte harte Stimmen über den Dorfplatz rufen.
»Schnell, du musst zum Callo!«, drängte ihn seine Mutter.
Sooft hatte sie ihn gewarnt. Nie hatte er hören wollen. Dazu waren die Kräfte, die ihm geschenkt worden waren, viel zu verlockend. Verdammter Leichtsinn!
»Rasch, sie nahen von Osten.«
Seine Mutter trieb ihn durch die kleine Luke in den Stall, hob ihn auf das Callo, das noch zu groß für ihn war, aber das einzig wertvolle, was seine Familie besaß. Sie sah ihn streng an, die Hand noch am Zügel des Tieres.
»Reite nach Norden, mein Sohn, reite. Und blicke nicht zurück. Auf keinen Fall! Egal, was du hörst! Du kannst noch so mächtig sein, blickst du zurück, kriegen sie dich!«
Sie ließ seine Hand los, eilte zur Stalltür und stieß diese auf. Er nickte ihr mit einem Kloß im Hals zu, dann drückte er dem Callo die Fersen in die Flanken. Er war ein Kind der Ebenen. Er hatte Reiten gelernt, noch bevor er laufen konnte. Aber er wusste, unter all den Drachen, die der Armee dienten, war selbst der schärfste Galopp eines Callos nur ein schwacher Hoffnungsschimmer. Wie ein Schatten preschte das schwarze Tier über das Gras. Trittsicher und leise. Es kannte jeden Stein im Umkreis von Kilometern. Lederne Flügelschläge jagten über die Ebene. Er duckte sich tief auf den Rücken seines Gefährten, um nicht trotz der wolkenverhangenen Nacht entdeckt zu werden. Hinter ihm wurde es trotz Distanz lauter. Zunächst hörte er noch das harsche Klopfen auf Holz, dunkle Männerstimmen. Er schluckte. Wie sehr wollte er daran glauben, dass seine Eltern, seine Brüder und seine beiden Schwestern es noch geschafft hatten, die Hütte zu verlassen. Aber die Zeit war zu knapp gewesen. Und wenn diese Männer nicht fanden, wonach sie suchten ...
Trotz seiner jungen Jahre war er nicht naiv. Wer auch immer ihn verraten hatte, hätte nun mit diesen Männern seine Familie auf dem Gewissen. Und wofür? Ein paar Goldstücke, als Belohnung für den Hinweis auf ihn? Seine Hände ballten sich um die Zügel zu Fäusten. Nicht zurückblicken!, sagte er sich. Aber wie könnte er das mit sich vereinbaren? Fliehen, um ein Leben ohne Heimat zu verbringen, ohne Familie? In dem Wissen, sie den Wachen hilflos ausgeliefert zu haben?
Er nagte an seiner Unterlippe. Was könnte er schon gegen die Königin ausrichten? Weiteres Flügelrauschen. Das heisere Bellen der Hunde verklang darunter. Ein Schrei. Das Geräusch von weiteren Callos auf der Ebene. Callos und etwas, das er nicht zuordnen konnte.
Noch ein Schrei zerriss die Nacht. Die Stimme seiner Schwester! Er atmete tief durch. Zwang das Callo zum Stehen. Noch eine Sekunde der Überlegung, dann stand der Entschluss – er würde nicht kampflos gehen. Er war schließlich der Grund, weshalb sie seine Familie angriffen.
Die Königin duldete keine so mächtigen Feen, hatte seine Mutter gesagt. Seine Vorgänger waren alle in ihren Verliesen verrottet. Und sehr wahrscheinlich würde ihn dieses Schicksal auch erwarten. Aber vielleicht könnte er wenigstens seiner Familie zur Flucht verhelfen, ehe es so weit war. Er glitt vom Rücken des Callos und dachte im selben Moment an seine seltene Gabe.
Er klappte seine Flügel auf und glitt dicht über den Boden. Die Hufe der Callos seiner Verfolger donnerten über das Gras wie Trommelschläge. Er zögerte keinen Augenblick. Die Schreie seiner Familie im Ohr sammelte sich die Magie wie von selbst in seinen Händen. Er ließ sie zu sich kommen und schoss schwarze Dolche auf sie. Sofort sackten die Wachen zusammen. Reue überkam ihn nicht. Stattdessen flog er schnellstmöglich zurück Richtung Dorf.
Die Hütte stand in Flammen. Durch den Schein des Feuers sah er die Männer, die seine Familie zusammengetrieben hatten. Ein Mann hatte seine Schwestern an den Haaren gepackt und schleifte sie hinter sich her. Als er erkannte, wo sie hingebracht wurden, gefror ihm das Blut in den Adern. Dort stand keine Fee. Es war eine dämonische Gestalt, nur Haut und Knochen und schwarzer Sand. Der Schatten war gekommen. Er wusste, was mit seinen Schwestern geschehen würde. Und solange er lebte, würde er das nicht zulassen.
Seine Magie rann aus seinen Händen, formte sich zu einem Speer aus zäher, schwarzer Masse, die absolut tödlich war.
»Lasst sie in Ruhe!«
Alle Köpfe ruckten zu ihm herum. Er stieß den Speer in das Herz des Mannes, der seine Schwestern im Griff hatte. Dieser sackte zusammen. Die beiden Mädchen schrien auf, flüchteten sich geistesgegenwärtig in die Arme des Vaters.
»Lauft!«, befahl er ihnen. Wenigstens sie sollten leben.
Dann trat er dem Dämon entgegen.
Es sollte der Untergang sein, der ihm prophezeit worden war. Und dem er nicht entkommen konnte.
VOM FEUER VERBRANNT.
VOM LICHT GEBLENDET.
VON ERDE ZERDRÜCKT.
VOM GIFT GETÖTET.
VOM WINDE VERWEHT.
SO STEHT ES GESCHRIEBEN, SO WIRD ES GESCHEHN.
IN DER GLUT DES FEUERS
IN DEM LICHT DER SONNE
IN DEN SAMEN DER BLUMEN
IN DER MACHT DES GIFTES
IN DEM HAUCH DER LUFT
DORT LIEGT IHRE MAGIE.
GEBOREN, UM LIEBE ZU SCHENKEN
GEBOREN, UM LEBEN ZU SCHÜTZEN
GEBOREN, UM GUTES ZU TUN
GEBOREN, UM ALLE ZU RETTEN
GEBOREN, UM LEID ZU MILDERN.
SO STEHT ES GESCHRIEBEN, SO WIRD ES GESCHEHN.
MIT DER GLUT DES FEUERS
MIT DER HITZE DES LICHTES
MIT DER SCHÖNHEIT DER PFLANZEN
MIT DER KÄLTE DES TODES
MIT DEM HAUCH DES WINDES
WERDEN SIE UNS ALLE RETTEN
UND DIE EINE SCHÜTZEN
DIE DEN STEIN WEISS ZU NÜTZEN
1.
Wogende Graslandschaften, soweit Venedta blicken konnte. Ihr Herzschlag legte einen Zahn zu. Sie kannte diesen Ort. Ihr war sofort bewusst, dass sie träumte. Wie oft hatte sie diese Panik schon durchlebt? Seit Iniyas Entführung waren die Albträume in Wellen zu ihr gekommen, aber nie verebbt. Auch diese Nacht war ihr keine Ruhe vergönnt.
Als sie sich umdrehte, stand ihr Vater neben ihr. Er deutete auf etwas in der Ferne – das Rudel von wilden Callos, wegen dem sie hier waren. Die Tiere grasten friedlich im hohen Gras. Das Röhren der Hirsche drang durch den starken Wind bis zu ihnen hinüber. Venedta brauchte nicht an sich herabzusehen, um zu wissen, dass sie ein junges Mädchen von zehn Wintern war. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Nichts davon war echt. Sie hatte das schon hundertmal erfolgreich durchgestanden.
Dann aber sah sie den Mann, der ihren Vater und sie verfolgte. Ihren Vater, der mit dem Nymphenjäger rang. Es spielte keine Rolle, wie alt sie war. Noch immer schnürte ihr der Anblick die Kehle zu. Beförderte nackte Panik zu Tage. Wie von selbst trugen ihre Füße sie wieder näher an die Kämpfenden.
»Nicht!«
Ihre junge Stimme hallte über die Ebene, vermischt mit dem aufgeregten Röhren des davon galoppierenden Rudels und dem Gebrüll der Männer. Der Angreifer hatte ihren Vater bereits an den Haaren gepackt. Ihre Brust verengte sich.
»Tut ihm nichts!«, flehte sie.
Der Mann lachte nur, stieß sie weg und hob das Messer an den Schädel ihres Vaters. Sie wäre sein nächstes Opfer. Venedta stemmte sich wieder auf. Hob ihre Hände, die vom Sturz aufgeschürft waren. Und da waren sie. Ihre Lichtstrahlen – unerwartet und so hell, dass sie den Mann blendeten. Der Jäger schrie auf, ließ das Messer fallen. Er griff sich vor die Augen, als versuche er, das Licht zu verdrängen, doch ihre Hände hörten erst auf zu leuchten, als ihr Vater ihre Hand griff und sie mit sich zog.
Die Umgebung veränderte sich. Ihre Finger, die eben noch die tröstende Nähe ihres Vaters gespürt hatten, griffen ins Leere. Venedta runzelte die Stirn. Es war kein Ort, den sie kannte. Ihr Blick wanderte zum Boden – weißer Marmor, dessen Linien sie folgte. Die Tür vor ihr war schmal, geradezu zierlich, und die Wache in rabenschwarzen Gewändern schenkte ihr keinerlei Beachtung, als sie hineintrat.
In dem kleinen Zimmer saß ein Kind auf dem Bett. Es hatte graue Haare, die sich wie eine Gewitterwolke um den Kopf kräuselten und blasse Haut, die nunmehr fast durchscheinend wirkte, wie bei allen Kindern, die die Mondkrankheit in sich trugen.
»Iniya.«
Ihre Stimme war kaum ein Flüstern. Doch das Mädchen nahm sie so oder so nicht wahr. Ihre Schwester starrte aus dem einzigen Fenster, das den schmucklosen Raum zierte, hinaus in eine Landschaft aus nebligem Nadelwald. Die kleinen Hände umschlossen ein Stofftier. Venedta schluckte, als sie die Marane erkannte, die sie ihr zum vierten Geburtstag genäht hatte. Sie trat vor Iniya, ging in die Hocke, umfasste ihre Hand. Keine Reaktion. Ihre Schwester schien durch sie hindurch zu sehen. Ein Schleier bedeckte ihre Augen, als wäre sie in Trance. Er glich dem Ausdruck, den Iniya trug, wenn sie schlafwandelte. Wenn ihre Krankheit Besitz von ihrem jungen Körper ergriff und sie nachts durchs Schloss spazieren ließ. Ihre Schwester war schon immer anders als sie gewesen. Zerbrechlich. Lichtempfindlich.
Der Lichtgeist Anyx hatte ihr im Land der Götter gesagt, sie wäre eine perfekte Abbildung des Sonnenlichtes. Venedta hatte das nicht hören wollen, wo doch auf ihre Schwester das genaue Gegenteil zutraf.
Iniya hatte zwei Seiten, wie der Mond. Sie war schon immer eher nachtaktiv, was selten war für Lichtfeen. Die erste Magie, die sie gewirkt hatte, war das sanfte Strahlen des Mondlichtes gewesen, das sie abends für sich verstärkte, um unter der Bettdecke mit ihren Selenitsteinen weiterzuspielen. Ihre Haare waren eigentlich schwarz, wie die ihres Vaters. Doch wie Venedta trug sie die Gabe der Nymphen in sich - und während sie selbst stets Probleme damit hatte, ihre Haarfarbe zu kontrollieren, hatte sich Iniya schon früh für eine Farbe entschieden, die sie nur selten wechselte. Graue, beinahe weiße Strähnen, die im Licht wie Silber schimmerten.
»Iniya!«, wiederholte sie.
Keine Reaktion. Sie drückte die Hand ihrer Schwester fester. Aber das Kind nahm sie nicht wahr. Mit Sorge sah Venedta, dass der Schimmer auf ihren Augen keineswegs von der Mondkrankheit stammte. Iniya lächelte, atmete. Sie war etwas abgemagert, aber körperlich unversehrt – zumindest auf den ersten Blick. Sollte sie das nicht beruhigen?
»Herzzerreißend, aber du kannst nichts für sie tun.«
Venedta fuhr herum. Ihr Puls beschleunigte sich. Im Schatten lehnte eine Frau, deren Gesicht wie immer von einem boshaften Grinsen entstellt war.
»Lasst sie gehen!«
Caldhra lachte. Das Geräusch fuhr Venedta durch Mark und Bein. Caldhra legte den Kopf schief, fixierte sie mit angehobenen Mundwinkeln.
»Jeder, der meinen Zauber brechen will, muss an seinen eigenen Ängsten vorbei, Prinzessin. Wollen wir uns Eure mal ansehen?«
Zauber? Was hatte das zu bedeuten? Sollte es sich bei dem Schleier in Iniyas Augen um eine Illusion handeln? Möglicherweise um eine, die Caldhra höchstpersönlich aufrechterhielt? Venedtas Puls raste. Sie hatte nie Träume von Orten, an denen sie noch nie war. Und schon gar keine, die sich so real anfühlten. Normalerweise war es, als stapfte sie durch Watte.
Sie hob die Arme, ihr helles Licht schoss auf die Königin zu. Doch die Dunkelheit war überall. Schwarze Masse überrollte sie, nahm ihr die Luft. Sie keuchte auf, ihre Muskeln zogen sich zusammen. Sie versank im Strudel und wusste, sie konnte nichts tun. Ruckartig fuhr sie hoch. Fühlte die Seide des Lakens unter ihren Händen. Irritiert griff sie an ihre Brust, das Atmen fiel ihr immer noch schwer. Sie schluckte. Was für ein verfluchter Traum! Sie atmete durch, ganz langsam. Mondlicht fiel in einem schmalen Streifen auf ihr Bett. Sie schlug die Augen zu, um den Traum vollends abzuschütteln. Das gelang ihr eher kläglich. Der fade Geschmack in ihrem Mund blieb. Könnte das mehr als ein Traum gewesen sein? Sie wagte einen Blick durch die Vorhänge des Himmelbettes. Tara war immerhin nicht durch sie wach geworden. Die Pflanzenfee schlief auf der anderen Seite des Zimmers tief und fest.
Venedta seufzte still. Ihr Herz pochte noch immer viel zu schnell. Sie hatte ihr Nachtgewand mit kaltem Schweiß durchzogen. Auch wenn es auf Ching nicht mehr so frisch war, wollte sie sich dennoch nicht erkälten. Sie durften sich keine weiteren Verzögerungen erlauben. Sie erhob sich und warf sich ihren Morgenmantel über, um zu den Fenstern zu tapsen. Der Mond stand hoch am Himmel. Sie schlug ihre Lider nieder. Schüttelte den Kopf. Diese Bilder würde sie so schnell nicht aus ihrem Kopf verbannen können. Wie so oft seit Iniyas Entführung, war an Schlaf nicht zu denken. Sie griff nach einem dickeren Umhang, schlüpfte in flache Schuhe und machte sich dann auf den Weg zu dem Platz, den sie auch gestern schon aufgesucht hatte.
Venedta hatte die kleine Holzbank bei einem Spaziergang mit Tara entdeckt. Im Schatten der alten Trauerweide fühlte sie sich geborgen und ein wenig in bessere Tage zurückversetzt. Der Baum erinnerte sie an jenen, der auf der Felseninsel des Nymphensees thronte. Auch dieser berührte mit seinen dünnen Zweigspitzen beinahe das Wasser. Sie verstand, warum Aghni sich als Kind nachts so oft in die Gärten geschlichen hatte. Allein die silbernen Rücken der Fische im Mondlicht zu sehen, war dieses Abenteuer wert. Es war sternenklar. Der Westwind strich kühl von den Bergen herab und sie wickelte den Mantel enger um sich.
»Prinzessin.«
Sie schreckte auf. »Was tut Ihr denn hier?«
Er blieb stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. »Dasselbe könnte ich Euch fragen.«
Venedta atmete tief durch. »Ich konnte nicht schlafen«, erwiderte sie ehrlich.
Prinz Keram nickte. Er sah sie an, dann warf er einen Blick auf den Teich. »Das wundert mich nicht. Könnt Ihr überhaupt schlafen seit ... seit der Entführung Eurer Schwester?«
Sie schluckte. Die Sorge, die in seiner Stimme lag, gefiel ihr gar nicht. Und auch nicht seine Anwesenheit und schon gar nicht die Blicke, mit denen er sie bei der Ratsversammlung bedacht hatte. Manskelie war ... er wäre definitiv kein Mann, den die werten Adligen ihrer Heimat als geeignet für eine Verbindung ansehen würden.
Und was ihr Bauch anstellte, jedes Mal, wenn sie auch nur im selben Raum mit ihm war, gefiel ihr am wenigsten. Nein. Das konnte sie so nicht stehen oder gar geschehen lassen. Solche lächerlichen Gefühle konnte sie nun wirklich nicht gebrauchen! Sie wusste ja nicht einmal, ob sie ihm überhaupt trauen konnte. Vermutlich würde sie vorerst niemandem mehr trauen – nach Nevins Verrat an Aghni prüfte auch sie jedes Lächeln, jede Aussage zweimal.
»Selten«, sagte sie nach einer Weile der Stille. »Und was hält Euch wach?«
»Derselbe Gedanke wie der Eure an Eure Schwester. Mein Bruder, Marek, er ...« Keram seufzte. »Er führt die Truppen an, die unser Vater Königin Melusine zur Hilfe geschickt hat, um Meral zurückzuerobern. Ich habe seit Wochen nichts von ihm gehört.«
Venedta sah, wie er tief Luft holte. Unwillkürlich stieg Mitleid in ihr auf. Nicht nur für ihn, der um seinen Bruder bangte. Sondern auch für Tara, die seit ihrer ersten Begegnung mit Prinz Marek auf dem phylenischen Tjost letzten Winter eine Art Zuneigung für ihn empfand. Wenn sie erfuhr, dass er an vorderster Front um die Rückeroberung Merals kämpfte, wie würde sie sich fühlen?
»Ihr habt nicht annähernd alles von dem erzählt, was Ihr auf der Reise erlebt habt, oder?«
Überrumpelt sah sie ihn an. Zuerst war sie einfach überrascht, dass er seine Vermutung so offen aussprach. Dann verschränkte sie ihre Arme vor der Brust. Was sollte diese Unterstellung?
»Ihr werft mir vor, nicht die Wahrheit gesagt zu haben?«
»Das habe ich nicht gesagt. Nur habt Ihr gewiss nicht alles offen aussprechen können. Eure Worte waren klug gewählt, um Euer Vorhaben voranzubringen und die Königreiche zu überzeugen. Aber die Pausen dazwischen haben viel Raum für Deutungsmöglichkeiten gelassen.«
»So, also unterstellt Ihr mir, wichtige Details verschwiegen zu haben?« Sie schnappte nach Luft.
Keram lachte leise. »Das würde ich nie wagen.« Er sah sie an. Im leichten Mondlicht stand die Belustigung in seinen Augen. Er zog sie nur auf. Von dem heißen Pflaster der politischen Reden und all den Geschehnissen der letzten Tage war sie so aufgewühlt, dass sie es nicht gemerkt hatte.
»Verzeiht, ich bin wohl etwas durcheinander«, gestand sie.
Keram zuckte mit den Schultern, aber seine Mundwinkel blieben oben und das verschmitzte Grinsen ließ ihr Herz flattern. »Ich muss mich entschuldigen. Ich wollte Euch keinesfalls noch mehr verwirren.«
Zaghaft griff er nach ihrer Hand. Ganz vorsichtig streifte sein Daumen den ihren, bevor sie ihre Finger schnell zurückzog.
»Ihr solltet nicht hier sein.« Venedta wich ein Stück weiter zurück. Ihre Finger kribbelten dort, wo er sie berührt hatte.
»Dann solltet Ihr nachts nicht allein durch die Gärten streifen. Haben meine Briefe und Nachrichten Euch so kaltgelassen?« Er sah ihr direkt in die Augen.
Sie schluckte. Konnte nicht anders, als langsam den Kopf zu schütteln. »Nein ... ich ...« Sie sah zornig auf ihre Hand, die noch immer prickelte, als würden die Grottenolme auf ihr tanzen. »Das haben sie nicht. Aber ...«
»Aber was? Venedta, Ihr seid eine bemerkenswerte Frau. Ich würde mir niemals einen Scherz mit Euch erlauben, glaubt ...«
»Das weiß ich«, fiel sie ihm ins Wort. »Aber die Umstände in meiner Heimat ... Keram, ich kann von Glück reden, wenn niemand uns zusammen sieht.«
Seine Augenbraue wanderte nach oben. »Warum das?«
»Wisst Ihr das nicht? Auf Kufkania herrschen Unruhen, schon seit Jahren. Sie werden von Rebellenführern getrieben, die sich mit adligen Unterstützern aus Manskelie verbündet haben. Sie versuchen vorrangig, die Thronfolge zu durchbrechen, aber auch, die Adelshäuser auf Kufkania anzugreifen, um eine militärische Führung durchzusetzen.«
Kerams Blick wanderte zum Boden. »Die kufkanischen Adligen würden eine Verbindung zu den Rebellen vermuten?«, fragte er zögerlich. Sie nickte. »Und deswegen würden sie verständlicherweise protestieren?«
Erneut nickte sie. Keram seufzte tief und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. Als seine braunen Augen ihre wieder trafen, fuhr ihr der Schmerz, der in ihnen stand, durch Mark und Bein. Sie wusste, dass er etwas für sie empfand. Auch wenn er kein Freund großer Worte war, so hatte er seine Gefühle nie zurückgehalten. Aber ... hatte sie sich nicht immer gewünscht, dass jemand sie so ansah?
Immerzu ihren Freundinnen von der perfekten Liebe, der perfekten Ehe ihrer Eltern vorgeschwärmt, deren Wärme sie auf Láthrá schmerzlich vermisst hatte.
Ihr Magen flatterte. Das war doch absurd! Sie wollte so fühlen, sie wollte ihren Gefühlen folgen und sich am liebsten in seine Arme werfen. Doch nie und nimmer dürfte sie sich das erlauben. Jetzt, wo Iniya entführt worden war, galt sie als einzige Thronerbin. Sie besaß nun den gleichen Stand wie Aghni und Nephele. Der Druck auf sie wuchs mit jedem Tag, und gerade in Zeiten des Krieges konnte sie froh sein, dass ihre Eltern so besonnen waren. Mit einem strengeren Vater hätte sie schon längst heiraten müssen. Aber garantiert keinen Prinzen aus Manskelie – selbst, wenn sie dieser Ehe sofort zugestimmt hätte, allen Ängsten zum Trotz, auch wenn sie das ihm gegenüber nie zugeben würde. Eher müsste sie einen der kufkanischen Grafensöhne ehelichen, die sich stets über sie lustig gemacht hatten. Sie atmete tief durch. Keram ahnte nicht ansatzweise, worauf er sich einlassen würde. Sie hatte ihm nie erzählt, wer sie wirklich war. Und das sollte vorerst so bleiben.
Es reichte, wenn ihre Freundinnen wussten, dass sie eine Halbnymphe war. Zwar glaubte sie nicht, dass er sich deshalb von ihr abwenden würde, doch wollte sie vermeiden, dass noch mehr Feen außerhalb ihres engsten Kreises unnötigerweise davon erfuhren. Sie hatte keinen Schimmer, wer überhaupt außerhalb ihrer Familie davon wusste. Lediglich den Rebellen traute sie zu, dass sie irgendwie die Wahrheit herausgefunden hatten. Auf Kufkania besaßen die Nymphen immerhin einen hohen Stellenwert – aber wie würde ihre Herkunft in anderen Ländern betrachtet werden?
Und selbst, wenn er es wüsste ... sie durfte sich nicht zu diesen braunen Augen hingezogen fühlen! Es war einfach unmöglich. Er war unmöglich!
Sekunden vergingen, in denen sie sich einfach nur anstarrten. Der Schmerz in seinen Augen wich nicht. Wenn sie ihren Schild auch nur eine Sekunde senkte, würde er denselben Schmerz in ihr entdecken. Rasch schlug sie die Lider nieder. Und spürte eine kleine Berührung auf der Wange. Für eine Millisekunde erlaubte sie sich, die Wärme von Kerams Fingerknöcheln zu genießen. Dieser Herzschlag schien ewig zu dauern. Nie wieder wollte sie ihre Lider öffnen, sondern bis in alle Ewigkeit so verharren. Stattdessen wich sie wieder zurück. Diesmal weiter.
»Verzeiht, aber ich ...« Venedta versteckte ihre Hände hinter ihrem Rücken, damit er sie nicht zittern sah. »Ich muss gehen.«
»Venedta«, flüsterte er.
Sie schüttelte den Kopf, machte weitere Schritte rückwärts, zwei, drei. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und rannte. Ja, das war albern. Aber wenn sie noch länger in seiner Gegenwart wäre ... Warum fiel es ihr nur so schwer, ihre Gefühle zu unterdrücken? Was löste er in ihr nur aus?
Erst als sie im Gemach stand, registrierte sie, dass sie schwer atmend die Tür zugeschlagen hatte. Tara war aus dem Schlaf hochgefahren und sah sie verwundert an.
2.
Davius zog sich sein Wams über. Heute ging es um alles. Das wussten alle, und eine entsprechend düstere Stimmung hing wie eine Axt über ihnen. Oht und er hatten zusammen mit dem Hauptmann der Orks einen Plan erarbeitet, um die Stadt zu infiltrieren. Nachdem der erste Versuch gescheitert war, da die Feen von Alaith ihrerseits die Stadt komplett abgeriegelt hatten und keine einzige Fee aus- oder einließen, hatten sie keinen Spion einschmuggeln können.
Sie mussten also mit den Stadtplänen arbeiten, die Oht vorlagen. Die waren sicher schon an die hundert Jahre alt. Vielleicht war das der Grund, warum Davius Bauchschmerzen bei der Sache hatte. Das oder die Unruhe, die seit dem gescheiterten ersten Manöver unter den Truppen herrschte. Er konnte den Männern da keinen Vorwurf machen. Er selbst hatte die letzten Tage schlecht geschlafen.
Alaith war eine gut gesicherte Festungsstadt. Hinter ihr warteten zudem noch die Truppen von Nidalis und deren Hilfe aus Maldôs und Neu Phylos auf sie. Es gab nur diese eine Chance, um die Stadt einzunehmen. Andernfalls würden sie in einen Kampf auf den offenen Ebenen vor der Stadt hineingezogen werden, den sie trotz der Orks nur schwer gewinnen könnten. Und das nur mit großen Verlusten. Durch die Pläne wussten sie immerhin, wie komplex die Wasserversorgung der Stadt aufgebaut war. Alaith saß auf einer uralten Quelle, die so tief lag, dass die nidalischen Feen einen Bach aus dem Brathilgebirge umgeleitet hatten, um zusätzlich an Wasser zu gelangen. Durch die Quelle im Inneren der Stadt war es seinen Truppen unmöglich, den Feen ihre Wasserversorgung vollständig abzudrehen. Oht hatte das vor seiner Ankunft schon am Bach ausprobiert und das Wasser mit Todesmagie verseucht. Die Wasserfeen waren viel zu bewandert darin, es wieder zu reinigen.
Der Bach war winzig. Davius hätte nie für möglich gehalten, dass damit die Versorgung einer ganzen Stadt möglich wäre. Doch hatte er schon in den letzten Tagen bemerkt, wie der Wasserzufluss ständig anschwoll - im Brathilgebirge hatte die Schneeschmelze eingesetzt. Aus den Plänen entnahm er, dass die Baumeister ein komplexes System aus Kanälen geschaffen hatten. Die Stadt drängte sich in steilen Stufen an die Hänge des erloschenen Vulkans, sodass diese Wasserleitungen niemals ohne die Hilfe der Wassermagier funktionieren würde.
Gleichzeitig war das ihre einzige Chance, die unüberwindlichen Mauern Alaiths zu durchbrechen. Das Kanalsystem schien die einzige Schwachstelle der Außenmauern zu sein.
»Sind die Männer startklar?«
Der Vorhang zum Zelt wurde zurückgeschlagen und Oht steckte seinen Kopf hinein. Davius brummte etwas Zustimmendes. Er würde es nie vor dem Älteren zugeben, aber es gefiel ihm nicht, bei diesem Manöver unter ihm zu stehen. Nur der Hilfsoffizier zu sein. Daher war es ihm auch nicht schwergefallen, sich im Geheimen einen Plan auszudenken, der Oht garantiert nicht gefallen würde.
Davius winkte ihn herein und erklärte, was er vorhatte.
»Sicher, dass ihr nicht von den Tierfeen entdeckt werden könnt?«, fragte Oht.
Davius knirschte mit den Zähnen. »Seit dem Befehl kurz nach meiner Ankunft töten unsere Männer jedes Tierviech, das sie finden. Jeden verdammten Vogel haben sie abgeschossen. Wie sollen sie da von unseren Plänen erfahren haben?«
»Na ja, wir haben noch nicht herausgefunden, was dieses haarige Monster alles kann«, grunzte Oht.
»Das muss klappen. Sobald die Männer drin sind. Wir geben ein Signal, sobald die Balliste ausgeschaltet sind, die den Drachen gefährlich werden können.«
»Und du willst mir nicht verraten, wie du die Männer da rein bekommst?« Oht sah ihn prüfend an.
»Glaube mir, das ist besser so.«
»Weil ich es nicht erlauben würde?«
Davius schluckte. Wie immer hatte der alte General ihn schnell durchschaut. Er nickte knapp. »Es ist riskant. Dadurch, dass wir niemanden mit Yamas Fähigkeiten hier haben ...«
»Hast du gerade zugegeben, auf Yama angewiesen zu sein?« Oht klang fast schon belustigt.
Davius schnaubte und winkte ab. »Natürlich nicht. Aber es würde die ganze Operation einfacher gestalten«, gab er zu. »Alaith hat keine Illusionsschilde. Und Yama ist eine der wenigen Feen, die die Kunst der Verwandlung insoweit beherrscht, dass sie uns für einen Angriff nutzen könnte. Ich sage das auch nicht gerne, Oht, aber es würde vermutlich das Leben einiger Männer retten, wenn sie an unserer Seite wäre.«
»Also willst du mir nichts von deinem Plan verraten? Würde ich dich nicht brauchen, würde ich dich liebend gerne den Orks vorwerfen.«
Davius schmunzelte. »Was ist mit denen? Sind sie auf ihren Positionen?«
»Sie stehen im Höhlensystem verteilt, ja.«
»Gut.«
Davius atmete etwas auf. Das Wirrwarr aus Höhlen und schmalen Gängen, das einer von Ohts Spähern vor wenigen Tagen entdeckt hatte, war wie gemacht dafür, Alaith unentdeckt zu unterwandern. Es schien mit den unterirdischen Teilen der Stadt verbunden zu sein und bot damit einen Weg, Flüchtlinge aus der Stadt abzufangen. Davius hatte ungern unschuldige Feen auf dem Gewissen, aber zum Schutz seiner eigenen Männer musste er alles tun, was notwendig war. Auch, wenn das Grausamkeit bedeutete.
»Ach, übrigens«, sagte er zu Oht, »ich gehe mit da rein.«
»Bitte was?«
Der Ältere sah ihn an, als wäre er verrückt geworden. Und ja, das war er vielleicht auch. Die Männer, die er ausgewählt hatte, waren ebenso zu solchen Manövern ausgebildet wie er. Dennoch konnte er mit seiner Magie besser umgehen als jeder Einzelne von ihnen. »Wenn ich mitgehe, wird es hoffentlich keine Selbstmordmission«, erklärte er schlicht. »Außerdem brauchen sie einen Anführer.«
»Davius, wenn du stirbst, bringt die Königin mich um«, behauptete Oht.
Das brachte ihn zum Schmunzeln. »Wenn sie mich unbedingt am Leben halten wollte, hätte sie mich wohl kaum an die Front geschickt«, gab er zu bedenken. »Außerdem leitest du die Truppen. Lass mich auch etwas Spaß haben.«
»Spaß«, brummte Oht. »Du Grünschnabel hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt.«
O doch, die hatte er. Er war allein in den kufkanischen Palast eingedrungen, ohne auch nur einen Mann an seiner Seite, und hatte die Hälfte der Leibgarde des Königs getötet. Seinetwegen hockte die junge Prinzessin nun in Caldhras Gewalt. Seinetwegen war der alte maldôsische König samt seiner Familie tot. Und nein, er bereute es auch nicht, um zu überleben, viele der Wachen und eine Priesterin des Nephostempels auf dem Gewissen zu haben – aus dem er ebenfalls ganz allein entkommen war.
Oht hatte keine Ahnung, was er seit ihrem letzten gemeinsamen Übungskampf alles durchgemacht hatte. Und wie er daran gewachsen war. Er war vielleicht nicht bis ans Ende von Erakos gesegelt – aber ungefähr so fühlte sich seine Erfahrung mittlerweile an.
Davius griff nach seinem Schwert und band sich die Scheide an den Gürtel. Er war startklar. Oht stellte sich vor ihn, packte ihn an den Schultern und sah ihm prüfend ins Gesicht.
»Und du bist sicher?«
Davius nickte. Er war alles immer und immer wieder durchgegangen, aber einen anderen Weg sah er nicht. Oht fing ihn in einer Umarmung. »Viel Glück«, sagte er nur.
Kein Abschiedsgruß, keine großen Reden.
Um ehrlich zu sein, hätte ihn das beim General auch gewundert. Oht wandte sich ab und stapfte aus dem Zelt. Davius fuhr ein letztes Mal prüfend über seine Ausrüstung. Das Schwert trug er nur für den Fall, dass es auf dem ersten Drittel des Weges unvorhergesehene Komplikationen gab. Spätestens in der Enge der Höhlensysteme war es kaum mehr zu gebrauchen und eine unnötige Last. Er schnürte sein Wams ein Stück enger, dann verließ auch er das Zelt. Seine Männer, eine Gruppe von neun talentierten Bändigern und wahre Assassinen, die er für diese Mission ausgewählt hatte, warteten unweit des Lagers auf ihn. Wie er waren sie komplett in Schwarz gehüllt.
Wortlos begannen sie ihren Aufstieg nach Nordosten. Wenn sie bei Anbruch des Sonnenuntergangs in den Höhlen sein wollten, mussten sie sich beeilen. In der Dunkelheit wäre es für sie innerhalb der Stadt einfacher. Das Geröll des Berges knirschte unter ihren Füßen, ansonsten blieb es still. Ab und an jaulte einer der Wölfe, die den Orks als Reittiere dienten und die rundum in den Bergen ebenfalls auf die Nacht warteten. Vom Tal wehten Geräusche der verschiedenen Lager hinauf, wenn der Wind drehte. Und die Sprechgesänge der Nephospriester, die im Herzen Alaiths in ihrem Tempel saßen und für die Stadt beteten. Davius schnaubte. Beten hatte ihn noch vorangebracht. Hartes Training dagegen schon.
Wie geplant erreichten sie bei Anbruch des Sonnenuntergangs die Öffnung zum Berg. Der kleine Eingang zum Höhlensystem klaffte wie eine verächtliche Fratze zwischen den Felsen hervor.
Immer noch schweigend legten seine Männer und er die Schwerter ab und deponierten sie nahe der Öffnung in einer Felsspalte. Jemand tippte auf seine Schulter. Davius fuhr herum. Einer der Männer deutete nach Norden, wo er einen winzigen grauen Vogel auf den Steinen erkannte. Davius nickte und der andere spannte seinen Reiterbogen und schoss. So knapp vor der Mission durften sie sich keinerlei Fehler erlauben. Der Mann behielt seinen Bogen bei sich, auch, als sie das Dunkel der Höhlen betraten. Hier drinnen waren ihnen die Bögen kaum von Vorteil, aber im Gegensatz zu den eisernen Schwertern besaßen sie kaum Gewicht und würden später über Leben und Tod entscheiden können. Er war der Einzige, der keinen bei sich trug. Davius war zwar begabt im Schießen, aber konnte er wählen, so waren ihm alle anderen Waffen lieber – er mochte die Distanz nicht. Das Schwert oder seine eigene Magie waren ihm vertrauter. Nur ein paar kleine Dolche hatte er zur Sicherheit an seiner Ausrüstung angebracht.
Sie entzündeten einige Fackeln, dann traten sie den Abstieg an. Der Gang führte recht steil nach unten. Lediglich die unebenen Wände und natürlichen Stufen halfen an einigen Stellen, dass er nicht das Gleichgewicht verlor. Je tiefer sie kamen, desto feuchter wurde es. Sie passierten zwei andere Gänge und waren schon längst in vollkommener Dunkelheit gefangen, als Davius das Plätschern hörte. Es war nur ein winziges Rinnsal, dem sie folgten. Im eiskalten Bergwasser hallten ihre Schritte verdächtig laut an den Höhlenwänden wieder. Aber die Späher hatten sich vergewissert, dass dieser kleine Zulauf zum Bach nicht bewacht war. Vermutlich, weil das Gelände so unwegsam war. Oder er war einfach vergessen worden. Der Bach hatte eine größere Quelle weiter nördlich von hier, doch die wurde strengstens von Außenposten beschützt. Davius wollte wenigstens eine Etappe ohne größeres Blutvergießen überstehen.
Das Wasser wurde langsam tiefer. Es reichte ihm schon bis zu den Knien und ließ ihn frösteln. Seine Stiefel und auch der Rest seiner ledernen Kleidung waren wasserfest behandelt, dennoch kroch die Kälte an seinen Beinen herauf. An sich wäre der Zulauf kaum tauglich für sein Vorhaben gewesen. Er war zu flach, als dass sie sich unentdeckt darin fortbewegen könnten. Nur durch die anhaltende Schneeschmelze wurde er weiter nördlich von einem zweiten Zulauf gespeist, in dessen Tiefen sie nachts nicht auffallen würden.
Bevor das Rinnsal unterirdisch auf den Bach traf, führte es durch einen engen Tunnel. Seine Männer und er mussten das Stück tauchend und tastend überstehen. Es waren nur gute zehn Meter, die durch den nackten Fels führten. Trotzdem rang er in den letzten Zügen unter Wasser um Luft und sein Herz überschlug sich. Schon lange hatte er sich nicht mehr so hilflos gefühlt. Endlich spürte er, wie sich die Strömung veränderte und sah, dass sich das Wasser einen Grauton erhellte. Beim Auftauchen zwang er sich, leise zu sein. Sie befanden sich leicht nördlich der Stadtmauer, die im Osten die Gebiete begrenzte, in denen die ärmere Bevölkerung hauste, und die baugeschichtlich jünger waren als der Rest von Alaith.
Davius vergewisserte sich, dass alle seine Assassinen die Passage geschafft hatten, dann wandte er seinen Blick zur Mauer. Obgleich dieser Teil der Stadt weniger bedeutend war, war es nicht verwunderlich, dass nun im Krieg Wachposten auf dem Wehr patrouillierten. Vermutlich waren auch welche im oder am Bach. Bändiger, die jeden Mucks im Wasser wahrnehmen konnten. Er befahl seinen Leuten mit einem Handzeichen, so wenig schnelle Bewegungen wie möglich zu machen. Der nächtliche Himmel war zwar auf ihrer Seite, dennoch hatten sie noch einen weiten Weg vor sich. Bevor sie sich der Mauer weiter näherten, erschuf er im Bach ein Schild seiner Magie, dicht an den Gittern der schmalen Pforte, die der einzige Schwachpunkt Alaiths zu sein schien. Durch den Schild könnte er hoffentlich die Wellen stoppen oder abmildern, die durch sie entstanden. Sie tauchten erst an der Mauer wieder auf. Wie erwartet, sah er hinter den Stäben die Stiefel von zwei Wachmännern, die am Ufer recht gelangweilt wirkten und – zu seinem Glück – ihre Aufgabe nicht ernst nahmen. Sie waren in ein leises Gespräch vertieft, die Rücken zu ihnen gedreht. Davius gab ein lautloses Zeichen und schon schnellten zwei Klingen auf die Ahnungslosen zu. Ohne einen Laut sackten sie zusammen. Seine Truppe zwängte sich durch das Gitter und versteckte die Leichen.
Laut dem Stadtplan von Oht war es nicht weit bis zum Eingang in die Unterwelt von Alaith. Er lag richtig. Sie waren kaum dreißig Schritte gegangen, immer im Schatten der Mauer, da sah er eine Abzweigung des Baches, der in einem unterirdischen Tunnel verschwand. Auch dort stand ein Mann, den sie erst beseitigen mussten. Dann machten sie sich auf den Weg ins Herz der Stadt. Eine Weile ging es immer tiefer hinab. In dem aus dem Felsen gehauenen Tunnel mussten sie schwimmen oder waten. Davius hielt das für ein gutes Zeichen. Da es bergab ging, dürften hier noch keine Bändiger arbeiten. Dennoch wollte er keinerlei Risiko eingehen und behielt sein Schild immer ein paar Meter vor ihnen im Wasser.
Gut so. Als sie die erste Biegung erreichten, stand dort eine Gruppe von Wasserfeen – Männern und Frauen, im hellen Schein einer Fackel – und filterten das Wasser. Einer bemerkte ihre Bewegungen im Bach, aber ehe er reagieren konnte, hatte Davius den Befehl gegeben und eine schwarze Wolke hüllte ihre Köpfe ein. Er tötete nicht gern auf diese Weise. Lieber hatte er einen ordentlichen Kampf, aber für das Leben seiner Männer war es notwendig.
Drei weitere Stationen folgten, von denen mehrere Tunnel abzweigten. Laut Ohts Plan führte der Haupttunnel direkt in Alaiths Heiligtum. Zu der alten Quelle, die inmitten des erloschenen Kraters lag. Vor dem Höhlenausgang, der in diesen Krater führte, wurde der Tunnel breiter und das Wasser flacher. Sie standen nur noch knietief im Nass, als Davius die Wachen vor dem Ausgang sah. Eine gestickte Forelle prangte auf ihren Umhängen und sie waren mit Speeren und Schwertern bewaffnet. Fackelschein drang aus dem Krater und beleuchtete ihre Mienen schauderhaft. Davius schickte seine Assassinen an, sich an die Felsen zu pressen. Dann löschte er sein Schild und bewegte seinen Fuß laut im Wasser. Beinahe augenblicklich wurde einer der Männer aufmerksam.
»He, wer da?«, rief er.
Als keine Antwort kam, zückte die Gruppe ihre Waffen und schlich näher zu ihnen in den Tunnel. Davius wartete, bis sie weit genug entfernt vom Lichtkegel waren, dann gab er das Zeichen zum Angriff. Auch hier kam der Tod schnell. Seine Männer preschten von den Wänden vor. Die Wachen hatten kaum Zeit, zu reagieren, da lagen ihnen dunkle Schnüre um Hals und Mund und drückten ihnen die Luft ab. Er presste sein eigenes Opfer dicht an seine Brust, bis der Körper endgültig erschlaffte, dann zog er ihn an den Rand des Kanals. Die Wasserfeen entlang der Versorgungsader der Stadt würden Blut – oder auch Spuren ihrer Magie – viel zu schnell wahrnehmen können. Daher war er stets darauf bedacht, dass nichts davon den Bach berührte.
Hinter seinem Schild hievten sie ihre Opfer auf die oberste Treppenstufe, dicht an den Rand des Felsens, damit niemand sie bemerkte. Mit geübten Griffen entwendete Davius seinem Gegner Hose, Tunika, ein paar lächerliche Handschuhe und Umhang und zog alles über. Die Handschuhe spannten, aber sie taten ihren Zweck. Er nahm sich auch das Schwert. Dann vergewisserte er sich, dass alle Wasserfeen erledigt waren. Sie mussten sich beeilen, um noch pünktlich bei der Wachablösung zu sein. Er zog sich die Kapuze übers Gesicht und marschierte mit seinen Männern in den Krater. Die Hand stützte er lässig auf den Schwertknauf – er durfte jetzt bloß keine Anspannung zeigen.
Die nackte Felswand öffnete sich schleichend zum Heiligtum der Stadt. Immer mehr Fackeln erhellten den kalten Stein. Er blieb mit seinen Männern am Rand stehen und wartete auf die Ablösung. Die Zeit nutzte er, um alles in sich aufzusaugen. Hier unten fühlte er sich wie in einer Grotte. Es war feucht. Der dunkle Stein war uneben, nur an einigen Stellen war er bearbeitet worden und es waren Treppenstufen und Wege nach oben auszumachen. Der Kanal, aus dem sie kamen, traf wenige Schritte weiter auf einen weiteren Graben. Dieser schien die Mitte des Kraters vollständig zu umrunden. Nur zwei Stege führten auf die künstliche Insel, die eine seltsame Konstruktion aufwies. Dort stand eine Art Pavillon, unter dessen Schutz die ursprüngliche Quelle Alaiths sprudelte. Vier Priesterinnen bewachten das Konstrukt in jede Himmelsrichtung. Das Dach des Pavillons stützte wiederum eine gewaltige Säule, um die sich eine Treppe mit Geländer schlängelte. Und darauf …
Davius traute seinen Augen kaum. Er hatte geahnt, dass die Wasserversorgung der Stadt komplex war. Doch das, was er sah, übertraf selbst seine kühnsten Vorstellungen. Der Kraterrand befand sich hunderte Meter über ihnen und dort oben hatten sie, wie in einem Schneckenhaus, ein weiteres architektonisches Wunder vollbracht. Die Säule, die vom Pavillon in die Höhe ragte, trug den Herzogssitz, der über vier Steinbrücken mit dem Kraterrand verbunden war. Auf der Treppe der Säule stand in Höhenabständen von ungefähr zwanzig Metern je eine Fee und wirkte Wassermagie, sodass das Wasser aus dem Bach der Schwerkraft trotzte und entgegen aller Vernunft senkrecht nach oben floss. Von den äußeren Kraterrändern kehrte ein Teil in Form von hauchzarten Wasserfällen zurück, was zu Sprühnebel führte, der sich innerhalb der Grotte wie Schleier ausbreitete.
Davius musste sich zusammenreißen, um sich durch dieses Schauspiel nicht ablenken zu lassen. Er durfte nicht wie jemand wirken, der das alles zum ersten Mal sah.
Die Wachablösung kam. Er salutierte mit denselben Gesten und nickte dem Gegenüber dann nur zu. Die späte Stunde war ein guter Grund, kein Gespräch anzufangen. Als er sich schon in die Richtung abwandte, aus der die Wachen soeben gekommen waren, durchschnitt die Stimme des Anführers die Luft.
»Solltet ihr nicht elf sein?«
Innerlich fluchte er.
»Unser Kamerad hat was Falsches gegessen«, log er.
Die Wache brummte nur, dann ließ er ihn in Ruhe. Dennoch spürte er den Blick der Ablösung im Nacken, während er die Grotte durchquerte. Seine innere Unruhe ließ auch nicht nach, als sie die Stufen erreichten, die steil nach oben führten. Er rief sich den Stadtplan ins Gedächtnis. Jetzt galt es, die Drachenballiste im dritten Ring auszuschalten. Davius hatte noch weitere Pläne, aber von denen hatte er Oht nichts erzählt.
Sie gelangten erstaunlicherweise ohne Zwischenfälle oder weitere Begegnungen über das Treppensystem bis hinauf in den dritten Ring. Laut der Karte lebten hier hauptsächlich Beamte, und soweit Davius das von den Häusern einschätzte, mochte das auch stimmen. Die weiß gekalkten Wände und die organische Form der Häuser erinnerten ihn an Lormoralia. Es war unverkennbar, dass der Glaube des Nephos den alten Kult um Ako vollständig verdrängt hatte. Etwas gelassener schlug er mit seinen Männern den Weg zur dritten Mauer ein. Der Aufbau der Stadt glich dem des vergessenen Reiches. Das erleichterte es ihm, sich auch ohne Ohts Aufzeichnungen zu orientieren. Er schickte zwei Männer voraus, die sich einen Überblick über die Balliste und die Bewachung der Mauer verschaffen sollten. Sie kamen rasch zurück.
»Nur alle fünfzig Meter ein Soldat. An den Ballisten jeweils zwei.«
»Wie viele Balliste?«
»Acht.«
Davius fluchte. Warum war diese Stadt so verdammt reich? Die Balliste zu sabotieren war an sich kein Problem. Doch mit jeweils zwei Mann bewacht würde die Sabotage nicht immer ohne Kampf vonstattengehen. Und man konnte vom Herzogssitz und dem vierten Ring, in dem sich die Tempelanlage des Nephos befand, hervorragend auf die Mauer herabblicken. Um auf mehr Wolken vor dem Mond zu warten, hatten sie zu wenig Zeit. Schon zum zweiten Mal wünschte er sich, dass Yama mit ihren Illusionskünsten hier wäre. Unfassbar!
Es machte keinen Sinn, bei der Herzogsresidenz zu beginnen. Das Wichtigste für Oht und das Heer war es, die Drachenabwehrsysteme loszuwerden. Davius atmete tief durch. Er wollte seine Magiereserven eigentlich für den Herzog aufsparen, aber hatte er nicht selbst gewusst, dass er sich auf eine Selbstmordmission begab?
»Jeder knüpft sich eine der Ballisten vor. Versucht, die Wachen im Sitzen zu erwischen oder besser noch, in den Sichtschatten zu locken. Dann nutzt nur so viel Magie, um sie zu lähmen. Nicht töten! Sie müssen noch ihre Haltung bewahren, damit es von oben so wirkt, als sei alles in Ordnung. Dann kappt ihr die Seile. Hakoen und ich kümmern uns um die Soldaten dazwischen. Selbe Strategie. Notsignal bleibt gleich. Wir treffen uns wieder bei den Treppen. Alles klar?«
Seine Assassinen nickten. Sie teilten sich auf. Davius schlich zunächst nach Westen. Die Taktik, für die sie sich entschieden hatten, erforderte viel Magie, die er und die Männer aufrechterhalten mussten. Wenn die Wachposten wieder aufwachten, würden sie sich zwar nicht erinnern können, doch er wollte so lange wie möglich sicherstellen, dass die Ballisten ausgeschaltet blieben.
Er arbeitete im Schatten der Häuser, bewegte sich auf den verschrobenen Dachfronten oder sprang wie eine Marane beinahe lautlos von Balken zu Balken. Die Dunkelheit war schon immer sein Freund gewesen. Als er mit seinem Vater noch in Tiranun gewohnt hatte, der Bergfeste im Norden Altmyrs, hatte er nur an wenigen Tagen im Jahr Sonnenlicht gesehen. Im Berg gab es nur Fackeln und ein paar magische Lichter. Doch die größten Wärme- und Lichtquellen waren die Feuer der großen Schmiedeessen gewesen, angetrieben durch ein paar alte Drachen. Die kleine Wohnung, in der er mit seinem Vater gelebt hatte, war ihm ans Herz gewachsen. Dort war er ein ganz normales Kind gewesen. Nur, dass er nicht wie die anderen Kinder schreiend zu seiner Mutter laufen konnte, wenn er sich wehgetan hatte. Die war fort – der Aussage seines Vaters nach tot. Der Ring, den Davius an einem ledernen Band um seinen Hals trug war das Einzige, was er von ihr besaß. Das und die vage Erinnerung an seine Großeltern mütterlicherseits, die seinen Vater für das Unglück ihrer Tochter verantwortlich machten und sich keinen Deut um ihren Enkel scherten. Er verstand schon damals, wieso sein Vater das Leben im Berg nicht mehr aushielt. Doch bis heute blieb es ihm ein Rätsel, wieso er mit ihm nach Ching zog. Dort hatten sie nichts. Sein Vater hatte ihm einmal gesagt, es wäre ihm nicht nur um das Gerede gegangen – er hatte schlicht kein Handwerker mehr sein wollen.
In Ching versuchte er sich als Schreiber, ermöglichte es Davius sogar, eine Schule zu besuchen, in der er schreiben und lesen lernte. Das half jedoch nicht gegen die Ausgrenzung. Die Feuerfeen wussten, dass sie Ausländer waren. Sie schienen zu spüren, dass Davius eine ihnen verhasste Gabe in sich trug. Sein Vater prägte ihm ständig ein, seine Magie nie zu benutzen, um keinen Hass auf sich zu ziehen. Als hätte das einen Unterschied gemacht. Sooft wie möglich, war er nur nachts unterwegs, um den jungen Feen, die ihn hänselten, aus dem Weg zu gehen.
Dann rettete er die Prinzessin. In der Schule machte das kaum einen Unterschied, aber mit dem Buchladen, den sein Vater für die Belohnung erstand, brauchte er sich darüber keine Gedanken mehr zu machen. Langsam aber sicher gewöhnten sich die Feuerfeen an den schrulligen Buchhändler und seinen Sohn.
Davius jedoch hatte schon immer gewusst, dass Papiere nicht sein Leben sein würden. Als der Schatten ihn vor ein paar Jahren einholte und ihn nach Altmyr brachte, war er nur im ersten Moment überrascht. Im Grunde hatte er gefühlt, dass er zu etwas anderem bestimmt war, die Götter andere Pläne mit ihm hatten.
Davius ließ sich vom Balken des nächsten Hauses fallen. Der Wachposten drehte sich nicht einmal um, sondern starrte weiter auf den Horizont. Er konzentrierte sich, ließ in jeder Hand eine winzige Wolke seiner Magie entstehen und sie in den Körper des Mannes fahren. Im Dunkel der Nacht war das kaum auszumachen – und schon bewegte sich der Soldat nicht mehr. Aus Erfahrung wusste Davius, dass er noch atmete.
Er behielt seine Magie bei und schlich im Schatten der Gebäude bis zum nächsten Mann. Es würde ihn viel Konzentration kosten, so viel Magie auf einmal aufrechtzuerhalten. Aber das war ihm lieber, als entdeckt zu werden.
3.
»Bei Ako, wie soll das funktionieren?«
Nuada stampfte mit dem Fuß auf. Ihr Blick wanderte zu Aghni, in der Hoffnung, dass die Feuerfee noch eine Idee hatte. Doch auch ihr Gesicht war ratlos.
»Schönes Geschenk«, brummte die Feuerfee und band sich das halbe Herz wieder um ihren zierlichen Hals. Den Anhänger, den Aghnis Großmutter ihnen so feierlich im Auftrag der Göttin Safrani übergeben hatte – und der dennoch keinerlei Kräfte zu besitzen schien.
Nuada konnte das noch gar nicht glauben. Die Götter existierten also wirklich! Aber noch weniger konnte sie sich vorstellen, dass dieses Geschenk, durch das sie angeblich die Macht der Liebe nutzen konnten, nicht funktionierte.
»Das kann doch nicht wahr sein.«
Aghni seufzte und ließ sich auf den Findling neben ihr sinken. Sie strich sich eine Strähne ihres langen schwarzen Haares aus der Stirn und sah wieder auf. »Morgen ...« Sie seufzte tief. »Morgen wollen wir aufbrechen. Wir müssen weiter. Ich wünschte nur ...« Sie schluckte sichtbar.
»Wir kommen schon noch dahinter, wie diese Magie funktioniert.« Aufmunternd ergriff Nuada die Hand der Feuerfee, obwohl sie ihren Frust viel lieber laut den umstehenden Bäumen entgegen geschmettert hätte. Aber sie durfte nicht vergessen, wo sie sich befand. Sie musste stark wirken.
Den gesamten gestrigen Tag hatte sie mit Aghnis Freundin Nahél in der Bibliothek verbracht, um etwas über diese angebliche Macht von Akos und Ylonas Erben herauszufinden. Aber sie hatten kein einziges Wort gefunden. Auch nicht in den Schriften vom Ylonaschrein, die ihnen die königliche Priesterin gern zur Verfügung gestellt hatte. Nuada ließ Aghnis Hand wieder los und wippte träge von einem Fuß auf den anderen.
Seit der Beerdigung vor zwei Tagen fühlte sie sich leer. Sie hatte ihre Brüder verloren. Tränen kamen keine mehr, obwohl sie allen Grund gehabt hätte, immer und immer weiter zu weinen.
Ab morgen dürfte sie offiziell kämpfen lernen – als einzige Erbin des nidalischen Thrones, die noch infrage kam, stand ihr das rechtmäßig zu. Selbst wenn von ihrem Land nach dem Krieg nicht mehr viel übrig bleiben sollte. Nicht nur heimliches Fächerwinken mit Tjorgen, sondern richtiges Kampftraining erwartete sie. Und auch Magieunterricht. Seit sie denken konnte, hatte sie sich nichts mehr gewünscht. Und nun? Sie würde die Götter anbetteln, ein braves Prinzessinnenleben führen zu dürfen, bekäme sie ihre Brüder dafür zurück.
Nuada drehte das halbe Herz in ihrer Hand und betrachtete es von allen Seiten. Es bestand aus einem silbernen Metall, Platin vielleicht, mit einer bläulich schimmernden Legierung auf ihrer Hälfte. Sie ballte die Hand darum zur Faust. Hätte Safrani ihnen keine Anleitung hinterlassen können? Wäre das, bei all den Problemen, die sie gerade hatten, zu viel verlangt gewesen?
Auf ihr Nachfragen hin war Aghni eingeknickt und hatte ihr etwas über ihre Reise zu den Göttern und zum alten Rat der fünf Weisen erzählt. Obwohl Nuada so viel las und eigentlich angenommen hatte, für ihr Alter gut belesen zu sein – niemals hätte sie sich ausmalen können, dass diese Wesen ... dass es die Götter noch gab. Dass sie noch immer das Schicksal von Erakos und den Feen in ihren Händen hielten.
Hieß das auch, dass sie sich selbst ein Grab gemeißelt hatte? An Treás Totenbett hatte sie ein großes Versprechen an Ako und Ylona abgegeben: ihren Bruder zu rächen und Caldhra dafür büßen lassen, was sie ihrer Familie angetan hatte. Würden die Gottheiten sie persönlich bestrafen, wenn sie dieses nicht einhalten konnte? Oder wären sie der Meinung, dass sie so oder so schon genug gestraft war? Würde sie von ihnen verflucht werden? Sie wollte nicht darüber nachdenken, denn es steigerte nur ihre Angst, dass diese Gedanken sie bis in ihre Träume verfolgten.
»Was, wenn wir mit unserer Magie probieren, sie zu aktivieren?«, riss Aghni sie aus ihren Gedanken.
Nuada runzelte die Stirn. »Wir können es versuchen, aber glaubst du denn, dass die Ketten das aushalten?« Schließlich hatten sie bisher keinerlei Anzeichen gezeigt, überhaupt magische Kräfte in sich zu tragen – und das machte Nuada rasend.
»Sie wurden von Safrani erschaffen. Es würde mich wundern, wenn eine Göttin sie nicht gegen Magie immun gemacht hätte.«
Aufgeben kam nicht infrage – wenn Maris Worte stimmten und diese Anhänger wirklich die Macht der Liebe heraufbeschwören konnten ... Vielleicht könnte sie damit zumindest einen ihrer Brüder zu sich zurückholen. Selbst, wenn sie noch nicht wusste, ob sie Nevin jemals verzeihen konnte.
Nur musste sie dazu das Geheimnis der Kette lüften.
Sie nickte und nahm ihren Anhänger wieder vom Hals. »Bei deiner Wasser und bei meiner Feuer? Sie sollen schließlich am besten funktionieren, wenn wir sie zusammen nutzen.« Aghni schoss eine kleine Flamme auf ihr Schmuckstück. Es schimmerte leicht auf und zischte, ansonsten tat sich nichts. Nuada stapfte mit dem Fuß auf, lenkte aber einen kleinen Wasserstrahl auf Aghnis Kette. Es folgte die gleiche Reaktion.
»Ich verstehe das nicht. Irgendwie muss es doch funktionieren. Wie sollen die uns sonst helfen?« Sie stützte ihre Hände in die Hüfte. »Wenn es stimmt, was deine Großmutter Mari gesagt hat und Ylona dich für irgendwas ausgewählt hat ...«
»... heißt das nicht, dass ich das will!« Aghni knirschte mit den Zähnen. »Aber wenn Safrani der Meinung ist, wir wären die genannten Nachfahren von Ako und Ylona, müssen wir dieses Wissen nutzen. Es wird Caldhra Angst machen – denn genau das wollte sie immer verhindern.«
Obwohl Nuada das alles surreal vorkam, steckte die Hoffnung wie ein kleiner Anker tief in ihr. Sie glaubte sogar, dass Safrani richtig liegen könnte. Sie trug die Magie des Nephos in sich. Aber im Gegensatz zu ihren Brüdern hatte sie sich damit nie wohlgefühlt.
»Wasser kam mir zwar immer wie etwas Vertrautes vor«, versuchte sie zu erklären, »war aber dennoch wie ein Fremdkörper in mir. Ein Ruhepol, der mich gleichzeitig aufwühlte. Wissen war immer meine Heimat.« Aghni sah sie nachdenklich an und sie fügte rasch hinzu: »Seit ich lesen konnte, habe ich fast keinen Tag ohne Buch in den Händen verbracht. Jedes Wort inhaliert. Jeder Satz war wie ein Geschenk, der sich in mein Gedächtnis brannte wie deine Flammen in die Erde. Vieles verschwindet irgendwann wieder, dennoch fühlen sich Worte auf alten Papyrusrollen für mich viel mehr nach Magie an als ein griesgrämiger Meeresgott und jegliche Berührung mit Wasser, die ich je hatte. Nur wusste ich nie, was das bedeutet. Schließlich kann ich mit meinem Wissen keine Magie wirken – und schon gar keinen Kampf austragen. Aber als Treás erzählte, dass wir von Ako abstammen, da ... ergab plötzlich vieles in meinem Inneren Sinn.«
Aghni sah sie schief von der Seite an. »Magie muss nicht unbedingt sichtbar sein«, murmelte sie und fuhr die Maserung auf dem Stein unter ihr mit den Fingern nach. »Wirst du weiterhin von Prinz Tjorgen unterrichtet?«, wechselte sie urplötzlich das Thema.
Verwundert darüber, dass die Feuerfee sie auf Tjorgen ansprach, sah sie auf. »Ja, jetzt mehr denn je. Ich kann es mir nicht leisten, unter diesen Umständen schwach zu sein. Nicht kämpfen zu können. Seit der Totenzeremonie haben mich mehrere Angebote von Feen erreicht, die mich trainieren wollen. Seltsam, wie sich plötzlich alle um mich reißen. Wie ernst sie mich nehmen. Und das, obwohl sich nichts an mir verändert hat.«
Sie wollte wütend sein, jeden anschreien, aber alle begegneten ihr plötzlich mit einem nie da gewesenen Respekt. Von heute auf morgen wurde sie nicht mehr wie ein Kind behandelt. Ihre Worte bei Treás Totenfeier hatten ihr einiges an Ehrfurcht eingehandelt. Das frustrierte sie noch mehr – aber sie wollte Aghni nicht noch mehr runterziehen.
Die Feuerfee sah auf ihre Hände herab. Dann erhob sie sich, kam näher und fasste sie bei den Schultern.
»Ich würde dir gern helfen, Nuada. Der Druck auf dir war ...« Sie räusperte sich »Du hast vorher schon vieles erdulden müssen. Das wird nicht besser werden, nun, da ganz Erakos auf dich schaut. Ich kann sehr gut verstehen, wie du dich fühlst. Mächtige Männer …« Aghni runzelte die Stirn, dann korrigierte sie sich. »Mächtige Feen, oder jene, die nach Macht streben, werden es immer auf uns Frauen absehen. Ohne unseren Namen, unsere Titel, ohne unser Erbe und unsere Fähigkeit, gleichzeitig auch noch Kinder zu gebären, haben sie es viel schwerer, ihre Ziele zu erreichen.«
Sie schluckte und Nuada fragte sich unweigerlich, was ihr Bruder sich von einer Heirat mit ihr erhofft hatte, bevor er sich Caldhra angeschlossen hatte. Waren es wirklich nur Gefühle gewesen? Oder vielmehr die Aussicht darauf, König von Ching werden zu können? Wäre der Verrat an Aghni aus Nevins Sicht nicht nötig gewesen, wäre er König geworden?
Nuada schauderte es. Sie wollte sich gar nicht vorstellen, was Nevin dann alles hätte anrichten können. Wie viele Feen möglicherweise zu Schaden gekommen wären. Wobei, es stand außer Frage, dass ihnen Schlimmes bevorstand. Dieser Krieg würde nicht enden, wenn ihre Heimat fiel. Das war erst der Anfang.
Von ihren Eltern hatte sie kein Wort gehört. Obwohl sie ihnen direkt nach Treás Tod eine Nautilusnachricht geschickt hatte, gab es noch kein Lebenszeichen von ihnen. Der Gedanke schnürte ihr immer wieder die Kehle zu.
»Ich weiß nicht, inwieweit der maldôsische Prinz dir Magie beibringen kann«, nahm Aghni das lose Ende wieder auf. »Aber ich kann dir jemanden zur Seite stellen, dem ich bedingungslos vertraue. Kinan hat seine Treue mehrmals bewiesen. Zudem hat er dich und Prinz Tjorgen wieder sicher aus Gao hierher geleitet. Er ist wie ein großer Bruder für mich und kennt sich gut mit Techniken der Magie aus. Er hat mich zwar nicht direkt unterrichtet, aber ich habe nach meinen Privatstunden bei den Gelehrten immer mit ihm geübt.«
»Danke Aghni. Seine Unterstützung wäre toll.«
Die Feuerfee lächelte. »Außerdem möchte ich dich noch mit jemanden bekannt machen. Triff mich heute Nachmittag beim großen Übungsplatz. Ich hoffe, du hast robuste Kleidung dabei.«
Die Treppenstufen vor ihnen waren pechschwarz. Der schmale Weg, der über den Tempel des Nephos hinauf zur Residenz des Herzogs führte, stank nach verbrannten Kräutermischungen und Ölen. Auf der Ebene des Tempels gab es keine Balliste. Obwohl Nephos der Sage nach Nidalis mit viel Gewalt zu seinem Glauben gebracht und den des Ako fast vollständig ausradiert hatte, so hatten seine Priester geschworen, hier ein gewaltfreies Leben zu führen. Und anders als in Lormoralia glaubten sie sich in Alaith offenbar so sicher, dass sie nicht einmal Wachen aufstellten.
Sie passierten den Tempel ohne Zwischenfälle. Langsam wurde Davius unruhig. Noch hatte es keinerlei größere Probleme gegeben. Schon bald erreichten sie den Ausgang des Treppengewölbes. Vorsichtig wagte Davius einen Blick nach draußen. Der Sichelmond brach vereinzelt durch die Wolken. Anscheinend hatte sie dieser Gang genau an den Kraterrand geführt. Er hörte das Gurgeln und Rauschen des Wassers, das in die Kanalsysteme über schmale Aquädukte an die Ränder geleitet und von dort über das komplizierte Netz aus Kanälen an die Bevölkerung verteilt wurde. Und die dünnen Wasserfälle, die vom überschüssigen Wasser stammten und in die Grotte zurückfielen.
Unweit von ihnen erhob sich eine breitere Brücke, die zum Herzogsitz führte. Davor erkannte Davius die schemenhaften Umrisse von vier Wachposten. Die Brücke lag offen. Es gab keinerlei Sichtschutz. Damit würde er sich später befassen. Denn auch auf dem schmalen Kraterrand hatten die Wasserfeen Drachenballisten aufgestellt, eine für jede der Haupthimmelsrichtungen.
Er ließ seinen Blick über die harten Felskanten wandern. Das Gelände war so offen, dass es unmöglich war, ungesehen zu seinen Zielobjekten zu gelangen. Er könnte seine Männer wieder ein Stück bergabwärts bringen und von unten agieren. Aber dafür war nicht genügend Zeit. Oht und die Armee warteten auf das Zeichen, um anzugreifen. Er seufzte still. Weitere Magie zu nutzen hatte er nicht eingeplant. Er spielte an seinem Schwertknauf. Selbst Pfeile wären in diesem Gelände zu hören. Offensive wäre das Beste – wenn auch dumm und wahnsinnig waghalsig. Zu seinem Glück waren die Wege dunkel, als wären sie direkt aus dem Stein des Berges gehauen.
»Wer von euch beherrscht seine Magie gut?«, fragte er seine Assassinen.
»Ich bin nicht schlecht«, sagte Hakoen. »Und die beiden hier.« Er deutete auf einen Jüngling und einen kleinen, aber beleibten Mann.
»Gut. Wir teilen uns in vier Gruppen. Hakoen und ich nehmen die Ballisten weiter hinten, zu denen der Weg am längsten ist. Versucht, mit eurer Magie einen Schild über euch zu spannen, sodass wir auf dem dunklen Untergrund nicht zu sehen sind. Und geht zügig und leise, damit die Soldaten nicht auf uns aufmerksam werden. Betäubt sie mit dergleichen Strategie wie eben. Wenn ihr eure Balliste entschärft habt, verharrt in dessen Nähe, bis ich das Signal gebe!«
Davius schnappte sich Hakoen und wartete, bis die ersten beiden Gruppen ihre Arbeit erledigt hatten. Seine Finger kribbelten vor Aufregung.
Wie zu erwarten war das Adelshaus von Braton schon auf den Beinen – überall waren Wachen, die durch eine Explosion an der östlichen Balliste aufgescheucht worden waren. Mit ihrer Aktion hatten sie die ganze Burg aufgeweckt, aber das war Davius egal. Da sie weiterhin die Kleidung der Wache von Alaith trugen, waren sie noch nicht aufgeflogen. Der Trubel kam ihm sogar recht. Er warf einen kurzen Blick auf den Anführer. Vielleicht war er Herzog Deoras’ Sohn.
Später, sagte er sich. Nur noch die eine Balliste, dann hatte er, was er wollte. Er zog sich mit seinen Männern in einen Seitengang zurück.
»Versucht, nicht aufzufallen. Hakoen und ich gehen dort nach oben und schalten das letzte Geschoss aus. Ihr seht zu, dass ihr aus dem Schatten heraus so viele wie möglich tötet. Lasst euch nicht erwischen. Falls ihr umstellt seid, wisst ihr, was zu tun ist.«