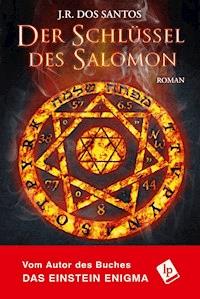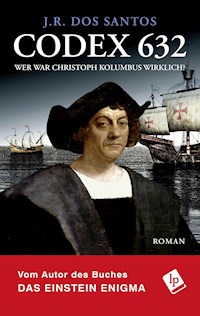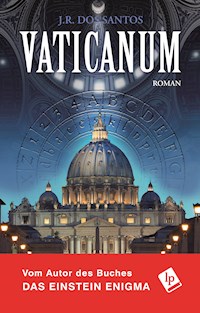
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: luzar publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tomás Noronha-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ist Papst Franziskus das letzte Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche? Die zahlreichen jahrhundertealten Prophezeiungen scheinen sich zu bewahrheiten, als ein Kommando der Terrororganisation „Islamischer Staat“ den Heiligen Vater entführt. Exakt um Mitternacht soll im Internet seine Hinrichtung live zu sehen sein. Historiker Tomás Noronha, der im Auftrag des Vatikans das Grab des Apostels Petrus erkundet, sieht sich sofort in die Ermittlungen rund um die Entführung des Pontifex Maximus verwickelt. Schnell stößt Noronha auf immer mehr Hinweise, die das dunkelste Geheimnis von Vatikanstadt sowie ihre mafiösen Machenschaften offenbaren. Und der Wettlauf gegen die Uhr beginnt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J.R. Dos Santos
Vaticanum
Roman
Aus dem Portugiesischen von Viktoria Reich
Im Original erschienen unter dem Titel „Vaticanum“
© José Rodrigues dos Santos/Gradiva Publicações, S.A., 2016
Copyright der deutschen Übersetzung
© 2019
luzarpublishing
www.luzarpublishing.com
Gefördert von der Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas
Redaktion: Brigitte Caspary, Egloffstein
Covergestaltung: Armando Lopes, Paz
Umschlagfotos: Shutterstock / Anton Balazh (Petersdom); Shutterstock / photogolfer (Kuppelgewölbe)
Umschlagadaptation und Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe
ISBN 978-3-946621-05-8
INHALT
VORGESCHICHTE
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
Kapitel XLVIII
Kapitel XLIX
Kapitel L
Kapitel LI
Kapitel LII
Kapitel LIII
Kapitel LIV
Kapitel LV
Kapitel LVI
Kapitel LVII
Kapitel LVIII
Kapitel LIX
Kapitel LX
Kapitel LXI
Kapitel LXII
Kapitel LXIII
Kapitel LXIV
Kapitel LXV
Kapitel LXVI
Kapitel LXVII
Kapitel LXVIII
Kapitel LXIX
Kapitel LXX
Kapitel LXXI
Kapitel LXXII
Kapitel LXXIII
Kapitel LXXIV
Kapitel LXXV
Kapitel LXXVI
Kapitel LXXVII
Kapitel LXXVIII
Kapitel LXXIX
Kapitel LXXX
Kapitel LXXXI
Kapitel LXXXII
Kapitel LXXXIII
Kapitel LXXXIV
Kapitel LXXXV
Kapitel LXXXVI
Kapitel LXXXVII
Kapitel LXXXVIII
Kapitel LXXXIX
Kapitel XC
Kapitel XCI
Kapitel XCII
Kapitel XCIII
Kapitel XCIV
Kapitel XCV
Kapitel XCVI
Kapitel XCVII
Kapitel XCVIII
Kapitel XCIX
Kapitel C
Kapitel CI
NACHGESCHICHTE
SCHLUSSBEMERKUNG
Hinweis
Alle in diesem Buch enthaltenen historischen Informationen beruhen auf wahren Begebenheiten, die lediglich an die Romanhandlung angepasst wurden. Geändert wurden dabei nur die Namen der beteiligten Personen und Jahreszahlen, nicht jedoch die Inhalte der Entdeckungen oder ihre Bedeutung.
Die Romanserie um Tomás Noronha erscheint auf Deutsch in anderer Reihenfolge als im portugiesischen Original. In Absprache mit dem Autor haben wir uns entschieden, zunächst seinen bekanntesten Titel, „Das Einstein Enigma“, zu veröffentlichen und anschließend mit einem verwandten Thema („Der Schlüssel des Salomon“) fortzufahren, anstatt die chronologische Reihenfolge einzuhalten. Das Leben von Tomás Noronha im deutschsprachigen Raum verläuft also nicht linear, aber jeder Roman kann völlig eigenständig gelesen werden.
José António Afonso Rodrigues dos Santos ist TV-Moderator und Sprecher der Abendnachrichten des portugiesischen Senders RTP1, mehrfach ausgezeichneter Kriegsberichterstatter und ehemaliger Dozent für Journalismus an der Neuen Universität Lissabon. Er hat das Talent, selbst anspruchsvollste Sachverhalte leicht und spannend zu vermitteln.
Mit seinen Büchern erreicht er ein Millionenpublikum und regelmäßige Bestsellerauflagen, insbesondere mit Das Einstein Enigma (430.000 Exemplare in Frankreich, 220.000 Exemplare in Portugal), das zudem verfilmt werden soll. 17 Romane und 7 politische Sachbücher liegen mittlerweile von ihm vor. Insgesamt wurden mehr als 3 Millionen seiner Bücher verkauft, in bis zu 20 verschiedenen Sprachen.
Folgende Werke sind oder werden demnächst bei luzarpublishing veröffentlicht: Das Einstein Enigma; Der Schlüssel des Salomon; Codex 632; Das letzte Geheimnis Jesu; Furia Divina; Zeichen von Leben und das vorliegende Vaticanum.
José Rodrigues dos Santos lebt in Lissabon.
Der Autor informiert regelmäßig über aktuelle Ereignisse unter: www.joserodriguesdossantos.com
Für meine drei FrauenFlorbela, Catarina und Inês.
»Niemand kann zwei Herren dienen:entweder er wird den einen hassen und den andern lieben,oder er wird dem einen anhängen und den andern verachten.Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.«Matthäus 6, 24
»Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein.Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle.«Matthäus 21, 13
VORGESCHICHTE
2016
Die beiden Männer stiegen die Treppe hinauf, ihr Weg nur erhellt vom Licht der Taschenlampen, die sie in den behandschuhten Händen hielten. Sie bewegten sich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze. Völlig in Schwarz gekleidet glitten sie wie unsichtbar durch den Schatten. Sogar ihr Kopf war von schwarzem Stoff verhüllt und ließ nur einen horizontalen Schlitz um die Augen frei.
Im ersten Stock hielten sie an, und der Erste hob die Hand, Stille gebietend. Sie horchten einige Momente in die Dunkelheit, hörten jedoch nichts und atmeten beruhigt auf. Langsam und vorsichtig öffnete der Anführer die Tür einen Spalt breit.
Alles schien ruhig.
„Ibn Taymiyyah, bist du bereit?“
Die Frage wurde nach hinten gehaucht, und der Mann, der ihm folgte, nickte.
„Möge Allah uns führen, Abu Bakr.“
Abu Bakr betrat entschlossen den Flur des ersten Stocks. Nur mühsam durchdrangen die unruhigen Lichter seiner Taschenlampe die Finsternis.
Er warf einen fragenden Blick auf seinen Partner, der ihm im Abstand von wenigen Metern folgte.
„Wo ist es?“
Als Antwort zog Ibn Taymiyyah einen Zettel aus der Jackentasche, hielt ihn unter seine Lampe und las die Anweisungen.
„Die zweite Tür.“
Auf leisen Sohlen schlichen sie dorthin. Dann beugte sich Abu Bakr vor, um das Schloss zu inspizieren, deutete mit dem Kopf auf den Sack, den sein Begleiter trug, und kommandierte: „Den Brenner.“
Ibn Taymiyyah nahm einen kleinen, blauen Zylinder aus dem Sack und reichte ihn Abu Bakr. Der drehte den Sicherungshebel, setzte das Butangas frei und entzündete den Lötbrenner. Er richtete die violette Flamme direkt auf das Schloss, dessen Metall sich in wenigen Sekunden auflöste. Mit einem einfachen Stoß öffnete Abu Bakr die Tür.
Mucksmäuschenstill traten die zwei Männer in das Büro und wandten sich, ihren Anweisungen folgend, sofort zum Safe, der unter dem Schreibtisch in ein Geheimfach eingebaut war. Abu Bakr drehte am Zahlenschloss, und nach einer Reihe von Klicks und einem abschließenden Klack öffnete sich der Safe.
„Fertig!“, flüsterte Abu Bakr, und der schwarze Stoff, der sein Gesicht verhüllte, verbarg ein triumphierendes Lächeln. „Wir sind besser als Ali Baba!“
Er entnahm dem Safe ein Bündel Geldscheine, das er seinem Begleiter übergab. Ibn Taymiyyah zählte die Scheine und schüttelte, beinahe enttäuscht, den Kopf.
„Vierhundert Euro …“
Abu Bakr zuckte gleichgültig mit den Schultern und wandte sich wieder dem Ausgang zu.
Nachdem er das Geld in den Sack gesteckt hatte, verließen die beiden Männer das Arbeitszimmer, ohne sich weiter um den Safe zu kümmern.
Während der nächsten halben Stunde wiederholten sie in sämtlichen Büros des ersten Stocks den Vorgang, indem sie mit dem Lötbrenner die Türschlösser einschmolzen und alles Geld mitnahmen, das sie in den Safes fanden. Sechshundert Euro hier, dreihundert dort, fünfhundert da, in Hunderterschritten wuchs ihre Beute.
Nachdem sie die ganze Etage leergefegt hatten, verharrte Abu Bakr am Anfang des Korridors und sah sich um. Alle Türen waren geschlossen, als sei nichts geschehen. Nur wer sehr aufmerksam hinschaute, nahm die geschmolzenen Schlösser wahr.
„Der erste Stock ist erledigt.“
Dann wandten sie sich zum Treppenhaus und stiegen in den zweiten Stock. Wieder fanden sie alles ruhig vor und setzten ihre Arbeit ungestört fort. Genau wie zuvor öffneten sie nach und nach alle Türen, von denen sie wussten, dass sich dahinter ein Safe verbarg, und entnahmen das ganze dort verwahrte Geld. Es war wieder nicht viel – ein paar hundert hier, ein paar hundert dort –, nichts, was sie reich gemacht hätte.
Als sie auch im zweiten Stock den letzten Safe ausgeräumt hatten, setzte Ibn Taymiyyah den Sack ab, nahm das Geld heraus und stapelte es auf dem Boden.
„Jetzt haben wir hundert, zweihundert, dreihundert…“
„Bei Allah, was tust du da?“, fragte ihn Abu Bakr. „Bist du verrückt geworden?“
„Ich zähle“, sagte der andere und fuhr nach einer kurzen Pause fort: „Vierhundert, fünfhundert, sechshundert …“
„Hör auf, du Idiot! Siehst du nicht, dass wir dafür keine Zeit haben?“
„Nur ganz schnell!“, bettelte der Jüngere. „Siebenhundert, achthundert, neunhundert …“
Abu Bakr näherte sich dem bedeckten Gesicht seines Begleiters und drückte seine Nase gegen die des anderen.
„Entweder hörst du jetzt auf, oder ich …“
Ein Pfiff, der vom Flur kam, ließ ihn verstummen. Blitzschnell löschten die beiden Eindringlinge ihre Lampen, und Abu Bakr glitt zur Tür, um sie sanft zu schließen.
Der Pfiff kam vermutlich vom Nachtwächter. Der Mann hatte allem Anschein nach die unglückliche Idee, gerade in diesem Augenblick seine Runde zu drehen, auch wenn alles darauf hindeutete, dass er noch nichts von den geschmolzenen Türschlössern bemerkt hatte. Allerdings gab es auch eine andere Möglichkeit, die man nicht außer Acht lassen durfte: Vielleicht hatte der Wächter den Einbruch schon bemerkt und verstellte sich nur.
Als er die Tür geschlossen hatte, richtete sich Abu Bakr auf und zückte mit einem Ruck den Dolch, den er am Gürtel trug. Wenn der Wachmann einträte, wäre er ein toter Mann. Abu Bakr lehnte sich an die Wand hinter der Tür und wartete. Das Pfeifen wurde lauter; es war der Wachmann, der durch den Flur ging und die Filmmelodie von Rampenlicht vor sich hinpfiff, bis er ausgerechnet vor der Bürotür stehenblieb, hinter der sich die Einbrecher befanden. Dann unterbrach er plötzlich das Pfeifen.
Abu Bakr hielt den Atem an und bereitete sich auf den Kampf vor.
„Pronto?“, sagte plötzlich eine Stimme auf Italienisch. „Sind Sie da?“
Sie waren entdeckt!, dachte Abu Bakr. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Was sollten sie tun? Warten, bis der Wächter einträte, um ihn zu überwältigen und ihm die Kehle durchzuschneiden? Oder besser initiativ werden und ihn auf dem Korridor angreifen? Die erste Möglichkeit schien ihm günstiger; so hatte er wenigstens einen gewissen Überraschungseffekt auf seiner Seite, aber auch das Risiko, dass der Wachmann gar nicht eintrat, sondern stattdessen den Alarm auslöste. Dann würden sie die Kontrolle über die Situation komplett verlieren.
Das Beste, entschied er, war wirklich, den Mann vorbeugend auszuschalten.
„Ich möchte einen Termin für sechs Uhr früh ausmachen, per favore“, hörten sie.
Mit Schweißtropfen, die ihm die Schläfen hinunter übers Gesicht liefen, ließ Abu Bakr seine Hand bis zum Türgriff gleiten und bereitete sich, leise wie ein Mudschahedin, darauf vor, zur Tat zu schreiten. Er würde dem Wächter das Messer in den Rücken oder in die Brust stechen, bevor er ihn an den Haaren packen und ihm die Kehle durchschneiden würde, wie der Prophet, möge er in Frieden ruhen, es mit den Kafirun, den Ungläubigen, während seines heiligen Dschihad getan hatte. Das wäre zwar blutig und nicht ohne Risiko, aber die beste Lösung.
Dann bereitete er das Messer vor, kontrollierte seine Atmung und den Herzschlag und zählte im Geist bis drei.
Eins…
Möge geschehen, was geschehen musste, der Wächter musste beseitigt werden, wenn die Operation, von der dieser Überfall nur der erste Schritt war, nicht unwiderruflich in Gefahr gebracht werden sollte.
Zwei…
„Francesca ist zu der Zeit frei? Wer ist sie? Die mit den großen Brüsten?“, wollte der Wachmann auf dem Flur wissen. „Benissimo!“ Er machte eine Pause. „Wo finde ich sie? An der Piazza Cavour? In Ordnung. Um sechs Uhr bei Francesca. Bis dann.“
Abu Bakr hielt sich gerade noch zurück und verharrte dicht hinter der Tür. Offensichtlich hatte der Wächter nicht etwa die Eindringlinge entdeckt, sondern war nur stehengeblieben, um einen Anruf zu tätigen und nach seiner Nachtschicht ein Treffen mit einer Prostituierten auszumachen. Ah, wie verdorben die Kafirun waren!
Mit dem Rücken seines schwarzen Handschuhs wischte Abu Bakr sich den Schweiß ab, trat einen Schritt zurück und atmete erleichtert auf. Er wartete noch zwei Minuten, nachdem auf dem Korridor wieder Stille eingekehrt war, dann flüsterte er in Richtung seines Begleiters, der sich hinter einem Schreibtisch versteckt hatte.
„Yellah!“, befahl er. „Komm!“
Die Ausmaße und der gute Geschmack der Einrichtung des Büros im vierten und letzten Stock bewiesen, dass dies die wichtigste Abteilung des ganzen Gebäudes war. Nachdem er die Anweisungen auf dem Papier seines Begleiters überprüft hatte, richtete Abu Bakr die Laterne auf das große Bild, das an der Wand hinter dem Schreibtisch hing.
Der wackelnde Lichtkegel offenbarte das selige Lächeln eines ganz in Weiß gekleideten Mannes mit einem weißen Käppchen auf dem Kopf und ebenfalls weißer Mozetta und Soutane. Auf seiner Brust hing ein mächtiges dunkles Metallkreuz, und die rechte Hand war erhoben, als segnete er den Betrachter.
„Aha, der Chef der Kreuzfahrer!“, knurrte Abu Bakr sarkastisch. „Ich vertreibe dir schon noch dein dummes Lächeln, untreuer Hund und Verkünder falscher Wahrheiten!“
Die Arme ausbreitend, nahm er das Bild mit der Fotografie des Papstes von der Wand und stellte es auf den Boden. Das Licht der Taschenlampe seines Begleiters suchte augenblicklich die Strukturen ab, die das Bild verborgen hatte.
„Dort sind sie!“
In der Tat befanden sich die sechs Safes genau an der Stelle, die auf dem Papier mit den Anweisungen angezeigt war. Sie näherten sich der Sequenz der Metalltüren und betrachteten sie mit Genugtuung. Die Mission hatte ihren Höhepunkt erreicht.
Abu Bakr streckte die Hand aus.
„Die Anweisungen?“
Statt ihm sofort das geforderte Stück Papier auszuhändigen, überprüfte Ibn Taymiyyah seinen Inhalt.
„Es ist der zweite von rechts.“
Mit einer ungeduldigen Handbewegung bestand Abu Bakr darauf, dass Ibn Taymiyyah ihm das Papier gab. Dann näherte er sich dem angezeigten Safe. Er studierte den Mechanismus, prüfte den auf das Papier gekritzelten Geheimcode und gab ihn in den Mechanismus ein, Ziffer um Ziffer.
Als er das Prozedere beendet hatte, ließ die gepanzerte Metalltür ein metallisches Klicken hören und öffnete sich sanft.
„Maschallah!“, rief er aus. „Gott sei Dank!“
Nachdem die beiden Männer einen zufriedenen Blick gewechselt hatten, leerte Abu Bakr den Safe und nahm vorsichtig alle Dokumente heraus. Er prüfte sämtliche Titel und ersten Seiten, um sicherzugehen, dass der Inhalt vollständig war.
Nach fünf Minuten hob er den Daumen.
„Hier ist Material genug, um diesen Hund und sein ganzes Pack von Kafirun unter die Erde zu bringen!“
Er verstaute die Dokumente im mitgebrachten Sack. Anschließend nahm er eine Sprühdose mit schwarzer Farbe und sprühte eine Art Graffiti über das Bild des Papstes.
Schließlich hob er den Sack auf und warf ihn sich über die Schulter.
„Los, gehen wir“, sagte er.
„Und die anderen Safes?“, fragte Ibn Taymiyyah erstaunt. „Öffnen wir die nicht auch?“
„Nein.“
„Aber den Anweisungen nach sollten wir doch alle öffnen!“
Abu Bakr blieb an der Tür stehen, sein dunkler Schatten tanzte unruhig an der Wand.
„Die Anweisungen haben aber auch nicht vorgesehen, dass der Nachtwächter seine Runden macht“, entgegnete er trocken. „Gehen wir, bevor der Ungläubige zurückkommt.“
Er drehte sich um, löschte seine Lampe, trat aus dem Büro und tauchte in den düsteren Korridor wie ein Gespenst, das mit der Nacht verschmilzt.
I
Die schwül-warme Luft der Katakomben roch modrig. Nachdem Tomás Noronha seinen Sicherheitshelm noch einmal zurechtgerückt hatte, bedeutete er Maria Flor, ihm zu folgen und leuchtete mit seiner Taschenlampe den Weg. Nervös zuckten die Lichtstrahlen über die vom Zahn der Zeit angegriffenen Wände und verloren sich kurz darauf in einem größeren Raum, der sich plötzlich vor ihnen öffnete.
Der Historiker blieb stehen und schaute sich um; sie standen vor einer Art Halle voller Trümmer.
„Brrr, ist das unheimlich“, sagte Maria Flor. „Wo sind wir hier?“
„Unter den Vatikanischen Grotten“, antwortete Tomás. „Genauer gesagt an deren südlichem Ende. Je weiter wir vorangehen, desto weiter gehen wir in der Zeit zurück. Dieser Teil hier stammt aus dem 3. Jahrhundert, da hinten beginnt das 2. Jahrhundert und noch weiter das 1. Jahrhundert.“
Ihre Stimmen hallten in dem geschlossenen Raum wider, verstärkt durch das in die Felswände gehauene System von Gängen und Gassen sowie die Fenster der umgebenden Mausoleen. An der Decke bildeten sich durch die hohe Luftfeuchtigkeit winzige Tropfen, die in einem unregelmäßigen Rhythmus zu Boden fielen, und deren Echo die Ruinen mit einem leisen Plätschern erfüllte. Hier schienen sich die Geister der Verstorbenen, die in den vergessenen und vom Staub der Jahrhunderte bedeckten Krypten ruhten, ein Stelldichein zu geben.
Wenig später erhellte der Schein ihrer Taschenlampe eine merkwürdige Struktur zwischen den Trümmern vor der großen, rot verputzten Wand dahinter. Tomás blieb stehen.
„Wir sind da. Hier beginnt das 1. Jahrhundert.“
„Was ist das?“
„Das Feld P.“
Das Licht seiner Taschenlampe fiel auf eine etwa achtzig Zentimeter hohe Marmorsäule, dann eine rechtwinklig abgehende Wand und schließlich auf die von der Säule getragene Marmorplatte mit zwei übereinander liegenden Nischen; das Ganze erinnerte an ein Vordach, konnte in einer Nekropole aber nichts anderes sein als eine Ädikula. Zu diesem „Tempelchen“ gehörten ursprünglich zwei Säulen, von denen jedoch nur eine erhalten war.
Maria Flor deutete auf die Reste des Denkmals.
„Das ist das Feld P?“
„Nein“, antwortete Tomás, und näherte sich dem in den Stein gehauenen Mausoleum. „Das Feld P ist der gesamte, für die Öffentlichkeit gesperrte Bereich, in dem wir uns befinden. Das hier ist offensichtlich das Tropaion des Gaius.“
„Das was?“
„Das Tropaion des Gaius.“
„Und was ist das?“
Tomás richtete sich auf und schaute sich um; die Fläche vor ihm war rechteckig und etwa sieben Meter lang, der Boden bedeckt von Steinen und Gräbern von Personen, die wahrscheinlich bescheidenerer Herkunft waren als diejenigen, deren Gebeine zur ewigen Ruhe in den Mausoleen begraben waren.
„Das ist die Entdeckung, die mir seit unserer Ankunft in Rom nicht aus dem Kopf geht.“
„Ich dachte, du wolltest das Grab des heiligen Petrus finden …“
Tomás nahm den Rucksack mit dem archäologischen Werkzeug von den Schultern und setzte ihn behutsam neben der Säule auf den Boden.
„Das Tropaion des Gaius ist das Petrusgrab, meine Liebe. ‚Feld P‘ ist die archäologische Bezeichnung für Petrusfeld.“
Skeptisch schaute seine Verlobte die Säule an.
„Das da ist ein Grab?“
„Ja. In diesem Bereich hier hat man Petrus gekreuzigt und seine sterblichen Überreste anschließend beigesetzt. Wir befinden uns hier im Grabmal von Simon, dem ersten Apostel, dem Sünder, zu dem Jesus angeblich sagte, er sei ‚der Fels‘, auf dem er seine Kirche bauen wolle. Das Wort ‚Fels‘ liegt auch dem Namen zugrunde, unter dem Shimon, oder Simon, ewige Berühmtheit erlangte: Petrus. Im Lateinischen heißt Fels petra. Simon, der Fels, oder Petrus, der erste Papst.“
„Woher weißt du das?“
„Woher weiß ich was?“, entgegnete er mit leicht spöttischem Unterton. „Dass Petrus Simon der Sünder war, der Jesus begleitete und der in der Folge der erste Papst wurde?“
„Quatsch, das natürlich nicht! Ich meine, woher weißt du, dass es hier ist, wo Petrus gekreuzigt und beigesetzt wurde.“
„Alle antiken Quellen, wie Tertullia im Jahr 195 oder Eusebius von Caesarea 325, bescheinigen, dass Petrus der Bischof von Rom war und dass er im Rahmen der Christenverfolgung unter Kaiser Nero im Jahr 64 gekreuzigt wurde. In einem apokryphen Text, den sogenannten Petrusakten, heißt es, er wurde mit dem Kopf nach unten ans Kreuz geschlagen, was indirekt das Johannesevangelium und eine andere von Eusebius genannte Quelle bestätigen.“
Maria Flor deutete beharrlich auf die Marmorstruktur und die Säule.
„Meinetwegen, aber woher weißt du, dass sich das ausgerechnet hier ereignet hat? Gibt es irgendwo eine Inschrift?“
„Nein, aber uns liegen mehrere entsprechende Hinweise vor, angefangen mit einem Zitat von Eusebius, dem ersten Kirchenhistoriker. Ihm zufolge schrieb ein Priester, der berühmte Gaius, im Jahr 200, es sei möglich, das Tropaion des Petrus unter dem Vatikanischen Hügel von Rom zu besuchen.“
Verdutzt schaute Maria Flor auf.
„War das hier damals schon der Vatikan?“
„Selbstverständlich“, bestätigte Tomás. „Zur Zeit Neros lag dieses Gelände außerhalb der Stadtgrenze Roms und galt als ungesund. Plinius der Ältere schrieb beispielsweise, dass der Vatikanische Hügel von Mücken und Schlangen verseucht gewesen sei. Offenbar gab es irgendwo einen Garten. Und später hat Kaiser Caligula einen Circus errichten lassen, ein Stadion für Wagenradrennen; dessen Fundamente wurden übrigens am südlichen Abhang des Hügels entdeckt. Der ägyptische Obelisk mitten auf dem heutigen Petersplatz war ein Teil davon. Und den Chroniken zufolge wurde Petrus nach dem Brand von Rom, den man den Christen anlastete, in eben diesem Circus des Caligula gekreuzigt.“
„Aber woher weiß man, dass Petrus exakt hier hingerichtet und begraben wurde?“
„Diese Nekropole gab es damals schon, und es ist daher wahrscheinlich, dass die Reste des heiligen Petrus hierher gebracht wurden, wie Gaius es schrieb. Übrigens kannst du sehen, dass dieses Mausoleum in die rote Wand hinein gegraben wurde. Warum? Es wäre doch einfacher gewesen, das Mausoleum neben der roten Wand zu bauen, anstatt sich die Mühe zu machen, es aus dem Stein zu hauen. Dass man es nicht getan hat, ist ein Zeichen dafür, dass es sehr wichtig war, das Mausoleum trotz aller Hindernisse genau an dieser Stelle zu errichten. Es musste exakt dieser Ort sein. Außerdem vergiss nicht, dass im Jahr 324 Kaiser Konstantin beschlossen hat, an dieser Stelle die Petersbasilika erbauen zu lassen. Wieso hier? Er muss wohl einen guten Grund dafür gehabt haben, findest du nicht? Nun, welch besseren Grund könnte es geben als den, dass Petrus, der Fels auf dem die Kirche gebaut werden sollte, an dieser Stelle am Kreuz gestorben war?“
„Schon, aber er könnte doch auch hier gekreuzigt und woanders beigesetzt worden sein …“
Der Historiker bückte sich und fuhr mit der flachen Hand über den feuchten Boden. Als er Maria Flor die Handfläche entgegen hielt, war sie ganz rot.
„Was ist das deiner Meinung nach für ein Gestein?“
Maria Flor wiegte ihren Kopf.
„Ton?“
„Ganz genau“, sagte Tomás und fuhr mit dem Finger über den Boden. „Hast du diese leichte Schräge bemerkt?“
Jetzt, wo ihr Verlobter sie darauf aufmerksam machte, sah auch Maria Flor, dass der Untergrund leicht geneigt war.
„Ja.“
„Zwischen dem nördlichen und südlichen Punkt der ersten Basilika lagen ursprünglich elf Meter Höhenunterschied, die durch Abtragen und Aufschütten mühsam ausgeglichen werden mussten. Dies und der tonhaltige Boden machen den Standort hier für ein solches Bauwerk sehr ungeeignet, denn es gefährdet seine Stabilität und Sicherheit. Und das wussten garantiert auch die römischen Architekten. Übrigens ist das Gefälle derart stark, dass besonders tiefe Fundamente und extra dicke Stützmauern nötig waren. In Anbetracht all dieser Schwierigkeiten stellt sich erst recht die Frage: Wieso haben die frühen Christen darauf bestanden, die erste Petersbasilika ausgerechnet hier zu bauen?“
„Weil hier der heilige Petrus gekreuzigt wurde, wie du schon gesagt hast. Aber meine Frage war …“
„Es ist wichtig, dass du verstehst, dass hier die Ruinen von drei Bauwerken zu finden sind: der Circus des Caligula, die Katakomben der frühen Christen und die erste Basilika, die unter Kaiser Konstantin erbaut wurde. Der heutige Petersdom, dessen Bau 1513 begann, wurde genau wie die anderen Gebäude des Vatikans auf den Ruinen der ersten Basilika errichtet.“
„In Ordnung, es gibt also drei archäologische Niveaus unter dem Dom. Und weiter?“
„Nun, es war kein Zufall, dass die erste Basilika genau so um die ältere Marmorkonstruktion mit den beiden Säulen erbaut wurde, dass diese im Mittelpunkt des Allerheiligsten zu stehen kam. Dadurch betonten die Erbauer eindeutig ihre Bedeutung. Und warum war dieser Ort so wichtig? Was hatte er so Besonderes?“
„Ja, ja, ich habe verstanden, dass Petrus hier hingerichtet wurde“, sagte Maria Flor gereizt. „Aber das ist doch keine Garantie dafür, dass man ihn hier auch beigesetzt hat.“
„Damals war es bei den Christen üblich – und vom römischen Recht genehmigt –, ihre Angehörigen in der Nähe des Ortes beizusetzen, an dem sie gestorben waren. Außerdem wurden die sterblichen Überreste natürlich stärker verehrt als der Ort des Todes. Deshalb zeigt die Tatsache, dass die Nekropole, die erste Basilika und der heutige Dom allesamt hier erbaut wurden, wie wichtig dieser Ort ist. Übrigens lag der Circus des Caligula zwar auf dem Vatikanischen Hügel, aber etwas weiter weg; sprich, dieser Ort hier lag außerhalb des Circus und ist somit höchstwahrscheinlich nicht identisch mit dem Ort der Kreuzigung. Wieso also sollte man ein derart wichtiges Mausoleum exakt hier errichten?“
Maria Flor runzelte die Stirn. In Anbetracht all der Erklärungen lag die Antwort quasi auf der Hand.
„Also gut … höchstwahrscheinlich, weil es sich um die Grabstätte des heiligen Petrus handelt.“
„Genau!“, rief Tomás und sprang auf. „Du kannst übrigens sehen, dass die erste Basilika nicht exakt gleich ausgerichtet ist wie die Nekropole oder der Circus. Sie weicht um ein paar Grad davon ab. Wenn sie aber nicht wie die alten Ruinen ausgerichtet ist, woran dann?“ Er deutete auf die rote Wand. „An dieser alten Mauer, auf der die Struktur der Grabkapelle beruht. Und das, meine Liebe, beweist, dass diese Grabstätte mit ihren beiden Säulen von höchster Bedeutung war. Wenn man alles zusammennimmt, kann dieser Ort nichts anderes sein als das von Gaius erwähnte Petrusgrab.“
Maria Flor nickte langsam.
„Wahrscheinlich hast du recht.“
Ihr Verlobter fuhr zärtlich über die Säule und entfernte den Staub, der sich im Laufe der Zeit auf ihr gesammelt hatte.
„Übrigens wurde auch der heutige Dom so gebaut, dass dieses Grabmal exakt unter der Confessio liegt, also dem Andachtsraum vor dem Heiligengrab, in dem der Überlieferung zufolge Petrus begraben wurde. Die Confessio stammt aus dem Jahr 160, was einmal mehr dem Tropaion des Gaius entspricht. Um dieses Mausoleum herum ließ Kaiser Konstantin die erste Petersbasilika bauen.“ Tomás hob den rechten Zeigefinger. „Und im heutigen Petersdom steht – mitten unter der imposanten Kuppel – oberhalb des Tropaion und der Kapelle mit der Confessio der großartige bronzene Baldachin, der den Papstaltar beherrscht und von Bernini entworfen wurde, dem größten Bildhauer und Architekten des Barock. Seither haben alle Päpste von diesem Altar aus ihre heiligen Messen zelebriert. Das kann kein Zufall sein.“
Maria Flor betrachtete die Marmorstruktur mit neuem Interesse.
„Wenn der heilige Petrus tatsächlich hier begraben wurde, wo sind dann seine Knochen?“
Auf diese Frage gab Tomás keine Antwort, sondern kratzte sich am Kopf. Waren die sterblichen Überreste des einstigen Begleiters Jesu noch erhalten? Wenn ja, wo könnten sie sein, und wie wären sie zu finden? Die Antwort darauf war kompliziert.
II
Nachdem er den Boden rund um das Tropaion gesäubert hatte, legte Tomás einige Werkzeuge in eine Nische in der Wand nahe der verschwundenen Säule. Er würde die Hacke und Schaufeln erst später brauchen.
Dann setzte er seinen deutlich leichter gewordenen Rucksack wieder auf und zwängte sich durch ein Loch in der roten Mauer.
„Komm“, forderte er Maria Flor auf.
„Wohin gehen wir?“
„Arbeiten, natürlich. Wir sind schließlich nicht zum Spaß hier. Und da du mich heute unbedingt begleiten wolltest, kannst du mir jetzt auch helfen.“
In Wahrheit wäre Maria Flor viel lieber durch Rom spaziert und shoppen gegangen, als den ganzen Tag lang in den Katakomben unter dem Vatikan umher zu irren, aber sie wollte auch einmal Zeit mit Tomás verbringen, und so fügte sie sich jetzt in ihr selbstgewähltes Schicksal. Sie würde am nächsten Tag wieder tun, wonach ihr der Sinn stand, während ihr Verlobter weiter an seinen Ausgrabungen arbeitete.
Sie bückte sich also und schlüpfte ebenfalls durch die Öffnung in der Wand, zurück in den Bereich der kleineren Grabmale hinter dem Feld P.
„Was hast du vor?“
„Ich habe eine Bestandsaufnahme aller Grabkammern hinter dem Tropaion gemacht“, sagte Tomás und wies auf die Steinruinen um sie herum. „Hier gibt es zahlreiche Knochenreste, die untersucht werden müssen, und dafür hat der Vatikan mich engagiert. Sie wollen wissen, wer wer ist.“
Maria Flor blickte sich um. Hier roch die Luft noch unangenehmer und feuchter als bisher.
„Uh, hier ist es wirklich düster“, sagte sie. „Wie konnte dieser Bereich in zweitausend Jahren bloß so herunterkommen?“
„Ganz einfach, die Katakomben waren mehr als tausend Jahre lang in Vergessenheit geraten.“
Maria Flor machte große Augen.
„Man hat sie einfach vergessen?“
„Ja.“
„Und wann hat man sich wieder an sie erinnert?“
„Während des Zweiten Weltkriegs, 1939. Als Papst Pius XI. starb, gab er in seinem Testament an, er wolle unter dem Dom beigesetzt werden, in den alten Grotten unmittelbar unter der Confessio des heiligen Petrus, der berühmten Krypta, in der sich laut Überlieferung das Petrusgrab befand. Was konnte es für einen Papst Größeres geben, als neben dem ersten Papst der Geschichte begraben zu werden?“
„Ich verstehe. Und dabei hat man all das hier unten entdeckt…“
„Ganz genau. Als sie dort hinabgestiegen sind, haben die Sanpietrini, das sind die Spezialarbeiter des Vatikans für die Instandhaltung des Petersdoms, festgestellt, dass es nicht genug Platz gab, um Papst Pius XI. beizusetzen. Um den nötigen Platz zu schaffen, wurde der Marmorboden entfernt und … bingo! Sie stießen auf eine Ziegelmauer und die Reste der ersten Basilika. Stell dir nur die Aufregung vor! Wichtiger aber noch war, dass sie Risse in den Mauern fanden, die in eine merkwürdige Kammer voller Steinbrocken führte.“
„Die Katakomben?“
„Ja, sie haben die Nekropole entdeckt. Aber das wusste zum damaligen Zeitpunkt niemand. Unter dem Dom wimmelte es also nur so von Rätseln. Der neue Papst, Pius XII., hat sich darüber natürlich Gedanken gemacht und nach reiflicher Überlegung beschlossen, die Gräberzone erforschen zu lassen. Selbstverständlich wusste er, dass sich hier das Grab des heiligen Petrus befinden sollte, und er wollte wissen, ob es das Grabmal tatsächlich gab und ob es all die Zeit überdauert haben konnte. Abgesehen von der außerordentlichen Bedeutung auf archäologischer Ebene stand auch in theologischer Sicht viel auf dem Spiel.“
„Ja sicher! Das hätte bewiesen, dass der heilige Petrus hier…“
„Mehr als das, Schatz. Immerhin hatte Luther abgestritten, dass sich das Grab des heiligen Petrus im Vatikan befand, und auch die orthodoxe Kirche stellte die Vorherrschaft der katholischen Kirche innerhalb des Christentums in Frage. Die Entdeckung des Petrusgrabes unter den Vatikanischen Grotten würde die katholische Kirche als Erbin des wahren Glaubens legitimieren, als die Christenheit, die Simon beziehungsweise Petrus gegründet hatte – der Fels, auf den Jesus seine Kirche bauen wollte. Das wäre eine bittere theologische Niederlage sowohl für die Protestanten als auch die Orthodoxen. Wie könnten sie dann noch abstreiten, dass die katholische Kirche wirklich die Kirche des Petrus, des ersten Jüngers Jesu, ist?“
Sie gingen langsam weiter. Im Schein der Taschenlampe suchten sie sich einen Weg zwischen den Trümmern, um nicht aus Versehen in ein Loch oder über einen Stein zu stolpern.
„Einverstanden, aber das Ganze stellte doch auch ein Risiko dar. Was, wenn sie nichts finden würden? Würde das nicht beweisen, dass die Protestanten und Orthodoxen recht hätten …?“
„Zwar nicht beweisen, aber nahe legen. Deshalb wurden die Arbeiten auch unter größter Geheimhaltung durchgeführt“, bestätigte Tomás. „Ohnehin standen die Chancen nicht gut, dass die Gebeine des heiligen Petrus zweitausend Jahre lang in diesen Ruinen mit all ihrer Feuchtigkeit überstanden haben konnten. Und nicht zuletzt gab es ja noch die blutigen Zeiten, die der Vatikan erlebt hatte; allen voran die Plünderung Roms durch die Westgoten, die Vandalen, die Ostgoten und die Ottomanen.“
„Sie alle haben die Überreste des Petrus gesucht?“, wunderte sich Maria Flor. „Aber als ich dich gerade gefragt habe, wo sie sind, hast du mir nicht geantwortet.“
Tomás zögerte.
„Nun ja, das Hauptziel der Grabungsarbeiten bestand darin, die Überreste Petri zu finden, das versteht sich von selbst.“
„Aber war das auch möglich?“, hakte Maria Flor nach. „Wie du schon gesagt hast, sind die Bedingungen hier unten nicht gerade dazu angetan, menschliche Überreste zweitausend Jahre lang zu erhalten. Abgesehen davon, wonach musste man eigentlich suchen? Ein Grabmal mit der Inschrift ‚Hier ruht der heilige Petrus‘?“
„Warum nicht?“
Maria Flor warf ihm einen schrägen Blick zu.
„Machst du dich über mich lustig?“
„Im Gegenteil, ich meine es ernst“, entgegnete Tomás. „Wir wissen, dass der zweite Nachfolger von Petrus, Papst Anaklet, ein Reliquiar anfertigen lassen hat, eine Art Sarg aus gebrannter Erde oder behauenem Stein, um die Gebeine des einstigen Begleiters Jesu zu konservieren. Und dank der Aussage des Gaius, die von Eusebius zitiert wurde, wissen wir auch, dass dieses Reliquiar in dem Tropaion nebenan eingelassen wurde.“
„Und? Hat man das Reliquiar dort gefunden?“
„Nicht dort.“
„Was soll das heißen? Wenn das Reliquiar nicht dort gefunden wurde – wo denn dann?“
„Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn das Reliquiar hat bewegte Zeiten miterlebt. Während der Christenverfolgungen wurden die Überreste des heiligen Petrus in den Katakomben an der Via Appia versteckt. Als die Lage sich beruhigt hatte, wurden die Gebeine zurück in die Nekropole des Vatikans gebracht. Das Problem besteht darin, dass die Stadt danach mehrfach geplündert wurde und alle Wertgegenstände verloren gingen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Plünderer auch das Reliquiar des heiligen Petrus mitgenommen haben.“
„Man hat also nichts gefunden …?“
Tomás verzog das Gesicht.
„Nicht wirklich. Während des Zweiten Weltkriegs wurden unter Papst Pius XII. umfangreiche Ausgrabungen vorgenommen. Sie entdeckten Tunnel zwischen den dicken Wänden und beförderten tonnenweise Erde, Schutt und Wasser ans Tageslicht. Nach einem Jahr konzentrierten sie ihre Suche auf den Bereich unter der Confessio, weil ja genau dort die sterblichen Überreste des Petrus vermutet wurden. Dabei stießen sie auf dieses Netz aus Gräbern und Mausoleen und drangen in Bereiche ein, die schon seit mehr als tausend Jahren kein Mensch mehr aufgesucht hatte, darunter das Feld P und das Tropaion des Gaius. Sie fanden Sarkophage und Fresken, Urnen und Ossarien sowie Keramikfragmente.“
„Aber nicht die Knochen des Petrus …“
Tomás zog eine leichte Grimasse.
„Das weiß man nicht.“
„Wie bitte? Wieso weiß man das nicht? Entweder hat man sie gefunden, oder man hat sie nicht gefunden, was ist denn daran unklar?“
Bevor er zu einer Erklärung ansetzte, atmete Tomás tief durch und ordnete seine Gedanken.
„Die Ausgrabungen begannen 1939 und dauerten insgesamt zehn Jahre. Ihr Leiter war ein gewisser Prälat Ludwig Kaas, leider ein Amateur ohne jede archäologische Erfahrung. Er kannte nicht einmal die grundlegendsten Regeln, wie etwa die Notwendigkeit, ein Tagebuch über die Entdeckungen und Fortschritte zu führen!“
„Ja, und?“, fragte Maria Flor ungeduldig. „Hat er nun die sterblichen Überreste des Petrus entdeckt oder nicht?“
Tomás deutete auf die Öffnung in der Wand hinter ihnen, die zum Feld P führte.
„Das Ausgrabungsteam entdeckte in der Tat nahe des Tropaion des Gaius menschliche Gebeine, und zwar in einer Nische der roten Mauer.“
Maria Flor horchte auf.
„Und?“
„Diese Knochen waren mit winzigen Stoffresten, Holzsplittern, Marmorbröckchen und ein paar Münzen vermischt. Die radiologischen, chemischen und mikroskopischen Untersuchungen ergaben, dass es sich um das fast vollständige Skelett eines Mannes von beleibter Statur und in fortgeschrittenem Alter handelte“
„Das heißt … den heiligen Petrus?“, rief Maria Flor mit großen Augen aus.
„Das war in der Tat die Schlussfolgerung der Untersuchungen“, bestätigte Tomás schmunzelnd, angesichts der Begeisterung seiner Verlobten. „Man hatte endlich die Gebeine des heiligen Petrus gefunden.“
„Das ist genial, einfach großartig …“
Aber Tomás bremste ihre Begeisterung.
„Das Problem war nur, dass ein anderer, kompetenterer Forscher etwas später die gleichen Knochen noch einmal untersuchte und dabei herausfand, dass es sich vielmehr um die Gebeine von drei verschiedenen Personen handelte, zwei Männern und einer Frau, und dass nichts davon mit dem heiligen Petrus in Verbindung gebracht werden konnte.“
Maria Flor stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
„Oh!“
„Man hatte also nicht viel vorzuweisen.“
„Das heißt … es gibt keine Überreste von Petrus mehr?“
Zur Antwort holte Tomás tief Luft und stand auf. Als er Maria Flor mit hängenden Schultern dastehen sah, nahm er sie in den Arm.
„Die Gebeine des Petrus sind nicht gefunden worden“, murmelte er. „Na und? Was macht das schon?“
Er gab seiner Verlobten einen Kuss und setzte schließlich seinen Rucksack wieder auf.
„Ich würde mich gerne ein wenig allein umschauen. Gibst du mir bitte eine Taschenlampe?“, bat Maria Flor.
Tomás zog eine der Ersatzlampen und einen Plan aus dem Rucksack und reichte ihr beides.
„Okay, wenn du magst. Pass aber auf, dass du nichts beschädigst“, sagte er mahnend. „Vergiss nicht, dass dieser ganze Bereich hier nur für archäologische Arbeiten zugänglich ist. Fass bitte nichts an.“
„Ich weiß, wo wir hier sind“, entgegnete sie spitz. „Und wo gehst du hin?“
Tomás machte kehrt und schwenkte seine Taschenlampe.
„Mein Auftrag lautet, die Grabkammern und alles, was sich hier befindet, zu katalogisieren. Heute beginne ich im Sektor der Familie Valerius.“
Bald hatte sich der Schein seiner Lampe im unterirdischen Labyrinth verloren, und sie hörte nur noch den dumpfen Klang seiner Schritte.
III
Seit bald einer Stunde inspizierte Tomás das Nachbargrab der Valerier und zerbrach sich den Kopf über dessen christliche Inschrift. Darin baten die Angehörigen des Verstorbenen, der zweifellos eine wichtige Persönlichkeit gewesen war, den heiligen Petrus, für die Seelen der ‚in seiner Nähe‘ beigesetzten Toten zu beten.
„In seiner Nähe“, murmelte Tomás. „Interessant.“
Dies war ein weiterer Hinweis darauf, dass der einstige Begleiter Jesu tatsächlich irgendwo hier begraben war. Und in dieser Kammer befand sich auch das zweitälteste bekannte Gemälde Christi, was ihren besonderen Charakter noch verstärkte.
Tomás kritzelte einige Notizen in sein archäologisches Tagebuch. Man würde diese Inschrift präzise datieren müssen. Wer auch immer ihr Verfasser gewesen war, er hatte sie geschrieben, als sich die Gebeine des heiligen Petrus noch im Tropaion des Gaius befunden haben mussten. Wie sonst sollte man diese Bitte interpretieren, dass der Apostelführer für die ‚in seiner Nähe‘ beigesetzten Toten beten möge?
„Tomás?“
Im Übrigen bestand die Arbeit eines Archäologen darin, sämtliche Details akribisch zu prüfen. Der Großteil dessen, was man heutzutage über die Vergangenheit weiß, wurde schließlich bei den Ausgrabungen aus indirekten Hinweisen abgeleitet; von Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick unwichtig erschienen oder sogar völlig belanglos gewirkt hatten, die dann aber den Weg zu großen Entdeckungen bereitet hatten. Durch das Vergleichen von Informationen und …
„Tomás!“
Tomás war derart in Gedanken versunken, dass er die Stimme Maria Flors erst jetzt wahrnahm. Er zuckte zusammen und drehte sich um, sah aber nichts als die Dunkelheit der Katakomben.
„Was ist?“
„Kannst du mal herkommen?“
Er seufzte frustriert und bedauerte, Maria Flor mitgenommen zu haben. Das war wirklich keine gute Idee gewesen; er liebte seine Arbeit und konnte sich stundenlang auf nur eine Aufgabe konzentrieren – seiner Meinung nach die einzig effiziente Methode. Störungen jeder Art waren ihm zuwider.
„Ich komme.“
Er stand auf und verzog vor Schmerzen das Gesicht; so lange gebückt zu sitzen, war nicht nur ermüdend, sondern auch schlecht für den Rücken. Er nahm seine Taschenlampe und den Rucksack und eilte in die Richtung, aus der er Maria Flors Stimme gehört hatte. Sie kam aus dem Bereich des Felds P.
Als er ein Stück durch die Ruinen zurückgelegt hatte, sah er den Schein ihrer Lampe durch die Öffnung in der roten Mauer dringen.
„Schau mal“, sagte sie. „Das musst du dir ansehen.“
Maria Flor stand im Tropaion des Gaius und beugte sich über die kleine Mauer, an der einst die zweite Säule gestanden hatte. Das Mäuerchen war knapp einen Meter hoch und fünfzig Zentimeter dick.
„Was ist denn?“
„Hier sind Dutzende von Inschriften. Schau nur!“
Tomás trat neben seine Verlobte und warf einen Blick auf die Botschaften.
„Ah ja, das ist die Graffiti-Mauer.“
„Die – was?“, fragte sie entsetzt. „Sag bloß nicht, dass jemand das Grabmal des heiligen Petrus geschändet hat!“
„Nein, nein. Die Graffiti-Mauer hat ihren Namen von all den Inschriften, die die Christen im 3. Jahrhundert dort anbrachten. Diese sind hier besonders zahlreich, was die Bedeutung unterstreicht, die sie diesem Mausoleum beigemessen haben. Außerdem sind die Inschriften kodiert, damit nur ein Eingeweihter sie entschlüsseln kann, was sehr interessant ist und uns einen Hinweis auf den damaligen Glauben liefert.“ Er deutete auf ein Graffito. „Siehst du diese beiden Symbole? Ein chi und ein rhô, was zusammen für Christus steht.
„Aha. Wie auf diesem Stein da.“
„Welcher Stein?“
Maria Flor bückte sich und deutete auf einen Brocken am Boden.
„Da, siehst du? Da ist auch etwas eingeritzt.“
Tomás hob das Bruchstück auf und stellte fest, dass es sich nicht um einen Stein, sondern ein Stück Putz handelte, das vermutlich von der roten Wand abgefallen war. Neugierig drehte er das Stück im Licht seiner Taschenlampe um und untersuchte die eingeritzte Inschrift.
„Merkwürdig …“
Fasziniert starrte er das Teil in seiner Hand an, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
„Was ist denn damit?“, fragte Maria Flor ungeduldig.
Erst nach einer gefühlten Ewigkeit, in der Tomás den Brocken mit ungläubigem Staunen rundum begutachtet hatte, bekam sie eine Art Reaktion.
„Sollte es möglich sein?“, murmelte er. „Das wäre ja …“
„Das wäre was? Nun sag schon, was los ist!“
Endlich wandte er den Blick von dem Objekt und schaute Maria Flor an.
„Wo hast du das gefunden?“
Sie zeigte auf den Boden, wo die rote Wand auf die Graffiti-Mauer stieß.
„Hier. Wieso?“
Statt einer Antwort öffnete Tomás eilig sein Notizheft und übertrug die beiden Wortfragmente auf ein leeres Blatt. Er starrte sie einen Moment nachdenklich an. Der zweite Buchstabe des oberen Wortes war ein E, der letzte vor der Bruchkante ein I. Zögernd setzte er auf das E einen Akzent, so dass es zu einem É wurde, und ergänzte das I um einen geschlossenen Halbkreis zu einem P. Nach einem Augenblick fügte er zwei weitere Buchstaben an, ein O und ein Σ.
„Heureka!“, rief er aus.
„Was ist?“, fragte Maria Flor.
„Siehst du nicht, was da steht?“
Er zeigte ihr das Blatt, auf dem er das obere Wort entsprechend ergänzt hatte.
ΠÉTPOΣÉNI
Maria Flor schaute verständnislos drein.
„Was soll das bedeuten?“
„Petros eni! Ist das nicht außergewöhnlich?“
„Willst du mir wohl endlich verraten, was das heißt?“
Tomás war derart in seinem Element, dass er wieder einmal vergessen hatte, dass nicht jeder so gut mit dem Thema vertraut war wie er.
„Petrus ist in griechischen Buchstaben geschrieben und heißt Stein. Eni ist eine Kurzform eines griechischen Verbs, das so viel heißt wie ‚ist hier‘. Petros eni heißt also ‚Hier ist Petrus‘. Verstehst du es jetzt?“
Seine Verlobte legte den Kopf schief.
„Hier? In diesem Mausoleum?“ Sie schaute sich um. „Aber wo genau?“
Das war eine berechtigte Frage. Tomás besah sich das Bruchstück in seiner Hand genauer: Von seiner Farbe und Struktur her zu schließen war es von der roten Wand abgefallen, die zudem älter war als das eigentliche Mausoleum. Die Überreste Petri mussten sich also irgendwo in dieser Wand oder ganz in der Nähe befinden.
Nachdem er das Fragment zur späteren Untersuchung im Labor in einen Plastikbeutel verpackt hatte, näherte sich Tomás dem Winkel aus roter Wand und Graffiti-Mauer. Wo sie einander berührten, entdeckte er eine Öffnung, die eher an ein Versteck als an ein Reliquiar erinnerte.
„So was aber auch!“
„Was ist?“
„Ein loculus“, sagte Tomás.
„Und das ist …?“, fragte Maria Flor gereizt.
Anstatt zu antworten, fuhr er mit der Hand in die Nische und tastete erst langsam, dann zunehmend schneller in alle Richtungen.
„Nichts“, sagte er schließlich enttäuscht.
„Aber wo kann der heilige Petrus denn sonst sein?“
Wortlos inspizierte Tomás die rote Wand, dann hob er hie und da ein Stück Stein vom Boden auf. Aber er fand keinen weiteren Hinweis. Dann hielt er inne und dachte noch einmal nach. Die Inschrift besagte eindeutig ‚Hier ist Petrus‘. Aber dieser verflixte loculus war leer. Vielleicht …
„Ich hab’s!“, rief er plötzlich und raffte in Windeseile seine Sachen zusammen. Dann packte er Maria Flor an der Hand und zog sie regelrecht zurück Richtung Ausgang. Er witterte eine Fährte.
IV
Der Mann mit Glatze, faltigem Gesicht und weißem Bärtchen saß unter einem Sonnendach und blinzelte in die Morgensonne. Noch ein wenig verschlafen beäugte er von Zeit zu Zeit die Touristen auf dem Hof des Pinienzapfens, die den vier Meter hohen Bronzezapfen fotografierten, sowie die Prälaten, die gemessenen Schrittes den Innenhof querten. Der Stock in der knochigen Hand des Alten zitterte leicht, aber ununterbrochen, ein sichtbares Zeichen dafür, dass er an Parkinson erkrankt war. Auch seine Augenlider fielen ihm ständig zu, so dass er regelmäßig einnickte und gleich darauf wieder aufschreckte.
Als er wieder einmal kurz davor war, einzuschlafen, nahm er eine Bewegung neben sich wahr und drehte den Kopf, um zu sehen, wer sich ihm näherte.
„Signor Sigone?“
Als er seinen Namen hörte, fingen die Augen des Alten an zu funkeln.
„Ah, Professor Noronha!“, rief er aus. „Wie schön, Sie zu sehen! Seine Eminenz sucht Sie.“
Tomás zog die Augenbrauen hoch. Auch Maria Flor schaute den alten Herrn verwundert an.
„Kardinal Barboni möchte mich sprechen?“
„Ja, er hat mich vor etwa einer Stunde gefragt, ob ich wisse, wo Sie seien.“
Damit hatte Tomás nun wirklich nicht gerechnet. Angelo Barboni war der Staatssekretär des Heiligen Stuhls, der zweitmächtigste Mann der römisch-katholischen Kirche nach dem Papst. Zumindest im Prinzip, denn in der Realität war der Kardinal noch mächtiger als der Papst selbst, da er für die Alltagsgeschäfte der Kurie und die Verwaltung des Vatikanstaats zuständig war, während der Papst sich den großen spirituellen und theologischen Fragen widmete.
„Was wollte Kardinal Barboni von mir?“
„Das weiß ich nicht“, sagte Sigone und winkte einem jungen Mann zu, der aus dem Pius-Klemens-Museum trat. „Fabio!“, rief er ihm zu. „Sag Seiner Eminenz, dass Professor Noronha hier ist! Schnell!“
„Selbstverständlich“, antwortete der Museumsmitarbeiter, dann überquerte er rasch den Hof, ehe er im angrenzenden Gebäude verschwand. Endlich konnte Tomás dem alten Herrn die Fragen stellen, die ihm auf den Nägeln brannten. Er setzte sich auf einen freien Stuhl neben ihn.
„Wie Sie wissen, Signor Sigone, hat die Päpstliche Kommission für Sakrale Archäologie mich beauftragt, ein Verzeichnis der Grabstätten in der Nekropole anzufertigen und die sterblichen Überreste des heiligen Petrus zu suchen. Sie waren doch seinerzeit an den Ausgrabungen unter Monsignor Kaas beteiligt, nicht wahr?“
„Das stimmt“, bestätigte Sigone mit einem nostalgisch verklärten Lächeln. „Damals war ich ein blutjunger, naiver Sanpietrino, als Seine Heiligkeit den Auftrag erteilte, die Nekropole zu erkunden.“
„Das muss eine großartige Zeit gewesen sein“, stimmte Tomás ein wenig neidvoll zu. „Vor allem, als Sie das Petrusgrab entdeckten! Da wäre ich gerne dabei gewesen …“
„Ach Professor, das war wirklich einzigartig. Ich danke der Heiligen Jungfrau Maria jeden Tag für diese Erfahrung.“
Tomás räusperte sich, bevor er die Frage stellte, die ihn so brennend interessierte.
„Signor Sigone, ich habe eine Frage zu der Graffiti-Mauer. Erinnern Sie sich, das ist die Wand neben dem Mausoleum …“
Der Blick des alten Herrn schweifte in die Ferne und schien sich in der Vergangenheit zu verlieren, als er sich die betreffenden Bilder wieder in Erinnerung rief. Zwar war er mehr als ein halbes Jahrhundert nicht mehr in der Nekropole gewesen, aber alle Einzelheiten des Petrusfeldes hatten sich in sein Gedächtnis fest eingraviert.
„Ja, ich erinnere mich“, sagte er. „Die Mauer voller Inschriften, direkt neben dem Mausoleum.“
„Genau die!“, bestätigte Tomás erleichtert. „Ich nehme an, Sie wissen auch, dass es in dieser Graffiti-Mauer etwa auf halber Höhe eine Nische gibt?“
„Lassen Sie mich überlegen …“
„Man könnte auch sagen, ein Loch in der Mauer, das von einer Marmorplatte bedeckt war. Erinnern Sie sich daran?“
Der Blick des Alten wurde plötzlich lebhaft.
„Natürlich! Ich weiß, was Sie meinen.“
„Diese Nische ist leer.“
Der ehemalige Sanpietrino schaute Tomás fragend an.
„Signor Sigone, finden Sie nicht auch, dass das merkwürdig ist? Wenn die frühen Christen die Nische mit einer Marmorplatte bedeckt haben, war sie doch sicher wichtig, vor allem, wenn man bedenkt, um welchen Ort es sich dabei handelt! Wieso hätten sie ein Vermögen für eine Marmorplatte ausgeben sollen, um damit ein leeres Fach zu verschließen?“
„Das ist in der Tat seltsam.“
„Als Sie damals das Mausoleum entdeckten, war die Nische in der Graffiti-Mauer da auch schon leer?“
Sigone nickte.
„Ja, das war sie.“
Die Antwort enttäuschte Tomás. Die Inschrift des Steinfragments von der roten Wand besagte doch klar und deutlich ‚Hier ist Petrus‘. Aber wo, wenn nicht in dieser Nische? Sigone war der letzte der Sanpietrini, die während des Zweiten Weltkrieges als Erste in die vergessene Nekropole hinabgestiegen waren und das Petrusgrab entdeckt hatten, und er bestätigte, dass die Nische schon damals leer war.
„So so“, murmelte Tomás. „Es war also nichts darin.“
Der alte Mann zögerte.
„Nun ja, nichts außer etwas Schutt.“
Wie elektrisiert fuhr Tomás auf.
„Was für Schutt war das?“
„Irgendwelcher Dreck. Abfälle.“ Er zuckte mit den Schultern. „Nichts Besonderes.“
Das Herz des Geschichtsprofessors machte einen regelrechten Freudensprung. Wäre es möglich, dass …
„Was ist mit diesem … Schutt passiert?“, fragte er nervös.
„Monsignor Kaas hat ihn wegbringen lassen.“
Tomás zuckte zusammen und hätte fast geschrien.
„Was heißt das, er hat ihn wegbringen lassen?“
Sigone war von der Heftigkeit der Reaktion seines Gegenübers erschreckt. Hatte er etwas Dummes gesagt?
„Gibt es ein Problem, Professor?“
„Ein Problem? Das ist eine Katastrophe!“, schäumte Tomás und hätte den Alten fast vor Wut am Kragen gepackt. „Ist Ihnen nicht bewusst, was Sie da gemacht haben? Was für ein Verbrechen Sie begangen haben?“
Verängstigt sank Sigone auf seinem Stuhl zusammen und schlug sich die Hände vors Gesicht.
„Professor, was habe ich falsch gemacht?“
Endlich merkte Tomás, dass sein Verhalten dem alten Herrn gegenüber inakzeptabel war und hatte sich schlagartig wieder unter Kontrolle. Mit einem Seitenblick stellte er fest, dass einige Touristen die Szene bereits beobachteten und vermutlich überlegten, ob sie die Gendarmerie oder die Schweizergarde rufen sollten.
Beschämt setzte Tomás sein breitestes Lächeln auf und legte freundschaftlich eine Hand auf Sigones Schulter. Die Schaulustigen trollten sich.
Erleichtert setzte Tomás die Befragung des alten Mannes fort.
„Signor Sigone, hat Monsignor Kaas wenigstens die Archäologen informiert?“
Der Angesprochene war noch etwas verstört, als er antwortete.
„Das war doch nur Schutt, Professor.“
„Sicher, aber hat er die Archäologen nun informiert oder nicht?“
„Natürlich nicht, Professor. Wieso hätte er ihnen etwas von diesem Unrat erzählen sollen?“
Tomás seufzte verzweifelt angesichts einer Ahnungslosigkeit, die selbst einem Hobbyarchäologen die Haare zu Berge hätte stehen lassen. Am liebsten hätte Tomás den alten Mann erneut angeschrien, aber er hielt sich zurück.
„Auf einer archäologischen Grabungsstätte ist alles wichtig, Signor Sigone“, setzte er an. „Selbst vermeintlicher Schutt. Vor allem dann, wenn er aus einer Nische mit der Aufschrift Petros eni stammt, verstehen Sie?“
„Petros … was?“
Tomás merkte, wie er abermals die Kontrolle zu verlieren drohte. Es wäre besser, jetzt zu gehen. Letztlich war ja auch nicht der einstige Sanpietrino für die Unfähigkeit des Monsignor Kaas verantwortlich, der sich für einen Archäologen gehalten und einen der größten Schätze aus der Frühzeit des Christentums zerstört hatte. Und selbst, wenn Sigone mitschuldig gewesen sein sollte, war es jetzt ohnehin zu spät.
Resigniert stand Tomás auf.
„Vergessen Sie das alles, Signor Sigone“, sagte er. „Es ist zwar verrückt, auf einer archäologischen Grabungsstätte irgendwelchen ‚Schutt‘ wegzuwerfen, erst recht an einem Ort von solcher Bedeutung, aber … sei’s drum. Was geschehen ist, ist geschehen.“ Er nickte Sigone versöhnlich zu. „Schönen Tag noch.“
Kopfschüttelnd und mit hängenden Schultern steuerte Tomás, gefolgt von Maria Flor, auf den Eingang des Museums zu, um zu fragen, wo er Kardinal Barboni fände. Er wollte dieses Treffen so schnell wie möglich hinter sich bringen und dann das Gelände des Vatikans verlassen. Wie hatte dieser Kaas nur so unfähig sein können? Kein anderer wäre auf die Idee gekommen …
„Er hat sie nicht weggeworfen.“
Die Worte des alten Mannes rissen Tomás aus seinen düsteren Gedanken.
„Wie bitte?“
„Monsignor Kaas hat den Schutt nicht weggeworfen.“
In einer Mischung aus Hoffnung und Ungläubigkeit schaute Tomás den ehemaligen Sanpietrino an.
„Sondern?“
Auf seinen Stock gestützt erhob sich der alte Herr und machte zwei Schritte auf Tomás und Maria Flor zu.
„Ich weiß, wo der Inhalt der Nische aufbewahrt wird“, sagte er verschmitzt.
V
Kaum hatte Giovanni Sigone die Türen des alten Lagerschrankes geöffnet, griff er zielstrebig in das mittlere Regal, fand aber nicht, was er suchte. Auch in den beiden anderen Fächern blieb seine Suche erfolglos. Unzufrieden brummte er etwas in sein Bärtchen und schloss die Türen wieder.
Dann wandte er sich dem nächsten Schrank zu und wiederholte das Ganze. Diesmal wurde er im zweiten Regal fündig.
„Da ist es.“
Brennend vor Neugierde traten Tomás und Maria Flor neben ihn und schauten über seine Schultern.
„Darf ich Ihnen helfen?“
Der alte Herr beugte sich zu dem Objekt hinab, um es hochzuheben.
„Porca miseria“, murmelte er dann. „Ich bin zwar alt, aber die Kraft habe ich doch noch …“
Weder Tomás noch Maria Flor hatten die Absicht, seine Fähigkeiten in Frage zu stellen. Vielmehr war es rührend zu sehen, wie der alte Mann seine ganze Willenskraft zusammen nahm, um ihnen zu zeigen, was er noch konnte. Aber sein geschwächter Körper zitterte derart stark, dass ihnen doch gewisse Zweifel kamen.
„Kann ich Ihnen nicht doch …?“
Mit zusammengebissenen Zähnen und unter Aufbietung aller Kräfte hievte Sigone ein riesiges Tablett auf den Tisch in der Mitte des Lagerraums. Sein Gesicht war vor Anstrengung gerötet, und er atmete schwer.
Das war zwar wahrlich nicht die beste Art für den Umgang mit wertvollen Reliquien, aber Tomás biss sich auf die Zunge, um den Mann, der ihnen helfen wollte, nicht zu beleidigen. Auf dem Tablett lag eine Holzkiste – kaum größer als eine Schuhschachtel.
„Ist das der Inhalt der Nische in der Graffiti-Mauer, den Monsignor Kaas entfernen lassen hat?“
„Das ist er“, nickte Sigone stolz. „Wollen Sie die Kiste öffnen, Professor?“
Tomás holte aus seiner Tasche ein Paar Schutzhandschuhe, wie Archäologen sie immer verwenden, wenn sie mit empfindlichen Gegenständen hantieren. Dann zog er sie an und breitete ein großes Tuch auf dem Tisch aus.
Langsam und vorsichtig hob er den Deckel der Kiste und zog den Inhalt Stück für Stück heraus. Eins nach dem anderen legte er die Teile sorgfältig nebeneinander auf das Tuch.
„Flor, kannst du bitte mitschreiben?“
Maria Flor griff in die Seitentasche seines Rucksacks, wo das archäologische Tagebuch und ein Stift immer griffbereit waren.
„Du kannst loslegen.“
„Gut. Schreib bitte: zwei rote Fragmente.“
Sie notierte es.
„Zwei Stücke Stoff.“
„Habe ich.“
„Mit Erde bedeckte Knochen.“
„Okay.“
„Kleine Steine, Marmorsplitter und Lehm.“
Das war alles. Zu dritt betrachteten sie die auf dem Tuch ausgebreiteten Gegenstände.
„Monsignor Kaas hatte Recht“, brach Sigone schließlich das Schweigen. „Nichts als Schutt.“
Tomás indes hielt nur mühsam seine Emotionen zurück.
„Das ist ein Schatz“, sagte er.
„Ein Schatz?“, echote der alte Sanpietrino ungläubig. „Aber Professor, das ist doch nur Erde, etwas Lehm, ein paar alte Knochen und zwei kleine Stofffetzen.“
„Damals gab es in Europa noch so gut wie keine edlen Stoffe, Signor Sigone. Alle Stoffe der damaligen Zeit erscheinen uns heutzutage grob. Aber sehen Sie, diese Stücke hier glänzen. Das ist etwas Besonderes.“
Die Miene des alten Mannes blieb skeptisch.
„Meinen Sie, Professor?“
„Ja.“ Tomás deutete auf eine andere Stelle des Stoffs. „Und hier sieht man winzige Goldfäden.“
Bei diesem Wort leuchteten die Augen des Italieners auf.
„Gold? Dio mio! Dann sind sie tatsächlich wertvoll!“
„Natürlich sind sie das. Aber jetzt stellt sich die Frage, wieso die Marmornische einen derart wertvollen Stoff enthielt.“
„Wahrscheinlich, weil in dem Stoff etwas sehr Kostbares eingewickelt war“, vermutete Maria Flor, die bis dahin kein Wort gesagt hatte.
„Aber was?“, fragte Sigone mit funkelnden Augen. „Gold? Edelsteine?“
Tomás verschränkte die Arme vor der Brust.
„Etwas noch viel Kostbareres.“
Der ehemalige Sanpietrino lachte.
„Was könnte es Kostbareres geben als Gold oder Edelsteine, Professor?“
Als Antwort deutete der Historiker auf die verblichenen, mit Erde verklebten Knochen. Dann nahm er behutsam eines der Knochenstücke in die Hand und betrachtete es eingehend mit einer Lupe. Es wirkte in der Tat sehr alt. Dann verstaute er die Lupe wieder in seinem Rucksack und legte das Fragment zurück auf das Tuch.
„Das sind die sterblichen Überreste des heiligen Petrus.“
VI
Maria Flor hatte mit einer solchen Antwort gerechnet, aber Giovanni Sigone war von Tomás’ Antwort geradezu überwältigt. Wäre der Portugiese nicht ein angesehener Universitätsprofessor gewesen, hätte Sigone ihn glatt ausgelacht. So jedoch schaute der alte Mann die Reliquien nur mit offenem Mund an.
„Madonna mia!“, entfuhr es ihm schließlich.
Nachdem er alle Fundstücke zurück in die Holzkiste gelegt hatte, schloss Tomás geradezu feierlich den Deckel.
„Jetzt muss das alles im Labor untersucht werden“, sagte er. Dann riss er ein leeres Blatt aus seinem Notizheft und fing an zu schreiben. „Diese Knochen sollten einem Gentest und einer Radiokarbonanalyse unterzogen werden, um festzustellen ob …“
„Professor Noronha, hier sind Sie also!“
Die Stimme klang sichtlich erleichtert und gehörte einem Mann in schwarzer Soutane mit scharlachrotem Zingulum um seinen prallen Bauch. Sein Gesicht war fast so rot wie das auf dem Kopf thronende Käppchen. Überrascht schaute der Geistliche sich in dem fensterlosen Lagerraum um.
Signor Sigone erkannte die gedrungene Gestalt als Erster. Sofort kniete er nieder, verneigte sich vor dem Neuankömmling und legte ehrerbietig seine zitternden Handflächen zusammen.
„Eure Eminenz …“
Mit einer Handbewegung forderte der Kardinal den alten Sanpietrino auf, sich wieder zu erheben und ging strammen Schrittes auf Tomás und Maria Flor zu, die ihn erwartungsvoll ansahen.
„Wir beide sind uns noch nicht begegnet, mein Sohn“, begann der Kardinal. „Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Angelo Barboni, Kardinalstaatssekretär des Heiligen Stuhls. Wie geht es Ihnen, Professor?“
Fast automatisch ergriff Tomás die fleischige Hand, die der Kardinal ihm entgegenstreckte. Dies also war der zweitmächtigste Mann des Vatikans, auf dessen Gesicht ein fast seliger Ausdruck lag.
„Kardinal … Eure Eminenz“, stammelte Tomás und überlegte, ob er ihm die Hand küssen oder einfach nur schütteln sollte. „Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?“
Angelo Barboni lächelte ihn gutmütig an.
„Ich habe Sie gesucht, mein Sohn.“
Tomás überkam ein Anflug schlechten Gewissens, dass er den Kardinal warten lassen hatte.
„Womit kann ich Ihnen dienen?“, fragte er.
„Ich benötige Ihre Hilfe“, antwortete der Staatssekretär mit der ihm eigenen Freundlichkeit. „Aber zunächst habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ihre Arbeit in den Katakomben muss leider unterbrochen werden.“
Diese Ankündigung traf Tomás wie ein Schlag ins Gesicht.
„Wie bitte?“
„Mir ist bewusst, dass das ein Schock für Sie ist, und wir bedauern es ebenso sehr wie Sie, glauben Sie mir. Aber es lässt sich nicht ändern. Das Fundament des Petersdoms ruht exakt über dem Bereich, in dem Sie arbeiten würden, und wir können kein unnötiges Risiko eingehen.“
„Welches Risiko, Eure Eminenz? Meine Arbeit hat doch keinerlei Auswirkungen auf die Bausubstanz oder die Stabilität der Gewölbe!“
„Das ist auch gar nicht nötig, mein Sohn. Soweit ich gehört habe, arbeiten Sie auf der Höhe der Hauptsäulen und verwenden dort auch eine Hacke und Schaufel, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt, aber die sind ganz klein und leicht, ich kann sie Ihnen gerne zeigen. Das ist absolut harmlos und hat nichts mit echten Bauarbeiten zu tun.“
„Ich fürchte, das tut nichts zur Sache. Unsere Ingenieure sind beunruhigt und machen sich Sorgen, dass Ihre Arbeit in der Nekropole unbeabsichtigte Erschütterungen auslösen könnte und die Gewölbe einstürzen oder aber Wasser in die Gänge eindringt und so die Fundamente des Doms gefährdet werden.“
„Aber die Päpstliche Kommission für Sakrale Archäologie hat mich doch ausdrücklich damit beauftragt, ein Verzeichnis der Grabinschriften anzufertigen! Ich habe alle notwendigen Genehmigungen. Eure Eminenz kann sich jederzeit an Monsignor Respighi wenden, der Ihnen …“
„Ich bedaure, aber die Genehmigungen sind vorübergehend außer Kraft gesetzt“, unterbrach der Kardinal den Redefluss des Professors freundlich, aber mit fester Stimme. „Die Katakomben werden gerade verschlossen, und niemand darf sie wieder betreten, ehe unsere Ingenieure nicht die Freigabe erteilt haben.“
„Aber … aber …“
Barboni legte Tomás eine Hand auf die Schulter.
„Mein Sohn, ich verstehe Ihre Enttäuschung und bedaure die Situation zutiefst. Dennoch werden Sie verstehen, das die Sicherheit des Petersdoms und der darin befindlichen Personen Vorrang haben. Ich bitte Sie um Verständnis und etwas Geduld. Seien Sie unbesorgt in Bezug auf Ihr Honorar; unsere Verpflichtungen halten wir selbstverständlich ein.“
Widerstrebend gab Tomás sich geschlagen. Was konnte er schon gegen eine Entscheidung vorbringen, die sich auf die Sicherheit berief?
„Nun gut“, seufzte er. „Wann werde ich mit meiner Arbeit fortfahren können?“
„Wahrscheinlich schon in ein paar Tagen.“
„Und was mache ich in der Zwischenzeit? Spazieren gehen?“
Der Kardinal klatschte in die Hände.
„Es gibt eine Frage, zu deren Beantwortung Ihre Hilfe unerlässlich ist.“ Er deutete Richtung Tür. „Hätten Sie die Güte, mich zu begleiten?“
„Worum geht es denn?“
„Um eine außerordentlich dringende Angelegenheit“, antwortete Barboni und fügte mit einem Blick auf Sigone und Maria Flor hinzu, „die äußerste Diskretion erfordert.“
„Aber meine Verlobte wird garantiert …“
Kardinal Barboni unterbrach ihn in strengem Ton.
„Mi dispiace, aber es ist zu riskant, die junge Dame in eine Angelegenheit von derartiger Bedeutung zu verwickeln.“
Maria Flors Augen verengten sich zu Schlitzen.
„Wie bitte? Was wollen Sie damit sagen?“
Auch Tomás wollte schon widersprechen, aber der Staatssekretär trat neben ihn und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
„Professor, es handelt sich um eine ernste Bedrohung. Aus Sicherheitsgründen darf niemand etwas davon wissen, auch nicht die Signorina. Vertrauen Sie mir bitte. Es ist zu ihrem eigenen Schutz.“
Tomás zögerte. Er wollte Maria Flor nicht ins Abseits drängen, aber die Worte des Kardinals beunruhigten ihn. Eine ernste Bedrohung? Wäre es sicherer für seine Verlobte, wenn sie nichts davon wüsste? Was hatte das alles zu bedeuten? Es war durchaus davon auszugehen, dass es sich um eine wirklich wichtige Angelegenheit handelte, wenn sich der Kardinalstaatssekretär höchstpersönlich auf die Suche nach ihm gemacht hatte.
Mit einem hilflosen Achselzucken wandte er sich an Maria Flor.
„Hör zu, Flor, du wirst am besten …“
„Was werde ich?“, fauchte sie ihn an. „Ich habe diesen Tag extra für uns reserviert, damit wir zusammen sind, und jetzt verlangst du, dass ich verschwinde?“
Tomás war von der Heftigkeit ihrer Reaktion überrascht.
„Schatz, es ist nicht, dass ich es will. Es ist aber sicherer …“
Maria Flor ging einen Schritt auf ihn zu und tippte ihm mit dem Zeigefinger wütend gegen die Brust.