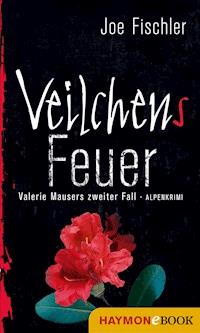Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Veilchen-Krimi
- Sprache: Deutsch
DIE UNGLAUBLICHE RÜCKKEHR DER VERLORENEN TOCHTER Eigentlich ist Valerie "Veilchen" Mauser auf Reha und soll endlich einmal Ruhe geben. Doch da passiert, was sie seit Jahren ersehnt, aber niemals gewagt hätte zu glauben: Ihre Tochter taucht auf, Luna - eine rastabelockte, kiffende kleine Rebellin, die ein Herz für Tiere hat, ansonsten aber ziemlich desinteressiert durch die Welt geht. Und vor allem: die bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt - Veilchen muss ihr dringend helfen. RASANT, ACTIONREICH UND AMOURÖS Gemeinsam mit ihrem Ermittlungspartner Stolwerk nimmt Veilchen es mit einem Gegner auf, der ihr stets einen Schritt voraus zu sein scheint. Einem Gegner, der ihre Tochter haben will - lebendig oder tot. Rasant und actionreich wird diese Jagd, mit von der Partie sind Valeries treuer Assistent Sven Schmatz und ihr singender Nachbar Sandro Weiler. Da fliegen die Funken, und zwar nicht nur auf wilden Verfolgungsjagden! ALPENKRIMI OHNE LEDERHOSEN VON JOE FISCHLER Filmreif, pointenreich und mordsmäßig spannend - im dritten Teil seiner Erfolgsserie rund um Valerie "Veilchen" Mauser schickt Joe Fischler seine toughe Ermittlerin durch emotionale Höhen und Tiefen. Ein rasanter, cooler Alpenkrimi ganz ohne Lederhosen! ********************************************************************************** Leserstimmen: "eine vielversprechende Krimiserie!" Jennifer B. Wind, Krimiautorin "Das Tiroler Flair ist gut getroffen, viel Witz und Humor und eine Prise Spannung geben eine gute Mischung." fredhel, lovelybooks.de "Immer überaus witzig und lebendig, unterhaltsame Dialoge und Protagonisten, die man einfach sympathisch finden muss …" esposa1969, vorablesen.de ********************************************************************************** Die kultige Veilchen-Krimireihe: Veilchens Winter Veilchens Feuer Veilchens Blut **********************************************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joe Fischler
Veilchens Blut
Ein Fall für Valerie Mauser
Alpenkrimi
Joe Fischler
Veilchens Blut
Für Gabriele
Donnerstag
Er traf sie mit Wucht. Unbarmherzig, unvorbereitet, ganz anders als geplant. Der Moment, den sie so lange herbeigesehnt hatte, war da.
Rebecca war da.
Valerie Mauser sprang auf, lief zum Schrank und zerrte die Straßenkleidung heraus. In ihrem Kopf nur ein Gedanke: Rebecca braucht mich. Weg mit dem Krankenhauspyjama, rein in Jeans, T-Shirt, Lederjacke, Sneakers. Kein BH, keine Socken, kein Blick in den Spiegel. Egal. Keine Zeit!
Sie zitterte. Hinaus auf den Gang, jemand grüßte, eine Krankenschwester machte große Augen, Valerie reagierte nicht, sprang die Treppen hinunter, zwei Stufen auf einmal.
„Grias di, Frau Mauser … Frau Mauser, hallo? Frau Mauser! … Ja hat dich der Hofer gestochen?“ Es war Sven Schmatz, der ihr entgegenkam, umdrehte und hinterherhechelte. Keine Zeit, ihm zu antworten, keine Lust, ihn zu verbessern. Er und seine falschen Sprichwörter. Hafer, nicht Hofer. Egal. Weiter!
„Ja du hast’s aber eilig, jetzt wart halt!“, hörte sie von schräg oben.
Sie stürzte ins Freie, raus aus der schützenden Umgebung des Reha-Zentrums Hochzirl, in dem sie sich noch eine Woche lang von ihrem Schädel-Hirn-Trauma erholen sollte, weiter über den Vorplatz, Richtung Parkplatz. Ihre Kondition war im Eimer. Herbstwind blies ihr ins Gesicht, warm noch vom Tal herauf, Bäume rauschten, Blätter fielen.
Völlig unwichtig.
Rebecca lebte. Und sie brauchte sie.
Außenstelle Innsbruck Hauptbahnhof, Fuchs … hier ist eine junge Frau, die in Schwierigkeiten steckt … sie behauptet, Sie seien ihre Mutter … wenige Worte, die sich in Endlosschleife in ihrem Kopf abspielten. Sie musste auf der Stelle hin. Aber wie?
Sie behauptet, Sie seien ihre Mutter. Konnte es denn sein, dass das Kind einfach so aufgetaucht war, nach all den Jahren? Dass Rebecca sich endlich entschlossen hatte, ihrer wahren Herkunft nachzugehen? Welche Schwierigkeiten?
Valerie blieb stehen. Atmete heftig, drehte sich einmal im Kreis herum, suchte nach dem schnellsten Weg hinunter ins Inntal und weiter in die Landeshauptstadt. Nur noch wenige Kilometer trennten sie von Rebecca … kein Taxi weit und breit … Schwierigkeiten …
Bitte lass es nichts Schlimmes sein! Ich muss sofort … jetzt gleich …
Schmatz neben ihr. Sie sah ihm in die Augen, besser gesagt, sie fixierte ihn, so eindringlich es ihr nur möglich war. „Schmatz, ich muss jetzt sofort zum Hauptbahnhof. Schnell!“
Ihr junger Assistent – möglicherweise bald Ex-Assistent, wegen ihrer Suspendierung und des bevorstehenden Straf- und Disziplinarverfahrens – senkte seinen Kopf, zeigte ihr seine blonden Wuschelhaare und starrte ein Loch in den Asphalt.
„Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut für dich ist, Frau Mauser“, murmelte er. „Ich glaub, du solltest wieder hinauf …“
„Schmatz!“, fuhr sie ihn an, wissend, dass sie sich gerade ordentlich im Ton vergriff. Nützte nichts. Sie packte ihn am Arm, zog ihn weiter und bellte: „Mach schon!“
„Jaja, Frau Mauser, jetzt beruhig dich, das ist nicht gut für deinen …“ Er tippte sich auf den Kopf.
Der kleinen bösen Souffleuse auf Valeries rechter Schulter kam schon der Dampf aus den Ohren. „Schmatz, jetzt sofort! Hauptbahnhof! Wo steht dein Auto?“
„Also mein …“
Gleich verlor sie die Geduld mit ihm. „Wo Schmatz, wo?“
Er deutete in eine Richtung, sie zerrte ihn hinter sich her, zum Parkplatz.
„Welches, Schmatz? Das da? Hm?“ Sie tippte auf einen rostigen Fiat Punto, lief ohne seine Reaktion abzuwarten hin und rüttelte am Griff. „Komm, aufsperren, los!“
„Nein, Frau Mauser, das da.“ Sein Zeigefinger wies auf ein rostiges, ungleich kleineres Vehikel direkt daneben – ein Motorfahrrad mit Tretpedalen. Puch Maxi, wenn sie nicht alles täuschte. Ein größerer Fahrradsitz plus Gepäckträger zwischen zwei kümmerlichen Rädchen, in deren Mitte ein putziges Nähmaschinen-Motörchen hing. Über dem Rückspiegel etwas, das aussah wie ein Asterix-Helm, mit langen, weißen Flügeln an den Seiten.
„Das da?“
„Das da.“
Kein Auto, ja klar, erinnerte sie sich an seine fragwürdigen Fahrkünste im Dienstwagen, wie auch daran, dass er einmal klatschnass im Büro gesessen war und ihr etwas von seinem Feuerstuhl erzählt hatte. Aber das da? Feuer? Half nichts. „Na dann!“, rief sie und zeigte abwechselnd auf das Ding und die Straße ins Tal.
Schmatz sah sie hilflos an. „Aber die Maschine geht nur solo!“
Maschine. Die adelige Bezeichnung für diesen kümmerlichen Behelfsuntersatz hätte sie sonst vielleicht amüsiert, doch nun packte sie die blinde Wut. Sie lief hin, umfasste die Griffe am Lenker, schob das Ding von seinem Hauptständer – und hätte es sich nicht rollen lassen, hätte sie das Zirkusteil hochgehoben und ihm in die Hand gedrückt. „Los, anlassen, Schmatz. Sofort!“
„Jaja, jetzt stress nicht so rum, Frau Mauser.“ Er fummelte eine halbe Ewigkeit in seiner Hose herum, zauberte einen winzigen Schlüssel hervor und steckte ihn ins Zündschlösschen.
„Du fährst“, befahl Valerie. Sie hatte keine Ahnung von diesen Dingern.
„Aber ich hab nur einen Helm!“
Scheiß auf den Helm!, schrie die böse Souffleuse.
„Scheiß auf den Helm!“, schrie Valerie. Was sollte schon passieren, schneller als ein Fahrrad konnte dieser Untersatz kaum sein. Sie würden eine Ewigkeit nach Innsbruck brauchen … keine Zeit für Diskussionen … Rebecca in Schwierigkeiten! Höchste Zeit, wegzukommen.
„Aber wie soll …“
„Anlassen!“, befahl sie erneut und drängte das schlechte Gewissen zurück.
Schmatz schüttelte den Kopf, Valerie auch, als er ihr den Helm anbot, also setzte er sich die optische Zumutung selber auf, ohne den Kinngurt zu schließen, stellte das Mofa zurück auf den Hauptständer und trat ein paarmal in die Pedale. Dazu schwangen die Asterix-Flügel im Takt. Als sich der Motor dann erstaunlich lautstark zu Wort meldete und dazu eine stinkende Rauchwolke ausstieß, grinste Schmatz vielsagend – seine Sommersprossen passten gerade besonders gut ins Gesamtbild – und schob sich in Startposition. Keine zwei Sekunden darauf hatte Valerie auf dem Gepäckträger Platz genommen und bemerkt, dass es hier nicht viel zum Festhalten gab. Also griff sie nach den schmalen Hüften des jungen Mannes, woraufhin dieser heftig zuckte, sich wand und zu ihr umdrehte.
„Bitte nicht kitzeln, Frau Mauser!“
„Na los jetzt!“
Wieder griff sie zu, wieder wand er sich. „Ahahahahahaha!“
Keine Chance. Wie konnte man nur so kitzlig sein! War ihr noch nie aufgefallen – Kunststück, hatte sie ihn wohl auch noch nie richtig berührt, schon gar nicht an den Hüften. Egal, musste es eben anders gehen, also umklammerte sie die Sattelstange, die akzeptablen Halt bot. Der Rauch, den das Mofa im Stand ausstieß, stank beißend und wurde immer dichter.
Rebecca braucht mich. Neues Adrenalin fuhr durch ihren Körper.
„Schmatz, ich bin fertig! Jetzt fahr endlich!“
„Aber auf deine Verantwortung!“ Wieder tippte er auf seinen Kopf.
„GUMMI!“, schrie sie.
Aus welchem Eck ihrer Erinnerung war dieser Biker-Slang jetzt so plötzlich aufgetaucht? Unwichtig, denn er tat seine Wirkung. Schmatz nickte einmal, als habe er soeben den Befehl einer höheren Macht empfangen, stemmte sich auf den Lenker, als wollte er seinen Trizeps trainieren, drehte am rechten Griff und ließ links die Kupplung schnalzen. Die Erklärung für seine ambitionierte Haltung folgte auf dem Fuß, denn begleitet von bestialischem Heulen ging das Vorderrad des Mofas in die Höhe, ein astreiner Wheely auf den ersten Metern, auch Valeries Gewicht am Gepäckträger geschuldet, wodurch sich der Schwerpunkt nach hinten verlagerte – fast wären sie umgekippt, doch Schmatz hielt sein Ross mit gekonnter Dosierung von Bremse und Gasgriff im Zaum. Kaum hatte das Vorderrad den Kontakt mit der Straße wiedergefunden, waren sie schon im zweiten Gang. Die Kraftentfaltung dieses Spielzeugmotörchens unter ihnen konnte unmöglich Serie sein.
Gut für uns, dachte Valerie, fand dann aber die Geschwindigkeit, mit der Schmatz die ersten Bergabkurven nahm, herzlich optimistisch. Fünfzig Kilometer pro Stunde und mehr konnten am Berg schnell ins Auge gehen, aber der junge Mann gab immer noch Gas. Dritter Gang. Dritter Gang? Valerie kannte solche Mofas eigentlich nur mit zwei, also handelte es sich wohl kaum um das ursprüngliche Getriebe – das Ding war ein umgebautes Tuning-Geschoss! Sie rauschten durch langgestreckte Biegungen, einmal rechts knapp an der Leitplanke, einmal links noch knapper am Felsen vorbei, hüben wie drüben wartete der Sensenmann, doch Schmatz verschenkte keinen Zentimeter der Ideallinie. Die Straße vor ihnen schien schmäler und schmäler zu werden. Valerie wollte instinktiv die seitlich nach vorne gestreckten Beine einziehen, ging nur nicht. Fahrtwind wirbelte durch die wenigen Zentimeter Haar, die seit der Operation nachgewachsen waren, weit entfernt von alter Pracht, aber besser als Glatze. Immer wieder hopsten sie über Unebenheiten, die vom Metall des Gepäckträgers ungefiltert an ihren Allerwertesten weitergegeben wurden. Ein fieser Kanaldeckel ließ sie kurz die Sterne sehen. Diese Fahrt würde sich gleich in mehrfacher Bedeutung einprägen. Egal. Rebecca braucht mich!
Hatte sie schon vorhin über die Potenz des Zweitakters unter ihr gestaunt, gab es nochmal einen Extraschub, als sich vor ihnen eine lange, verkehrsfreie Gerade auftat. Vierter Gang. VIERTER Gang! Oh Gott, dachte Valerie. Aber ob der ihr noch helfen konnte?
Schmatz duckte sich ganz tief runter, sein Kopf zwischen den Hörnern der Lenkstange versenkt, um möglichst wenig Luftwiderstand zu produzieren, dazu Vollgas bis zum Anschlag. Seine windschlüpfrige Haltung bedingte auch, dass ihr sein Hintern näher kam, als ihr lieb war, Schmatz und seine Schlabberhosen, das Gesamtbild unnötig zu erwähnen.
Wir sind im Arsch!, schrie die böse Souffleuse, meinte damit aber die heillose Geschwindigkeit, mit der sie auf die erste Kehre zurasten. Hundert Meter vor ihnen ging es scharf rechts ab, in eine Bahnunterführung, umschlossen von meterhohem (und wohl auch meterdickem) Beton. Schmatz schien die Kurve nicht zu sehen, vielleicht war er im Delirium, vielleicht hatte er seinen Lebenswillen verloren, oder meinte er etwa, sie könnten massive Wände durchstoßen und kämen unterirdisch schneller nach Innsbruck – nur so viel war fix: Dieser Kerl war völlig wahnsinnig!
Valerie graute. Gleich sind wir tot! Ein Helm wäre jetzt doch praktisch gewesen. Praktisch … sinnlos! Wenn Schmatz nicht sofort bremste, musste sie es für ihn tun, also ließ sie ihre Sneakers auf der Fahrbahn streifen, zuerst leicht, dann immer fester, schließlich stemmte sie sich mit rauchenden Sohlen dem Schicksal entgegen, die Sattelstange mit beiden Händen umklammernd, mehr Anker als Passagier. Ja, Schmatz war definitiv durchgedreht, das ging sich doch nie mehr aus!
Schmatz!, wollte sie schreien, doch es blieb ihr im Hals stecken. Als sie schon ans Abspringen dachte, bremste er. Und wie. Unvermittelt ließ er den dritten Gang kommen und zog den Bremshebel so fest, dass sie mit Kopf und Oberkörper an seinen Rücken stieß, unfähig, sich dem körperlichen Vollkontakt zu entziehen. Wie ein Magnet pappte sie an seiner Rückseite. Der zweite Gang brüllte auf. Als sie in die Kurve stachen, waren sie immer noch viel zu schnell, doch Schmatz fuhr sein Knie in Valentino-Rossi-Manier aus und widersetzte sich der Zentrifugalkraft, gab am Scheitelpunkt der Biegung bereits wieder Gas und zog die Kurve sauber durch, während Valerie zu tun hatte, ihr rechtes Bein irgendwo zwischen Auspuffrohr, Tretpedalen und der Straße hindurchzufädeln. Was die Gesetze der Physik mit dieser Schräglage gemein haben sollten, war ihr ein Rätsel, aber es ging sich doch irgendwie aus.
Der Lebensfilm, der schon vor ihr vorbeizuziehen begonnen hatte, flatterte wieder davon, und erst jetzt bemerkte Valerie, wie heiß ihre Füße vom Mitbremsen am Asphalt geworden waren. Dazu war ihr, als röche sie verbrannten Gummi. Keine gute Idee. Oben lassen!, nahm sie sich vor, streckte die Sohlen in den Fahrtwind und vertraute im Übrigen auf Gott. Und Schmatz. Schmatz und Gott. Schmatz, der bereits die nächste Haarnadel anvisierte, und Gott, den sie flehentlich bat, auch dieses Mal beide Augen zuzudrücken.
Rebecca braucht mich doch!
Einige Spitzkehren, Stoßgebete und Begegnungen der dritten Art (wie jene mit dem gelbweißen Linienbus, der sie unheimlich knapp verfehlte) später hatte Valerie sich auf Schmatz’ Fahrstil eingelassen und konnte erstmals wieder Gedanken fassen, die sich nicht ausschließlich um Blut, Asphalt und unfreiwillige Organspenden drehten. Schneller als erwartet würden sie am Bahnhof Innsbruck sein. Und das war gut.
Bald würde sie zum ersten Mal seit der Geburt ihre Tochter wiedersehen. Als sie daran dachte, setzte ihr Herz einen Schlag aus. Was sollte sie ihr sagen? Tausendmal hatte Valerie die Situation durchgespielt, nie die richtigen Eröffnungsworte gefunden. Es gab drei Favoriten, die sie seit Jahren auswendig kannte.
Oh Kind, es tut mir ja so leid.
Ich bin so dankbar, dass ich dich wiedersehen darf.
Nie wieder werde ich dich allein lassen.
Alle stimmten. Doch kein Satz konnte es je wiedergutmachen: Sie hatte Rebecca im Stich gelassen. Zur anonymen Adoption fortgegeben. Verstoßen. Weil das Kind nicht in den Lebensentwurf einer schrecklich naiven Achtzehnjährigen gepasst hatte, die meinte, gegen die Welt rebellieren zu müssen. Alles wäre anders gekommen, hätte Valeries Vater damals noch gelebt. Doch mit seinem Tod erlosch auch ein Teil ihres Lebens, brachte eine dunkle Valerie hervor, die das Wort Rebellion fortan unsichtbar auf der Stirn trug. Rebellion gegen die Mutter, Rebellion gegen die Welt, Rebellion gegen sich selbst. Feuchtfröhlicher Anlass, Filmriss, unbekannter Vater. Unbekanntes Kind.
Rabenmutter.
„Geht’s?“, schrie Schmatz nach hinten, als sie an einem Vorrang-geben-Schild anhielten. Sofort hüllte sich alles in Rauch.
„Jaja, weiter!“ Ihr Hintern glühte. Aber sie musste durchhalten.
Der Berg lag endlich hinter ihnen, nun fuhr der junge Mann zu ihrem Erstaunen auf den breit ausgebauten Autobahnzubringer. Dieses Mofa war wohl weder dafür zugelassen noch geeignet! Bald hatten sie wieder Höchstgeschwindigkeit erreicht, rasten weiter Richtung Autobahn, bis Schmatz im letzten Moment die Ausfahrt nahm, im Kreisel ging es einmal rundherum auf die Bundesstraße, die am Fuß des Berghangs entlangführte. Wieder beschleunigte er, musste vor einem abbiegenden Schottertransporter scharf abbremsen, bevor er den Gasgriff erneut bis zum Anschlag drehen konnte. Langgezogene Kurven wanden sich Innsbruck entgegen. Große Plakate, die zur Vorsicht mahnten und darauf schließen ließen, dass die Strecke bei Motorradfahrern sehr beliebt sein musste. Vierter Gang. Schmatz überholte ein silbergraues Pärchen auf einem voluminösen Reisemotorrad, dann einen Traktor, schließlich einen ausgewachsenen Geländewagen. Das Mofa brüllte bei den Überholvorgängen noch lauter, als wollte es jedem, den es hinter sich ließ, eine Warnung mit auf den Weg geben. Greifvögel kreisten über ihnen, Segelflugzeuge auch. Hin und wieder eine Windböe von der Seite, Blätter auf der Fahrbahn, von schräg hinten wärmte die Herbstsonne. Valerie schätzte ihre Geschwindigkeit auf gute achtzig Kilometer pro Stunde.
Sie musste nicht erst nachrechnen, um das Alter ihrer Tochter zu kennen. Vierundzwanzig. Sechs Jahre älter, als sie selbst bei ihrer Geburt gewesen war. In ihrem Alter war Valerie schon im Dienst der österreichischen Polizei gestanden, hatte die wilden Jahre hinter sich, jedenfalls privat gesehen. Damals war auch die Schuld gekeimt, die von dort an beständig größer wurde. Tag für Tag hatte sie ein kleines bisschen mehr an ihr genagt, ob rational oder nicht, das schlechte Gewissen hatte sich aufgebläht, hatte immer mehr Platz eingenommen und andere Dinge verdrängt. Bis Valerie letztendlich davon überzeugt gewesen war: Sie hatte ihr Kind verstoßen.
Monster.
Sie schüttelte den Kopf, zwang sich zu schöneren Gedanken, die zwar kamen, sich aber ums selbe Thema drehten. Drehen mussten. Jeden vierten Dezember zündete sie Geburtstagskerzen für Rebecca an, wünschte sich beim Ausblasen, das Kind möge sich endlich melden. Nun war es so weit. Bald würden sich Mutter und Tochter gegenüberstehen, zum ersten Mal seit all den Jahren zusammen sein. Bald würden sie womöglich gemeinsam Rebeccas Geburtstag feiern können. Bald würde Valerie aber auch viele unangenehme Fragen beantworten müssen. Das war nur gerecht. Doch würde es im Gegenzug auch Antworten auf ihre eigenen, immer gleichen Fragen geben: Welchen Namen man ihrer Tochter wohl gegeben hatte? Was sie wohl tat? Wo sie wohl lebte? Sicher war sie wunderhübsch und klug und … und tolerant. Ja, tolerant musste sie sein. Und verzeihend. Ein großartiger, edler, weltoffener Charakter, ohne jeden Zweifel. Mit beiden Beinen fest im Leben stehend, unersetzlich für ihre Umwelt. Beliebt bei allen. Und glücklich – ganz ohne ihre leibliche Mutter. Vielleicht sogar deswegen. Valerie fühlte tiefe Dankbarkeit, diese Person in Kürze kennenlernen zu dürfen. Aber was konnten das nur für Schwierigkeiten sein, in denen sie steckte?
Sie waren bereits kurz vor Innsbruck, als Schmatz unvermittelt bremste. Valerie legte den Kopf zur Seite, um sehen zu können, warum. Augenblicklich schoss eine Extraportion Adrenalin in jede Faser ihres Körpers: Verkehrskontrolle. Auch das noch. Ein Polizist zeigte mit der einen Hand auf Schmatz und winkte sie mit der anderen in eine Parkbucht. Dazu machte er ein ziemlich finsteres Gesicht. Blitzschnell überschlug sie die Situation. Sie musste zum Bahnhof. Jetzt. Keine Zeit für Erklärungen. Kein Hallo, Kollegen!, weil: keine Dienstmarke, kein Ausweis. Erschwerend kam hinzu, dass sie keinen Helm trug und auf einem böse frisierten, irre qualmenden Moped saß. Besser gesagt: auf dessen Gepäckträger! Der Besuch der nächstgelegenen Dienststelle war vorprogrammiert. Sinnlos verschwendete Stunden.
Rebecca braucht mich!
„Gib Gas, Schmatz!“, schrie sie und klopfte ihm mit der flachen Hand auf den Rücken.
„Was? Aber Frau Mauser, ich kann nicht weiter, da stehen Poli…“
„GUMMI!“
Wieder tat das Zauberwort seinen Dienst. Sie schlugen einen Haken um den polizeilichen Winkmeister und verfehlten ihn nur um Zentimeter. Valerie konnte den Luftzug spüren, vielleicht sogar noch etwas mehr als das. Sie warf den Kopf herum. Der uniformierte Kollege ruderte mit seinen Armen, dann brüllte er wie ein wild gewordener Affe. Hoffentlich lässt er seine Glock stecken, dachte Valerie, als sie in die Kranebitter Allee rasten, kaum Verkehr, hinter ihnen das Folgetonhorn der Polizei, leise, lauter, ganz laut. Valerie lehnte sich zurück und legte den Kopf in den Nacken, sah alles verkehrt herum und staunte erneut über die Rauchwolke, die das Gefährt ausstieß, mittendrin der Einsatzwagen, der rasch aufholte und schließlich bis auf wenige Zentimeter auffuhr, fast hätte der Fahrer sie gerammt, der Idiot. Einen Verfolgten auf die Hörner zu nehmen, stand so in keiner polizeilichen Dienstanweisung. Valerie quittierte die rücksichtslose Fahrweise des Beamten mit ihrer rechten Hand, erst Scheibenwischer, gefolgt vom Autofahrergruß, was nicht unbedingt zur Deeskalation beitrug, aus ihrer Sicht aber mehr als gerechtfertigt war.
Als das Polizeiauto zum Überholen ansetzte, verlagerte Valerie ihr Gewicht nach links, brachte das Moped aus der Spur, und bis Schmatz die unerwartete Lastverlagerung wieder ausbalancieren sowie gegenlenken konnte, waren sie auch schon auf die andere Fahrbahn geraten und hatten den Überholweg blockiert. Heftiges Hupen verriet, was die Polizisten von diesem Manöver hielten.
„Hey!“, protestierte auch Schmatz.
„Niemanden überholen lassen!“, befahl Valerie und feuerte sicherheitshalber ein dreifaches „Gummi! Gummi! GUMMI!“ hinterher. Rechts ließen sie das Innsbrucker Ortsschild hinter sich. Jetzt war es nicht mehr weit.
Schmatz hatte seinen Auftrag endlich begriffen: sie ohne Rücksicht auf Verluste auf schnellstem Weg zum Innsbrucker Hauptbahnhof zu bringen. Deshalb brauchte sie ihn nicht mehr extra anzuweisen, rote Ampeln zu überfahren oder erneute Überholversuche zu blockieren. Seine Fahrweise war sogar richtig geschickt, schlitzohrig boshaft, landläufig hundsgemein – aber auf nette Art, jedenfalls aus ihrer Perspektive. Von rechts kam ein weiterer Polizeiwagen mit Blaulicht, zu spät, um ihnen den Weg abzuschneiden, und so musste sich die Verstärkung ebenfalls hinter ihnen einreihen. Bald wird noch ein Hubschrauber über uns schweben, fürchtete Valerie und fühlte sich an Live-Verfolgungsjagden aus den USA erinnert. Und daran, wie oft diese fatal ausgingen, weil entweder die Verfolgten oder die Cops die Nerven verloren. Sie würde sich nicht mehr aufhalten lassen. Alle Schuld auf sich nehmen. Ich muss Rebecca helfen!
Sie bogen rechts um einen zackig geformten Häuserblock herum auf die Universitätsbrücke, ein Windstoß, unter ihnen Wasser, hinter ihnen Chaos, vor ihnen Schicksal. Zur Abwechslung zeigten die Ampeln grün, als sie unweit des LKA Tirol den Innrain querten und die Anichstraße nahmen, Linkskurve, dann am Leokino vorbei, geradeaus, scharf rechts, am Zebrastreifen um einen Mann mit Stock herum, dieser verschaffte ihnen wieder etwas Vorsprung, denn das Polizeiauto musste warten, bis der Greis seiner Empörung mit wedelnder Gehhilfe ausreichend Luft gemacht hatte. Schmatz fuhr geradeaus, links, Müllerstraße, Leopoldstraße, bei Rotlicht in die Salurnerstraße, der Bahnhof wenige hundert Meter vor ihnen.
„Zur Bahnhofswache, Schmatz!“, präzisierte Valerie den Zielort.
Als sie zurückblickte, klebten schon drei Blaulichtfahrzeuge an ihren Fersen. Noch einmal Vollgas, noch einmal Rot missachtet, links den Südtiroler Platz hinunter, rechts direkt vor die Polizeidienststelle auf den Gehsteig. Schmatz hielt an, hinter ihnen quietschende Autoreifen, Valerie stieg ab, besser gesagt: stand auf, spürte ihren Hintern nicht mehr, spürte gar nichts mehr, rannte ins Innere, direkt auf den Schalter zu.
Vor fünf Tagen | Hosin, Tschechische Republik
Sophia ist hier. Sie weiß es. Spürt es. Er hat sie hierhergebracht.
Vorsichtig schiebt sie die Zweige auseinander, um den Blick aufs Gelände freizumachen. Von hier oben sieht sie alles, besser gesagt nichts, wie schon seit gestern. Nur die umherlaufenden Wachhunde lassen darauf schließen, dass Menschen anwesend sind oder bald zurückkehren werden.
Hallen, darüber Büros, ein Wohntrakt, dunkel in der Nacht, verlassen am Tag. Brachliegende, geschotterte Freiflächen, von zähen Pflanzen und Unkraut durchstoßen. Verwahrlost.
Hier verlaufen sich Sophias Spuren im Sand, im Wald nahe Hosin, unweit der tschechischen Stadt Budweis. Das Gelände gehört Knarr, Milan Knarr, jenem Mann, dem sie gemeinsam in die Suppe spucken wollten, damals, als sie noch Seite an Seite waren. Dem Mann, der eine Bande von Tierschmugglern anführte, die Millionen damit verdiente, exotische Tiere nach Deutschland und Österreich zu schmuggeln, und dabei in Kauf nahm, dass diese in falschen Autoreifen, Koffern und Verstecken aller Art elendiglich verreckten. Sophia und sie hatten herausgefunden, dass Knarr hinter der Geschichte mit den fünfzehn Hundewelpen steckte, erst ein paar Wochen alt, die in der sengenden Sonne eines Autobahnstaus überhitzt waren. Der Zoll hatte sie entdeckt. Alle tot. Und Knarr? Der kam mit einer Geldbuße davon.
Sie hasst es, dass der Staat Tiere wie Sachen behandelt und meint, Tiermord und Tierleid seien bloße Sachbeschädigung. Man verbrüht Eier von Vögeln, die vom Aussterben bedroht sind, weil man zu blöd ist, diese sicher zu transportieren, und das soll gleich schlimm sein wie das Stehlen eines Mercedes-Sterns? Man erschlägt unverkäufliche Hundewelpen, und wenn man erwischt wird, ist es, als schlüge man Fensterscheiben ein? Wer keinen Profit abwirft, hat es nicht verdient, zu leben? Geld macht alles wieder gut? Aber wie lässt sich ein totes Tier wiedergutmachen? Sie ballt die Faust. Diese Gesetze stammen nicht von Menschen, sondern von Bestien. Was ihrer Erfahrung nach auf dasselbe hinausläuft.
Sie wollten Knarr eine Lektion erteilen, nicht mehr, haben ihn aufgespürt in seiner Nobelvilla am Attersee, wo er mit seinen schicken Wägen und einem Motorboot direkt am hauseigenen Steg protzte. Zugegeben, ihr Plan hatte Lücken. Sie wollten sich diesen Knarr greifen, ihn verprügeln, dazu noch in die kleinste Kiste stecken, die sie finden konnten, damit er am eigenen Leib erfahren würde, wie sich das anfühlte. Oder so ähnlich. Jedenfalls sollte er wissen, dass es jemanden da draußen gab, der etwas gegen ihn und seine Machenschaften hatte, wenn es denen da oben schon scheißegal war. Sophia und sie haben auf den perfekten Moment gewartet, gehofft, er würde einfach so auf den Steg hinausstolzieren wie am Morgen zuvor. Und so kam es auch, selbstgefällig wankte er bei Tagesanbruch aus dem Haus und zum Wasser, stand auf den Holzplanken ganz vorne, Nebelfetzen über dem See, keine Boote, keine Menschenseele außer ihnen und Knarr – hier stand es, das perfekte Ziel, keine dreißig Meter entfernt … keiner würde sie sehen … aber Sophia hat so lange gezögert – sie war immer so zögerlich …
Und genau damit hatte sie ihnen das Leben gerettet. Denn gerade, als sie sich losreißen und nach vorne laufen wollte, brachten zwei Männer einen Gefesselten heraus und drückten ihn vor Knarr auf die Knie. Dieser zog eine Pistole aus seinem Mantel und schoss ihm aus nächster Nähe in den Kopf.
Knarr muss Sophia gefunden haben.
Sie nimmt den Anhänger ihres Goldkettchens zwischen Zeigefinger und Daumen, spürt die Zacken, wo die kleine Münze geteilt wurde, führt sie in den Mund. Salzig. Sie hat das Zeichen ihrer Verbundenheit kein einziges Mal abgenommen, nicht einmal, als sich ihre Wege scheinbar für immer getrennt haben. Blutsschwester war man für immer. Sie und Sophia. Und wie sie Schwestern waren. Das gemeinsame Elternhaus, Rebellion und Ausbruch, ihr Kampf für das Gute, gegen die Menschen. Der Messerschnitt, der sie zu Blutsschwestern machte. Das Versprechen, sich für Tiere einzusetzen, wann immer man konnte.
Was sie erlebt haben. Wahnsinnige Räusche, Kämpfe und Triumphe, unbändiges Leben. Und Niederlagen. Die Zeit im WWF, ihr Ausscheiden, weil sie die Spielregeln nicht befolgten. Aber was erreichte man schon mit Regeln im Kampf gegen Leute, die sich an keine einzige hielten!
Knarr, der Tier- und jetzt auch Menschenmörder. Wie er in Seelenruhe abgedrückt hat, in der Öffentlichkeit des Seeufers, wo er doch damit rechnen musste, beobachtet zu werden. Irgendwer sah immer etwas. Aber das war ihm ebenso egal wie die Lautstärke des Schusses. Wie er über den zur Seite gefallenen Körper gestiegen und wieder hineingegangen ist, einem seiner Männer im Vorbeigehen die Waffe gereicht hat, während sich schwächer werdende Blutfontänen aus dem Kopf des Mannes in den See ergossen. Wie Sophia ihr den Mund zugehalten hat, weil alles in ihr schrie und aus ihr herauswollte. Wie sie sich schweigend davongestohlen haben und nicht wussten, wie umgehen … wie sie nie wieder ein Wort über das Gesehene verloren haben.
Wie es begann, Sophia aufzufressen.
Die schweren Schatten, die folgten. Nächte unter Brücken bei arktischen Temperaturen, dem Tod näher als dem Leben. Männer wie Tiere. Nein, viel schlimmer. Sophias eskalierende Heroinabhängigkeit, die Vergewaltigung, sie im Wodkarausch daneben, unfähig, einzuschreiten. Sie hat später für Gerechtigkeit gesorgt. Wer sonst, die Polizei vielleicht? Sie spuckt aus, als hätte sie einen schlechten Geschmack im Mund.
Überdosen, unfreundliches Klinikpersonal, meistens waren sie wegen Sophias Drückerei dort, manchmal hatte sie selbst zu viel Booze erwischt. Die Fratzen angewiderter Passanten und systemkonformer Spießer, denen sie wohl zu schlecht rochen. Tage ohne Essen, Tage im Rausch, Tage in der Hölle. Sophia und sie taten, was nötig war, um zu überleben, wofür Sophia eben härtere Sachen brauchte. Sie wären füreinander gestorben … jedenfalls wäre sie für Sophia gestorben. Ob es umgekehrt auch so war, kann sie heute nicht mehr eindeutig sagen.
Dann war Sophia weg.
Man hatte die Männerleiche gefunden, Monate später, in einem beschwerten Plastiksack am Grund des Sees. Mafiamord am Attersee war die Schlagzeile gewesen, die Polizei tappte im Dunkeln, was sonst. Sophia war sofort entschlossen, gegen Knarr auszusagen, sie wusste, sie würde damit nicht zurechtkommen, keine Droge war so stark, die Erschießung aus dem Kopf zu vertreiben. Nichts konnte sie mehr davon abbringen, auch nicht der Vorschlag, sich diesen Knarr selber vorzuknöpfen, ohne Polizei.
„Wann kapierst du endlich, dass wir aufhören müssen zu träumen?“, hatte Sophia sie angeschrien, und es war das Letzte gewesen, das sie von ihr gehört hat. Dann war sie weg.
Das Innenministerium hatte ihr Zeugenschutz angeboten, eigentlich aufgedrängt, weil Knarr genug Beziehungen hatte, um sich auch aus der Gefangenschaft heraus an ihr rächen zu können. Aber der große Prozess brachte ihn gar nicht erst hinter Gitter. Die Geschworenen haben Sophia nicht geglaubt – Knarr wurde „aus Mangel an Beweisen im Zweifelsfall“ freigesprochen. Weil diese Idioten einer Drogenabhängigen weniger glaubten als einem Schwerverbrecher. Sie selbst hat es aus einer Gratiszeitung erfahren, zum Prozess ist sie nicht gegangen, aus Trotz und Wut gegenüber dem System, das alles nur schlechter machte, und genau so ist es dann auch gekommen. Statt Knarr musste Sophia in die Isolation, bekam ein völlig neues Leben umgehängt, alles Alte vorbei. Aber Blutsschwester war man doch für immer! Sie würde auch heute noch für sie sterben … würde sie … würde sie wirklich?
Gebell. Sie lässt den Anhänger fallen, er klatscht ihr wohlvertraut gegen den Hals. Kein Hinweis, was die Hunde so aufregend finden, vielleicht ein Tier im gegenüberliegenden Waldstück, vielleicht haben sie einfach Langeweile, wer kann es ihnen verdenken, hier in dieser Pampa.
Sie wartet nur noch aus einem einzigen Grund: weil sie glaubt, es Sophia schuldig zu sein. Ihr Zögern hat ihnen damals das Leben gerettet. Ginge es nach ihr, würde sie einfach hineinstürmen, diesen Knarr suchen und ihm an die Gurgel springen, egal, was danach passiert. Aber damit würde sie Sophia gefährden. Wenn sie noch lebt.
Wie konnte er sie finden, wenn es nicht mal ihr selbst gelang? Bei Gott, sie hat es versucht. Auf allen Wegen, die ihr eingefallen sind. Bei ihren gemeinsamen Adoptiveltern, die sie eigentlich nie hatte wiedersehen wollen. Am Gericht und sogar bei den Bullen … ach, fuck. Sie hatte bald nicht mehr gewusst, wen sie noch fragen sollte. Sie war in Sophias neuem Leben genauso unerwünscht wie Milan Knarr. Aber wenigstens einmal melden hätte sie sich können, sie wissen lassen, dass es ihr gut geht. Nada.
Es regnet wieder, also zieht sie sich in den Unterstand zurück.
Nada, bis zu diesem Artikel in der Zeitung. Sekretärin Stefanie Wend, abgängig in München. Auf dem Foto eindeutig Sophia und doch sonderbar fremd. Nicht mehr die Sophia aus ihrer Erinnerung. Ernster. Erwachsener und gepflegter … besser, wie sie zugeben musste. Stefanie Wend, die Büro-Saftschubse, sah gesünder aus als Sophia Brennsteiner, die heroinabhängige, gelegenheitskriminelle Tierschützerin. Und war doch eindeutig sie. Abgängig in München. Daraufhin hatte sie versucht, mehr herauszufinden, aber vergebens. Keine Adresse, kein Arbeitgeber, sie war Sekretärin für Mister Nobody in einer Luftschlossfirma, hatte keinen Mann oder Freund, keine Kinder, war ein Phantom von Sekretärin, das niemandem fehlte.
Ihre gemeinsame Adoptivmutter gab sich bestürzt über Sophias Verschwinden, unternahm aber nichts. Was sollte sie schon machen, Zeugenschutzprogramm und so weiter, die liebe Frau Nationalrätin versteckte sich lieber hinter Behörden und Vorschriften, als sich um ihr Kind … Adoptivkind zu kümmern. Sophia und sie haben schon gewusst, warum sie nichts mehr von ihrem früheren Zuhause wissen wollten. Sie spuckt aus.
Nie zuvor hat sie so aufmerksam alle Nachrichten verfolgt, aber lange schien es, als wäre Sophia vom Erdboden verschluckt worden. Bis zum nächsten Artikel vergingen drei Monate. Er zeigte tschechische Polizeibeamte genau vor diesem Gelände hier, in Verbindung mit dem Hinweis, dass sich Stefanie Wends Handy ziemlich genau an dieser Stelle unweit des Flugplatzes Hosin vor Wochen ins Netz eingeloggt hat, bevor es vermutlich deaktiviert wurde. Oder zerstört. Jedenfalls hatten die paar Hinweise ausgereicht, um hierherzufinden.
Dass die Polizei nichts gefunden hat, bedeutet gar nichts. Wo Kohle im Spiel ist, lässt sich Blindheit erkaufen. Überall auf der Welt – und ganz konkret, man musste sich nur diesen Prozess ansehen. Ein Witz war das, kein Prozess. Hätte Sophia nur auf sie gehört …
Je mehr Zeit vergeht, desto schlechter kann es um ihre Blutsschwester stehen. Wenn sie überhaupt noch lebt … Ihre Essensvorräte sind fast aufgebraucht, nicht weiter schlimm, es gäbe genug Pflanzen, Beeren, Pilze und Insekten, sie könnte auch an der nahe gelegenen Moldau fischen gehen, doch dafür bräuchte sie Zeit, die sie nicht hat, denn sie darf nichts verpassen. Ihr Beobachtungsposten ist trocken, an Wasser kommt sie auch jederzeit. Sie könnte Wochen hier im Wald aushalten, es wäre auch nicht das erste Mal, doch diese Untätigkeit hier bringt sie nicht weiter. Sie muss etwas unternehmen. Sie wird im Schutz der Dunkelheit ein Loch in den Zaun schneiden und notfalls jeden Stein nach Sophia umdrehen. Bald.
Verdammt, Sophia!
Drei Stunden später entschloss sie sich zum Einbruch. Zuerst musste sie die Hunde ruhigstellen. Sie war zwar den Tieren näher als den Menschen, deshalb aber nicht so durchgeknallt, sich an deutschen Schäferhunden vorbeimogeln oder diese mit irgendwelchen Psychotricks aus Fernsehkrimis besänftigen zu wollen. Die Betäubungsaktion war dann schwieriger als gedacht. Denn die beiden haben den ersten Versuch, ihre hausgemachten Magic Mushrooms, schlicht verschmäht. Die vermeintliche Delikatesse: Steinpilze, präpariert mit je zwei Benzo-Tabletten. Fritz und Franz, wie sie die beiden Rüden getauft hatte, haben dran geschnuppert, sie dann aber einfach liegen gelassen. Und weil sie gerade weder Würstchen noch andere Leckereien griffbereit hatte, hieß es – so unauffällig es ging – ab in den nächsten Supermarkt und wieder zurück. Unnötige Aufmerksamkeit erregt und wertvolle Zeit verschwendet. Vier Benzos obendrein. Nochmal je zwei davon in die Bratwürste gesteckt, damit war der Tablettenblister leer. Die nächsten Tage würden hart werden. Fuck.
Wenigstens taten die Tranquilizer ihren Dienst. Sie hat die präparierten Leckerbissen über den Zaun geworfen, die Hunde haben sie aus dutzenden Metern gewittert und sich gierig draufgestürzt. Schon wenige Minuten später bewegten sich Fritz und Franz nur noch in Zeitlupe.
Jetzt liegen sie da.
Mit dem Multifunktionstool zwickt sie ein Loch in den Maschendrahtzaun und steigt hindurch. Ohne die Taschenlampe anzumachen, läuft sie geduckt über das Gelände, dorthin, wo die Hunde sind, ertastet ihre Lage, checkt Atmung und Herzschlag, ruhig und gleichmäßig. Sehr gut. Die würden eine Weile schlafen, aber bei ihrer Größe und Körpervolumen kaum Schaden nehmen, denn wie sie aus eigener Erfahrung weiß, kann man schon einige davon schlucken, bevor man in die Nähe einer Atemdepression kommt. Sie fährt den Tieren noch ein paarmal durchs Fell, dieses ist stellenweise verfilzt, sie ahnt, dass sich Parasiten darin eingenistet haben. Knarr sind seine Tiere so scheißegal wie die Menschen, denkt sie, dann rennt sie weiter, geduckt, gut hundert Meter bis zu den leeren Käfigen, es stinkt nach Exkrementen, sie schlüpft hinter die ersten Gebäude, in den Innenhof, der bisher vor ihren Blicken verborgen war. Auch hier kein Licht, keine Autos, kein Hinweis auf Anwesende oder Gefangene. Keine Spur von Sophia.
Nichts, das ihr helfen würde, etwas zu sehen, immer noch ist es bewölkt und nieselt. Nach mehreren Minuten des Umherirrens, Tastens und Stolperns entschließt sie sich, die Taschenlampe anzumachen, nähert sich leise dem ersten Gebäude, das aus zusammengeschweißten rostigen Containern besteht, tritt zur Tür und lauscht … nichts. Vorsichtig drückt sie die Klinke hinunter, zieht und drückt in Zeitlupe, zuerst leicht, dann fester. Versperrt. Sie ist sich ziemlich sicher, dass weder Milan noch jemand von seinen Leuten hier ist, hat aber nichts dabei, um sich gewaltsamen Zugang zu verschaffen. Kurz überlegt sie, nach Sophia zu rufen, verdrängt den Impuls wieder. Weiter zum nächsten Eingang. Auch hier nichts zu machen. Wenigstens gibt es hier ein Fenster, sie leuchtet hinein, erkennt durch die schmutzigen Scheiben zwei Feldbetten. Gerümpel, einen Tisch, Flaschen, Papier und Gläser. Die Aufenthaltsbaracke. Und weiter.
Immer wieder macht sie Pause, hockt sich hin und konzentriert sich ganz auf ihr Gehör. Wäre Sophia eingesperrt, würde sie vielleicht klopfen oder sonst wie auf sich aufmerksam machen. Aber nichts. Vielleicht hat sie schon aufgegeben, Signale nach draußen senden zu wollen. Kein S.O.S. im Morsecode. Wasser tropft, Wind rauscht in den Bäumen. Kein Klappern, keine Schritte, kein Niesen, Husten oder Schnarchen. Nichts, das auf die Anwesenheit eines Menschen deuten würde.
Mehr und mehr gibt sie die anfängliche Vorsicht auf, bewegt sich freier, leuchtet jeden Winkel des Geländes mit der Taschenlampe aus, rüttelt an Türen und ruft dann doch Sophias Namen, zuerst verhalten, gegen Türen, in Spalte hinein, gezischt, dann lauter, schließlich übers ganze Gelände. Wenn sie nicht bald einen Hinweis hat, wird sie Fenster einschlagen und im Inneren weitersuchen. Vorher noch die Garagen. Zumindest diese sind unversperrt, mit metallischem Quietschen öffnet sie das erste Tor, es schwingt von alleine nach oben und kracht gegen einen Bolzen. Sie schreckt zusammen. Wäre jemand hier, hätte er das definitiv nicht überhören können. Kurz wartet sie, aber wieder keine Reaktion, dann leuchtet sie hinein. Leer. Nur Dreck, von breiten Reifen hereingetragen, sonst nichts. Weiter zur zweiten, auch diese nicht verschlossen, hier lagern Gerümpel, Kleintierkäfige, schlampig verwahrtes Werkzeug, ein ausrangiertes Aquarium, Kanister und Dosen, es riecht nach Putzmitteln, der Fliesenboden ist schmierig, der Boden … in der Mitte Holzplanken … es gibt einen Bretterboden! Darunter ist sicher so eine schmale Grube, die man braucht, um an die Unterseite von Autos heranzukommen, kombiniert sie. Das perfekte Versteck für … „Sophia!“, ruft sie laut. Keine Reaktion. Hastig versucht sie, eines der Holzbretter mit bloßen Fingern herauszuheben, doch sie liegen zu dicht aneinander, also sucht sie im Werkzeug, findet einen Schraubenzieher, sticht damit in den Zwischenspalt und zwängt ein Brett über das andere, hebt es heraus und wirft es zur Seite, dann das nächste, noch eines, glaubt, etwas in der Tiefe zu erkennen. „Sophia!“, schreit sie, greift nach der neben ihr am Boden liegenden Taschenlampe, um in die Grube zu leuchten …