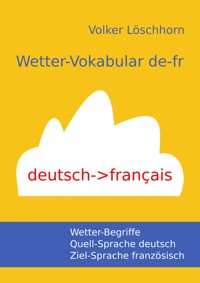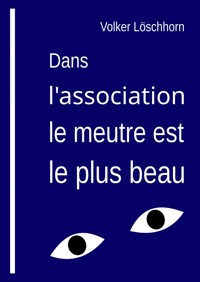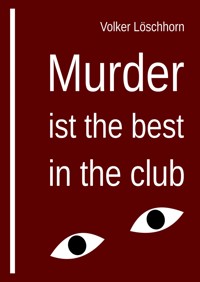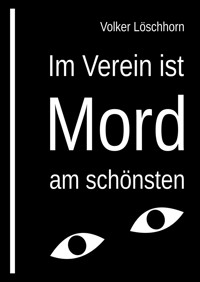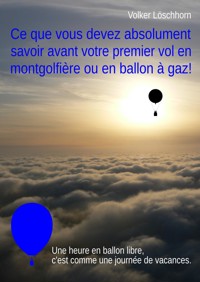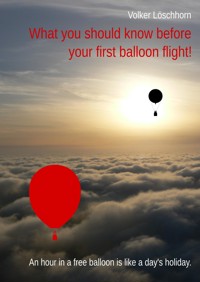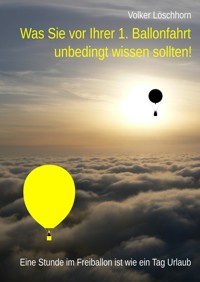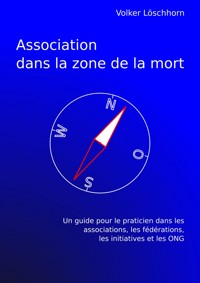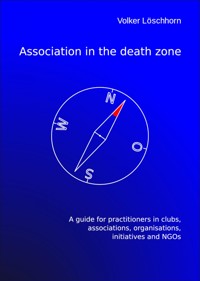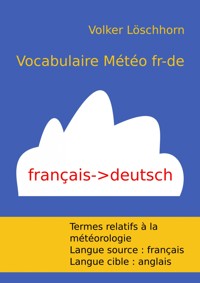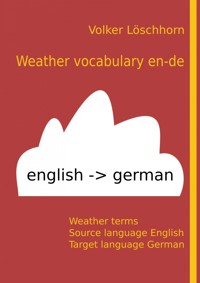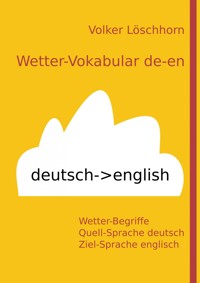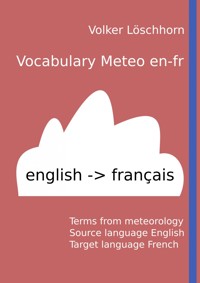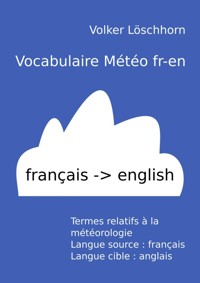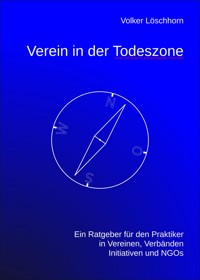
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Vereine sterben leise. Aber warum? Und vor allem wie kann man das ändern? Klagen hilft nicht weiter, Veränderung muss her. Aber wie soll sich der Verein verändern? Wenn es die Mitglieder wüssten, würden sie keinen Rat benötigen. Dieses Buch lenkt den Blick auf die Vereinskultur, die zwischenmenschliche Seite die einen Verein attraktiv macht. Der Leser soll anhand der im Buch genannten Punkte prüfen, welche auf seinen Verein zutreffen, und welche als Ansatz für Veränderung dienen können. Veränderung ist ein Prozess, der zum einen Vorüberlegungen benötigt, wie man ihn startet. Und dann eine fortlaufende Rückkopplung und Prüfung, ob man in der gewünschten Richtung und Geschwindigkeit vorankommt. Die Aussagen dieses Buches treffen nicht nur auf Vereine zu, sondern auf viele anderen Organisationen ebenso: Verbände, NGOs, Initiativen, Gruppen und so weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Löschhorn
Verein in der Todeszone
Impressum
Texte: © 2024 Copyright by Volker Löschhorn
Umschlag: © 2024 Copyright by Volker Löschhorn
Verlag
Volker Löschhorn
Dattelweg 37 B
70619 Stuttgart
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.loeschhorn.name
Mehr Bücher und anderes von mir finden sie auf meiner Homepage
Inhaltsverzeichnis
Impressum 2
Vorwort 5
Verein kann nur als Verein funktionieren 7
Analyse 11
Gruppen im Verein 13
Wie groß ist der Leidensdruck? 16
Was soll erreicht werden? 17
Der Weg 18
Vereinsversammlung als Initialzündung 28
Tag der Entscheidung 32
Fallstricke 37
Den Kurs halten 43
Fehlverhalten 50
Es geht nur echt 55
Eine positive Vision entwickeln 56
Es geht um Menschen 60
Anhang 61
Feedback an den Autor 68
Vorwort
Vereine müssen sich vielfältigsten Herausforderungen stellen, und werden dabei von Amateuren geführt. Im Begriff Amateur steckt das Wort LIEBE, und die Liebe zur Sache ist eine tolle Voraussetzung, eine tolle Motivation für das eigene Engagement. Nur muss die Liebe um das entsprechende Handwerkszeug ergänzt werden, um der aus Liebe getanen Arbeit Wirksamkeit zu verleihen. Umgekehrt nützt das beste Handwerkszeug nichts, wenn es nicht zielgerichtet eingesetzt wird. Was im Verein bedeutet, dass es für ein gemeinsames Ziel eingesetzt wird. Professionelle Vereinsarbeit hat nichts mit einer Monetarisierung zu tun, sondern die Arbeitsweise an die Bedingungen ehrenamtlichen Engagements in einer sich selbst organisierenden Gemeinschaft anzupassen.
Ein Verein ist eine sich selbst organisierende Gemeinschaft.
Und eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Verein ist die Erkenntnis - und zwar wirklich Erkenntnis und nicht Lippenbekenntnis - dass das wichtigste Kapital eines Vereins seine mitarbeitenden Mitglieder sind, und dass sich auch unbezahlte Arbeit lohnen muss. Und dieser Lohn heißt Wertschätzung, Gestaltungsmöglichkeiten, Erfolg.
Dankesfloskeln ungleich Wertschätzung – Dank als Bezahlung.
Dieses Buch möchte ein Ratgeber sein. Aber ein Rat ist keine Anweisung, der Ratgeber kein Bestimmer, und der Beratene muss prüfen, ob der Rat auf seine Situation passt. Bestenfalls setzt ein Rat eine Entwicklung in Gang. In diesem Sinne, nicht nur lesen, sondern die Gedanken weiterentwickeln.
Ein Rat ist kein Befehl.
Die Motivation des Amateurs um professionelles Handwerkszeug zu ergänzen, damit »Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint.« zu »Gut gemeint und gut gemacht.« wird, das ist das Ziel dieses Buches. Und professionell arbeiten bedeutet hier, die Arbeitstechniken an die besonderen Verhältnisse einer »Gemeinschaft mitwirkender Mitglieder« anzupassen. Und nicht Führungsverhalten aus dem beruflichen Umfeld im Verein einzusetzen. Und – ganz wichtig – dabei nie aus den Augen verlieren, dass unser Verein nicht Selbstzweck ist, sondern einen Zweck, ein Ziel verfolgt. Und der Verein ermöglichen soll, dieses Ziel zu erreichen. Und die gelebte Vereinskultur der Schlüssel zu einem erfolgreichen Verein ist.
Vereinskultur leben bedeutet mitwirken am Vereinszweck, der Organisation die diesen ermöglicht, und dem Vereinsleben, dass die spezielle Organisationsform des Idealvereins ausmacht.
Und der Verein ist in Gefahr wenn die Vereinskultur nicht stimmt - viele Vereine sind in ihrer Existenz bedroht, weil ihre Kultur nicht stimmt.
Die Vereinskultur ist ein Regelwerk meist ungeschriebener Regeln nach denen der Verein nach Meinung seiner Mitglieder bisher erfolgreich funktioniert hat.
ABER: Wenn er mit dieser Kultur, diesen Regeln und Verfahren, nicht oder nicht mehr erfolgreich funktioniert, gilt:
Nichts ist so schwer zu ändern wie die Kultur eines Vereins!
Vereinskultur ist die gemeinsame Vorstellung der Mitglieder über Regeln und Verfahren, die im Verein gelebt werden.
Und wie das Zusammenwirken der Vereinsmitglieder nach diesen Regeln funktioniert, davon hängt der Erfolg des Vereins ab.
Verein kann nur als Verein funktionieren
Aber was macht einen Verein zum Verein, was macht einen Verein so besonders?
Ein Hauptmotivation für die Mitgliedschaft im Verein ist nach wie vor die Geselligkeit.
Der Hauptgrund für die Mitarbeit in einer Firma ist das Einkommen.
Ein Verein ist keine Firma.
Unser Verein – unser Stamm?
Natürlich verfolgt ein Verein Ziele, hat einen Zweck, stellt sich Aufgaben. Aber vor allem ist ein Verein eine soziale Gemeinschaft – mit allem was zu menschlichen Beziehungen dazu gehört: »Wir sind alle eine große Familie, und genauso streiten wir uns auch…«.
Im Unterschied zur Familie ist die Mitgliedschaft im Verein freiwillig, wir haben uns bewusst dafür entschieden. Andererseits können der Kontakt und die Beziehungen unter Vereinsmitgliedern intensiver als in mancher Familie sein, und damit steigt auch die Bedeutung dieser Beziehungen. Vereine sind demokratisch verfasst, aber es gibt Vereine die mehr paternalistisch geführt werden als dass sich die Mitglieder am Entscheidungsprozess beteiligen. Die Frage ist, liegt das am Führungspersonal? Oder an den Mitgliedern, die es bequemer finden sich leiten zu lassen? Auf Dauer führt ein Führungsstil nach dem Motto »Ich bin der Kapitän, ihr seid die Ruderer« zu einer Verarmung des Vereins. Denn die Kompetenzen der Mitglieder fließen nicht in die Entscheidungsfindung ein, und Mitglieder die mitwirken möchten, ziehen sich zurück oder verlassen gar den Verein.
Ich bin der Kapitän – ihr seid die Ruderer.
Ich brauche keinen Vormund.
Dem paternalistischen oder auch autokratischen Führungsstil wird Vorschub geleistet, wenn sich die Mitglieder der Übernahme von Aufgaben und Verantwortung verweigern. Und die Vereinsführung dann schnell nach der Devise handelt: »Wenn wir schon alles allein machen müssen, dann entscheiden wir auch allein«. Und die Mitglieder den Vorstand den Karren alleine ziehen lassen nach dem Motto: »Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt.« Und sich dann wundern, dass diejenigen die den Karren ziehen auch die Richtung bestimmen.
Mitwirkung muss gefordert UND geleistet werden. Und eigentlich möchten wir doch alle mitwirken. Warum klappt es dann mit der Mitarbeit im Verein so oft nicht? Liegt es daran, dass das Rollenbewusstsein nicht passt, dass uns gar nicht bewusst ist, in welcher besonderen Weise ein Verein nur funktionieren kann?
Unser Verein – ein Dienstleister?
Der Zweck allein trägt einen Verein nicht. Sport beispielsweise kann ich im Studio oder im Verein treiben. Aber im Sportstudio bin ich ausschließlich Nutzer, und meine Beziehung reduziert sich auf eine Geschäftsbeziehung – Zahlung gegen Leistung. Und diejenigen, die dafür arbeiten die Leistung bereit zu stellen, werden dafür mit Geld entlohnt. Für den Verein ist problematisch,
dass Mitglieder meinen, sie könnten im Verein genauso verfahren, ihre Beziehung zum Verein auf Bezahlung gegen Leistung reduzieren,
und dass Vereine meinen, sie müssten da mitmachen, da sie sonst diese Mitglieder verlieren würden.
Unser Verein – eine sich selbst organisierende Gemeinschaft?
Von der Struktur her ist ein Verein eine sich selbst organisierende Gemeinschaft. Angefangen von der Gründung des Vereins, die nur durch mehrere erfolgen kann, bis zur Festlegung von Zweck und Satzung. Im Ursprung besteht der Verein aus gleichberechtigten Mitgliedern, bis, ja bis, zur Wahl des Vorstandes. Vielfach gewinnt man den Eindruck, dass die Mitglieder meinen, mit der Wahl des Vorstandes hätten sie jetzt genug geleistet, und der Vorstand möchte sich jetzt bitte um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse kümmern. Auma Obama, die Schwester des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, hat einmal in einem Interview auf den Vorwurf, dass ihr Bruder so wenig umgesetzt habe, geantwortet, dass er falsch verstanden worden sei. Sein Motto sei immer »Yes, we can« gewesen und nicht »Yes, I can«. Und sie hätten ihn gewählt und dann allein gelassen. Wenn unser Verein auch nicht mit den Vereinigten Staaten von Amerika gleichzusetzen ist, kommt einem das nicht bekannt vor? Der Vorstand wird gewählt, aber wird er auch unterstützt?
Je mehr ein Verein sich in seiner Arbeitsweise von der sich selbst organisierenden Gemeinschaft entfernt, desto weniger funktioniert er, und die Zufriedenheit der Mitglieder sinkt. Diesen Gedanken sollten wir bei allen weiteren Überlegungen im Hinterkopf behalten.
Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt.
Mitwirkung beruht auf Gegenseitigkeit.
Verein auf Dienstleistung zu reduzieren, ist das die Zukunft?
Berechnen, statt sich einzubringen
Analyse
Beginnen wir mit der Bestandsaufnahme – wie schätzen wir den IST-Zustand unseres Vereins ein? Scheuen wir uns nicht eine realistische Sicht zu entwickeln. Wer den Finger in die Wunde legt wird oft als Miesepeter verschrien. Aber die Realität wahrzunehmen ist eine Grundvoraussetzung für Veränderung, denn die Realität ist die Ausgangslage. Ziel unserer Analyse ist die Ausgangslage zu erfassen – um darauf aufbauend Veränderungen in Angriff zu nehmen.