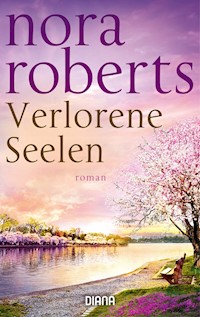
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Frauenmörder treibt sein Unwesen in Washington. Seine Opfer: Blondinen. Sein Kennzeichen: ein weißer Priesterschal. Tess Court, die mit der Aufklärung des Falles betraute Psychologin, fällt nicht nur Ben Paris von der Mordkommission auf, der mit ihr an dem Fall arbeitet. Auch dem Mörder bleibt die bemerkenswerte Blondine nicht verborgen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Zum Buch
Eine furchterregende Mordserie hält Washington in Atem: Den Täter treiben offenbar religiöse Motive um, denn die Opfer – allesamt junge blonde Frauen – werden mit einer weißen Priesterstola erdrosselt. Zudem findet die Polizei bei den Leichen Zettel, die den Toten Vergebung versprechen. Der ermittelnde Police Sergeant Ben Paris zieht die Psychologin Tess Court zu dem Fall hinzu. Schon bald empfinden beide mehr als nur berufliches Interesse füreinander. Doch längst hat noch ein ganz anderer ein Auge auf Tess geworfen. Die Profilerin, jung und blond wie die Opfer, gerät in höchste Gefahr …
Zur Autorin
Nora Roberts wurde 1950 geboren und gehört heute zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von über 500 Millionen Exemplaren, und auch in Deutschland erobert sie mit ihren Romanen regelmäßig die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland, USA.
nora
roberts
Verlorene
Seelen
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Michael Koseler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1987 by Nora Roberts
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel
Sacred Sins bei Bantam, New York.
Copyright © 2001 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag und Copyright © 2022 dieser Ausgabe
by Diana Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München Umschlagmotive: Shutterstock.com (Peter Wey; iravgustin; Linda Hughes Photography; designbydx; Benjamin Tucker; Vintage Tone; jirobkk; Kai Brosinski)
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-15667-1V003
www.diana-verlag.de
1
Fünfzehnter August. Ein weiterer schwüler Tag. Kein einziges weißes Wölkchen stand am diesigen Himmel, kein Lüftchen ging. Die Hitze war so unerträglich, dass man kaum atmen konnte.
Die Sechs-Uhr- und die Elf-Uhr-Nachrichten brachten die deprimierende Meldung, dass es noch eine Weile so weitergehen würde. In den langen, sich träge dahinziehenden letzten Tagen des Sommers bildete die furchtbare Hitzewelle, die jetzt in die zweite Woche ging, das Hauptgesprächsthema der Einwohner von Washington, D. C.
Der Senat hatte sich bis zum September vertagt, sodass Capitol Hill wie ausgestorben wirkte. Der Präsident hatte sich nach Camp David zurückgezogen, um sich vor seiner vieldiskutierten Europareise noch ein wenig in kühlerer Umgebung zu entspannen. Ohne die tägliche Hektik des politischen Lebens war Washington eine Stadt der Touristen und der Straßenhändler. Gegenüber vom Smithsonian produzierte sich ein Pantomime vor einer verschwitzten Menschenmenge, die weniger um seiner Künste willen stehen geblieben war als vielmehr, um gemeinsam zu verschnaufen. Hübsche Sommerkleider hingen wie Lappen an ihren Trägerinnen, Kinder verlangten quengelnd nach Eis.
Jung und Alt strömte in den Rock Creek Park, um im Schatten der Bäume und am Wasser der schlimmsten Hitze zu entgehen. Fruchtsäfte und Limonade wurden literweise konsumiert, ebenso Bier und Wein, wenn auch weniger auffällig. Sobald Parkwächter aufkreuzten, ließ man rasch die Flaschen verschwinden. Picknicks und Grillpartys wurden abgehalten, deren Teilnehmer sich immer wieder den Schweiß von der Stirn wischten, ihre Grillwürstchen anbrennen ließen und auf Babys aufpassten, die in Windeln über den Rasen watschelten. Mütter riefen ihren Kindern zu, nicht ans Wasser zu gehen, nicht auf die Straße zu laufen, den Stock oder Stein wieder hinzulegen. Die Musik aus den tragbaren Radiogeräten war wie gewöhnlich laut und provokativ; die Discjockeys sprachen von heißen Scheiben und verkündeten, dass die Temperatur weit über dreißig Grad betrage.
Kleine Gruppen von Studenten fanden sich zusammen. Einige saßen auf den Felsen oberhalb des Baches, um über den Zustand der Welt zu diskutieren. Andere, die eher am Zustand ihrer Sonnenbräune interessiert waren, lagen ausgestreckt im Gras. Wer genügend Zeit und Benzin hatte, war an den Strand oder in die Berge geflohen. Ein paar Collegestudenten brachten die Energie auf, mit einer Frisbeescheibe zu spielen. Die jungen Männer hatten sich bis auf die Shorts ausgezogen, um mit ihren gleichmäßig gebräunten Oberkörpern anzugeben.
Unter einem Baum saß eine hübsche junge Kunststudentin und zeichnete in aller Muse. Nachdem einer der Frisbeespieler mehrmals versucht hatte, ihre Aufmerksamkeit auf seinen Bizeps zu lenken, an dem er sechs Monate lang gearbeitet hatte, griff er zu einer direkteren Methode. Die Frisbeescheibe landete klatschend auf ihrem Skizzenbuch. Als sie verärgert aufblickte, kam er angetrabt. Er grinste entschuldigend auf eine Weise, die er für unwiderstehlich hielt.
»Tut mir leid. Ist mir aus der Hand gerutscht.« Nachdem sie sich ihre dunkle Haarmähne aus dem Gesicht gestrichen hatte, gab die Studentin ihm die Wurfscheibe zurück. »Macht nichts.« Dann zeichnete sie weiter, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen.
Doch die Jugend ist nun mal hartnäckig. Er hockte sich neben sie und betrachtete ihre Zeichnung. Er verstand von Kunst ungefähr so viel wie ein Esel vom Tanzen, doch ein Aufhänger war halt ein Aufhänger. »Hey, das ist ja toll. Wo studierst du denn?«
Da sie die Masche durchschaute, wollte sie ihn eigentlich abblitzen lassen. Doch dann blickte sie lange genug auf, um sein Lächeln zu sehen. Seine Tour mochte ja ziemlich plump sein, aber süß war er schon. »In Georgetown.«
»Im Ernst? Ich auch. Einführung in die Rechtswissenschaft.«
Ungeduldig rief sein Partner vom anderen Ende des Rasens: »Rod! Gehen wir nun ein Bier trinken oder nicht?«
»Kommst du oft hierher?«, fragte Rod, ohne auf seinen Freund zu achten. Das Mädchen hatte die größten braunen Augen, die er je gesehen hatte.
»Ab und an.«
»Wollen wir uns nicht …«
»Rod, nun komm doch. Lass uns endlich was trinken gehen.«
Rod sah zu seinem verschwitzten, leicht übergewichtigen Freund hinüber. Dann blickte er wieder in die kühlen braunen Augen des Mädchens. Gar keine Frage, wem er den Vorzug gab. »Ich komme später nach, Pete!«, rief er und schleuderte die Frisbeescheibe mit einer lässigen Bewegung hoch in die Luft.
»Bist du fertig mit Spielen?«, fragte die Kunststudentin, während sie den Flug der Wurfscheibe verfolgte.
Er grinste und berührte ihre Haarspitzen. »Kommt ganz darauf an.«
Schimpfend nahm Pete die Verfolgung der Wurfscheibe auf. Erst vor Kurzem hatte er sechs Dollar dafür ausgegeben. Nachdem er beinahe über einen Hund gestolpert wäre, kraxelte er einen Abhang hinunter. Er hoffte inständig, dass die Frisbeescheibe nicht im Bach landen würde. Für seine Ledersandalen hatte er noch einiges mehr hingeblättert. Als die Scheibe in Richtung Wasser flog, stieß er laute Flüche aus. Dann prallte sie von einem Baum ab und trudelte ins Gebüsch. Schweißtriefend und ständig an das kühle Bier denkend, das ihn erwartete, schob Pete Äste zur Seite und bahnte sich einen Weg.
Plötzlich stockte ihm das Herz, und gleich darauf begann das Blut in seinen Schläfen zu hämmern. Bevor er dazu kam, einen Schrei auszustoßen, gab er seinen Lunch, bestehend aus Pommes frites und zwei Hotdogs, wieder von sich.
Die Frisbeescheibe war am Ufer des Baches gelandet und lag – neu und rot und fröhlich wirkend – auf einer kalten weißen Hand, welche die Scheibe ihrem Besitzer entgegenzuhalten schien.
Es handelte sich um Carla Johnson, eine dreiundzwanzig Jahre alte Schauspielschülerin, die als Kellnerin gejobbt hatte. Vor zwölf bis fünfzehn Stunden war sie mit dem Humerale eines Priesters – weiß mit goldenen Borten – erdrosselt worden.
Nachdem er seinen schriftlichen Bericht über den Johnson-Mord abgeschlossen hatte, saß Detective Ben Paris zusammengesunken am Schreibtisch. Er hatte die Fakten mit zwei Fingern in die Maschine gehämmert, doch jetzt gaben ihm ebendiese Fakten den Ball zurück. Keine Vergewaltigung, kein Raubmord. Ihr Portemonnaie hatte unter ihr gelegen und dreiundzwanzig Dollar und sechsundsiebzig Cent sowie eine Mastercard enthalten. Ein Ring mit einem Opal, für den man beim Pfandleiher etwa fünfzig Dollar bekommen hätte, hatte noch an ihrem Finger gesteckt. Kein Motiv, keine Verdächtigen. Nichts.
Ben und sein Partner hatten den Nachmittag damit verbracht, die Familie des Opfers zu vernehmen. Eine unangenehme Sache, dachte er bei sich. Notwendig, aber unangenehm. All ihre Fragen hatten immer wieder dasselbe zutage gefördert. Carla hatte Schauspielerin werden wollen. Sie war ganz in ihren Studien aufgegangen. Ab und zu hatte sie sich zwar mit Männern verabredet, aber keine ernsthafte Beziehung gehabt – dafür war ihr Ehrgeiz zu groß gewesen, ein Ehrgeiz, der jetzt keine Erfüllung mehr finden würde.
Ben überflog noch einmal den Bericht und verweilte bei dem Gegenstand, mit dem sie getötet worden war, dem Schultertuch eines Priesters. Daneben war ein Zettel an die Kleidung der Toten geheftet gewesen. Vor einigen Stunden hatte er selbst neben der Leiche gekniet, um zu lesen, was darauf stand:
Ihre Sünden sind ihr vergeben.
»Amen«, murmelte Ben und stieß einen tiefen Seufzer aus.
In der zweiten Septemberwoche ging Barbara Clayton kurz nach ein Uhr nachts quer über den Rasen vor der Washington Cathedral. Die Luft war warm, die Sterne funkelten, doch sie war nicht in der Verfassung, um sich an solchen Dingen zu erfreuen. Während sie über den Rasen schritt, fluchte sie leise vor sich hin. Diesem Automechaniker mit dem Frettchengesicht würde sie morgen früh aber die Meinung sagen. Angeblich hatte er das Getriebe ihres Autos repariert, sodass es wieder wie neu war. So ein Armleuchter! Nur gut, dass sie bloß noch ein paar Blocks zu laufen hatte. Jetzt würde sie mit dem Bus zur Arbeit fahren müssen. Das sollte ihr der miese kleine Dreckskerl büßen. Als eine Sternschnuppe niederging und am Himmel ihre leuchtende Spur hinterließ, bemerkte sie es nicht einmal.
Ebenso wenig bemerkte es der Mann, der sie beobachtete. Er hatte gewusst, dass sie kommen würde. War ihm nicht aufgetragen worden, wachsam zu sein? Platzte ihm eben jetzt nicht fast der Schädel, weil die STIMME darin so laut dröhnte? Er war auserwählt, die Bürde auf sich zu nehmen und der Glorie teilhaftig zu werden.
»Dominus vobiscum«, murmelte er. Dann schlossen sich seine Hände fest um den glatten Stoff des Humerales.
Als seine Mission vollendet war, spürte er, wie die göttliche Macht ihn heiß durchströmte. Seine Lenden explodierten. Sein Blut rauschte. Er war rein von Sünde. Und sie jetzt ebenfalls. Mit einer langsamen, sanften Bewegung fuhr er ihr mit dem Daumen über die Stirn, die Lippen und die Brust, um das Zeichen des Kreuzes zu machen. Er erteilte ihr Absolution. Doch er musste sich beeilen, denn die STIMME hatte ihn darauf hingewiesen, dass es viele Menschen gab, die die Reinheit seines Werkes nicht begreifen würden.
Er ließ ihren Körper im Schatten liegen und ging davon. Tränen der Freude und des Wahnsinns glänzten in seinen Augen.
»Die Medien setzen uns gewaltig zu.« Captain Harris schlug mit der Faust auf die Zeitung, die aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag. »Die ganze gottverdammte Stadt ist in Panik geraten. Wenn ich herausfinde, wer der Presse Informationen zugespielt hat …«
Er riss sich zusammen und verstummte. Es passierte nicht oft, dass er beinahe die Beherrschung verlor. Wenn er auch hinter einem Schreibtisch saß, so war er doch, sagte er sich, immer noch Polizist, und zwar ein verdammt guter. Ein guter Polizist verlor nicht die Beherrschung. Schließlich faltete er die Zeitung zusammen und ließ den Blick über die anderen Polizisten schweifen, die sich im Zimmer befanden. Auch sie waren, wie Harris zugeben musste, verdammt gut in ihrem Job. Etwas anderes hätte er auch nicht geduldet.
Ben Paris saß auf der Ecke des Schreibtischs und spielte mit einem Briefbeschwerer aus Gussharz. Harris kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass Ben gern etwas in der Hand hatte, wenn er nachdachte. Er war noch verhältnismäßig jung, doch zehn Jahre Polizeidienst hatten ihn zu einem erfahrenen, bewährten Beamten gemacht. Ein erstklassiger Polizist, auch wenn er sich nicht immer an die Regeln hielt. Die beiden Belobigungen wegen Tapferkeit hatte er zu Recht erhalten, fand Harris. In entspannteren Situationen amüsierte es ihn sogar, dass der dunkelhaarige, drahtige Ben mit seinem hageren Gesicht und dem kräftigen Knochenbau wie die Hollywoodversion eines Undercoveragenten aussah. Er hatte volles Haar, das für einen konventionellen Haarschnitt zu lang war, aber schließlich ließ er es auch in einem jener modischen kleinen Friseursalons in Georgetown schneiden. Er hatte hellgrüne Augen, denen nichts Wichtiges entging.
Auf einem Stuhl saß, die ellenlangen Beine von sich gestreckt, Ed Jackson, Bens Partner. Bei einer Körpergröße von eins fünfundneunzig und einem Gewicht von zweihundertfünfzig Pfund schaffte er es normalerweise, einen Verdächtigen allein durch seinen Anblick einzuschüchtern. Er trug – was mit einer bestimmten Absicht verbunden oder eine Marotte sein mochte – einen Vollbart, der so rot war wie die Lockenmähne auf seinem Kopf. Seine Augen waren blau und blickten freundlich drein. Auf eine Entfernung von fünfzig Metern konnte er mit seiner Dienstpistole ein Loch durch den Adler auf einer Vierteldollarmünze schießen.
Harris legte die Zeitung beiseite, setzte sich jedoch nicht hin. »Also, was habt ihr rausgefunden?«
Ben warf den Briefbeschwerer von einer Hand in die andere, dann stellte er ihn wieder auf den Tisch. »Abgesehen von Statur und Hautfarbe gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Mordopfern. Keine gemeinsamen Freunde, keine gemeinsamen Stammlokale. Den Bericht über Carla Johnson haben Sie ja schon. Barbara Clayton hat in einer Boutique gearbeitet, geschieden, keine Kinder. Die Familie wohnt in Maryland, Fabrikarbeiter. Bis vor drei Monaten hat sie sich ziemlich häufig mit einem Mann getroffen. Die Sache ging in die Brüche, er ist nach
L. A. gezogen. Wir überprüfen ihn noch, sieht aber so aus, als hätte er nichts damit zu tun.«
Er griff in die Tasche, um eine Zigarette herauszuholen, und fing dabei den Blick seines Partners auf.
»Das macht sechs«, sagte Ed fröhlich. »Ben versucht nämlich, weniger als eine Schachtel am Tag zu rauchen«, erklärte er. Dann setzte er selbst den Bericht fort.
»Clayton hat den Abend in einer Bar in der Wisconsin Avenue verbracht. Mit einer Freundin, die mit ihr zusammenarbeitet, eine Art Damenabend. Die Freundin sagt, Clayton sei gegen eins gegangen. Ihr Auto hat man ein paar Blocks vom Tatort entfernt gefunden. Es gab wohl Probleme mit dem Getriebe, sodass sie nicht weiterfahren konnte. Offenbar hat sie beschlossen, von dort nach Hause zu gehen. Bis zu ihrem Apartment ist es nur ungefähr eine halbe Meile.«
»Das Einzige, was die beiden Mordopfer verbindet, ist, dass sie blonde Haare haben, Weiße und Frauen sind.« Ben inhalierte tief den Rauch seiner Zigarette. »Und jetzt sind sie tot.«
Und das Ganze ist in meinem Bezirk passiert, dachte Harris, der die Sache persönlich nahm. »Die Mordwaffe, der Priesterschal.«
»Das Humerale«, ergänzte Ben. »Eine heiße Spur, hätte man meinen können. Unser Mann verwendet das beste Material – Seide.«
»In der Stadt hat er es nicht gekauft«, fuhr Ed fort. »Jedenfalls nicht im Laufe dieses Jahres. Wir haben jeden Laden für Kirchenbedarf und jede Kirche überprüft. Wir wissen, dass es in Neuengland drei Einzelhandelsgeschäfte gibt, die diese Sorte führen.«
»Die Mitteilungen hat er auf Papier geschrieben, wie man es in jedem billigen Warenhaus bekommt«, fügte Ben hinzu. »Das lässt sich nicht zurückverfolgen.«
»Mit anderen Worten, ihr habt nichts herausgefunden.«
»Lässt sich nicht leugnen«, erwiderte Ben und zog wieder an seiner Zigarette.
Schweigend musterte Harris beide Männer. Er mochte zwar wünschen, dass Ben einen Schlips tragen oder dass Ed seinen Bart stutzen würde, aber das war etwas Persönliches. Sie waren seine besten Leute. Paris, mit seinem ungezwungenen Charme und seiner scheinbaren Wurstigkeit, hatte den Instinkt eines Fuchses und einen Verstand, der so scharf war wie ein Stilett. Jackson war so gründlich und so tüchtig wie eine altjüngferliche Tante. Ein Fall war für ihn wie ein Puzzlespiel, dessen einzelne Teile er unermüdlich hin und her schob.
Genüsslich inhalierte Harris den Rauch aus Bens Zigarette, doch dann fiel ihm ein, dass er das Rauchen zu seinem eigenen Besten aufgegeben hatte. »Sprecht noch einmal mit allen Beteiligten. Ich will einen Bericht über den ehemaligen Freund der Clayton und die Kundenlisten der besagten Einzelhandelsgeschäfte.« Er warf einen Blick auf die Zeitung. »Ich will diesen Burschen schnappen!«
»Der Priester«, murmelte Ben, als er die Schlagzeile überflog. »Die Presse gibt Psychopathen gern einen Spitznamen.«
»Und berichtet auch gern ausführlich über sie«, fügte Harris hinzu. »Lasst uns dafür sorgen, dass er aus den Schlagzeilen verschwindet und hinter Gitter kommt.«
Nachdem sie bis spät in die Nacht am Schreibtisch gesessen hatte, nippte Dr. Teresa Court noch ziemlich verschlafen an ihrem Kaffee und blätterte die Post durch. Seit dem zweiten Mord war eine ganze Woche vergangen, ohne dass man den Priester, wie die Presse ihn nannte, gefasst hätte. Sie fand zwar, dass über ihn zu lesen nicht gerade die beste Methode war, um den Tag zu beginnen, interessierte sich jedoch aus beruflichen Gründen für ihn. Der Tod von zwei jungen Frauen ließ sie gewiss nicht kalt, doch es war ihr Beruf, sich an Fakten zu halten und eine Diagnose zu stellen. Darin bestand ihre Lebensaufgabe.
In ihrem Beruf wurde sie tagtäglich mit Problemen, Schmerz und Frustration konfrontiert. Um einen Ausgleich zu schaffen, sorgte sie dafür, dass ihr Privatleben geordnet und unkompliziert war. Da sie aus einer reichen, kultivierten Familie stammte, nahm sie die Lithografie von Matisse an der Wand und das Baccarat-Kristall auf dem Tisch als selbstverständlich hin. Sie bevorzugte klare Linien und Pastelltöne, obwohl sie bisweilen auch Grelles mochte, wie das abstrakte, mit kühnen Pinselstrichen und in schreienden Farben ausgeführte Ölgemälde über ihrem Tisch zeigte. Sie wusste, dass sie sowohl Krasses als auch Liebliches brauchte, und war damit zufrieden. Zufriedenheit war für sie von größter Wichtigkeit.
Da der Kaffee bereits kalt war, schob sie die Tasse beiseite. Kurz darauf schob sie die Zeitung ebenfalls von sich. Sie wünschte, mehr über den Mörder und die Opfer zu erfahren und alle Einzelheiten zu kennen. Dann fiel ihr das alte Sprichwort ein, dass man beim Wünschen vorsichtig sein soll, weil der Wunsch in Erfüllung gehen könnte. Nachdem sie einen Blick auf ihre Armbanduhr geworfen hatte, stand sie vom Tisch auf. Sie hatte keine Zeit, über einen Bericht in der Zeitung nachzudenken. Sie musste sich um ihre Patienten kümmern.
Am schönsten sind die Städte an der Ostküste im Herbst. Der Sommer dörrt sie aus, der Winter macht sie öde und schmutzig, doch der Herbst verleiht ihnen Würde und übergießt sie mit Farben.
An einem kühlen Oktobermorgen erwachte Ben Paris ganz plötzlich gegen zwei Uhr früh und stellte fest, dass er hellwach war. Es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken, was ihn aus dem Schlaf gerissen und seinen interessanten Traum, in dem drei Blondinen vorkamen, gestört hatte. Nachdem er aufgestanden war, ging er nackt zur Frisierkommode und suchte nach seinen Zigaretten. Zweiundzwanzig, zählte er im Geiste.
Er zündete sich eine an und wartete, bis er den vertrauten bitteren Geschmack im Mund hatte, bevor er in die Küche ging, um Kaffee zu machen. Er schaltete nur die Neonröhre über dem Herd an und hielt Ausschau nach Schaben, die eilig in Ritzen huschten, doch es war nichts zu sehen. Während Ben die Flamme unter dem Kessel aufdrehte, dachte er bei sich, dass die Wirkung der letzten Vertilgungsaktion wohl noch anhielt. Als er nach einer Tasse langte, schob er die ungeöffnete Post von zwei Tagen zur Seite.
Im grellen Küchenlicht sah sein Gesicht hart, beinahe gefährlich aus. Aber schließlich dachte er auch über Mord nach. Sein nackter Körper war schlaksig und von einer Magerkeit, die ohne die feinen Muskelstränge hager gewirkt hätte.
Der Kaffee würde ihn nicht am Wiedereinschlafen hindern. Wenn sein Geist bereit war, würde sein Körper einfach seinem Beispiel folgen. Das hatte er bei endlosen Überwachungsaktionen gelernt.
Eine magere sandfarbene Katze sprang auf den Tisch und starrte ihn an, während er seinen Kaffee trank und rauchte. Als sie bemerkte, dass er nicht reagierte, gab sie den Gedanken an einen frühmorgendlichen Imbiss auf und setzte sich hin, um sich zu putzen.
Sie waren von der Ergreifung des Mörders noch genauso weit entfernt wie an jenem Nachmittag, als man die erste Leiche gefunden hatte. Wenn sie auf etwas gestoßen waren, das zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Anhaltspunkt hatte, dann war das Ganze im Sande verlaufen, sobald man angefangen hatte nachzuhaken. Eine Sackgasse, dachte Ben. Absolute Fehlanzeige.
Natürlich hatte es allein in einem Monat fünf Geständnisse gegeben, die allesamt von kranken Gemütern stammten, die nach Aufmerksamkeit lechzten. Sechsundzwanzig Tage nach dem zweiten Mord waren sie noch keinen Schritt weiter. Und mit jedem Tag, der verging, wurde die Spur kälter, das wusste er. Die Berichterstattung in der Presse ließ nach, und die Leute beruhigten sich allmählich wieder. Das gefiel ihm nicht. Die Ruhe vor dem Sturm, dachte Ben, während er sich am Stummel seiner Zigarette eine neue anzündete. Er blickte in die kühle, vom Halbmond erhellte Nacht hinaus und machte sich Gedanken.
Doug’s war nur fünf Meilen von Bens Apartment entfernt. Jetzt war in dem kleinen Club alles dunkel. Die Musiker waren nach Hause gegangen, die Getränkepfützen aufgewischt. Francie Bowers trat aus der Tür des Hintereingangs und zog sich ihren Pullover an. Die Füße taten ihr weh. Nach sechs Stunden auf zehn Zentimeter hohen Absätzen – jetzt trug sie Turnschuhe – hatte sie Krämpfe in den Zehen. Doch das Trinkgeld war die Mühe wert gewesen. Mochte ja sein, dass man viel laufen musste, wenn man als Cocktailkellnerin arbeitete, aber wenn man gute Beine hatte – und die hatte sie –, gab es auch reichlich Trinkgeld.
Noch ein paar Nächte wie diese, überlegte sie, und sie würde vielleicht die erste Rate für den kleinen VW bezahlen können. Dann würde der ganze Ärger mit dem Bus wegfallen. Das war ihre Vorstellung vom Paradies.
Ein stechender Schmerz in ihrem Spann ließ Francie zusammenzucken. Sie beäugte die Gasse, in der sie sich befand. Wenn sie hier entlangging, würde sie ihren Weg um eine Viertelmeile abkürzen. Aber die Gasse war dunkel. Sie machte zwei weitere Schritte in Richtung der hell erleuchteten Hauptstraße, dann gab sie es auf. Egal, wie dunkel die Gasse war, sie würde jedenfalls keinen Schritt mehr als nötig gehen.
Er hatte lange gewartet. Aber er hatte es gewusst. Die STIMME hatte gesagt, dass eine der Verlorenen zu ihm geschickt werde. Sie kam rasch näher, als sei sie erpicht darauf, Erlösung zu finden. Tagelang hatte er für sie gebetet, für die Reinigung ihrer Seele. Jetzt war der Zeitpunkt der Vergebung fast gekommen. Er war nur ein Werkzeug. Der Tumult setzte in seinem Kopf ein und breitete sich nach unten aus. Göttliche Macht strömte in ihn. Im Schatten stehend betete er, bis sie vorüberkam.
Er handelte rasch, was nur barmherzig war. Als er ihr das Humerale um den Hals geschlungen hatte, blieb ihr nur noch ein Augenblick, um aufzukeuchen, bevor er das Tuch fest zusammenzog. Als ihr die Luftzufuhr abgeschnitten wurde, stieß sie einen leisen, gurgelnden Laut aus. Von Entsetzen gepackt, ließ sie ihren Leinwandbeutel fallen und griff mit beiden Händen nach dem, was ihr den Hals abschnürte.
Manchmal, wenn seine Macht groß war, konnte er sie schnell wieder loslassen. Doch das Böse in ihr war stark und forderte ihn zum Kampf heraus. Ihre Finger zerrten an der Seide, dann gruben sie sich tief in die Handschuhe, die er trug. Als sie nach hinten trat, hob er sie hoch, aber sie hörte nicht auf, wild um sich zu treten. Einer ihrer Füße stieß gegen eine Mülltonne, die klappernd umfiel. Der Lärm hallte in seinen Kopf wider, dass er fast aufgeschrien hätte.
Dann erschlaffte ihr Körper, und die Herbstluft trocknete die Tränen auf seinem Gesicht. Er legte sie behutsam auf den Asphalt der Straße und erteilte ihr in der alten Sprache Absolution. Nachdem er ihr den Zettel an den Pullover geheftet hatte, segnete er sie.
Sie hatte Frieden gefunden. Und er ebenfalls, zumindest im Moment.
»Es besteht kein Grund für diese selbstmörderische Fahrweise.« Eds Stimme klang gelassen, als Ben mit fünfzig Meilen um eine Ecke raste. »Sie ist bereits tot.«
Ben schaltete den Gang herunter und bog nach rechts ab. »Du bist ja wohl derjenige, der das Auto zu Schrott gefahren hat. Mein Auto«, fügte er ohne allzu große Gehässigkeit hinzu. »Das hatte erst fünfundsiebzigtausend Meilen drauf.«
»War eben eine rasante Verfolgungsjagd«, murmelte Ed.
Der Mustang geriet ins Schlingern, als sie über eine unebene Stelle fuhren, was Ben daran erinnerte, dass er die Stoßdämpfer hatte überprüfen wollen.
»Und du hast es ja überlebt.«
»Mit Quetschungen und Schnittwunden.« Ben huschte bei Gelb durch und schaltete in den dritten Gang. »Zahlreichen Quetschungen und Schnittwunden.«
Ed lächelte, als ihm alles wieder einfiel. »Wir haben sie doch erwischt, oder?«
»Sie waren ja auch bewusstlos.« Ben hielt mit kreischenden Bremsen am Bordstein an und steckte die Autoschlüssel in die Tasche. »Und mein Arm musste fünfmal genäht werden.«
»Mecker, mecker, mecker.« Gähnend hievte Ed sich aus dem Auto und trat auf den Bürgersteig.
Es war noch früh am Morgen und so kalt, dass man den eigenen Atem sehen konnte. Dennoch hatte sich bereits eine Menschenansammlung gebildet. Fröstelnd bahnte sich Ben, der alles für einen heißen Kaffee gegeben hätte, seinen Weg durch die Schar der Neugierigen und trat in die Gasse, die man mit einem Seil abgesperrt hatte.
»Sly.« Ben nickte dem Polizeifotografen zu und sah sich Opfer Nummer drei an.
Ihr Alter schätzte er auf sechsundzwanzig bis achtundzwanzig. Sie trug einen billigen Pullover aus Polyester, und die Sohlen ihrer Turnschuhe hatten fast kein Profil mehr. Sie trug lang herabhängende, vergoldete Ohrringe. Ihr Gesicht war stark geschminkt, was weder zu dem Kaufhauspullover noch zu ihren Cordhosen passte.
Die zweite Zigarette des Tages in der hohlen Hand haltend, hörte er sich den Bericht des neben ihm stehenden Streifenpolizisten an.
»Ein Penner hat sie gefunden. Wir haben ihn zur Ausnüchterung in einen Streifenwagen verfrachtet. Offensichtlich ist er auf sie gestoßen, als er im Müll herumstöberte. Das hat ihm einen gewaltigen Schrecken eingejagt, sodass er aus der Gasse gerannt und mir fast vors Auto gelaufen ist.«
Ben nickte und betrachtete den säuberlich beschrifteten Zettel, der an ihren Pullover geheftet war. Fast ohne dass er es merkte, erfüllten ihn einen Augenblick lang Wut und Frustration. Ed bückte sich, um den großen Leinwandbeutel aufzuheben, der neben ihr lag. Dabei fielen einige Busfahrscheine heraus.
Es würde ein langer Tag werden.
Sechs Stunden später betraten sie das Revier der Mordkommission, das zwar nicht den schäbigen Glamour des Sittendezernats aufwies, aber auch nicht so sauber und ordentlich war wie die Reviere in den Vororten. Vor zwei Jahren hatte man die Wände in einer Farbe gestrichen, die Ben als Apartmenthausbeige bezeichnete. Die Fußbodenfliesen schwitzten im Sommer und speicherten im Winter die Kälte. In den Räumen roch es permanent nach abgestandenem Rauch, feuchtem Kaffeesatz und frischem Schweiß, so eifrig das Wartungspersonal auch mit nach Fichtennadel duftenden Reinigungsmitteln und Putzlappen hantieren mochte. Gewiss, im Frühjahr hatten sie alle gesammelt und einen ihrer Kollegen beauftragt, Blumentöpfe für die Fensterbretter zu kaufen. Die Pflanzen gingen zwar nicht ein, gediehen aber auch nicht so recht.
Ben ging an einem Schreibtisch vorbei und nickte seinem Kollegen Lou Roderick zu, der gerade einen Bericht tippte. Roderick war ein Polizist, der seine Arbeit ruhig und gleichmäßig verrichtete, etwa so wie ein Finanzbeamter, der seine Akten abarbeitet.
»Harris will dich sprechen«, teilte Lou ohne aufzublicken mit, wenn auch mit einem Anflug von Mitgefühl in der Stimme. »Er hat gerade eine Besprechung mit dem Bürgermeister gehabt. Außerdem hat Lowenstein eine Nachricht für dich entgegengenommen.«
»Danke.« Ben beäugte die Snickers-Packung auf Rodericks Schreibtisch. »Sag mal, Lou …«
»Vergiss es.« Ohne aus dem Takt zu kommen, tippte Roderick seinen Bericht weiter.
»So viel zum Thema Kollegialität«, murmelte Ben und schlenderte zu Lowenstein hinüber.
Sie war ein gänzlich anderer Typ als Roderick. Sie arbeitete nach dem Stop-and-go-Prinzip und wurde in Abständen von Arbeitswut befallen. Praktische Tätigkeiten lagen ihr mehr als Schreibtischarbeit. Ben respektierte Lous Akribie, doch als Partner hätte er sich Lowenstein ausgesucht, deren höchst schickliche Kostüme und adrette Kleider nicht über die Tatsache hinwegzutäuschen vermochten, dass sie die schönsten Beine im Dezernat hatte. Bevor er sich auf die Ecke ihres Schreibtischs setzte, warf Ben rasch einen Blick auf ebendiese Beine. Zu blöde, dass sie verheiratet ist, dachte er bei sich.
Während er wartete, bis sie ihr Telefonat beendet hatte, schnüffelte er in den Papieren auf ihrem Schreibtisch herum. »Wie geht’s denn so, Lowenstein?«
»Mein Müllschlucker ist kaputt, und der Klempner verlangt für die Reparatur dreihundert, aber das ist kein Problem, weil mein Mann ihn wieder in Ordnung bringen wird.« Sie spannte ein Formular in die Schreibmaschine ein. »Auf diese Weise wird uns das Ganze nur doppelt so viel kosten. Und wie steht’s bei dir?« Sie schlug seine Hand weg, die sich nach der auf ihrem Tisch stehenden Pepsi-Flasche ausstreckte. »Gibt’s irgendetwas Neues über unseren Priester?«
»Nur eine Leiche.« Wenn seine Stimme bitter klang, dann war es schwer herauszuhören. »Bist du schon mal bei Doug’s gewesen, unten am Kanal?«
»Ich habe ja nicht dein buntes Privatleben, Paris.«
Er stieß ein verächtliches Schnauben aus. Dann nahm er den dicken Becher in die Hand, in dem sich ihre Bleistifte befanden. »Sie war dort Cocktailkellnerin. Siebenundzwanzig.«
»Nimm es dir nicht so zu Herzen. Das hat keinen Sinn«, murmelte sie und reichte ihm, als sie sein Gesicht sah, die Pepsi. Man nahm es sich immer zu Herzen. »Harris will dich und Ed sprechen.«
»Ja, ich weiß.« Er nahm einen langen Schluck und pumpte seinen Organismus mit Zucker und Koffein voll.
»Du hast eine Nachricht für mich?«
»Ach ja.« Grinsend suchte sie in ihren Papieren herum, bis sie den Zettel fand. »Häschen hat angerufen.« Als die hohe, atemlose Stimme, mit der sie sprach, keine Reaktion bei ihm hervorrief, warf sie ihm einen verschmitzten Blick zu und reichte ihm den Zettel. »Sie will wissen, wann du sie abholst. Sie hat sich angehört, als sei sie wirklich süß, Paris.«
Er steckte den Zettel ein und grinste. »Sie ist auch wirklich süß, Lowenstein, aber ich würde ihr sofort den Laufpass geben, falls du die Absicht haben solltest, deinen Mann zu betrügen.«
Als er mit der Pepsi-Flasche in der Hand davonging, lachte sie und machte sich wieder daran, das Formular mit der Schreibmaschine auszufüllen.
»Mein Apartment wird in eine Eigentumswohnung umgewandelt.« Ed legte den Telefonhörer auf und ging mit Ben auf Harris’ Büro zu. »Fünfzigtausend. Meine Güte.«
»Die sanitären Anlagen sind völlig verrottet.« Ben trank den Rest der Pepsi Cola aus und warf die leere Flasche in einen Mülleimer.
»Stimmt. Gibt es in deinem Haus nicht eine leere Wohnung?«
»Da ziehen die Leute erst aus, wenn sie sterben.« Durch die große gläserne Trennscheibe von Harris’ Büro konnten sie sehen, wie der Captain neben seinem Schreibtisch stand und telefonierte. Für einen Mann von siebenundfünfzig, der die letzten zehn Jahre hinter einem Schreibtisch verbracht hatte, hatte er sich gut gehalten. Seine Willenskraft war zu groß, als dass er Fett angesetzt hätte. Seine erste Ehe war an seinem Beruf gescheitert, die zweite am Alkohol. Harris hatte Suff und Ehe aufgegeben, und das eine wie das andere ersetzte ihm jetzt sein Job. Die Leute in seinem Dezernat mochten ihn nicht gerade, respektierten ihn jedoch. Diese Einstellung zog Harris vor. Er blickte auf und winkte die beiden Männer ins Büro.
»Ich brauche den Laborbericht noch vor fünf. Wenn auf ihrem Pullover ein Fussel ist, will ich wissen, wo er herkommt. Macht euren Job, und gebt mir etwas an die Hand, damit ich meinen machen kann.« Nachdem er aufgelegt hatte, ging er zu seiner Warmhalteplatte und goss sich einen Kaffee ein. Nach fünf Jahren wünschte er immer noch, es wäre Scotch. »Erzählt mir von Francie Bowers.«
»Sie arbeitete seit fast einem Jahr als Kellnerin bei Doug’s. Stammte aus Virginia und ist im November letzten Jahres nach Washington gezogen. Wohnte allein in einem Apartment im Nordwesten der Stadt.« Ed verlagerte sein Gewicht und blätterte in seinem Notizbuch. »Zweimal verheiratet, keine der beiden Ehen dauerte länger als ein Jahr. Die beiden Exgatten überprüfen wir noch. Sie hat nachts gearbeitet und tagsüber geschlafen, deshalb wissen ihre Nachbarn nicht viel von ihr. Um eins hatte sie Feierabend. Anscheinend ist sie durch die Gasse gegangen, um den Weg zur Bushaltestelle abzukürzen. Sie besaß kein Auto.«
»Niemand hat etwas gehört oder gesehen«, fügte Ben hinzu.
»Dann fragt noch mal rum«, sagte Harris ohne Umschweife, »und macht jemanden ausfindig, der etwas gehört oder gesehen hat. Irgendetwas Neues zu Nummer eins?«
Ben mochte es nicht, wenn man Mordopfer nummerierte, und steckte die Hände in die Taschen. »Carla Johnsons Freund lebt in L. A. Hat eine kleine Nebenrolle in einer Seifenoper. Hat nichts mit dem Mord zu tun. Offensichtlich hatte sie am Tag vor ihrer Ermordung eine Auseinandersetzung mit einem anderen Schauspielschüler. Augenzeugen zufolge ging es dabei ziemlich heiß her.«
»Der Betreffende hat die Sache zugegeben«, fuhr Ed fort. »Offenbar haben sie sich ein paarmal verabredet, aber sie hatte kein Interesse an ihm.«
»Hat er ein Alibi?«
»Er behauptet, er habe sich volllaufen lassen und eine Erstsemesterstudentin aufgegabelt.« Ben zuckte die Achseln und setzte sich auf die Armlehne eines Stuhls. »Jetzt sind sie verlobt. Wir können ihn noch mal vernehmen, aber keiner von uns glaubt, dass er etwas damit zu tun hat. Einen Zusammenhang zwischen ihm und der Clayton oder der Bowers gibt es nicht. Als wir ihn überprüften, haben wir festgestellt, dass er ein typischer amerikanischer Junge aus dem gehobenen Mittelstand ist. Ein As in Leichtathletik. Eher ließe sich von Ed annehmen, dass er ein Psychotiker ist, als von diesem Collegestudenten.«
»Vielen herzlichen Dank, Partner.«
»Überprüft ihn trotzdem noch mal. Wie heißt er?«
»Robert Lawrence Dors. Er fährt einen Honda Civic und trägt Polohemden.« Ben zog eine Zigarette aus der Schachtel. »Außerdem weiße Turnschuhe und keine Socken.«
»Roderick kann ihn sich vornehmen.«
»Moment mal …«
»Ich werde eine Sondereinheit für diese Angelegenheit aufstellen«, sagte Harris und schnitt Ben das Wort ab. Er schenkte sich eine zweite Tasse Kaffee ein. »Roderick, Lowenstein und Bigsby werden mit euch zusammenarbeiten. Ich will diesen Burschen schnappen, bevor er wieder eine Frau umbringt, die nachts allein unterwegs ist.« Der Ton seiner Stimme war mild, vernünftig und entschieden.
»Haben Sie irgendetwas dagegen einzuwenden?«
Ben stolzierte zum Fenster und starrte hinaus. Seine Gefühle waren rein persönlich, das wusste er. »Nein, wir alle wollen ihn schnappen.«
»Einschließlich des Bürgermeisters«, fügte Harris mit einem leichten Anflug von Bitterkeit in der Stimme hinzu. »Er möchte in der Lage sein, der Presse am Ende der Woche etwas Konkretes mitzuteilen. Wir ziehen einen Psychiater hinzu, der uns ein Täterprofil erstellt.«
»Einen Seelenklempner?« Humorlos lachend drehte Ben sich um. »Machen Sie keine Witze, Captain.«
Da Harris die Sache auch nicht gefiel, wurde seine Stimme eisig. »Dr. Court hat sich auf Wunsch des Bürgermeisters bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir wissen nicht, was in dem Täter vorgeht. Vielleicht ist es an der Zeit herauszufinden, wie er denkt. Im Moment«, fügte er hinzu, indem er beide Männer ruhig und fest anschaute, »würde ich sogar in eine Kristallkugel blicken, falls wir dadurch irgendeinen Anhaltspunkt bekommen könnten. Seid um vier wieder in meinem Büro.«
Als Ben den Mund öffnete, um eine Bemerkung zu machen, fing er Eds warnenden Blick auf. Ohne ein Wort zu sagen, stolzierten sie hinaus. »Vielleicht sollten wir ein Medium hinzuziehen«, murmelte Ben.
»Du bist aber auch gar nicht aufgeschlossen.«
»Ich bin Realist.«
»Die menschliche Seele ist ein faszinierendes Mysterium.«
»Du hast dir wieder mal was angelesen.«
»Und diejenigen, die gelernt haben, die Seele zu verstehen, können Türen öffnen, an die Laien vergeblich klopfen.«
Ben seufzte und schnippte seine Zigarette auf den Parkplatz, als sie aus dem Gebäude traten. »Scheiße«, sagte er.
»Scheiße«, murmelte Tess, als sie aus dem Fenster ihres Büros blickte. Zu zwei Sachen hatte sie momentan nicht die geringste Lust. Die erste war, sich bei dem kalten, unangenehmen Regen, der gerade eingesetzt hatte, ins Verkehrsgewühl zu stürzen. Die zweite war, in die Untersuchung der Morde, die die Stadt heimsuchten, hineingezogen zu werden. Ersteres würde sie machen müssen, weil der Bürgermeister und ihr Großvater sie zu Letzterem gedrängt hatten.
Sie hatte bereits zu viele Fälle, um die sie sich kümmern musste. Dem Bürgermeister hätte sie seine Bitte vielleicht noch abschlagen können, höflich und voller Bedauern. Bei ihrem Großvater war das etwas anderes. Wenn sie mit ihm zu tun hatte, fühlte sie sich nicht mehr wie Dr. Teresa Court. Nach fünf Minuten hörte sie auf, eine ein Meter dreiundsechzig große Frau zu sein, mit einem schwarz gerahmten Diplom, das hinter ihr an der Wand hing, und wurde wieder zu einer mageren Zwölfjährigen, dominiert von der Persönlichkeit des Mannes, den sie über alles in der Welt liebte.
Er hatte schließlich dafür gesorgt, dass sie das schwarz gerahmte Diplom bekommen hatte, nicht wahr? Durch sein Vertrauen, überlegte sie, seine Unterstützung, seinen unerschütterlichen Glauben an sie. Wie konnte sie da Nein sagen, wenn er sie bat, ihre Fachkenntnisse zur Verfügung zu stellen? Weil sie zehn Stunden am Tag brauchte, um sich um ihre gegenwärtigen Fälle zu kümmern. Vielleicht sollte sie aufhören, so stur zu sein, und sich mit einem Partner zusammentun.
Tess sah sich in ihrem in Pastelltönen gehaltenen Büro mit den sorgfältig ausgesuchten Antiquitäten und Aquarellen um. Alles meins, dachte sie. Dann warf sie einen Blick auf den hohen, aus den Zwanzigerjahren stammenden Aktenschrank aus Eiche, der voller Patientenakten war. Die gehörten ebenfalls ihr. Nein, sie würde sich nicht mit einem Partner zusammentun. In einem Jahr wurde sie dreißig. Sie hatte ihre eigene Praxis, ihr eigenes Büro, ihre eigenen Probleme. Und so sollte es bleiben.
Sie nahm den nerzbesetzten Regenmantel aus dem Wandschrank und schlüpfte hinein. Vielleicht, wenn auch nur vielleicht, konnte sie der Polizei ja helfen, den Mann zu finden, der Tag für Tag Schlagzeilen machte. Dazu beitragen, ihn zu finden und an weiteren Morden zu hindern, damit ihm dann die Hilfe, die er brauchte, zuteilwerden konnte.
Sie schnappte sich ihre Handtasche und ihre Aktentasche, die von Unterlagen überquoll. Die würde sie abends noch durchsehen müssen. »Kate.« Tess trat ins Vorzimmer und schlug den Kragen ihres Regenmantels hoch.
»Ich fahre jetzt in Captain Harris’ Büro. Rufen Sie mich dort aber bitte nur an, wenn es dringend ist.«
»Sie sollten einen Hut aufsetzen«, bemerkte ihre Sekretärin.
»Ich habe einen im Auto. Bis morgen dann.«
»Fahren Sie vorsichtig.«
Während sie durch die Tür ging und nach ihren Autoschlüsseln suchte, eilten ihre Gedanken schon voraus. Vielleicht konnte sie sich auf dem Heimweg aus irgendeinem chinesischen Restaurant etwas mitnehmen und in aller Ruhe zu Abend essen, bevor sie …
»Tess!«
Ein weiterer Schritt, und sie wäre im Fahrstuhl gewesen. Leise vor sich hin fluchend, drehte Tess sich um und rang sich ein Lächeln ab. »Frank.« Und dabei war es ihr doch fast zehn Tage lang gelungen, ihm aus dem Weg zu gehen.
»Du bist wirklich schwer zu erwischen.«
Er stolzierte auf sie zu. Makellos. Das war das Wort, das Tess immer unwillkürlich einfiel, wenn sie Dr. F. R. Fuller sah. Gleich danach kam langweilig. Sein bei Brooks Brothers gekaufter Anzug war perlgrau, ein Farbton, der sich in seiner gestreiften Krawatte ebenso wiederholte wie das Schweinchenrosa seines Oberhemds. Sein Haar war perfekt und konservativ geschnitten. Sie gab sich große Mühe, ihr Lächeln beizubehalten. Es war schließlich nicht Franks Schuld, dass sie sich nicht für Perfektion erwärmen konnte.
»Ich hatte viel zu tun.«
»Du kennst doch bestimmt das Sprichwort über Arbeit, Tess.«
Sie biss die Zähne zusammen, um nicht zu sagen: Nein, wie lautet es denn? Dann würde er lachen und eine Plattitüde zum Besten geben. »Mit dem Risiko muss ich leben.« Sie drückte auf den Abwärts-Knopf und hoffte, dass der Fahrstuhl rasch kommen würde.
»Aber heute gehst du früher nach Hause.«
»Ein Außentermin.« Demonstrativ blickte sie auf die Uhr. Sie hatte noch Zeit. »Bin ein bisschen spät dran«, log sie ohne Skrupel.
»Ich versuche schon seit einiger Zeit, mich mit dir in Verbindung zu setzen.« Mit der Handfläche gegen die Wand gelehnt, stand er über sie gebeugt da. Eine weitere seiner Angewohnheiten, die Tess widerwärtig fand. »Man sollte annehmen, dass das kein Problem sein dürfte, da unsere Büros ja nebeneinanderliegen.«
Wo, zum Teufel, blieb bloß der Fahrstuhl? »Du weißt ja, wie das ist, wenn man einen vollen Terminkalender hat, Frank.«
»Aber sicher weiß ich das.« Er ließ sein Zahnpastalächeln sehen, und sie fragte sich, ob er annahm, dass sein Rasierwasser sie antörne. »Ab und an müssen wir jedoch alle mal entspannen, stimmt’s, Frau Doktor?«
»Jeder auf seine Weise.«
»Ich habe Karten für das Stück von Noël Coward, das morgen Abend im Kennedy Center gegeben wird. Warum entspannen wir uns nicht zusammen?«
Beim letzten und einzigen Mal, als sie eingewilligt hatte, sich mit ihm zu entspannen, war sie gerade noch davongekommen, ohne dass er ihr die Kleider vom Leib gerissen hatte. Und was noch schlimmer war: Bevor es zum Gerangel kam, hatte sie sich drei Stunden lang fast zu Tode gelangweilt. »Nett von dir, an mich zu denken, Frank.« Erneut log sie, ohne zu zögern. »Aber leider bin ich morgen Abend schon vergeben.«
»Warum können wir uns nicht …«
Die Fahrstuhltür öffnete sich. »Huch, ich komme ja zu spät.« Nachdem sie ihm ein freundliches Lächeln geschenkt hatte, trat sie in die Kabine. »Arbeite nicht zu viel, Frank. Du kennst doch das Sprichwort.«
Infolge des prasselnden Regens und des starken Verkehrs ging fast ihre gesamte überschüssige Zeit für die Fahrt zum Revier drauf. Seltsamerweise verdarb ihr die halbe Stunde, die sie im Verkehrsgewühl steckte, nicht die Laune. Vielleicht lag es daran, dass sie Frank so elegant abgeschmettert hatte. Wenn sie es übers Herz gebracht hätte – was nicht der Fall war –, hätte sie ihm einfach gesagt, dass sie ihn für einen Blödmann hielt. Damit wäre die Sache dann erledigt. Sofern er sie nicht allzu sehr in die Enge trieb, würde sie jedoch weiterhin mit Takt und Ausreden arbeiten.
Sie langte neben sich, ergriff einen Filzhut und stopfte ihre Haare darunter, als sie ihn aufsetzte. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel und rümpfte die Nase. Sinnlos, jetzt an sich herumzumachen. Das wäre bei dem Regen nur Zeitverschwendung. Doch im Gebäude würde es sicher eine Damentoilette geben, wo sie sich ein bisschen herrichten konnte, um dann würdevoll und profihaft aufzutreten. Im Moment würde sie einfach nass aussehen.
Tess öffnete die Tür des Autos, hielt ihren Hut mit einer Hand fest und rannte auf das Gebäude zu.
»Sieh doch mal«, sagte Ben zu seinem Partner, als sie die Stufen zur Polizeizentrale hinaufschritten. Ohne auf den Regen zu achten, blieben sie stehen und sahen zu, wie Tess über die Pfützen sprang.
»Hübsche Beine«, kommentierte Ed.
»Will ich meinen. Besser als die von Lowenstein.«
»Schon möglich.« Ed dachte kurz darüber nach. »Lässt sich bei dem Regen schwer feststellen.«
Mit gesenktem Kopf rannte Tess die Stufen hoch und stieß mit Ben zusammen. Er hörte sie fluchen, als er sie bei den Schultern packte und weit genug zurückwich, um ihr Gesicht sehen zu können.
Es war ein Gesicht, für das es sich lohnte, nass zu werden.
Elegant. Obwohl der Regen über ihr Gesicht strömte, fiel Ben sofort das Wort Eleganz ein. Die Wangenknochen waren stark ausgeprägt und setzten so weit oben an, dass er an Wikingermädchen denken musste. Ihr Mund war weich und feucht, was ihn an andere Dinge denken ließ. Ihre Haut war blass, mit einem leichten rosenfarbenen Schimmer. Doch es waren ihre Augen, die ihn die nassforsche Bemerkung, die er schon auf der Zunge gehabt hatte, vergessen ließen. Sie waren groß und blickten kühl und ein klein wenig verärgert drein. Und sie waren violett. Bisher hatte er angenommen, diese Farbe sei für Elizabeth Taylor und wilde Blumen reserviert.
»Entschuldigung«, stieß Tess hervor, als sie wieder zu Atem gekommen war. »Ich habe Sie nicht gesehen.«
»Natürlich nicht.« Er hätte sie am liebsten noch weiter angestarrt, riss sich aber zusammen. Sein Ruf als Frauenheld war legendär, was zwar übertrieben war, gleichwohl auf Tatsachen beruhte. »Ist ja kein Wunder, so schnell, wie Sie gerannt sind.« Es war angenehm, sie so festzuhalten und die an ihren Wimpern haftenden Regentropfen zu betrachten. »Ich könnte Sie jetzt verhaften, weil Sie einen Polizeibeamten angegriffen haben.«
»Die Dame wird nass«, murmelte Ed.
Bisher hatte Tess nur den Mann bemerkt, der sie festhielt und sie anstarrte, als hätte sie sich in einer Rauchwolke materialisiert. Jetzt blickte sie zur Seite, dann nach oben und sah einen nassen Riesen mit lachenden blauen Augen und triefender roter Haarmähne vor sich. War dies ein Polizeirevier, oder war sie in ein Märchen geraten?
Ohne ihren Arm loszulassen, öffnete Ben die Eingangstür. Er ließ sie herein, aber er würde sie nicht entwischen lassen. Jedenfalls noch nicht.
Als sie im Gebäude waren, warf Tess einen weiteren Blick auf Ed und kam zu dem Schluss, dass es ihn wirklich gab. Dann wandte sie sich Ben zu. Ihn ebenfalls. Und er hielt immer noch ihren Arm fest. Amüsiert zog sie eine Augenbraue hoch. »Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich eine Beschwerde wegen Misshandlung durch die Polizei einreichen werde, falls Sie mich wegen Angriffs auf einen Polizisten verhaften.« Als er lächelte, machte etwas bei ihr klick. Er war also doch nicht so harmlos, wie sie angenommen hatte. »Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden …«
»Lassen wir das doch.« Ben hielt immer noch ihren Arm fest. »Wenn es wegen eines Strafzettels irgendetwas in Ordnung zu bringen gibt …«
»Sergeant …«
»Detective«, verbessert er. »Ben.«
»Darauf komme ich vielleicht ein andermal zurück, Detective, aber im Moment habe ich es sehr eilig. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen …«
»Das ist meine Pflicht als Beamter.«
»Dann lassen Sie bitte meinen Arm los und sagen Sie mir, wo ich Captain Harris finde.«
»Captain Harris? Von der Mordkommission?«
Sie sah die Überraschung und den Argwohn in seinem Gesicht und merkte, wie er ihren Arm freigab. Seine Reaktion weckte ihre Neugier. Sie warf den Kopf zurück und nahm ihren Hut ab, sodass sich ihr hellblondes Haar über ihre Schultern ergoss. »Genau.«
Bens Blick glitt über ihre Haarmähne, bevor er ihr wieder ins Gesicht sah. Das passt nicht zusammen, dachte er verblüfft. Er vermutete Dinge, die einfach nicht passten.
»Dr. Court?«
Es kostet immer Mühe, Unhöflichkeit und Zynismus mit Würde zu begegnen. Diese Mühe machte Tess sich nicht. »Schon wieder ins Schwarze getroffen – Detective.«
»Sie sind Seelenklempnerin?«
Sie wich keinem seiner Blicke aus. »Sie sind Bulle?« Vielleicht hätte jeder von ihnen die Grenze der Höflichkeit noch weiter hinter sich gelassen, wenn Ed nicht in Lachen ausgebrochen wäre. »Ende der ersten Runde«, sagte er fröhlich. »Harris’ Büro ist die neutrale Ecke.« Dann nahm er Tess selbst beim Arm und zeigte ihr den Weg.
2
Flankiert von den beiden Männern, ging Tess die Korridore entlang. Ab und zu bellte irgendwo eine Stimme, oder eine Tür wurde geöffnet und schlug mit dumpfem Knall zu. Aus allen Richtungen kam das Klingeln von Telefonen, doch es schien nie jemand ranzugehen. Regen schlug gegen die Fensterscheiben, was auch nicht gerade erheiternd wirkte. Ein Mann in Hemdsärmeln und Overall wischte irgendeine Pfütze auf. Der Korridor roch stark nach Lysol und Feuchtigkeit.
Sie war nicht zum erstenmal auf einem Polizeirevier, aber es war das erste Mal, dass sie sich fast eingeschüchtert fühlte. Ohne Ben zu beachten, konzentrierte sie sich auf seinen Partner.
»Treten Sie beide immer als Paar auf?«
Ed grinste freundlich. Ihm gefiel ihre Stimme, weil sie dunkel war und so kühl wie Fruchteis an einem heißen Sonntagnachmittag. »Der Captain will es so, damit ich ein bisschen auf ihn aufpasse.«
»Kann ich mir vorstellen.«
Ben bog scharf nach links ab. »Hier entlang … Frau Doktor.«
Tess warf ihm einen Seitenblick zu und ging an ihm vorbei. Er roch nach Regen und Seife. Als sie die Räume des Dezernats betrat, zerrten gerade zwei Männer einen Teenager in Handschellen hinaus. In einer Ecke saß eine Frau, die mit beiden Händen eine Tasse umklammerte und leise vor sich hin weinte. Vom Korridor drangen die Geräusche einer lautstarken Auseinandersetzung herein.
»Willkommen in der Wirklichkeit«, sagte Ben, während irgendjemand anfing zu fluchen.
Tess sah ihn eine Weile unverwandt an und kam zu dem Schluss, dass er ein Dummkopf war. Meinte er vielleicht, sie hätte Tee und Gebäck erwartet? Verglichen mit der Klinik, in der sie einmal in der Woche Dienst tat, war dies hier ein Gartenfest. »Danke, Detective …«
»Paris.« Er fragte sich, warum er das Gefühl hatte, dass sie sich über ihn lustig machte. »Ben Paris, Dr. Court. Und das ist mein Partner Ed Jackson.« Er nahm eine Zigarette heraus und zündete sie an, während er Tess anschaute. Sie wirkte in den schäbigen Räumlichkeiten des Dezernats so deplatziert wie eine Rose auf einem Müllhaufen. Aber das war ihr Problem. »Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten.«
»Wie schön.« Sie setzte das Lächeln auf, mit dem sie sonst immer lästige Verkäuferinnen bedachte, und rauschte an ihm vorbei. Bevor sie an Harris’ Tür klopfen konnte, öffnete Ben die Tür.
»Captain.« Ben wartete, bis Harris einige Schriftstücke beiseite gelegt und sich erhoben hatte. »Das ist Dr. Court.« Er hatte weder eine Frau erwartet noch jemanden, der so jung war. Doch Harris hatte schon viele Polizistinnen, darunter viele Anfängerinnen, als Chef unter sich gehabt, sodass sich seine Überraschung schnell wieder legte. Der Bürgermeister hatte sie empfohlen. Auf ihr bestanden, korrigierte sich Harris. Und der Bürgermeister war ein cleverer Mann, der wenig falsch machte, so sehr er einen auch nerven mochte.
»Dr. Court.« Er streckte die Hand aus und stellte fest, dass die ihre weich und klein, wenn auch von einer gewissen Festigkeit war. »Ich freue mich, dass Sie gekommen sind.«
Das nahm sie ihm nicht ganz ab, doch mit solchen Dingen wusste sie fertigzuwerden. »Ich hoffe, ich kann Ihnen behilflich sein.«
»Bitte setzen Sie sich.«
Als sie sich aus ihrem Regenmantel schälen wollte, spürte sie den Druck von Händen auf ihren Armen. Rasch warf sie einen Blick über die Schulter und sah Ben hinter sich stehen. »Ein schöner Mantel, Frau Doktor.« Seine Finger strichen über den Pelzbesatz, als er ihr den Mantel abnahm. »Fünfzigminütige Stunden müssen sehr einträglich sein.«
»Nichts macht mehr Spass, als Patienten zu schröpfen«, entgegnete sie, indem sie ihre Stimme ebenfalls dämpfte. Dann wandte sie sich von ihm ab. Arroganter Blödmann, dachte sie und setzte sich.
»Vielleicht möchte Dr. Court einen Kaffee«, warf Ed ein und grinste dabei in Richtung seines Partners. Er war immer gern bereit, etwas amüsant zu finden. »Sie ist auf dem Weg hierher ziemlich nass geworden.«
Als sie das Funkeln in Eds Augen sah, musste Tess ebenfalls grinsen. »Ja, gern. Schwarz, bitte.«
Harris warf einen Blick auf den schäbigen Rest in der Kanne auf der Warmhalteplatte und griff nach dem Telefon. »Roderick, bringen Sie uns doch bitte Kaffee. Vier Tassen … nein, drei«, verbesserte er sich, als sein Blick auf Ed fiel.
»Wenn ich vielleicht etwas heißes Wasser haben könnte …« Ed langte in seine Tasche und zog einen Beutel mit Kräutertee heraus.
»Und eine Tasse heißes Wasser«, sagte Harris, dessen Lippen sich zu einem Lächeln verzogen. »Genau, für Jackson. Dr. Court …« Harris wusste zwar nicht, worüber sie sich amüsierte, hatte aber das Gefühl, dass es etwas mit seinen beiden Untergebenen zu tun hatte. Besser, man kam gleich zur Sache. »Wir wären Ihnen dankbar für jede Hilfe, die sie uns zuteilwerden lassen können. Und Sie werden unsere volle Unterstützung haben.« Letzteres sagte er mit einem vielsagenden Blick in Bens Richtung. »Man hat Ihnen schon kurz mitgeteilt, was wir brauchen?«
Tess dachte an ihre zweistündige Zusammenkunft mit dem Bürgermeister und an die Aktenstapel, die sie aus seinem Büro mit nach Hause genommen hatte. Kurz war wohl nicht der richtige Ausdruck.
»Ja. Sie brauchen ein psychologisches Täterprofil des Mörders, den man den Priester nennt. Sie wollen ein Sachverständigengutachten über seine Motive und über die Art und Weise, wie er tötet. Ich soll Ihnen erklären, wie er denkt, wie er fühlt. Aufgrund der Tatsachen, die ich schon kenne, und derjenigen, die Sie mir noch mitteilen, werde ich in der Lage sein, mir eine Meinung zu bilden … eine Meinung«, betonte sie, »darüber, wie er psychologisch beschaffen ist und warum er so ist. Damit kommen Sie seiner Ergreifung vielleicht einen Schritt näher.«
Sie versprach also keine Wunder, was Harris einigermaßen beruhigte. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Ben sie unablässig beobachtete und dabei mit dem Finger über ihren Regenmantel strich. »Setzen Sie sich, Paris«, forderte er ihn auf. »Hat der Bürgermeister Ihnen schon Einzelheiten mitgeteilt?«, fragte er die Psychiaterin.
»Ein paar. Einen Teil der Unterlagen habe ich mir gestern Abend angesehen.«
»Diese Berichte hier müssen Sie ebenfalls lesen.« Harris nahm einen Schnellhefter vom Schreibtisch und reichte ihn ihr.
»Danke.« Tess zog eine Brille mit Schildpattfassung aus der Handtasche und öffnete den Ordner.
Eine Seelenklempnerin, dachte Ben, während er ihr Profil studierte. Eigentlich sah sie eher wie eine Cheerleaderin bei einer Sportveranstaltung der Universität aus. Oder wie jemand, der sich ins Mayflower setzt und Cognac trinkt. Er wusste zwar nicht so recht, warum beide Bilder zu ihr zu passen schienen, aber sie taten es. Was nicht passte, war das Bild, das er von einem Psychiater hatte. Psychiater waren groß und dürr und bleich und hatten einen ruhigen Blick, ruhige Stimmen, ruhige Hände.
Er erinnerte sich an den Psychiater, den sein Bruder drei Jahre lang aufgesucht hatte, nachdem er aus Vietnam zurückgekommen war. Als Josh in den Krieg zog, war er ein junger Idealist mit frischem Gesicht gewesen. Zurückgekehrt war ein gehetzter, aggressiver Mensch. Der Psychiater hatte ihm geholfen. Zumindest hatte es so geschienen, und alle hatten es gesagt, auch Josh. Bis er seinen Armeerevolver genommen und sich um alle Chancen gebracht hatte, die er noch gehabt haben mochte.
Der Psychiater hatte von verzögertem Stresssyndrom gesprochen. Erst da war Ben klargeworden, wie sehr er Etikettierungen hasste.
Roderick brachte den Kaffee herein und schaffte es, nicht verärgert auszusehen, weil er den Laufburschen spielen musste.
»Haben Sie schon Dors und seine Verlobte vernommen?«, fragte ihn Harris.
»Ich wollte gerade losziehen.«
»Paris und Jackson werden Sie, Lowenstein und Bigsby morgen früh nach dem Anwesenheitsappell instruieren.« Mit einem Kopfnicken entließ er ihn, während er drei Teelöffel Zucker in seinen Kaffee schaufelte. Als Ed das sah, zuckte er zusammen.
Tess nahm ihre Tasse entgegen, indem sie, ohne aufzublicken, etwas vor sich hin murmelte. »Muss man annehmen, dass der Mörder überdurchschnittlich stark ist?«
Ben nahm eine Zigarette heraus, die er eingehend betrachtete. »Wieso das?«
Tess zog sich die Brille bis zur Nasenspitze herunter, ein Trick, den sie einem ihrer Collegeprofessoren abgeguckt hatte und der andere aus der Fassung bringen sollte. »Abgesehen von den Strangulationsmalen gab es keine Quetschungen, keine Zeichen von Gewaltanwendung, keine zerrissene Kleidung und auch sonst nichts, was auf einen Kampf schließen lässt.«
Ohne Notiz von seinem Kaffee zu nehmen, zog Ben an seiner Zigarette. »Keines der Opfer war besonders kräftig gebaut. Barbara Clayton, die einsdreiundsechzig groß war und hundertzwanzig Pfund wog, war die Größte und Schwerste von allen.«
»Wenn ein Mensch Angst hat, kann er gewaltige Kräfte entwickeln«, konterte sie. »Ihren Berichten zufolge nehmen Sie an, dass er sie von hinten überrumpelt und überfällt.«
»Das schließen wir aus dem Winkel und der Position der Quetschungen.«
»Verstehe«, sagte sie forsch und schob sich die Brille wieder hoch. Es war nicht leicht, einen Holzkopf aus der Fassung zu bringen. »Keines der Opfer war in der Lage, ihm das Gesicht zu zerkratzen, denn sonst hätte man Haut- oder Fleischspuren unter ihren Nägeln gefunden. Sehe ich das richtig?« Bevor er antworten konnte, wandte sie sich demonstrativ an Ed. »Er ist also gerissen genug, um verdächtige Spuren zu vermeiden. Offensichtlich tötet er nicht sporadisch, sondern plant alles auf zielstrebige, ja logische Weise. Ihre Kleidung«, fuhr sie fort, »war sie irgendwie in Unordnung, waren Knöpfe auf, Nähte gerissen, hatte sie ihre Schuhe verloren?«
Ed schüttelte den Kopf. Er bewunderte ihr methodisches Vorgehen. »Nein. Alle drei waren wie aus dem Ei gepellt.«
»Und die Mordwaffe, das Humerale?«
»War über Kreuz auf der Brust zusammengelegt.«
»Ein ordentlicher Psychotiker«, warf Ben ein.
Tess zog lediglich die Augenbraue hoch. »Sie sind mit einer Diagnose schnell bei der Hand, Detective Paris. Aber statt von ordentlich würde ich eher von ehrfürchtig sprechen.«
Harris schnitt Ben, der etwas entgegnen wollte, das Wort ab, indem er den Finger hob. »Könnten Sie das bitte erklären, Frau Doktor?«
»Ich kann Ihnen natürlich kein detailliertes Täterprofil geben, ohne die Unterlagen genauer studiert zu haben, Captain, aber in groben Zügen lässt sich seine Person, glaube ich, schon umreißen. Der Mörder ist offenbar tief religiös und vermutlich mit den Riten der Kirche bestens vertraut.«
»Dann sind Sie also auf den Priester-Aspekt aus?«
Erneut wandte sie sich Ben zu. »Der Mann mag früher einmal dem geistlichen Stand angehört haben. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so, dass die Autorität der Kirche ihn fasziniert oder dass er sie sogar fürchtet. Dass er das Humerale benutzt, ist ein Symbol – für ihn selbst, für uns, sogar für seine Opfer. Es wäre denkbar, dass er es in rebellischer Absicht benutzt, aber das würde ich aufgrund der Mitteilungen, die er hinterlässt, ausschließen. Da die drei Opfer derselben Altersgruppe angehörten, weist alles darauf hin, dass sie irgendeine wichtige weibliche Person in seinem Leben repräsentieren. Seine Mutter, eine Ehefrau, eine Geliebte, eine Schwester. Jemanden, der ihm auf emotionaler Ebene nahestand oder noch immer steht. Ich vermute, dass ihn diese Person auf irgendeine Weise, die mit der Kirche zu tun hat, enttäuscht hat.«
»Indem sie eine Sünde beging?« Ben stieß eine Rauchwolke aus.
Er mag ja ein Holzkopf sein, dachte sie, aber dumm ist er nicht. »Für den Begriff Sünde gibt es viele Definitionen«, sagte sie mit kühler Stimme. »Aber Sie haben durchaus recht. Es geht um etwas, das in seinen Augen eine Sünde war, vermutlich eine Sünde sexueller Natur.«
Er hasste die gelassene, unpersönliche Art, in der sie ihre Analyse vortrug. »Dann bestraft er also stellvertretend andere Frauen?«
Sie hörte den Hohn in seiner Stimme und schloss den Schnellhefter. »Nein, er rettet die Frauen.«
Ben öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder. Das ergab durchaus einen Sinn, einen entsetzlichen Sinn.
»Das ist der einzige Aspekt, der absolut klar ist«, sagte Tess, indem sie sich wieder Harris zuwandte. »Das geht aus allen Mitteilungen hervor. Der Mann versteht sich als Retter. Da er keine Gewalt anwendet, würde ich sagen, dass er sie nicht bestrafen will. Wenn es um Rache ginge, würde er brutal und grausam sein und dafür sorgen, dass ihnen bewusst wird, was mit ihnen geschieht. Stattdessen tötet er sie so schnell wie möglich. Dann bringt er ihre Kleidung in Ordnung, legt ehrfürchtig das Humerale über Kreuz und hinterlässt einen Zettel, auf dem steht, dass sie gerettet sind.«
Sie nahm ihre Brille ab und wirbelte sie am Bügel herum. »Er vergewaltigt sie nicht. Höchstwahrscheinlich ist er impotent, von größerer Wichtigkeit ist jedoch, dass eine sexuelle Attacke eine Sünde wäre. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass ihm das Töten sexuelle Erleichterung verschafft, aber eher auf vergeistigte Weise.«
»Ein religiöser Fanatiker«, sagte Harris nachdenklich.
»Im Inneren«, erwiderte Tess. »Nach außen hin funktioniert er wahrscheinlich über lange Zeiträume hinweg ganz normal. Die Morde liegen mehrere Wochen auseinander, was darauf schließen lässt, dass er sich bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Es kann durchaus sein, dass er einen gewöhnlichen Beruf ausübt, Umgang mit anderen Menschen hat und zur Kirche geht.«
»Zur Kirche.« Ben erhob sich und trat ans Fenster.
»Und zwar regelmäßig, würde ich meinen. Die Kirche ist sein Hauptbezugspunkt. Wenn dieser Mann vielleicht auch kein Priester ist, so nimmt er doch während der Morde die Eigenschaften eines Priesters an. Nach seiner Vorstellung handelt er dann als Geistlicher.«
»Absolution«, murmelte Ben. »Die Sterbesakramente.« Fasziniert kniff Tess die Augen zusammen. »Genau.« Ed, der nicht viel über die Kirche wusste, brachte das Gespräch auf ein anderes Thema. »Ein Schizophrener?«
Stirnrunzelnd blickte Tess auf ihre Brille, während sie den Kopf schüttelte. »Schizophrenie, manische Depression, gespaltene Persönlichkeit. Solche Etikettierungen werden zu leichtfertig verwendet und verallgemeinern meistens zu sehr.«
Ben drehte sich um und starrte sie an, was sie aber gar nicht bemerkte. Sie schob ihre Brille ins Etui zurück und warf es in ihre Handtasche. »Jede psychische Störung ist ein höchst individuelles Problem, und jedes Problem kann man nur verstehen und in Angriff nehmen, indem man seine Ursachen aufdeckt.«
»Ich arbeite auch lieber mit konkreten Fakten«, sagte Harris zu ihr. »Aber die sind in diesem Falle rar. Haben wir es mit einem Psychopathen zu tun?«
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich ganz leicht. Sie ist ungehalten, dachte Ben, der die feine Falte zwischen ihren Augenbrauen und das rasche Zucken ihrer Lippen bemerkte. Dann war sie wieder ganz profihaft. »Wenn Sie einen allgemeinen Begriff brauchen, kann man von Psychopathie sprechen. Das bedeutet Geistesgestörtheit.«
Ed strich sich über den Bart. »Er ist also wahnsinnig.«
»Wahnsinn ist ein juristischer Begriff, Detective«, sagte Tess fast ein wenig gouvernantenhaft, während sie den Schnellhefter an sich nahm und aufstand. »Darüber wird man sich auseinandersetzen müssen, wenn man ihn gefasst hat und vor Gericht stellt. Ich werde Ihnen so schnell wie möglich ein Täterprofil erstellen, Captain. Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn ich mir die auf den Leichen hinterlassenen Zettel und die Mordwaffen ansehen könnte.«
Unzufrieden stand Harris auf. Obwohl er wusste, dass man nicht mehr erwarten konnte, reichte ihm das alles nicht. Er wollte feste Anhaltspunkte haben. »Detective Paris wird Ihnen alles zeigen. Vielen Dank, Dr. Court.«





























