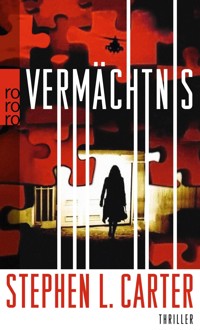
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sein letzter Wunsch ist ihr Verhängnis. Wall Street und CIA: Jahrzehntelang war Jericho Ainsley einer der mächtigsten Männer Amerikas. Nun liegt er im Sterben. Sein letzter Wunsch: Einmal noch möchte er Rebecca sehen. Vor vielen Jahren hatten sie eine leidenschaftliche Affäre, für die er Ehe und Job opfern musste. Rebecca glaubt, es gehe um ein Abschiedstreffen. Doch kaum betritt sie das Anwesen ihres ehemaligen Geliebten, wird sie in einen Kampf um ein brisantes CIA-Geheimnis hineingezogen, das ausländische Regierungen und mächtige Firmen Jericho gleichermaßen entlocken wollen. Bald fragt sie sich zu Recht, wem in diesem Vexierspiel sie eigentlich noch trauen kann … «Der beste Spionageroman, den ich in den letzten zwanzig Jahren gelesen habe.» (Lincoln Child) «Ein Meisterwerk!» (Steve Berry) «Carter hat die glückliche Hand für einen guten Thriller: Spannung, Tempo und ein spektakuläres Ende.» (Library Journal) «Ein Thriller mit Nonstop-Action und voller überraschender Wendungen.» (Bookpage) «Ein absoluter Knüller!» (Christopher Reich)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stephen L. Carter
Vermächtnis
Thriller
Deutsch von Judith Schwaab
Noch einmal, in Liebe, für Enola
Und es begab sich, da Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und ward gewahr, dass ein Mann ihm gegenüberstand und hatte sein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du uns an oder unsern Feinden?
Josua, 5,13
PROLOG - DIE RÜCKKEHR
An dem Sonntag bevor der Schrecken seinen Lauf nahm, lenkte Rebecca DeForde ihren Mietwagen in die trübe Finsternis ihrer fernen Vergangenheit. Der Interstate Highway lag hinter ihr, ebenso wie der eisige Regen, der ihr Tempo gedrosselt hatte. Die Landstraße wand sich durch die dichten Wälder Colorados, mal schlängelte sie sich an Berggipfeln entlang, mal führte sie zwischen finsteren Baumreihen hindurch. Hier und da blinkten die Lichter eines Bauernhofes auf und verschwanden wieder. Nebel umgab sie wie plötzliche Leere. Die Nacht war mondlos, und auch keine Sterne standen am Himmel. Straßenlaternen waren in diesen Winkel Amerikas ebenso wenig vorgedrungen wie die Programmierer des Navigationssystems ihres Wagens. Die Straße war kurvig und schadhaft, selbst jetzt, Mitte April, gab es noch vereiste Stellen. Dennoch fuhr Rebecca sehr schnell, wie immer. Ob sie auf der Flucht war oder Zuflucht suchte, wusste sie nicht. Sie war vierunddreißig Jahre alt und hatte den größten Teil ihres Lebens das Gefühl gehabt, am Seitenstreifen des Lebens auf und ab zu gehen, wie ein Cheerleader, der den anderen beim Spiel zuschaut. Sie hatte sich an ihre Rolle gewöhnt und hasste es, wenn sie doch einmal aufs Spielfeld musste. Diese Reise hatte sie nicht machen wollen, aber sie musste. Jericho Ainsley lag im Sterben, und obwohl sich mittlerweile fast niemand mehr daran erinnern konnte, was Rebecca und Jericho einander bedeutet hatten, waren sich alle darin einig, dass sie etwas Besonderes gewesen waren. Beck selbst bereitete es Mühe, sich ihre gemeinsamen achtzehn Monate in allen Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen, obwohl es doch Zeiten gegeben hatte, in denen sie darüber der Presse Rede und Antwort gestanden hatte.
«Na komm schon», drängte sie den lahmen Wagen, der sich die Anhöhe hochquälte. Wie viele einsame Menschen pflegte Beck ebenso oft mit den Dingen in ihrer Umgebung vertrauliche Gespräche zu führen wie mit sich selbst. «Na komm schon, du schaffst das, lass mich jetzt nicht im Stich.»
Der Wagen schien ihr mit einem mürrischen Brummen zu antworten.
«Ist schon in Ordnung.» Sie tätschelte das Armaturenbrett, dessen Anzeige vorwurfsvoll glühte. «Ist schon okay. Du kannst das.»
Endlich zog der Wagen wieder an und wurde schneller. Rebecca lächelte, obwohl sie andererseits gar nicht vorankommen wollte.
Jericho sollte nicht sterben. Noch nicht. Noch mussten er und Beck – ja, was denn? Sich versöhnen? Sich verzeihen? Endlich wieder ein ganz normales Gespräch führen? Jedenfalls war zwischen ihnen das letzte Wort noch nicht gesprochen, und eigentlich hätten sie dafür alle Zeit der Welt haben sollen.
«Wird wohl nichts», murmelte sie.
Von Jerichos Zustand hatte Beck nicht durch seine Familie erfahren, sondern über einen forschen Reporter, der sie in Boston aufgespürt hatte. Er hatte sie nicht auf dem BlackBerry angerufen, den sie geschäftlich nutzte, sondern auf ihrem Privathandy, dessen Nummer nur eine Handvoll Menschen kannte. Es war Samstag gewesen. Sie mochte das Wochenende, weil dann die Kaufhäuser überfüllt waren und man die Kundenströme beobachten und nach Engpässen oder ineffizient genutztem Raum Ausschau halten konnte.
Ich bringe Botschafter Ainsleys Nachruf auf den letzten Stand, hatte der Reporter ins Telefon geschrien, weil Rebecca irgendwo im Kaufhaus unterwegs war und ihn bei dem Lärm kaum hören konnte. Nicht was Sicherheitsfragen betrifft, erläuterte der Reporter. Es soll um die persönliche Seite gehen. Die Skandale. Für den Fall, dass er diesmal wirklich stirbt.
Und dann hatte er gefragt, ob sie zu einem Kommentar bereit sei.
Becks Antwort war unhöflich und nicht öffentlichkeitstauglich ausgefallen. Sie beendete das Gespräch und rief sofort im Haus an, eine Nummer, die sie nie vergessen hatte, obwohl sie sie seit Jahren nicht mehr benutzte. Fast befürchtete, ja hoffte sie, die Nummer sei nicht mehr aktuell, doch schon beim zweiten Klingeln war Audrey drangegangen und hatte gesagt, Jericho habe nach ihr gefragt: Audrey, die sonst nie außer Haus ging. Wenn Audrey an seinem Bett saß, dann stand es tatsächlich schlecht um ihn. Die Ärzte haben ihn aufgegeben, sagte sie. Was nun mit meinem Vater geschieht, liegt in Gottes Hand, fügte Audrey hinzu, die das freilich von allen Dingen behauptete.
Beck hatte versprochen, umgehend zu kommen.
Umgehend hatte sich als kompliziert erwiesen. Sie hatte ihren Stellvertreter, der bereits mit den Hufen scharrte, gebeten, die anstehende halbjährliche Inspektion der neunzehn neuenglischen Kaufhäuser der Handelskette zu übernehmen, bei der sie angestellt war, und dann ihren Chef angerufen, einen säuerlichen kleinen Mann namens Pfister, der murrte und brummte, das sei nun wirklich eine denkbar ungünstige Zeit, Urlaub aus familiären Gründen zu nehmen. Hätte Rebecca das College fertig gemacht, wäre sie wahrscheinlich Pfisters Boss gewesen, das wussten sie beide, was zur Folge hatte, dass er umso härter mit ihr umsprang. Doch als Rebecca auf ihrem Urlaubsantrag bestand, hatte Pfister ihr, über seine eigene Großzügigkeit erstaunt, drei Tage gewährt, nicht mehr. Er brauche sie dringend zur Konferenz der regionalen Manager, die am Freitagmorgen in Chicago beginnen sollte. Beck versprach ihm, dort zu sein.
Doch dieses Versprechen würde sie nicht einhalten können.
Bis Freitag lief Rebecca DeForde um ihr Leben.
SONNTAGABEND
ERSTES KAPITEL - DER BERG
I
Um sie herum war es stockfinster, während der Wagen bebend den Berg erklomm. In der Ferne tanzten Lichter am Rande ihres Gesichtsfeldes, verschwanden dann wieder. Beck fragte sich, wie schlimm es wohl sein würde. Vor ihrem geistigen Auge sah sie nur den Jericho, den sie vor fünfzehn Jahren geliebt hatte und in gewisser Weise immer noch liebte: den blendend aussehenden Sprössling einer alten neuenglischen Familie, die bereits seit dem Unabhängigkeitskrieg ihre Söhne in hohe Regierungspositionen entsandte. Nach einem seiner Vorfahren war in Washington ein Kreisverkehr benannt worden. Eine Cousine von ihm war Mitglied des Senats. Die Familiengeschichte war beeindruckend; und ganz gewiss beeindruckt hatte Beck der Jericho, in den sie sich einst verliebt hatte. Er war brillant und entschlossen gewesen, selbstbewusst und witzig, und stets wartete er mit Kostproben ewiger Weisheit oder mit spitzen Bemerkungen auf. Der Gedanke, dass ebendieser Mann von einer Krankheit dahingerafft würde, gefiel ihr nicht. Doch sie machte sich keine Illusionen. Dazu stand das, was der Krebs bei ihrem Vater angerichtet hatte, ihr noch allzu gut im Gedächtnis.
Was auch immer sie dort erwartete – sie musste hin.
Als sie am Samstagnachmittag mit Pfister alles geklärt hatte, nahm Beck den Flugshuttle von Boston nach Washington. Sie lebte in Virginia, einen Katzensprung vom Reagan National Airport entfernt. Ihre Tochter war auf einer Freizeit der Kirchengemeinde; Beck hatte sie religiös erzogen, weil auch sie selbst so aufgewachsen war und ihre Mutter es ihr übelgenommen hätte, wenn sie es gewagt hätte, in diesem Punkt gegen sie aufzubegehren. Beck beschloss, Nina könne noch eine Nacht bei den anderen Kindern verbringen. Am Sonntag würden sie dann gemeinsam zum Airport fahren und Flugzeuge in verschiedene Richtungen besteigen. Rebeccas Mutter Jacqueline hatte schon seit Wochen den Wunsch geäußert, Nina solle sie doch einmal besuchen, und vielleicht war es ja jetzt wirklich an der Zeit. Die Kleine ging erst in die zweite Klasse; dass sie ein paar Tage Schule versäumte, würde ihr sicher nicht schaden. Beck zögerte und machte dann den unvermeidlichen Anruf nach Florida, um ihre Mutter zu bitten, ob sie sich um Nina kümmern könne. Schon bald brach Streit aus.
Ich weiß nicht, wie es dir auch nur im Traum einfallen kann, eine Sechsjährige zu Besuch bei einem solchen Mann mitzunehmen.
Ich nehme sie nicht mit, Mom. Deshalb rufe ich dich ja an.
Du sagtest, du hättest beschlossen, sie nicht mitzunehmen. Das bedeutet, dass du es durchaus in Erwägung gezogen hast. Manchmal begreife ich wirklich nicht, was in deinem Kopf vorgeht.
Vergeblich versuchte sich Beck an eine Zeit zu erinnern, in der sie und ihre Mutter nicht miteinander auf Kriegsfuß gestanden hatten. Denn in den Augen ihrer auf Ewigkeit enttäuschten Mutter würde Beck nie älter werden als zehn Jahre. Gewiss hatte es diese Feindseligkeit schon vor Jericho gegeben; und vielleicht hatte sie auch (wie alle Therapeuten glaubten, die Rebecca in den vergangenen Jahren aufgesucht hatte) eine Rolle dabei gespielt, dass sich Beck bereits in ihrem zweiten Studienjahr am College in ihn verliebt hatte: einen verheirateten Mann von zweiunddreißig Jahren, der seine bemerkenswerte Karriere in den Sand gesetzt hatte, nur um sie haben zu können.
Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Mom.
Aha, du weißt sie also zu schätzen. Heißt das, dass du mich jetzt öfter anrufst?
Doch Beck rief überhaupt nur selten jemanden an. Sie war kein Mensch, der gerne telefonierte. Sie wohnte in einem schmucken Reihenhaus in Alexandria, zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Katze, und wenn sie nicht gerade mit Haushalt oder Kindererziehung beschäftigt war, arbeitete sie. Ihre Mutter hatte früh geheiratet und war von ihrem Ehemann zeit seines Lebens unterstützt worden. Becks Ehe hatte weniger als zwei Jahre gehalten. Die Sache mit Jericho habe Rebeccas Ruf bei Männern verdorben, behauptete ihre Mutter hartnäckig; und vielleicht stimmte das ja auch. Ihre Mutter war rasch mit einer festen Meinung zur Hand, wenn es um andere ging; und die nächsten paar Tage würde sie auch Nina ihre fiebrigen Dogmen einreden wollen. Beck hasste sich dafür, dass sie ihre Tochter dennoch in den Flieger nach Florida gesetzt hatte; und Nina, den Katzenkäfig in beiden Armen, war wie eine kleine Königin in den Jetway hineingeschritten und hatte nicht einmal den Kopf gedreht, um ihr ein letztes Mal zuzunicken, denn sie ähnelte ihrer Großmutter wesentlich mehr als ihrer Mutter.
Oder vielleicht auch nicht. Rebecca war selbst eine kleine Kratzbürste gewesen, ein neugieriges und willensstarkes Kind, jederzeit zu Widerworten aufgelegt. Sie hatte immer so getan, als komme sie ohne ihre Mutter bestens zurecht, vielleicht deshalb, weil ihre Mutter so viel Zeit darauf verwandte, ihr genau das Gegenteil zu beweisen. Ihr rebellischer Charakter hatte sie zeit ihres Lebens in Schwierigkeiten gebracht, auch während ihres kostspieligen Aufenthalts an einer Privatschule, als sie den Dresscode nicht einhielt und deshalb rausflog, und in Princeton, wo ein hochdekorierter Footballstar sich an die unwillige Erstsemesterstudentin herangemacht, dafür eine gebrochene Nase kassiert hatte und für eine halbe Spielsaison ausgefallen war. Ein Jahr später war Beck in Jerichos Bett gelandet. Vielleicht war ja Nina überhaupt nicht wie ihre Großmutter, sondern einfach nur eine jüngere Ausgabe von Beck – eine Möglichkeit, die so furchterregend war, dass sie lieber nicht darüber nachdenken wollte.
II
Scheinwerfer im Rückspiegel. Wurde sie verfolgt? Eine klügere Frau, sagte sich Beck, hätte sofort erkannt, dass eine derartige Vermutung Unsinn war, wie so vieles andere, was Beck dachte, wenn es um Jericho ging. Nun jedoch, in einer eisigen Nacht auf einer einsamen und unbeleuchteten Straße in den Bergen, wo dieses eine Paar Scheinwerfer hinter ihr immer wieder aus dem Nebel auftauchte und verschwand, war es leichter, ängstlich zu sein als klug.
Sie beschleunigte – keine leichte Aufgabe für den kleinen Mietwagen–, und die Scheinwerfer wurden vom Dunst verschluckt. Kaum jedoch wurde sie in einer Kurve etwas langsamer, tauchten sie wieder hinter ihr auf.
«Woher willst du denn eigentlich wissen, dass es die gleichen Scheinwerfer sind?», fragte sie höhnisch.
Sie wusste es eben. Sie wusste es, weil die Jahre wie im Flug vergangen waren und sie wieder in Jerichos Welt war, einer Welt, in der ein knutschendes Pärchen am Nebentisch eines Hotelrestaurants auf Barbados bedeutete, dass man überwacht wurde, wo das Zimmermädchen im Ritz das Schlafzimmer verwanzte und wo unerwartetes Fahrzeugaufkommen mitten in Yucatán nur auf eine Handvoll Terroristen schließen ließ, die an einem aufrechten Verteidiger des Vaterlandes Rache üben wollten.
Beck rief sich ins Gedächtnis, dass Jerichos Paranoia keine Macht über ihr Leben mehr hatte, doch ihr Fuß stieg dennoch fester aufs Gas, und der kleine Wagen rumpelte bebend weiter. Sie schoss ins Tal hinab, durchquerte eine kleine Stadt. Es begann zu schneien. Erneut fuhr sie bergauf, kämpfte sich vorwärts, um eine Kurve herum und hing plötzlich im Nichts.
Keine Scheinwerfer hinter ihr, keine Straße vor ihr.
Dann fuhr sie fast in den Abgrund.
Dergleichen kam in den Rocky Mountains öfter vor, nicht metaphorisch, sondern tatsächlich, besonders mitten in der Nacht, wenn man seinen Gedanken nachhing und unerwartet in ein Schneegestöber hineingeriet – unerwartet deshalb, weil man in der Ecke des Landes, aus der Beck kam, im April schlimmstenfalls mit einem Regenguss zu rechnen hatte. Auf dreitausend Metern Höhe jedoch war das Wetter anders, wie ihr erst jetzt dämmerte. Noch einen Moment zuvor war sie, hypnotisiert von den beiden Lichtkegeln, die ihre Scheinwerfer auf die düstere Straße vor ihr warfen, und den dunklen Baumreihen, die zu beiden Seiten an ihr vorbeiflitzten, einfach dahingeglitten und hatte die Fehlentscheidungen ihres Lebens Revue passieren lassen; und dann, bevor sie wusste, wie ihr geschah, wirbelten dicke Flocken um sie her, und die Straße war verschwunden.
Rebecca schaltete herunter, der Wagen kam ins Schlittern und schien plötzlich mit dem Kühler halb über einer unsichtbaren Schwelle zu hängen, während das hintere Ende hin und her schleuderte, doch dann erinnerte sie sich daran, wie man im Winter zu fahren hatte, und steuerte dagegen. Rutschend und rumpelnd kam der Wagen gut drei Meter neben der Straße zum Stehen. Sie saß ganz still da, atmete stoßweise. Hinter ihr keine Scheinwerfer, auch oben auf der Straße war nichts zu sehen.
«Falscher Alarm», murmelte Beck, wütend auf sich selbst, weil sie es zugelassen hatte, dass Jericho ihr wieder mit seinen wahnwitzigen Verschwörungstheorien im Kopf herumgeisterte.
Sie zog die Handbremse, öffnete die Tür und stellte zu ihrer Erleichterung fest, dass sie weder in einen Graben noch in eine Schneewehe gefahren war. Sie konnte den Wagen also bergauf auf die Fahrbahn zurücksetzen. Doch das Wendemanöver würde leichter sein, wenn genügend Platz war. Zitternd, weil die Kälte langsam die Sohlen ihrer modischen Stiefel durchdrang, blickte sie mit zusammengekniffenen Augen durch die Windschutzscheibe und versuchte etwas zu erkennen. Das Schneegestöber hatte sich gelegt. Dennoch war es schwer, Distanzen abzuschätzen. Die Lichtstrahlen ihrer Scheinwerfer wurden von einem Grüppchen Nadelbäume direkt vor ihr geschluckt, doch Platz war genug. Allerdings stellte sich bei näherem Hinsehen heraus, dass es sich um einen ganzen Wald handelte, der meilenweit entfernt auf der anderen Seite einer tiefen Schlucht stand. Vorsichtig ertastete sie mit der Spitze ihres Stiefels die Kante und glitt dann mit den Füßen rückwärts. Hätte sie versucht zu wenden, statt den Wagen am Hang zurückzusetzen, wäre sie wahrscheinlich in den Abgrund gefahren.
Da war es auf den Punkt gebracht, ihr Leben seit Jericho: immer nur vorsichtig im Rückwärtsgang, mit gezogener Handbremse, ohne ein Risiko einzugehen. Ein Sturz über die Klippe reichte pro Leben.
Beck stand am Abgrund und spähte in die gähnende Dunkelheit. Ganz dort oben, am gegenüberliegenden Hang, waren jetzt die Lichter von Jerichos weitläufigem Haus zu erkennen. Mit seinem Familienvermögen hatte er dieses Anwesen gekauft, und seit dem Skandal, den ihre Beziehung verursachte, hatte er sich dorthin zurückgezogen. Beck hatte sich von dem Gedanken verabschiedet, am College ihren Abschluss zu machen, er von wesentlich mehr. Rasch rechnete sie nach, wie viele Präsidentenohren es eigentlich gewesen waren, in die er seine doppelzüngigen Ratschläge geflüstert hatte. Sie dachte an das Jahr zurück, als sie sich kennengelernt hatten, als er begonnen hatte, sich für immer aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und von nun an in den rasenbewachsenen Gefilden Princetons zu leben. Sie dachte daran zurück, wie man an der Fakultät ehrfürchtig Jerichos Namen geflüstert hatte, und sie erinnerte sich, wie seine Seminare in fast wöchentlichen Abständen von Protestaktionen unterbrochen worden waren, die ihn als Kriegsverbrecher anprangerten; und daran, wie genüsslich er seine jungen Ankläger geködert hatte, indem er sie bat, ihm zu erklären, welche der Regime, an deren Umsturz er angeblich mitgewirkt hatte, sie gerne am Leben erhalten hätten, und aus welchem Grund.
Seit er den Dienst bei der Regierung quittiert hatte, hatte Jericho ein halbes Dutzend Bücher über internationale Politik veröffentlicht, doch es krähte kein Hahn mehr danach. Kaum jemand erinnerte sich noch daran, wer er war oder gewesen war. Vor nicht einmal zwei Monaten hatte sie seinen jüngsten neunhundertseitigen Schinken über die Friedensabkommen im Nahen Osten bei der Buchhandlung Barnes & Noble gesehen, der zum Preis für drei Dollar und neunundneunzig Cent auf dem Remittendentisch lag.
Das Handy vibrierte an ihrer Hüfte. Beck war überrascht. Gewöhnlich hatte man hier oben keinen Empfang, doch ab und zu fand sich in diesem Gebirge offenbar doch ein Fleckchen, das digital mit dem Rest der Welt verbunden war. Sie angelte das Mobiltelefon aus ihrer Tasche. Auf dem Display stand: UNBEKANNTE NUMMER. Als sie das Gespräch annehmen wollte, hörte sie nur ein statisches Rauschen, dem das trillernde Geräusch eines Faxzeichens folgte. Verärgert würgte sie den Anruf ab. Sofort klingelte das Telefon wieder, nochmal eine unbekannte Nummer, das gleiche Trillern in ihrem Ohr. Kein drittes Klingeln. Sie beschloss, die Tatsache zu nutzen, dass ihr Handy am Netz hing, und ihre Nachrichten abzuhören, doch als sie es versuchte, sah sie, dass sie wieder keinen Empfang hatte.
Wie hatte es dann derjenige, der sie angerufen hatte, geschafft, zu ihr durchzukommen? Sie ging in der Lichtung auf und ab, bekam aber nirgendwo ein Signal.
Auch egal. Höchste Zeit, weiterzufahren. Es hatte wieder angefangen zu regnen, in dicken, gefrierenden Tropfen, und Beck rang sich ob dieser Absurdität ein kleines Lächeln ab. Regen, Nebel, Schnee, dann wieder Regen – jetzt fehlte nur noch eine Sintflut, um den biblischen Wetterzyklus vollkommen zu machen, denn in ihrer gegenwärtigen Stimmung war sie gewillt, an alles zu glauben.
Das dumpfe Wummern eines sich nähernden Motors drang an ihr Ohr. Noch ein Auto, dachte sie, doch dann flitzte ein tintenschwarzer Umriss vor ihr vorbei, und sie ging instinktiv in die Hocke, bis ihr bewusstwurde, dass die Perspektive ihr erneut einen Streich spielte: Es war ein Hubschrauber, der zwar tief flog, sich aber immer noch Hunderte von Metern hoch in der Luft befinden musste. Ihr war nicht bewusst gewesen, dass man die Dinger so geräuscharm bauen konnte. Der Hubschrauber flog direkt über sie hinweg und tauchte dann ins Tal hinab, wo er mit anderen Umrissen verschmolz. Dann stieg er wieder an und erreichte die Höhe von Jerichos Haus, wo der Pilot zu zögern schien und zu kreisen begann, offenbar auf der Suche nach einem anderen Landeplatz. War sie zu spät gekommen? Konnte das der Rettungshubschrauber sein, der den Patienten nach Denver hinunterbringen sollte? Oder hatte er vielleicht einen VIP an Bord, der sich von Jericho verabschieden wollte und es vorzog, diesen Weg in dunkler Verschwiegenheit zurückzulegen?
Weder – noch. Der Helikopter landete gar nicht. Einen Moment lang hielt der Pilot ihn in der Schwebe. Noch ein weiterer Abflug, ein weiteres Kreisen. Dann war man offenbar an Bord zufrieden, und das Fluggerät erhob sich erneut und kehrte auf demselben Weg zurück, den es gekommen war. Zu ihrer eigenen Überraschung schaltete Beck rasch ihre Scheinwerfer aus. Ein nicht näher zu benennender Instinkt riet ihr, sich von demjenigen, der da an Bord war, nicht entdecken zu lassen.
Die Medien, beschloss sie und stieg wieder in den Wagen, während der Hubschrauber über den Hügeln verschwand. Ein Fernsehsender, der Material für den Nachruf zusammentrug. Keine Frage, das war des Rätsels Lösung.
Und doch…
Und doch – warum sollte jemand einen Flug durch die Rocky Mountains riskieren, nur um mitten in der Nacht ein Foto vom Haus zu machen? Denen ging es um die Atmosphäre, mutmaßte sie und ließ den Motor an. Die wollten den Zuschauern zeigen, wie unheimlich es hier war.
Und das war es in der Tat.
ZWEITES KAPITEL - DIE FESTUNG
I
Noch weitere eineinhalb Stunden hielt der Berg sie in seiner Gewalt und ließ den kleinen Wagen vor seiner gewaltigen Masse verschwinden, wie es Berge nach Einbruch der Dunkelheit oft tun. Sie glitt in den Wald hinein und wieder hinaus, fuhr ins Tal hinab und auf der anderen Seite wieder bergauf, kämpfte sich Serpentinen hoch, bis sie schließlich das Hochplateau erreichte, an das sie sich noch erinnerte. Der Hubschrauber hatte es da leichter. Einiges hier hatte sich im Verlauf der Zeit verändert. Der im Sturm geborstene Baum, an dem man sich früher orientieren konnte, war nicht mehr da, und auch der kleine Düker war verschwunden. Aufs Geratewohl fand Beck schließlich die Abzweigung, eine nicht ausgeschilderte Schotterstraße, an der vor fünfzehn Jahren noch ein Überwachungsfahrzeug ohne Kennzeichen gestanden hatte. Nach einer von Schlaglöchern durchgeschüttelten Meile kam das alte Wachhäuschen, dessen Dach eingefallen war. Die großen Flügel des schmiedeeisernen Tores standen weit offen. Auf einem verblassten Schild die Inschrift STONE HEIGHTS, Jerichos anmaßender Name für seine Festung in den Bergen. Als das Licht ihrer Scheinwerfer die Tore streifte, sah sie das wuchernde und mit Schnee bestäubte Unterholz und den Unrat, der sich an den tief eingelassenen Pfosten angesammelt hatte. Offensichtlich wurde das Tor schon seit Jahren nicht mehr geschlossen und würde es jetzt wohl auch nicht mehr. Es tat ihr leid um Jericho, der immer stolz auf seine Sicherheitsvorkehrungen gewesen war, obwohl er sie angeblich hasste, damals, als er, den Kopf randvoll mit Geheimnissen des Kalten Krieges, in seiner Zwingburg umherschlenderte und mit einem Gewehr in Reichweite schlief, weil, wie er ihr im Bett zuflüsterte, früher oder später die Russen, die Chinesen oder gar Schlimmere kommen würden, um ihn zu holen.
Die Zufahrt wand sich weiter den Berg hoch, immer noch zwischen Bäumen hindurch, und jetzt entdeckte sie endlich den schwarzen Suburban, nach dem sie bereits Ausschau gehalten hatte, mitsamt seinen abgedunkelten Scheiben. Der Fahrer war nur ein bleicher Fleck in der Dunkelheit. Beck fuhr automatisch langsamer, doch er hob nicht einmal den Kopf. Während nun das Haus in Sicht kam und wie ein wuchtiger kastenförmiger Klotz vor ihr aufragte, wobei man auf allen Seiten fast fünfzig Meter Wald abgeholzt hatte, um freie Schussbahn zu haben, hätte Rebecca beinahe gelächelt. Mittlerweile gab es nur noch einen Wachposten, aber immerhin passte überhaupt jemand auf. Ob der Typ nun vom Außenministerium, vom Geheimdienst oder einfach von der Polizei war – wenigstens legte der Sterbende immer noch Wert auf seine Sicherheit. Rebecca war erleichtert, um Jerichos willen.
Mehrere Autos, unterschiedlich dicke Schneedecken auf den Dächern, parkten auf dem Vorplatz. Der silberfarbene Prius ließ darauf schließen, dass Pamela hier war, die jüngste von Jerichos Töchtern, die dennoch älter war als Beck – ein Umstand, der vom ersten Moment an Öl ins Feuer gegossen hatte. Den verbeulten braunen Kastenwagen fuhr vermutlich Audrey, vielleicht eine Leihgabe des Nonnenordens, bei dem sie Mitglied war, oder wie auch immer man das nannte. Rebecca, die trotz ihrer Kirchgänge sorgfältig Distanz zu allem übermäßig Frommen hielt, war sich bei solchen Details nie ganz sicher. Vor dem Garagentor stand ein schimmernder Pick-up Truck, und das war genau der Wagen, den Jericho immer gemocht hatte, obwohl es nur schwer vorstellbar war, dass er heutzutage noch viel selbst am Steuer saß.
Jericho hatte einen nachtragenden Sohn namens Sean, der in New York eine Umweltschutzstiftung leitete, doch Sean würde eher eine Kohlenmine gründen, als seinem Vater in seinen letzten Tagen beizustehen. Außerdem wäre Sean lieber selbst gestorben, als in einen Pick-up zu steigen. Jericho hatte hier in den Bergen immer mehrere Freunde um sich herum gehabt, schweigsame, zuverlässige Männer, die an der Gegend hingen und allesamt Aufkleber der National Rifle Association, des Nationalen Schusswaffenverbandes, an ihren Stoßstangen hatten. Vielleicht gehörte der Truck ja einem alten Bekannten. Doch es lag bereits eine dicke Schneeschicht auf der Kühlerhaube, und jener Instinkt, der Beck vorhin veranlasst hatte, vor dem Hubschrauber in Deckung zu gehen, ließ sie nun vermuten, dass es mit dem Wagen noch etwas anderes auf sich hatte. Der Wagen gehörte Jericho, und es gab einen Grund, warum er nicht in der Garage stand.
Wie auch immer. Nicht ihr Problem.
Rebecca parkte ihr bescheidenes Mietfahrzeug neben Audreys klapprigem Kastenwagen. Als sie ausstieg, fiel ihr als Erstes die große Stille auf. Früher wäre Jericho in diesem Moment aus dem Haus gestürzt, hätte sie buchstäblich in seine Arme gerissen und sich lautstark über ihr Transportmittel lustig gemacht. Stets war es im Haus hoch hergegangen, der Vorplatz war vollgeparkt mit den Autos von Besuchern, die ihn wegen seiner Klugheit, seines Geldes, seiner teuren Alkoholika oder seiner Beziehungen aufsuchten, oder um ihm einfach die Hand zu schütteln. Dann hatte er sie nach drinnen gezogen und sie dazu genötigt, sich seinen Gästen anzuschließen, wen auch immer er gerade beherbergte, auch wenn die Gruppe aus zwei oder drei kaltäugigen Männern bestand, die dem innersten verschwiegenen Kreis der CIA angehörten und gerade über ein Projekt in Malaysia, Peru oder im Iran sprachen. So hatte Jericho sie immer genannt – Projekte–, selbst als die Männer längst nicht mehr zu ihm ins Haus kamen.
Langsam schwand Becks gute Stimmung dahin. Am liebsten hätte sie sich eine Ausrede gesucht, nicht hineinzugehen. Ein Jericho, der keine Gäste hatte, war einfach nicht er selbst. Der überschwängliche, vor Kraft strotzende, weltweit agierende Mann, den sie geliebt hatte, wenn man das, was sie füreinander empfunden hatten, denn als Liebe bezeichnen konnte – dieser Mann lag im oberen Stockwerk leidend in einem Bett, aus dem er sich nie wieder erheben würde. In dem Haus war es still geworden, es war nur noch die Heimstatt eines reichen, aber unbedeutenden Mannes, dessen bevorstehender Abgang nicht einmal einen Fernsehübertragungswagen am Fuße des Berges wert war. Wenige standen ihm in seinen allerletzten Tagen bei, und obwohl Jericho zeit seines Lebens ein Mann gewesen war, der nur Männer zu Freunden hatte, waren jetzt ausschließlich Frauen bei ihm: zwei Töchter, die ihm längst entfremdet waren, und die Frau, die seine Karriere ruiniert hatte und in diesem Moment die Treppe hochstieg.
Doch da war auch noch ein weiterer Beobachter.
Als Rebecca auf den Kies hinaustrat und geräuschvoll ihren Rollkoffer hinter sich herzog, waren ganz kurz wieder ihre Freunde aus dem Hubschrauber da, machten wummernd ein paar Umdrehungen ihrer Rotorblätter, wendeten dann und senkten kurz die Nase des Helikopters, wie zum Gruß.
II
Die Frau, die die schwere Tür öffnete, war groß und schlank und so bleich, dass es durchaus verzeihlich gewesen wäre, in ihr selbst die Patientin zu vermuten. Sie trug alte Jeans und einen alterslosen Pullover, beides ohne Designerlabel, und Perlen, die derlei nicht bedurften. Ihre Füße waren nackt, die Frisur lässig zerzaust. Ihre klaren Augen blickten taxierend. Sie war von jener ätherischen Schönheit, wie gewisse kühle und distanzierte Frauen sie oft erst Ende dreißig erlangen, nachdem sie ihnen den größten Teil ihres Lebens verwehrt geblieben war.
«Du hast es also geschafft, sehe ich», sagte sie mit der missmutigen Stimme eines Menschen, der bei anderen stets nach Fehlern sucht.
«Tut mir leid, dass ich so spät komme. Hallo, Pamela.»
«Die Fahrt von Denver dauert nur zweieinhalb Stunden. Es ist fast Mitternacht.»
«Mein Flug hatte Verspätung», sagte Beck, schon jetzt in der Defensive; doch das war sie bei Pamela immer gewesen. Die beiden Frauen hatten in den vergangenen vierundzwanzig Stunden zweimal miteinander telefoniert, doch bis jetzt schien Pamela noch nicht in Betracht zu ziehen, dass Rebecca vielleicht auch etwas richtig machen könnte. «Der Sturm.»
«Du hättest anrufen sollen.»
«Kam nicht durch.»
Pamela sagte nichts und gab damit zu verstehen, was sie von dieser erbärmlichen Ausrede hielt. Sie hatte von ihrem Vater die mühelose Selbstsicherheit eines Menschen geerbt, der immer etwas Wichtigeres zu tun hat, und gab Rebecca, als sie ins Haus trat, zu verstehen, dass sie ihr eigentlich bloß einen Gefallen tat.
Beck schaffte es nur mit angehaltenem Atem, die Schwelle zu überschreiten. Der weitläufige Eingangsbereich war so leer, wie sie ihn in Erinnerung hatte, und wirkte ebenso trostlos. Die breiten Dielen waren uralt, nicht mit Teppichen bedeckt und knarrten bei jedem Schritt, weil Jericho, wie er zu sagen pflegte, hören wollte, wenn sie kamen. Es war das, was Jericho den großen Raum nannte. Mittendrin prangte ein riesiger Kamin, der zwar mit Holzscheiten gefüllt, jedoch nicht angezündet war. Die Wände zogen sich über zwei Stockwerke hinweg und waren oben von prachtvoll bunten Glasfenstern durchbrochen, die man aus einer abgebrannten Kirche gerettet hatte. Vor Panoramafenstern waren mehrere bequeme Sitzgelegenheiten arrangiert, neben der Treppe stand eine Handvoll gedrungener Holzstühle, die willkürlich angeordnet waren – bewusst eingesetzte Hindernisse, über die unerwünschte Eindringlinge stolpern könnten. Sie sahen genauso aus wie die Stühle von vor fünfzehn Jahren. Damals hatte Jericho einmal ein Dienstmädchen auf die Straße gesetzt, weil es gewagt hatte, das Arrangement zu verändern.
«Wie geht es ihm?», fragte Beck und vermied dabei, Pamelas Blick zu begegnen.
«Er liegt im Sterben.»
«Sind Sie sicher?»
Ein verächtliches Kichern kam aus dem geziert geschürzten Mund. «Du bist hier, oder? Das bedeutet doch, dass du dir sicher bist.»
Rebecca ging auf die breiten Fenster zu, die bei Tage eine berückende Aussicht bis ins Tal boten, nachts jedoch im grellen Schein der Flutlichter lagen, auf die Jericho so großen Wert legte. Dort, wo keine Fenster waren, bedeckten Bücherregale mit Tausenden von Bänden die Wände, die meisten davon gebunden und mit Eselsohren. Oft hatte Jericho seiner jungen Geliebten ein Regal gezeigt und ihr die Anweisung gegeben, wahllos ein Buch herauszuziehen und ihm darüber im Verlauf einer Woche Bericht zu erstatten. Diese kleinen Spielchen hatte er geliebt. Heute jedoch schien die Feindseligkeit mit Händen zu greifen. Pamela war erst zweiundzwanzig gewesen und stand kurz vor ihrem Abschluss am College, als ihr Vater verkündet hatte, er werde ihre Mutter wegen einer Neunzehnjährigen verlassen.
«Audrey sagte, er habe nach mir gefragt», meinte Rebecca.
«Er fragt schon seit Jahren nach dir», kam Pamelas Stimme von hinten. «Bislang hat dich das nie hierher gebracht.»
Beck sagte nichts. Sie schaute zur Balustrade hoch, hörte eine Tür schlagen. Vermutlich hielt sich Jericho in seiner alten Suite auf. Von dort aus hatte er den großartigen Blick, der einem Mann seines Standes gebührte. Wenn man bei einem Haus in den Rocky Mountains die Fenster richtig positionierte, hatte man den Eindruck, die Berge seien endlos, und die Fenster dort oben waren richtig positioniert. Ihre eigene, kleinere Suite hatte gleich nebenan gelegen, doch die meisten Nächte hatte sie bei ihm verbracht.
«Rebecca?», fragte Pamela. «Hallo?»
Beck sagte immer noch nichts. Sie stand ganz still. Sie wollte nicht dort hochgehen. Lieber wäre sie in Alexandria, zusammen mit Nina und ihrer Katze Tom Terrific. Sie wollte wieder in ihrem Büro sein, Pfisters Geschwätz lauschen und dabei so tun, als wäre sie nicht so schlau wie er. In diesem Moment wäre sie sogar lieber unten in Florida gewesen, hätte ihrer zickigen Mutter im Wohnzimmer gegenübergesessen und den Offenbarungen ihrer TV-Heiligen Nancy Grace gelauscht. Alles, nur um ein Wiedersehen mit Jericho zu vermeiden. Und das nicht, weil er ihr Leben ruiniert hatte; schließlich hatte sie seines auch ruiniert.
Nein.
Beck wurde von dem gleichen Gefühl geplagt, das sie schon gestern niedergeschmettert hatte, als sie den Anruf bekam. Sie war immer davon ausgegangen, dass Jericho unsterblich sei. Seine ferne Präsenz, nicht nur in ihrer Erinnerung, sondern auch hier in dieser Bergfeste, hatte sie in all den Jahren, in denen sie erwachsen geworden war, gespürt. Vielleicht würden sie sich nie wieder lieben, doch eine Welt, in der er nicht existierte, war für sie einfach unvorstellbar.
Als sie nun neben dem erkalteten Kamin stand, begann Rebecca zu zittern. Sie erinnerte sich daran zurück, wie sie damals dieses Haus zum allerersten Mal betreten hatte, wie sie vor Begeisterung gequietscht hatte, als sie über den Boden rannte – Du hast das für uns gekauft? – Nicht für uns, Liebes. Für dich–, wie sie das Gesicht an die funkelnden Fenster presste, ganz das Kind, das sie bis vor kurzem noch gewesen war, und sich dann in seine gewaltigen ausgebreiteten Arme gestürzt hatte. Sie erinnerte sich, wie sie vor dem herrlichen Kamin für ihn getanzt und dann ganz langsam sich selbst und ihn entkleidet hatte, und daran, wie das Flackern der Flammen auf ihren Körpern die Berührungen noch intensiver gemacht hatte. Sie erinnerte sich auch an jene Nacht, als ihr Liebesspiel von drei Männern des CIA-Sicherheitsbüros unterbrochen worden war, die sie mit strengen Gesichtern in getrennte Räume abgeführt und anderthalb Stunden verhört hatten, wobei es sie besonders verärgerte, als Beck Probleme hatte, sich an den Namen ihres Spanischlehrers aus der fünften Klasse zu erinnern. Hinterher hatte sich Beck bei Jericho darüber beklagt, dass die Männer es ihr verweigert hatten, sich anzuziehen, und sie das ganze Verhör in eine Decke gewickelt durchstehen musste. Damals gestand er ihr, selbst als Autor bei dem Handbuch mitgewirkt zu haben, in dem genau diese Form der Demütigung vorgeschlagen wurde, um störrische Frauenzimmer zum Reden zu bringen.
Aber was wollen die?, hatte sie gefragt. Warum sind sie gekommen?
Bis letztes Jahr war ich Direktor der CIA, hatte er ruhig geantwortet. Davor war ich Verteidigungsminister und davor Sicherheitsberater des Weißen Hauses. Du gehörst jetzt zu meinem Leben dazu, mein Liebes. Du wirst für immer in ihren Akten stehen. Aus seinem Mund klang das so, als wäre es eine Ehre. Für die meisten Leute ist Sex einfach Sex. In meinem Metier müssen wir, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, immer davon ausgehen, dass eine Affäre ein Vorwand für etwas anderes ist.
Damals wollte Jericho das unterbrochene Liebesspiel einfach wiederaufnehmen, doch Rebecca war schnurstracks nach oben in ihre Suite marschiert, hatte die Tür abgeschlossen, Ewigkeiten geduscht und dann drei Pyjamas übereinander angezogen. In jener Nacht hatten sie getrennt geschlafen.
Und Jericho hatte recht gehabt, was ihre Akten anging. Im Lauf der Jahre war es fünf- oder sechsmal vorgekommen, dass ein paar solcher Besucher, immer ohne Vorwarnung, bei ihr zu Hause oder im Büro aufgetaucht waren. Niemals hatten sie vorher angerufen, sich immerhin jedoch bei einigen Gelegenheiten entschuldigt. Einmal hatten sie sie beim Mittagessen während einer Kreuzfahrt in der Karibik überrascht, ein anderes Mal waren sie in einem Pub in Edinburgh aufgetaucht. Beck bezweifelte, dass jeder Exfreundin eines Ex-CIA-Direktors diese Behandlung widerfuhr, und ab und zu hatte sie die Männer gefragt, was sie denn so besonders mache.
Sie hatte nur ein mitleidiges Lächeln als Antwort bekommen.
«Ja», sagte Pamela, die immer noch hinter ihr stand. «Er hat nach dir gefragt.»
«Dann gehe ich jetzt besser zu ihm.»
«Es ist spät.»
Beck sah Pamela an, die schon auf halbem Weg in die Küche war. «Trotzdem. Ich sollte schauen, ob er noch wach ist. Ich halte ihn nicht lange auf, das verspreche ich.»
«Okay.» Pamelas Stimme klang munter, wach, ja zufrieden, als hätte sie gerade einen erstklassigen Deal abgeschlossen: Pamela, die früher Independent-Filme gedreht hatte und heute bei ihrem Mann Koproduzentin von Katastrophenfilmen war und in Beverly Hills lebte. Sie zeigte auf die Balustrade. «Dad ist in der Mastersuite. Ich bin mir sicher, du weißt noch, wo das ist. Audrey und ich wohnen auf der Hauptetage. Dich habe ich hinten untergebracht.»
In der Suite, die Jericho die Enkelkindersuite genannt hatte. Zufall oder bewusste Kränkung? Bei Pamela konnte man das nie sagen.
«Danke.»
«Ich hasse dieses Haus», sagte Pamela, verschränkte die Arme über dem Pullover und rieb sich den Bizeps. «Ich hab nie hier gewohnt. Es war nie mein Haus, Rebecca. Und auch nicht das von Audrey oder von unserer Mom. Wir sind in Virginia aufgewachsen. Dieses Haus hier – nun, das war immer seins.» Eine Pause. Und deins, sagte Pamela, ohne es auszusprechen. «Dad hätte es schon lange verkaufen sollen.»
Wieder streckte die Erinnerung ihre Fühler nach Beck aus. «Legt er nach Einbruch der Dunkelheit immer noch Sprengsätze hinter die Türen?»
«Nicht dass ich wüsste.»
Sie lachten gemeinsam, ein gezwungenes Lachen.
Pamela legte den Kopf schief, und die beiden Frauen lauschten demselben Geräusch. «Verdammter Hubschrauber», brummte sie. «Der rattert schon die ganze Nacht hier rum.»
«Die Presse…»
«Von wegen. Das sind nur irgendwelche Unruhestifter. Die sind alle hier oben aufgetaucht, die gleichen Typen, die damals überall dort protestierten, wo Dad eine Rede hielt. Die können es kaum erwarten, auf seinem Grab zu tanzen.»
Rebecca schaute zum Fenster, hinter dem das flutlichtbeschienene Grundstück lag. «In einem Helikopter?»
«Klar, die fahren alle Geschütze auf. Du solltest dir mal anschauen, was die im Internet veranstalten.»
«Lieber nicht.»
Beck stieg die geschwungene, blanke Treppe hoch, die Hand auf dem Geländer, als sie hinter sich Pamelas Stimme hörte, unerwartet traurig. «Rebecca, hör mal.» Sie benutzte nie ihren Kosenamen. «Mein Vater hat nicht mehr viel Zeit.»
«Ich verstehe.»
«Da bin ich mir nicht so sicher, Rebecca. Es gibt nur noch uns drei. Audrey und mich und Dad. Sean kommt nicht. Es gibt keine Pflegerin. Dad schmeißt sie alle wieder raus. Er glaubt, sie schnüffeln hinter ihm her. Außerdem», sagte sie zögernd, «na ja, für eine Krankenschwester gibt es an dieser Stelle sowieso nicht mehr viel zu tun.»
«Verstehe», sagte Beck über die Schulter hinweg.
«Dad weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Tante Maggie war zwischendurch hier. Sie kommt nicht zurück. Dads Büro in Denver ist geschlossen. Mrs.Blumen ist letztes Jahr gestorben.» Jerichos langjährige Assistentin. «Es ist niemand mehr da.»
«Ich sagte, ich verstehe, Pamela.»
«Was ich sagen will, ist, ich weiß nicht, wie er darauf reagieren wird, dass du hier bist, Rebecca. Bitte bring die Dinge nicht noch einmal durcheinander.»
Das war dann endgültig zu viel. Doch als Beck sich zu ihrer alten Gegenspielerin umdrehte, bereit, einen Streit vom Zaun zu brechen, war Pamela in der Küche verschwunden. Sie schien die Einzige zu sein, die auf Jerichos knarrendem Dielenboden gehen konnte, ohne ein Geräusch zu machen. Während Beck die Treppe hochstieg, läutete wieder ihr Telefon. Unbekannte Nummer und dann ein digitales Plärren. Doch dieses Mal war sie nicht mehr überrascht. Als sie überprüfte, ob sie Empfang hatte, sah sie, dass die Verbindung tot war.
DRITTES KAPITEL - DAS KRANKENZIMMER
I
Wie auch das übrige Haus war der zweite Stock hell erleuchtet, damit Jericho sehen konnte, wann die bösen Männer kamen. Beck stand auf der obersten Treppenstufe. Die Galerie verlief an allen drei großen Schlafzimmern vorbei, einschließlich der Suite des Hausherrn und ihres alten Zimmers, das jetzt von Pamela belegt war. Der Flur führte zu Jerichos Arbeitszimmer im hinteren Teil des Hauses, machte dann eine Rechtskurve und endete schließlich vor der letzten Suite, die ganz hinten in einer Ecke lag, weil Jericho sich seine zukünftigen Enkelkinder so weit wie möglich vom Leib halten wollte. Dich hab ich hinten untergebracht.
Während sich Beck der Doppeltür der Mastersuite näherte, öffnete sich diese schwungvoll, und heraus trat eine lächelnde Audrey – die heilige Audrey, wie Jericho höhnisch zu sagen pflegte, eine Frau, die immer zuckersüß und freundlich war und daher, in Becks gepeinigtem Denken, noch weniger vertrauenswürdig als ihre jüngere Schwester. Audrey schloss Rebecca in ihre dicken Arme und zog sie an ihre ausladende Brust. Sie war von gewaltiger Statur, eher wuchtig als rundlich, und hatte ein plumpes, irgendwie großmütterliches Gesicht. Ihr dunkles Haar, das an den Seiten bereits grau meliert war, sah mehr gestriegelt aus als frisiert. In ihrem grünen Pyjama und dem braunen Morgenmantel wirkte sie wie ein Teil des Bergmassivs.
«Du siehst phantastisch aus», sagte Audrey, wobei die erschöpften Augen diese überschwängliche Begrüßung Lügen straften. Sie war eine Nonne, rief sich Beck verwundert ins Gedächtnis. Eine Nonne der episkopalischen Kirche. Ehe Audrey vor zehn oder zwölf Jahren ihrem Orden beigetreten war, hatte Beck nicht einmal gewusst, dass es in der episkopalischen Kirche Nonnen gab. «Wie hältst du dich nur so schlank?»
Rebecca lieferte ihre Standardantwort. «Über Tag hab ich zu viel zu tun, um zu essen, und wenn ich nach Hause komme, bin ich zu müde.»
«Du arbeitest zu viel.»
«Das sagt meine Mutter auch.»
In der kurzen Pause, die eintrat, gedachten vielleicht beide Frauen Audreys verstorbener Mutter, die seit acht Jahren unter der Erde lag. Audreys Mutter, Jerichos Exfrau. Der Frau, die er für eine Collegestudentin verlassen hatte.
«Und wie geht es deinem süßen kleinen Fratz?», fragte Audrey strahlend, die Nina nie begegnet war.
«Sie ist wundervoll. Ein Schatz.»
«Sean sagt, sie ist eine Augenweide, wie ihre Mutter.»
Lag da ein Hauch von Spott in ihren Augen? Rebecca war sich nicht ganz sicher. Sie wandte den Blick ab. «Danke», murmelte sie.
«Du bist gesegnet», sagte Audrey, deren Hände immer noch auf Becks Schultern lagen. «Es gibt so vieles, wofür du dankbar sein solltest.»
«Ich bin dankbar, Aud. Glaub mir.» Beck biss sich auf die Lippe, hoffte, Audrey würde nicht anfangen, über Gott zu schwafeln, was sie oft tat; obwohl sie andererseits auch dankbar für jede Ablenkung war, die den Moment hinausschob, in dem sie das Krankenzimmer betreten musste. «Ich bin zufrieden mit meinem Leben», fügte sie hinzu, als müsste sie sich beherrschen, um nicht von größeren Gefühlen überwältigt zu werden.
Doch die Nonne hörte ihr kaum zu. Einen ihrer schweren Arme immer noch fest um Becks Schultern gelegt, zog Audrey sie ein Stück vom Eingang zur Suite des Hausherrn. «Er ist nicht mehr der Jericho, an den du dich erinnerst, Beck. Bitte bedenke das.»
«Ja.»
«Ich rede nicht von der Krankheit.» Audrey klang entschlossen. Und ganz gleich, wie herzlich ihr Willkommen gewesen war, lag in ihren Augen ein wachsamer und argwöhnischer Ausdruck, als sei sie besorgt, ihr Gast könne sich mit dem Tafelsilber aus dem Staub machen. «Er wartet schon die ganze Zeit auf dich, Beck. Und er ist überglücklich, dass du hier bist. Er sieht so aus wie immer, wenn er irgendwas im Schilde führt. Sei also auf der Hut. Er wird dich täuschen, wird so tun, als sei alles beim Alten. Er wird geistreich sein, lustig, sarkastisch. Er wird dich aufziehen, dich in Diskussionen verwickeln und dir das Wort im Mund herumdrehen. Er wird dich bezirzen, Beck, dann wird er dir Angst machen und dich wieder bezirzen. Ganz wie in alten Tagen. Du wirst denken, abgesehen vom Krebs ist doch alles in Ordnung. Aber lass dich nicht täuschen. Der Krebs ist bis in sein Gehirn vorgedrungen. Und schon bevor er es bis dorthin geschafft hatte, war mit meinem Dad etwas nicht mehr in Ordnung. Jetzt ist es schlimmer geworden. Alles, was er sagt, scheint logisch zu sein. Aber das ist es nicht. Behalt das im Hinterkopf. Es ist nicht logisch, und es ist auch nicht unbedingt wahr.» Sie küsste Beck auf die Wange. «Ich schätze, du solltest jetzt reingehen. Er wartet auf dich. Vergiss einfach nicht, dass er ein Wahnsinniger ist.»
II
Auf den ersten und sogar auf den zweiten Blick sah Jericho Ainsley aus wie das blühende Leben. Gut, da stand eine Sauerstoffflasche neben seinem Bett, doch ansonsten waren entgegen Rebeccas Erwartung keine medizinischen Geräte zu sehen. Kein Schlauch in seiner Nase, keine Überwachungsmonitore, die sinnlos vor sich hin piepsten, kein Krankenhausbett und auch nicht der widerliche Geruch nach Krankheit und Tod, der ihrer Vorstellung nach selbst die letzten Tage der Reichen begleitete, und auch derjenigen, die im Geheimen starben.
Beck trat ganz vorsichtig auf das Bett zu, wie sie es auch in den letzten Tagen ihrer Beziehung getan hatte, als keiner von ihnen so recht wusste, ob die nächste Berührung das Feuer ihrer Leidenschaft wieder entfachen oder zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen würde. Die Einrichtung war so prachtvoll wie immer. Noch mehr Bücherregale, die seit ihrer Zeit offenbar erneuert und in die Wand eingelassen worden waren. Ein Schreibtisch gleich neben dem Erkerfenster war mit Akten überhäuft. Im Hintergrund spielte leise der erste Satz von Mendelssohns Italienischer Sinfonie – eines seiner Lieblingsstücke. Als sie näher kam, rechnete sie damit, dass man Jericho die Verwüstungen durch seine Krebserkrankung ansehen würde. Doch er sah so kraftvoll und blendend aus wie immer, seine seltsam goldbraunen Augen blickten offen und lebhaft, wie sie zwischen ihrem Gesicht und den Händen hin- und herhuschten und sich keine noch so kleine Bewegung entgehen ließen. Nur seine Hände, die sich wie ein Schraubstock ins Bettzeug krallten, und der feine Schweißfilm auf seiner Oberlippe zeugten von seinem Kampf gegen den Schmerz.
«Wie geht es dir?», fragte sie, als sie ihrer Stimme endlich trauen konnte. Sie stand neben dem Bett, knetete nervös die Hände und fragte sich, ob sie ihm Wasser aus dem Plastikbecher mit dem kleinen Strohhalm anbieten solle. Die Frage, das wusste sie, war absurd, aber niemand hatte bisher ein Benimmbuch für den richtigen Umgang mit Sterbenden geschrieben. Vielleicht war das auch der Grund, warum wir in Gegenwart derer, die nicht mehr lange bei uns sein werden, so still sind: Wir warten darauf, dass sie uns mitteilen, was wir sagen sollen.
Jericho runzelte die Stirn – genauer gesagt zogen sich die Falten in seinem Gesicht zusammen und strafften sich, was eher der Andeutung eines Gesichtsausdrucks gleichkam. Er flüsterte ein paar Worte zur Antwort. Sie konnte ihn nicht hören, beugte sich zu ihm. Sein Atem war heiß und feucht, er barg Schmerz und Furcht.
«Du hättest nicht kommen sollen», krächzte er.
Beck hielt ihr Gesicht nahe an das seine. Auf dem Tisch neben dem Bett lag der dicke Wälzer eines Nobelpreisträgers, in dem dieser den Zusammenbruch des Finanzsystems erklärte. «Sei nicht albern. Natürlich musste ich kommen.»
«Warum?»
Sie zögerte. Wenn sie sagte, sie sei hier, weil er sie gerufen hatte, würde ihn das vielleicht kränken. «Du fehlst mir», sagte sie und fragte sich dabei, ob das wirklich stimmte.
Wieder sagte er flüsternd etwas, das sie nicht ganz verstand. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass sie seine Hand hielt oder, genauer gesagt, er die ihre. Seine Finger waren stark wie Krallen.
«Du solltest besser gehen», sagte er.
«Wohin gehen?»
«Heim.» Er hustete, wand sich, fand aber keine bequeme Position. «Du kannst nicht hier sein, Beck. Das ist Wahnsinn.» Zwar fiel ihr wieder Audreys Warnung ein, doch sie fragte sich auch, ob er vielleicht an ihre Streitigkeiten in jener ersten stürmischen Zeit ihrer Beziehung zurückdachte. Um beiden Möglichkeiten Rechnung zu tragen, sagte sie: «Ich bin hier, weil ich es will. Es gibt keinen anderen Grund.»
Er hob den Kopf und die Schultern, zitternd von der Anstrengung. «Die werden dich umbringen», sagte er klar und deutlich.
Sie blinzelte. «Was hast du gesagt?»
«Bist du neuerdings taub? Ich sagte, die werden dich umbringen. Sei auf der Hut. Nicht jetzt. Aber sobald ich aus dem Weg bin, werden die dich umbringen.»
«Ich glaube nicht, dass…»
«Wirst du mir jetzt zuhören? Wirst du wenigstens einmal in deinem Leben auf mich hören?» Seine Wangen wurden noch röter, und seine frühere Kraft schien wieder da zu sein, wenn auch nur für den Moment. Er machte seine Hand frei, winkte in Richtung geschlossene Tür. «Die werden dich umbringen. Die Mädchen auch. Idiotinnen. Sentimentale Idiotinnen. Nimm sie mit, Beck. Sei kein Dummkopf. Nimm sie mit und haut alle hier ab.»
Alles, was er sagt, scheint logisch zu sein. Aber das ist es nicht. Es ist nicht logisch, und es ist auch nicht unbedingt wahr.
«Wer wird mich umbringen?», fragte sie leise.
«Warum ist das von Bedeutung? Gibt es denn jemanden, von dem du besonders gern umgebracht werden möchtest?» Er machte eine knappe Bewegung mit dem Kinn. «Hol mir mein Adressbuch. Ich hab eine ganze Liste von Killern, die man anheuern kann. Ich kann da was für dich arrangieren, wenn du willst.»
«Das ist nicht witzig.»
«Die sind sehr gut, Beck. Die Killer auf meiner Liste. Schnell und schmerzlos. Die jagen dir eine flinke Kugel in den Kopf, und schon stehst du bei Petrus am Himmelstor. Da gibt es Schlimmeres, glaub mir.»
Sie küsste ihn auf die Stirn, drückte ihn sanft in das Kissen zurück. Ihr kam der Gedanke, dass er über etwas redete, das er sich für sich selbst wünschte. «Du musst dich ausruhen.»
«Du glaubst mir nicht. Dummes Ding. Du solltest besser aufpassen, wenn ich dir was sage.»
«Bitte, Liebling.» Das Kosewort kam ihr ganz automatisch über die Lippen. «Du musst mit deinen Kräften haushalten.»
Die schlauen Augen ließen sie nicht los. Wieder stellte sein offenkundig gesundes Äußeres ihre Vorstellung vom Tod auf die Probe. «Warum? Werde ich dann länger leben?»
«Es ist spät. Nach Mitternacht.»
«Besonders für mich.»
Beck brauchte eine Sekunde. Sie sah Johnson und Nixon auf den signierten Fotos an, die einträchtig nebeneinander über dem Bett hingen, doch keiner der beiden Präsidenten bot Hilfe an. Drei weitere Präsidentenkonterfeis schmückten die Wände, doch die Männer, die während des Vietnamkriegs an der Macht gewesen waren, waren seine Lieblinge. «Jericho…»
«Du bist dumm», sagte er und hob rügend den Zeigefinger. «Das zu machen, was ich dir sage, darin warst du nie gut, stimmt’s? Das war immer schon dein Problem, Beck. Hättest du mehr Zeit damit verbracht, auf mich zu hören, und dich nicht damit aufgehalten, meine Unzulänglichkeiten aufzulisten, dann wäre was Besseres aus dir geworden als eine Kassiererin.»
Rebecca wischte sich die Augen.
«Hör auf damit, Jericho. Bitte. Möchtest du so bei den Menschen in Erinnerung bleiben?»
Plötzlich wurde er wütend. «Ich möchte überhaupt nicht in Erinnerung bleiben. Das ist der Punkt. Ich möchte derjenige sein, der nach der Beerdigung herumsitzt und in Erinnerungen schwelgt. Ich will derjenige sein, der sich besäuft und alte Schoten über den armen Teufel erzählt, den man gerade unter die Erde gebracht hat. Hast du irgendeine Vorstellung, wie es ist, wenn man weiß, dass es nicht so sein wird?»
Sie schüttelte den Kopf, stand aber nicht auf. Jericho sank in die Kissen zurück. Seine Atemzüge wurden rasselnd. Sie wagte einen Blick auf sein Gesicht. Seine Augen standen offen und blickten schmerzerfüllt an die Decke.
«Audrey sagte mir, du wartest auf mich», meinte sie schließlich. «Dass es dich glücklich macht, mich hier zu haben. Warum? Damit du endlich Gelegenheit hast, es mir nochmal richtig zu geben?»
Sein Versuch zu grinsen endete in einem Hustenanfall. «Ist das nicht Grund genug? Das Totenbett bringt viele Vorteile mit sich, meine Liebe, und einer davon ist, dass man sagen kann, was man will, zu jedem, und dass keiner widerspricht. Ich empfehle dir, das auch mal irgendwann zu probieren. Sterben, meine ich.» Ein ersticktes, gurgelndes Lachen. «Nun, ziemlich bald wirst du sehen, was ich meine.»
«Sag’s mir», beharrte Beck.
Die Augen wurden sanft. «Danke, dass du gekommen bist, mein Liebes. Das war klasse.» Er drückte ihr die Hand. «Und was das Warum angeht…» – plötzlich schlug er einen lehrerhaften Ton an, wie damals im Vorlesungssaal–, «nun, du bist hier, um mir zu helfen.»
«Dir helfen, was zu tun?»
«Das sag ich dir morgen. Ich bin müde. Wo ist die heilige Audrey?»
Der rasche Themenwechsel nahm ihr den Wind aus den Segeln. «Macht eine Pause.»
«Warum hat sie das getan?»
«Sie ist auch müde.»
«Nein, ich meine, warum hat sie ihren Job an den Nagel gehängt? Um Nonne zu werden? Sie war phantastisch. Eine phantastische Psychologin. Fast so phantastisch, wie du es hättest sein können, wenn du nicht beschlossen hättest, dein Leben wegzuschmeißen. Und dann, eines Tages, begehrt sie auf, verlässt das Familienunternehmen, schickt ihren Mann in die Wüste, wird Nonne. Ein Problem, finde ich. Frag sie.»
«Was soll ich sie fragen?»
«Warum sie Nonne geworden ist. Warum sie das Familienunternehmen verlassen hat. Und ihren Mann. Frag sie nach ihrem Mann.» Ein schmerzliches Aufstöhnen, dann ein schauriges Grinsen. «Hat sie dir Avancen gemacht?»
«Wie bitte?»
«Die heilige Audrey. Sie steht jetzt auf Mädchen. Hast du das nicht gewusst?»
Beck schüttelte den Kopf. «Geht mich nichts an.»
«Wenn sie dir an die Wäsche will, schon.» Er hustete. Kurz schlossen sich die Lider über seinen wässrigen Augen, dann blickte er sie wieder an. «Mir ist kalt.»
«Ich hol dir noch eine Decke.»
Ein unerwartetes Blinzeln. Einen köstlichen Moment lang war er wieder der Jericho, den sie geliebt hatte. «Ich könnte mir bessere Methoden denken, mich aufzuwärmen.» Er klopfte auf das Bettlaken. «Na komm schon, meine Liebe. Für ein kleines Schäferstündchen bin ich nicht zu krank. Das Privileg eines sterbenden Mannes. Du kannst sogar oben liegen, wenn du willst. Schließ bloß vorher die Tür ab.» Er lachte, hustete, lachte noch lauter, hustete noch mehr, und dann lag sein Kopf wieder auf dem Kissen, und die Augen blickten so leer wie zuvor. «Ist zu kalt. Sag ihnen das.»
«Ich sag’s ihnen», antwortete sie und hielt weinend seine Hand, bis er eingeschlafen war.
Am nächsten Tag fand sie den toten Hund.
MONTAG
VIERTES KAPITEL - DER PROTEST
I
Rebecca DeForde war Frühaufsteherin. Es war der erste Montag seit Monaten, an dem sie nicht Nina für die Schule fertig machen, ins Büro eilen oder ein Kaufhaus besuchen musste, und am liebsten hätte sie sich dort in dem hinteren Gästezimmer wieder unter die dicke Daunenbettdecke gekuschelt und noch ein paar Stunden die Augen zugemacht. Doch ihre Mutter hatte sie anderweitig gedrillt, und so war sie bereits um halb sieben in ihre Laufschuhe geschlüpft, während die anderen im Haus noch in tiefem Schlummer lagen, ging mit großen Schritten über das Grundstück und ließ sich von der Kälte wach rütteln. Sie war keine Läuferin, doch eine begeisterte Walkerin. Während ihrer Zeit hier oben mit Jericho hatte sie die aufwühlende Klarheit der frischen Bergluft lieben gelernt. In jenen Tagen hatte Rebecca Stunden damit zugebracht, ganz allein in den Wäldern herumzustreifen und sich Fluchtstrategien zurechtzulegen, die sie dann nie in die Tat umsetzen würde, denn stets schien Jericho zu ahnen, was sie vorhatte: Kaum setzte sie einen Fuß über die Schwelle, mit Argumenten gewappnet, warum sie gehen musste, stand er mit Blumen oder einem noch teureren Geschenk bereit. Manchmal, im Bett, fragte sie Jericho, was ihn an ihr eigentlich anziehe: nicht warum er ganz zu Beginn hinter ihr her gewesen war – Beck hatte es weiß Gott öfter erlebt, dass ein Mann hinter ihr her war–, nein, sondern warum er so an ihr hing, sie bei sich behielt und warum sie fast immer hier oben in den Bergen waren und zum größten Teil in trauter Zweisamkeit. Nie gab er ihr darauf eine Antwort, doch ab und zu, wenn sie ihn allzu sehr bedrängte, verschwand er in seinem Arbeitszimmer, und wenn er nach etwa einer Stunde wieder herauskam, hatte er alles arrangiert: ein Privatflugzeug in eine abgeschiedene Villa, etwa auf Teneriffa oder in Neuseeland – einem fernen Ort, wo sie zusammen sein konnten und doch allein. Am allerbesten jedoch war es gewesen, wenn er sie mit einem Chauffeur nach Aspen oder Vail bringen ließ, wo sie in den schicksten Boutiquen das Geld der Ainsleys auf den Kopf haute und sich die Garderobe erstand, die ihrer Stellung angemessen war – eine Stellung, die Jericho süffisant als «Begleiterin» titulierte, für die ihre Mutter jedoch das Wort «Konkubine» benutzte.
Sie hatte ihn geliebt. Das stand für sie außer Frage. Damals war sie erst neunzehn gewesen und hatte ihn mit einer Inbrunst geliebt, die sie bislang noch keinem Mann entgegengebracht hatte. Er war ein schneidiger Typ gewesen. Nie zuvor hatte sie einen ausgewachsenen Mann erlebt, der liebevolle Zuneigung mit sanfter Niedertracht vereinte. Jericho war schlau und lustig und in vieler Hinsicht freundlich und liebenswert. Gewiss, er konnte aufbrausend sein, aber das traf zumindest sie nur selten. Er hatte sie in eine Welt solcher Privilegien eingeführt, dass sie es immer noch nicht ganz begriffen hatte. Und er hatte seine Karriere für sie aufgegeben.
Das war der andere Grund, warum Rebecca schließlich nach Stone Heights zurückgekehrt war, nachdem sie es so lange gemieden hatte. Weil sie es ihm schuldig war. Jericho Ainsley hatte seine bemerkenswerte Karriere geopfert, um mit ihr zusammen zu sein, und obwohl sie ihm dafür dankbar war, musste sie in ihren nachdenklichsten Momenten zugeben, dass sie deshalb auch ein schlechtes Gewissen hatte.
Das gewaltige Anwesen selbst symbolisierte den Skandal ihrer Verstrickung. Jericho hatte es vor fünfzehn Jahren gekauft, als er sich schließlich eingestehen musste, dass ihre Beziehung ein normales Leben für sie beide unmöglich machte. Hab uns ein Häuschen in Colorado gekauft, Becky-Bär. Ganz und gar abgeschieden. Nur wir beide. Es wird dir gefallen.
Sie hatte Zweifel angemeldet.
Achthundert Morgen, hatte Jericho zu ihr gesagt. Tolle Aussicht, mitten im Nirgendwo. Der nächste Ort ist dreißig Meilen entfernt.
Zu der Zeit hatte Rebecca den Gedanken aufregend gefunden, er könne eine geheime Welt nur für sie beide erschaffen. Das Haus lag auf halbem Weg im Gebirge, und Jericho besaß den größten Teil des Grundes bis dorthin. Manchmal stiegen die beiden auf dem steinigen Pfad bis zum Gipfel und schauten hinab, ein Panorama, das sich über viele Meilen erstreckte und dessen Konturen zuerst ganz klar und dann immer verschwommener wurden, bis es sich inmitten höherer Gipfelketten verlor.
Was man in gewisser Weise auch vom Verlauf von Jerichos Karriere behaupten konnte.
An diesem Morgen lief Rebecca zum Tor, nicht hoch in Richtung Gipfel. Sie marschierte im Wald herum, hielt sich dabei in der Nähe der Schotterstraße, um sich nicht zu verirren, und fragte sich immer noch, warum Jericho nach ihr geschickt hatte oder ob er sich überhaupt daran erinnerte. Über der Bergspitze ging gerade die Sonne auf. Unten im Tal, östlich von Jerichos Bergen, warfen die hohen Bäume klarumrissene Schatten in ihre Richtung, wie messerscharfe Dolche. Sie hörte das Schnüffeln von Tieren, die vorbeihuschten, entdeckte hie und da ihre Fährten in der feuchten Erde und dem leichten Schnee, sah jedoch fast nichts von ihnen selbst außer einem Aufblitzen von Braun oder Grau am Wegesrand. Für den Weg hinab zum Tor brauchte sie zehn Minuten. Der Chevy Suburban vom vorigen Abend war verschwunden, und auch kein anderer Wagen stand dort. Vielleicht verlangte Jericho eine solche Überwachung nur über Nacht. Vielleicht standen die Sicherheitsbeamten auch irgendwo im Verborgenen. Das mochte auch für Becks wahre Gefühle gelten – sie lagen im Verborgenen, auch für sie selbst. Vielleicht war es ja ein Akt des Wahnsinns gewesen, hier hoch nach Stone Heights zu kommen und sich von Jerichos Wahnsinn peinigen zu lassen. Von Pamelas Feindseligkeit und von Audreys zuckersüß repressiver Toleranz. In drei Tagen musste sie in dem Flugzeug von Denver nach Chicago sitzen. Die Frage war berechtigt, ob sie alle es überhaupt so lange miteinander aushalten würden.
Eine Meile hinter dem Tor erreichte Rebecca die Hauptstraße und machte ächzend ein paar Dehnübungen. Hier wandte sie sich nach Westen, weg von der Stadt. Die Straße führte weiter hoch in Richtung Gipfel. Sie wusste, dass ihre Mutter Nina früh wecken würde, und versuchte sie auf dem Handy anzurufen, aber sie hatte wie üblich auf dieser Seite des Berges keinen Empfang. Ein kleiner Lieferwagen rumpelte an ihr vorbei in Richtung Tal, zwei Köpfe drehten sich gaffend zu ihr um. Ein leuchtend roter Explorer mit getönten Scheiben überholte sie und verschwand hinter einer Kurve aus ihrem Blickfeld. Die Sicht in Richtung Tal war jetzt schärfer. Unter ihr standen vereinzelt Häuser, und in der Ferne glitzerte die Sonne auf den Dächern von Vail. Nach etwa einer Meile gelangte Rebecca zum nächsten Eingang, dem Refugium eines Software-Magnaten, der um ein Vielfaches reicher war als Jericho. Das Haus war zu dieser Jahreszeit verrammelt, das Tor jedoch funkelnagelneu, sorgfältig verschlossen. Deprimiert, ohne zu wissen, warum eigentlich, drehte sie sich um und trat den Rückweg auf der Straße an, wo erneut der rote Explorer an ihr vorbeikam, jetzt in der anderen Richtung. Sie fragte sich, was für eine morgendliche Besorgung den Fahrer in aller Herrgottsfrühe dazu gebracht hatte, dem Gipfel einen so kurzen Besuch abzustatten, oder ob er sich nur verfahren hatte, und sie dachte daran zurück, wie Jericho sie vor langer Zeit gewarnt hatte, immer auf Autos zu achten, die hier auf der Straße auftauchten.
Dann hörte sie den Schuss.
Natürlich verstand Beck etwas von Schusswaffen. Jericho hatte von ihr verlangt, dass sie schießen lernte, und selbst jetzt bewahrte sie als alleinstehende Frau einen geladenen Revolver in ihrem Haus auf, in einer abgeschlossenen Kiste unter ihrem Bett. Sie hob den Kopf. Es folgte kein zweiter Schuss. Irgendein Gewehr war es gewesen. Wahrscheinlich ein Jäger. Auf dieser Höhe war ein Schuss über weite Entfernungen hinweg zu hören, doch konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser hier relativ nah abgefeuert worden war.
Schnell und schmerzlos. Die jagen dir eine flinke Kugel in den Kopf… Da gibt es Schlimmeres, glaub mir.
Nein. Nein. Nicht möglich. Nicht so bald und nicht so.
Dennoch lief sie weiter, zurück in Richtung Stone Heights, schnell. Es war leichter, bergab zu gehen als bergauf. Nach nur wenigen Minuten hatte Rebecca die Grenzen des Grundstücks erreicht, lief die unbefestigte Straße entlang zu den eingefrorenen Toren und musste dann wieder klettern. Der Hund lag auf halbem Weg in der Zufahrt.
Sie stand ganz still.
Der Hund war schwarz und glatthaarig und musste einmal ein schönes Tier gewesen sein, doch der Schuss hatte seine Gehirnmasse über dem ganzen Schotter verteilt. Da war Blut, da waren weiße Partikel, bei denen es sich um Knochen oder Gehirn handeln musste – und Erbrochenes, direkt daneben, aber das war von ihr.
Als sie vor vierzig Minuten an dieser Stelle vorbeigekommen war, war die Zufahrt leer gewesen. Da war sie sich sicher.





























