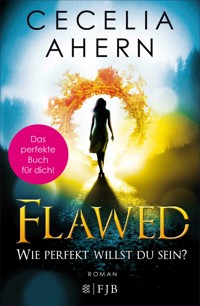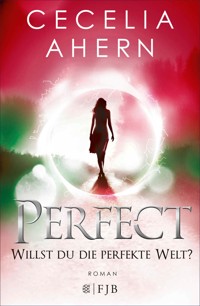8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sandy Shortt zehn Jahre alt ist, verschwindet ein Mädchen aus ihrer Klasse. Seit dieser Zeit sucht sie leidenschaftlich nach allem, was vermisst wird: nach Socken, Schlüsseln und später auch nach Menschen. In ihrer Suchagentur macht sie Angehörigen Mut, denn sie gibt niemals auf. Doch als Sandy den Auftrag bekommt, den Bruder von Jack Ruttle wiederzufinden, verirrt sie sich im Wald und verschwindet selbst – an einen geheimnisvollen Ort, den alle nur »Hier« nennen ... Fantasievoll, spannend und tief berührend macht sich Cecelia Aherns Roman auf die Suche – nach dem Leben, der Liebe und uns selbst. »Was für ein bezauberndes Märchen!« Für Sie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Cecelia Ahern
Vermiss mein nicht
Roman
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh
FISCHER E-Books
Inhalt
Für dich, Dad, mit Liebe. Per ardua surgo.
»Als vermisst gilt eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Dabei ist es unerheblich, unter welchen Umständen sie verschwunden ist.
Die betreffende Person gilt so lange als vermisst, bis sie gefunden ist und klare Angaben über ihre Befindlichkeit gemacht werden können.«
Eins
Jenny-May Butler, die in der gleichen Straße wohnte wie ich, verschwand, als ich noch ein Kind war.
Die Polizei strengte umfassende Ermittlungen an, die in eine endlose Suche nach dem kleinen Mädchen mündeten. Monatelang war die Geschichte jeden Abend in den Fernsehnachrichten, prangte morgens auf der Titelseite der Zeitungen und war überall Gesprächsthema Nummer eins. Das ganze Land beteiligte sich – es war die größte Vermissten-Suchaktion, die ich je erlebt habe, und aus irgendeinem Grund schien jeder sich davon betroffen zu fühlen.
Tag für Tag lächelte Jenny-May Butler, ein hübsches blauäugiges Blondchen, in jedem Wohnzimmer des Landes von der Mattscheibe, rührte die Menschen zu Tränen und brachte Eltern reihenweise dazu, ihre Kinder beim Gutenachtsagen ein bisschen fester und länger an sich zu drücken. Alle träumten von Jenny-May, alle schlossen sie in ihre Gebete mit ein.
Sie war zehn Jahre alt, genau wie ich, ging in die gleiche Klasse, und jeden Tag sah ich ihr hübsches Foto in den Nachrichten. Die Leute sprachen von ihr, als wäre sie ein Engel. Wenn man ihre Gespräche hörte, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass Jenny-May in der Pause, wenn die Lehrerin gerade mal nicht hinschaute, mit Steinen nach Fiona Brady warf oder dass sie mich gern als »blödes Kraushaarschaf« betitelte, vor allem, wenn Stephen Spencer in der Nähe war, und das nur, weil sie mit ihm gehen und mich als Konkurrentin ausstechen wollte. Nein, in diesen Monaten der Suche nach ihr war sie schlicht perfekt, und ich hätte es auch nicht fair gefunden, dieses Bild zu zerstören. Nach einer Weile vergaß ich sogar ihre ganzen Gemeinheiten, weil das Mädchen, das gesucht wurde, eigentlich gar nicht mehr die normale Jenny-May war, sondern die liebe süße Jenny-May Butler, die vermisst wurde und deren furchtbar nette Eltern jeden Abend in den Neun-Uhr-Nachrichten um sie weinten.
Sie blieb verschwunden. Man fand weder ihre Leiche noch sonst irgendeine Spur – es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Niemand hatte in der Gegend irgendwelche zwielichtigen Subjekte bemerkt, auf keiner Überwachungskamera war zu sehen, was sie zuletzt getan hatte, es gab keine Zeugen, keine Verdächtigen, und das, obwohl die Polizei wirklich jeden Möglichen und Unmöglichen verhörte. Allmählich breitete sich ein gewisses Misstrauen unter den Menschen aus. Wenn man den Nachbarn morgens auf dem Weg zur Arbeit ein freundliches Hallo zurief, machte man sich plötzlich ungewohnte und unerfreuliche Gedanken. Gegen diese Phantasien war kein Kraut gewachsen – bei ganz normalen Samstagmorgenbeschäftigungen wie Autowaschen, Gartenzaunstreichen, Unkrautjäten und Rasenmähen blickte man sich verstohlen um, stellte sich im Stillen unangenehme Fragen und hing Spekulationen nach, die einen zutiefst beschämten. Schockiert und wütend stellten die Menschen fest, dass sie sich gegenseitig verdächtigten und dieser Vorfall sie auf völlig abwegige Ideen brachte. Sie schrubbten emsig, drehten den Gartenschlauch unerbittlich auf und versuchten alle vermeintlichen Schweinereien zusammen mit dem Seifenschaum von der Kühlerhaube zu spülen, bis der Lack glänzte und auch die Gartenzäune in makellosem Weiß erstrahlten. In dieser Gegend, wo ein grüner Daumen zur Grundausstattung gehörte, wusste man, dass die Blumenzwiebeln nicht lange unter der Erde ausharrten, sondern dass die Triebe bald durch die Oberfläche dringen würden. Das war auch nur richtig so, es entsprach schließlich ihrer Natur.
Doch die hinter verschlossenen Türen angedeuteten Vorwürfe waren für die Polizei nutzlos, ihr einziger Hinweis war ein hübsches Bild. So blieb Jenny-May Butlers Verschwinden ein unlösbares Rätsel.
Ich fragte mich, wo sie jetzt wohl sein mochte. Wie um alles in der Welt konnte sich ein Mensch einfach in Luft auflösen, ohne die geringste Spur zu hinterlassen, ohne dass irgendwer irgendwas darüber wusste? Nachts starrte ich aus meinem Schlafzimmerfenster zu ihrem Haus hinüber, wo immer Licht brannte. Anscheinend schlief auch Mrs. Butler nicht besonders gut, denn ich sah sie oft auf der Sofakante sitzen, als kauerte sie in den Startlöchern und wartete darauf, endlich einen Startschuss zu hören. Sie wartete auf Neuigkeiten. Manchmal winkte ich ihr zu, und sie winkte traurig zurück. Durch den Tränenschleier konnte sie mich wahrscheinlich kaum erkennen.
Genau wie Mrs. Butler war auch ich unglücklich darüber, dass wir keine Antworten auf all unsere Fragen hatten. Seit Jenny-May weg war, konnte ich sie viel besser leiden, und auch das erschien mir bemerkenswert. Ich vermisste sie, ich vermisste die Vorstellung von Jenny-May Butler und überlegte, ob sie wohl irgendwo in der Nähe war, andere Kinder mit Steinen bewarf und dabei laut und gehässig lachte. Aber wir fanden sie nicht, und ich hörte sie auch nicht lachen. Nach ihrem Verschwinden fing ich an, nach allem Möglichen zu suchen. Wenn eine meiner Lieblingssocken fehlte, stellte ich das ganze Haus auf den Kopf, suchte und suchte, während meine besorgten Eltern mich ratlos beobachteten. Meistens endete es damit, dass sie mir beim Suchen halfen.
Es beunruhigte mich, wenn ich Sachen verlor und nicht finden konnte, und wenn dann doch einmal etwas wieder auftauchte, war es meist nur eine einzelne poplige Socke, was ich ebenfalls irritierend fand. Dann stellte ich mir wieder vor, wie Jenny-May Butler irgendwo mit Steinen warf, gehässig lachte und dabei meine Lieblingssocken anhatte.
Ich wollte nie etwas Neues für meine verschwundenen Sachen haben. Schon mit zehn Jahren war ich überzeugt, dass man etwas Verlorenes nicht ersetzen kann. Ich beharrte darauf, dass es wiedergefunden werden musste.
Vermutlich machte ich mir noch mehr Gedanken über Jenny-May Butler und die einzelnen Socken als Mrs. Butler. Aber wir waren beide nachts wach und grübelten.
Vielleicht ist mir alles deshalb passiert. Vielleicht habe ich, weil ich so viele Jahre damit verbracht habe, in meinem Leben das Oberste zuunterst zu kehren und krampfhaft nach allem Möglichen zu suchen, irgendwann vergessen, mich um mich selbst zu kümmern, mich zu fragen, wer und wo ich eigentlich war.
Vierundzwanzig Jahre nach Jenny-May Butlers Verschwinden verschwand ich ebenfalls.
Hier ist meine Geschichte.
Zwei
In meinem Leben hat das Schicksal eine Menge Ironie bewiesen, und dass ich verschwunden bin, ist nur einer von vielen absurden und aberwitzigen Vorfällen. Ich würde gern darüber lachen, wenn ich nicht meinen Sinn für Humor verloren hätte, als ich selbst verloren gegangen bin.
Zuerst einmal bin ich einen Meter fünfundachtzig groß. Schon als Kind habe ich fast immer alle um mich herum überragt. Im Einkaufszentrum konnte ich nicht unauffällig in der Menge untertauchen wie andere Kids, beim Versteckspielen wurde ich immer als Erste gefunden. In der Disco forderte mich keiner zum Tanzen auf, und ich war vermutlich der einzige weibliche Teenager, der nicht den dringenden Wunsch verspürte, endlich hochhackige Schuhe tragen zu dürfen. Jenny-May Butler nannte mich gern eine blöde Bohnenstange und zwang mich regelmäßig jeden Dienstag um zehn, vor aller Augen ein Buch für sie aus der obersten Reihe der Schulbibliothek zu angeln. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich war diejenige, die man meilenweit sehen konnte, ich war diejenige, die auf dem Tanzparkett ungelenk rumhampelte, ich war diejenige, hinter der im Kino niemand sitzen wollte, ich war die, die im Jeansgeschäft nach Hosen mit Überlänge fragen musste. Kurz gesagt, ich falle auf wie ein bunter Hund, und jeder, der an mir vorbeigeht, bemerkt mich und erinnert sich später an mich. Lassen wir die vereinzelten Socken und ausnahmsweise auch Jenny-May Butler beiseite – die Krönung all dieser unerklärlichen Vorkommnisse war eindeutig, dass ausgerechnet ich, das schwarze Schaf in einer durchgängig weißen Herde, plötzlich unsichtbar war. Das Rätsel, das ich mir selbst aufgab, übertraf alle anderen bei weitem.
Die zweite große Ironie meines Lebens besteht darin, dass ich beruflich nach vermissten Personen suchte. Nach dem Schulabschluss wurde ich Polizistin und arbeitete am liebsten an Fällen, in denen jemand vermisst wurde. Aber da es dafür keine eigene Abteilung gab, spielte mir der Zufall nur gelegentlich etwas nach meinem Geschmack in die Hände. Wisst ihr, die Situation mit Jenny-May Butler brachte in mir echt etwas in Bewegung. Ich wollte Antworten, Lösungen, und ich wollte sie alle selbst finden. Vermutlich mutierte meine Sucherei dabei zu einer Art Besessenheit, und ich war so damit beschäftigt, in der Außenwelt nach Hinweisen zu forschen, dass ich nicht ein einziges Mal überlegte, was eigentlich in meinem eigenen Kopf vor sich ging.
Bei der Polizei fanden wir manchmal Leute in einem Zustand wieder, den ich für den Rest meines Lebens und noch weit ins nächste hinein nicht vergessen werde, und es gab auch Menschen, die einfach nicht gefunden werden wollten. Doch viel zu oft fanden wir Vermisste gar nicht, keine Spur. Solche Fälle machten mich wahnsinnig, so sehr, dass ich oft einfach auf eigene Faust weitersuchte. Ich ermittelte in Fällen, die längst abgeschlossen waren, ich blieb mit den Familien in Kontakt, nachdem die offizielle Suche längst abgeblasen war. Bis man mir irgendwann mitteilte, ich solle gefälligst mit diesen Sperenzchen aufhören. Es gab dringendere Fälle, bei denen meine Arbeitskraft gebraucht wurde. Nach einer ganzen Serie von solchen und ähnlichen Ermahnungen wurde mir klar, dass es für mich schlicht nicht möglich war, mich einem neuen Fall zuzuwenden, bevor ich den vorhergehenden hundertprozentig gelöst hatte.
Man warf mir vor, ich würde den Leuten falsche Hoffnungen machen, und meine ständige Sucherei hindere die Familien daran, sich damit abzufinden, dass die gesuchte Person einfach verschwunden war und man nie etwas Genaues über ihren Verbleib in Erfahrung bringen würde. Aber ich konnte einfach keinen Schlussstrich ziehen, denn für mich galt als Schlussstrich nur, wenn ich die vermisste Person wiederfand. Ich akzeptierte keine Zwischenlösung. Deshalb schmiss ich meinen Job bei der Polizei eines Tages hin, machte mich selbständig und das Suchen zu meinem Beruf. Ihr würdet nicht glauben, wie vielen Menschen das genauso am Herzen lag wie mir. Allerdings fragten sich meine Klienten oft, aus welchem Grund ich eigentlich suchte. Sie selbst hatten ja eine Beziehung zu den Vermissten, sie liebten sie und wollten sie wiederhaben. Wenn es mir also nicht ums Geld ging – und darum ging es mir ganz offensichtlich nicht –, worin bestand dann meine Motivation? Vermutlich ging es mir um meinen Seelenfrieden. Das Suchen half mir, abends einzuschlafen.
Aber wie kann jemand wie ich, mit meinen körperlichen Eigenschaften und meiner inneren Einstellung, verloren gehen?
Dabei fällt mir ein, dass ich euch noch gar nicht meinen Namen gesagt habe. Ich heiße Sandy Shortt. »Short« wie »klein«. Ja, es darf gelacht werden. Wenn es mir nicht das Herz brechen würde, würde ich auch darüber lachen. Meine Eltern haben mich Sandy genannt, weil ich mit dichten sandfarbenen Haaren auf die Welt gekommen bin. Leider konnten sie nicht wissen, dass meine Haare pechschwarz werden würden und dass meine niedlichen feisten Beinchen bald nicht mehr strampeln, sondern viel zu schnell wachsen und viel zu lang werden würden. Also nochmal: Mein Name ist Sandy Shortt. Sandhell und klein sollte ich sein, so definiert mich mein Name für alle Zeiten, aber leider trifft das genaue Gegenteil auf mich zu. Dieser Widerspruch bringt die Leute fast immer zum Lachen, wenn ich mich vorstelle, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich selbst unter diesen Umständen keine Miene verziehe. Wisst ihr, es ist nicht lustig, verschwunden zu sein, aber ich habe gemerkt, dass es auch nicht viel anders ist als vorher – ich mache eigentlich genau dasselbe wie immer.
Ich suche. Nur suche ich jetzt nach einer Möglichkeit, gefunden zu werden.
Eines hab ich allerdings gelernt, und das ist durchaus erwähnenswert: Auf einmal sehne ich mich nach Hause zurück. Und das ist vollkommen neu.
Was für ein miserables Timing. Dass mir das ausgerechnet jetzt klar wird, ist wahrscheinlich die größte Ironie an der ganzen Geschichte.
Drei
Geboren und aufgewachsen bin ich im County Leitrim, dem mit ungefähr 25000 Einwohnern kleinsten irischen County. Da meine Heimatstadt früher die Hauptstadt war, sind dort die Überreste einer Festung und noch ein paar andere altehrwürdige Gebäude zu bewundern. Heute hat das Städtchen allerdings seine Bedeutung verloren und ist praktisch zu einem Dorf geschrumpft. Die Gegend ist hauptsächlich hügelig, aber es gibt auch richtige Berge mit tief eingeschnittenen Tälern und pittoresken Seen. Der Boden kann besonders gut Wasser speichern, und es ist ein stehender Witz, dass man die Grundstücke in Leitrim nach Litern und nicht nach Hektar verkauft. Leitrim grenzt nirgends ans Meer, sondern im Westen an Sligo und Roscommon, im Süden an Roscommon und Longford, im Osten an Cavan und Fermanagh und im Norden an Donegal. Wenn ich dort bin, werde ich jedes Mal von klaustrophobischen Gefühlen überfallen.
Besonders bezeichnend für Leitrim aber ist der Spruch, dass das Beste an dieser Grafschaft die Straße ist, die nach Dublin führt. Mit siebzehn war ich mit der Schule fertig und landete tatsächlich auf ebendieser Straße, als ich meinen Ausbildungsplatz bei der Polizei bekam. Seither habe ich den Ort meiner Herkunft nur äußerst selten mit meiner Gegenwart beglückt. Ungefähr alle zwei Monate besuche ich meine Eltern in ihrem Reihenhäuschen, das in der kleinen Sackgasse mit zwölf Häusern steht, in der ich aufgewachsen bin. Gewöhnlich nehme ich mir vor, übers Wochenende zu bleiben, aber meistens halte ich es nur einen Tag dort aus und muss einen dringenden Notfall bei der Arbeit vorschützen, um mir so schnell wie möglich meine Tasche zu schnappen, die ich vorsorglich immer unausgepackt neben der Tür stehen lasse, und in Windeseile auf der Straße, die das Beste an Leitrim ist, das Weite zu suchen.
Nicht dass ich je eine schlechte Beziehung zu meinen Eltern gehabt hätte. Sie waren immer sehr nett zu mir, haben mich unterstützt, wären jederzeit für mich durchs Feuer gegangen oder von einem Berg gesprungen und hätten mich mit ihren Leibern vor heransausenden Pistolenkugeln beschützt. Aber die Wahrheit ist, dass mir ihre Gesellschaft unbehaglich war. In ihren Augen konnte ich sehen, was sie sahen, und das gefiel mir nicht. Ich sah meine Reflektion in ihren Gesichtern deutlicher als in jedem Spiegel. Manche Menschen können das – sie schauen einen an und teilen einem mit ihrem Gesichtsausdruck unmissverständlich mit, wie man sich soeben verhalten hat. Vermutlich verfügten meine Eltern über diese Fähigkeit, weil sie mich liebten, aber ich konnte einfach nicht lange mit Leuten zusammen sein, die mich liebten – wegen dieser Augen, wegen dieses Spiegelbilds.
Schon als ich noch ein Kind war, sind sie auf Zehenspitzen um mich herumgeschlichen, haben mich in dieser selbst erzeugten Stille argwöhnisch beobachtet, Pseudogespräche geführt und gekünsteltes Gelächter produziert, das überall im ganzen Haus widerhallte. Sie versuchten, meine Gedanken abzulenken und eine entspannte Atmosphäre von Normalität zu schaffen. Aber ich durchschaute sie. Ich wusste auch, warum sie sich so aufführten, und so schafften sie letztlich nur, mir bewusst zu machen, dass etwas nicht stimmte.
Sie waren so hilfsbereit, sie liebten mich so sehr, und jedes Mal, wenn ich wieder einmal das Haus auf den Kopf stellte, um etwas zu suchen, gab es die gleichen netten Abwehrmechanismen. Milch und Kekse am Küchentisch, Musik aus dem Radio, das Brummen der Waschmaschine im Hintergrund – alles nur, um die unbehagliche Stille zu übertünchen, die unweigerlich über uns hereinbrach.
Mum betrachtete mich mit einem Lächeln, das nie ihre Augen erreichte, diesem Lächeln, bei dem sie, wenn sie dachte, ich würde nicht hinsehen, die Lippen fest zusammenkniff und leise mit den Zähnen knirschte. Die gezwungene Lockerheit ihrer Stimme, das verbissen glückliche Gesicht, wenn sie neckisch den Kopf schief legte – wobei sie sich alle Mühe gab, mich nicht merken zu lassen, dass sie mich durchdringend musterte – und fragte: »Warum möchtest du denn das Haus wieder durchsuchen, Honey?« Immer nannte sie mich Honey, als wüsste sie, dass ich genauso wenig Sandy Shortt war wie Jenny-May Butler ein Engelchen.
Ganz egal, wie viel Lärm und Geschäftigkeit in der Küche heraufbeschworen wurde, um die Stille zu füllen, es funktionierte nie. Die Stille überschwemmte alles.
»Weil wieder eine Socke weg ist«, beantwortete ich ihre Frage wahrheitsgemäß.
»Von welchem Paar denn diesmal?«, hakte sie nach, mit diesem unecht entspannten Lächeln, mit dem sie mir vorzugaukeln versuchte, dass es sich um ein ganz beiläufiges Gespräch handelte und nicht etwa einen verzweifelten Versuch herauszufinden, wie ich eigentlich tickte.
»Von dem blauen mit den weißen Streifen.« Ich zog grundsätzlich nur farbenfrohe Socken an, weil sie gut zu identifizieren waren und sich im Allgemeinen leicht finden ließen.
»Hmm, vielleicht hast du sie nicht beide in den Wäschekorb getan, vielleicht ist eine noch bei dir im Zimmer.« Erneut das aufgesetzt entspannte Lächeln, das unterdrückte nervöse Gezappel, das mühsame Schlucken.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab beide in den Korb geworfen, und ich hab auch gesehen, wie du beide in die Waschmaschine gesteckt hast. Aber es ist nur eine wieder rausgekommen. Sie ist nicht in der Maschine und auch nicht im Korb.«
Der Plan, als Ablenkung die Waschmaschine anzustellen, erwies sich als Schuss in den Ofen, denn stattdessen rückte die Maschine jetzt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Trotzdem bemühte sich meine Mum, auch beim Anblick des umgekippten Wäschekorbs ihr gelassenes Lächeln aufrechtzuerhalten. Alle säuberlich zusammengefalteten Sachen lagen chaotisch auf dem Boden herum. Für eine kurze Sekunde konnte ich hinter die Fassade blicken. Wenn ich geblinzelt hätte, wäre es mir entgangen, aber ich sah den Ausdruck auf ihrem Gesicht, als sie rasch und verstohlen nach unten schaute. Es war die nackte Angst. Nicht wegen der vermissten Socke, nein, meine Mutter hatte Angst um mich. Doch unverzüglich klebte sie ihr Lächeln wieder an und zuckte die Achseln, als wäre nichts geschehen.
»Vielleicht hat der Wind sie weggeblasen, ich hab vorhin die Verandatür aufgemacht«, meinte sie lächelnd.
Ich schüttelte entschieden den Kopf.
»Sie könnte auch aus dem Korb gefallen sein, als ich ihn rübergetragen habe.«
Erneutes Kopfschütteln meinerseits.
Sie schluckte, und ihr Lächeln wurde noch verkniffener. »Vielleicht hat sie sich zwischen den Laken verfangen. Die sind riesig, da übersieht man so eine kleine Socke schon mal.«
»Ich hab aber nachgeschaut.«
Sie nahm sich einen Keks vom Tisch und biss viel zu heftig hinein, weil ihr Gesicht vom Lächeln schmerzte und sie sich irgendeine Erleichterung verschaffen musste. Dann kaute sie eine Weile, tat so, als würde sie nicht nachdenken, sondern dem Radio lauschen, summte dabei aber einen ganz anderen Song. Sie wollte mir unbedingt weismachen, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte.
»Honey«, lächelte sie schließlich wieder. »Manchmal gehen Dinge einfach verloren.«
»Aber wo kommen sie denn hin, wenn sie verloren gegangen sind?«
»Sie kommen nirgendwohin«, lächelte sie. »Sie bleiben einfach dort, wo die Person sie fallen lassen oder vergessen hat. Wir suchen einfach nur nicht an der richtigen Stelle, wenn wir etwas nicht finden können.«
»Aber ich hab überall gesucht, Mum. Das tu ich immer.«
Das stimmte. Ich drehte jeden Stein um, ich kehrte das Unterste zuoberst, und in unserem kleinen Haus gab es garantiert keinen Winkel, den ich vergaß.
»Eine Socke kann ja ohne Fuß nicht einfach so wegmarschieren«, pseudolachte sie.
Seht ihr, genau an diesem Punkt, an dem Mum aufgab, hören auch die meisten anderen Leute auf zu überlegen. Auf einmal kümmert es sie nicht mehr, was eigentlich los ist. Man findet etwas nicht, man weiß, es muss irgendwo sein, aber obwohl man überall nachgeschaut hat, bleibt es verschwunden, spurlos. Von einem Moment zum andern gibt man sich damit zufrieden, hält sich vielleicht für verrückt, gibt sich die Schuld, dass man das Betreffende verloren hat, und vergisst den Vorfall irgendwann. Aber genau das konnte ich nicht.
Ich weiß noch, wie mein Dad an diesem Abend von der Arbeit zurückkam, in ein Haus, in dem buchstäblich nichts mehr an seinem angestammten Platz war.
»Hast du was verloren, Honey?«
»Eine von meinen blau-weiß gestreiften Socken«, ertönte gedämpft meine Antwort von unter dem Sofa.
»Wieder nur die eine?«
Ich kam zum Vorschein und nickte.
»Die linke oder die rechte?«
»Die linke.«
»Okay, ich schau mal oben nach.« Er hängte seinen Mantel an die Garderobe neben der Tür, stellte den Schirm in den Schirmständer, gab seiner nervösen Frau einen zärtlichen Kuss auf die Wange und strich ihr beruhigend mit der Hand über den Rücken. Dann ging er die Treppe hinauf. Zwei Stunden lang verschanzte er sich im Elternschlafzimmer und suchte. Aber ich hörte ihn nicht umhergehen, und als ich nach einer Weile einen Blick durchs Schlüsselloch riskierte, sah ich, dass er mit einem nassen Waschlappen über dem Gesicht auf dem Bett lag.
Bei meinen Besuchen in späteren Jahren stellten meine Eltern stets dieselben entspannten Fragen, die niemals übergriffig sein sollten, sich für jemanden, der schon bis zur Nasenspitze mit Argwohn gewappnet war, aber so anhörten.
»Irgendwelche interessanten Fälle bei der Arbeit?«
»Was gibt’s Neues in Dublin?«
»Wie ist die Wohnung?«
»Fester Freund in Sicht?«
Es war nie ein fester Freund in Sicht; ich hatte keine Lust, mich tagaus, tagein von einem weiteren durchdringenden Augenpaar piesacken zu lassen. Ich hatte Liebhaber und Kontrahenten, Jungs, Männer, Freundinnen, verheiratete Freunde und Bekannte. Ich hatte genug ausprobiert, um zu wissen, dass bei mir auf Dauer keine Beziehung funktionieren würde, denn ich ertrug keine Nähe, war nicht anhänglich genug, konnte nicht genug geben und brauchte auch nicht genug. Ich hatte keinen Bedarf für das, was diese Menschen mir anzubieten hatten, sie hatten kein Verständnis für meine Wünsche, also gab es rundum verkniffenes Lächeln, wenn ich meinen Eltern erzählte, dass bei der Arbeit alles gut lief, dass in Dublin viel los war, dass meine Wohnung mir gefiel und dass ich keinen festen Freund hatte, nein.
Jedes Mal, wenn ich das Haus verließ – selbst dann, wenn ich meinen Aufenthalt abkürzte –, verkündete Dad mit stolzgeschwellter Brust, dass ich das Beste sei, was Leitrim je hervorgebracht hatte.
Sie unterstützten mich, wo sie nur konnten, und das begreife ich erst jetzt.
Mit jedem Tag, der vergeht, wird mir klarer, dass diese Erkenntnis weit frustrierender ist, als irgendetwas nicht wiederzufinden.
Vier
Als Jenny-May Butler verschwunden ist, hat sie einen Teil von mir mitgenommen – sozusagen als letzte Gemeinheit mir gegenüber.
Ich glaube, es ist kein Wunder, dass danach ein Teil von mir einfach nicht mehr da war. Je älter ich wurde, je größer ich wurde, desto tiefer wurde auch dieses Loch in mir, bis es überall in meinem erwachsenen Leben klaffte, wie das aufgerissene Maul eines starräugigen Fischs auf dem Trockenen. Aber was ist mit meinem körperlichen Selbst? Wie bin ich dorthin gekommen, wo ich jetzt bin? Zuerst und vor allem: Wo bin ich überhaupt?
Ich bin hier, das ist alles, was ich weiß.
Ich sehe mich um, ob ich irgendwo etwas entdecke, was mir bekannt vorkommt. Ich wandere durch die Gegend und suche den Weg hinaus, aber es gibt keinen. Verwirrung und Geheimnis allüberall, die Luft dick von verlorenen Gerüchen, vermischt mit persönlichen Aromen, einige davon tröstlich wie der längst vergessene Duft eines Hauses aus der Kindheit, einer Küche, in der gerade gebacken wurde. Babypuder und Penatencreme, Gerüche, die eine Mutter vergisst, wenn ihr Kind erwachsen ist. Ältere, muffige Gerüche von Lieblingsgroßeltern – Lavendel für Grandma, Zigarren-, Zigaretten- oder Pfeifenrauch für Granddad. Der Duft ehemaliger Liebhaber, süßes Parfüm und Aftershave. All die Gerüche, die im Leben der Menschen verloren gegangen sind, haben sich anscheinend hierher verzogen.
Aber wo ist dieses Hier? Wenn ich das wüsste! Ein Chaos von persönlichen Gegenständen umgibt mich, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Handys, Handtaschen, Jacken, Koffer mit Gepäckaufklebern, einzelne Schuhe, wichtig aussehende Akten, Fotos, Dosenöffner, Scheren, Ohrringe, die gelegentlich zwischen anderen verlorenen Gegenständen aufblitzen, wenn das Licht sie trifft. Und Socken. Jede Menge einzelner Socken.
Wo ich auch hingehe, stolpere ich über Sachen, die irgendwelche Leute wahrscheinlich immer noch suchen, händeringend, aber vergeblich.
Auch Tiere gibt es hier. Hunde und Katzen mit kleinen verlorenen Gesichtern und schütteren Schnurrhaaren. Garantiert besteht zwischen ihnen und den Fotos, die ihre Besitzer einst an kleinstädtische Telefonmasten geklebt haben, nicht mehr viel Ähnlichkeit. Keine noch so hohe Belohnung wird ihnen die ehemaligen kleinen Lieblinge zurückbringen.
Wie es hier aussieht und riecht, wisst ihr jetzt, aber nun kommen wir zu den Geräuschen. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, hält man die Erinnerung an ihn fest, an den Klang des Lachens, an das Gefühl und den Geruch von Haut und Haaren. Aber wenn genug Zeit verstrichen ist, gehen auch diese Erinnerungen allmählich verloren, man kann den Geruch nicht mehr heraufbeschwören, das Lachen und das Weinen nicht mehr hören. Auch bleibt nicht alles genau so in Erinnerung, wie es wirklich einmal war. Gesichter und Stimmen verschwimmen, und gerade die Dinge, die uns unverwechselbar machen, verblassen mit der Zeit. Jede verlorene Erinnerung taucht hier wieder auf, hier, wo ich jetzt bin. Wir hören den Klang jedes vergessenen Lachens, jedes Weinen, Rufen, Schreien und Singen, sobald es in unsere Atmosphäre eintritt. Wenn ein Mensch sehr lange Zeit verschwunden ist, taucht die gesamte Erinnerung an ihn irgendwann hier auf.
Stellt euch vor, wie die Leute hier sich fühlen, wenn sie plötzlich ihr eigenes Lachen hören! Denn das kann ja nur eines bedeuten. Nämlich dass man sie vergessen hat.
Wie soll ich diesen Ort, dieses Hier am besten beschreiben? Es ist eine Art Zwischenwelt. Wie ein großer Korridor, der nirgendwo hinführt, ein Bankett aus Resten von gestern, ein Sportteam aus lauter Leuten, die niemand ausgesucht hat, eine Mutter ohne ihr Kind, ein Körper ohne Herz. Dieser Ort ist nur halb da, nicht ganz. Randvoll mit persönlichen Gegenständen, aber doch leer, weil die Menschen, denen sie gehören, nicht hier sind, um sie zu lieben.
Wie ich hergekommen bin? Ich bin eine von diesen verschwundenen Joggerinnen. Erbärmlich, oder? Früher hab ich mir die ganzen B-Movies reingezogen und jedes Mal laut gestöhnt, wenn nach dem Vorspann gleich der Tatort gezeigt wurde, wo am frühen Morgen wieder mal eine Joggerin ermordet worden war. Es war doch strohdoof, dass Frauen sich unbedingt in stockdunkler Nacht oder in aller Herrgottsfrühe auf einsamen Gassen herumtrieben, vor allem, wenn jeder wusste, dass dort ein bekannter Serienkiller auf der Lauer lag. Aber genau das ist mir passiert – ich war eine berechenbare, bemitleidenswerte, tragisch naive Joggerin in einem grauen Trainingsanzug, die mit plärrenden Kopfhörern in den frühen Morgenstunden an einem Kanal entlangrannte. Allerdings hat mich niemand entführt, ich bin nur auf den falschen Weg geraten.
Ich joggte also vor mich hin, und meine Füße schlugen wie immer wütend auf den Boden, sodass mein ganzer Körper vibrierte. Ich weiß noch, dass mir der Schweiß über Stirn, Brust und Rücken lief, und dass irgendwann eine kühle Brise aufkam, die mich, verschwitzt wie ich war, zum Frösteln brachte. Jedes Mal, wenn ich mir diesen Morgen durch den Kopf gehen lasse, muss ich gegen die Hoffnung ankämpfen, dass ich diesmal meinen verhängnisvollen Fehler vielleicht vermeiden kann. Natürlich komme ich trotzdem wieder vom Weg ab. Es passierte um Viertel vor sechs an einem hellen Sommermorgen, und abgesehen vom Titelsong aus Rocky, der in meinen Ohren dröhnte und mich anspornte, war alles still. Obwohl ich es nicht hören konnte, wusste ich, dass ich schwer atmete, denn ich legte mich beim Joggen immer ziemlich ins Zeug. Sobald ich Lust auf eine Pause bekam, zwang ich mich, noch schneller zu laufen. Keine Ahnung, was mich dazu trieb, meinem Körper stets neue Höchstleistungen abzuverlangen – ob es eine Strafe war, die ich mir tagtäglich auferlegte, oder ob beim Joggen einfach der Teil meiner Persönlichkeit die Oberhand gewann, der Dinge erforschen und zu unbekannten Orten vorstoßen wollte.
Im Dunkel des grün-schwarzen Grabens neben mir entdeckte ich eine Blume, eine Water-Violet, auch Sumpfwasserfeder genannt. Auf einmal erinnerte ich mich daran, wie mein Vater mir als dünnem schwarzhaarigen Mädchen, das sich seines widersprüchlichen Namens schämte, einmal erzählt hatte, wie seltsam unpassend der Name dieser helllila-rosafarbigen Bachblüte mit dem gelben Punkt in der Mitte doch war, denn sie war weder violett, noch hatte sie Ähnlichkeit mit einer Feder. War sie nicht wunderschön? Und war der verquere Name nicht sehr lustig? Kopfschüttelnd hatte ich ihm geantwortet, dass ich unpassende Namen überhaupt nicht zum Lachen fand. Jetzt sah ich die Blume an und sagte ihr in Gedanken: Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Aber im Weiterlaufen merkte ich plötzlich, wie mir meine Armbanduhr vom Handgelenk glitt und zwischen den Bäumen links von mir auf den Boden fiel. Als ich die Uhr das allererste Mal umgelegt hatte, war der Verschluss kaputt gegangen, und seither machte sie sich gelegentlich selbständig. Ich blieb stehen, drehte mich um und sah die Uhr unter einem Blutweiderich auf dem feuchten Boden der Kanalböschung liegen. Atemlos lehnte ich mich einen Moment an die raue Rinde einer Erle, und da entdeckte ich einen schmalen Trampelpfad, der nach links abbog. Nicht besonders einladend, sicher auch nicht unbedingt für Jogger gedacht, aber mein Forscherdrang befahl mir nachzusehen, wohin dieser Weg führte.
Er führte mich hierher.
Ich rannte so weit und so schnell, dass ich, als mein iPod seinen Vorrat an Songs aufgebraucht hatte, nicht mehr wusste, wo ich war. Von dicken Nebelschwaden umwabert, stand ich hoch oben an einem von Nadelbäumen überwucherten Berghang, der mir völlig unbekannt vorkam. Die Bäume standen kerzengerade in Habachtstellung, stachlig und abweisend wie Igel, die sich bedroht fühlten. Langsam nahm ich die Kopfhörer ab, hörte, wie mein Keuchen von den majestätischen Bergen widerhallte, und wusste, dass ich mich nicht mehr in der Kleinstadt Glin, ja wahrscheinlich nicht einmal mehr in Irland befand.
Ich war hier, an diesem seltsamen Ort. Das war vor anderthalb Tagen, und ich bin immer noch hier.
Ich arbeite als Ermittlerin, ich weiß, wie man bei einer Suche vorgeht. Gelegentlich packe ich meine Sachen und verziehe mich einfach mal für eine Woche, ohne einem Menschen Bescheid zu sagen. Genau genommen verschwinde ich regelmäßig, breche für eine Weile den Kontakt zu meiner Umgebung ab, und niemand kümmert sich darum, was mir gerade recht ist. Ich mag es, wenn ich kommen und gehen kann, wie es mir gefällt, und dann reise ich oft zu den Stellen, wo man eine vermisste Person zuletzt gesehen hat, um die Gegend auszukundschaften und ein bisschen herumzufragen. Nur war das Problem jetzt, dass ich frühmorgens in diese Stadt gekommen und direkt zum Joggen ins Mündungsgebiet des Shannon, das Shannon Estuary, gefahren war. Bisher hatte ich mit niemandem gesprochen, mir noch keine Unterkunft gesucht, war noch über keine belebte Straße gegangen und hatte noch keinerlei Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Mir ist klar, was die Leute sagen werden, ich weiß, dass ich für die Polizei nicht einmal ein richtiger Fall bin, sondern nur eine weitere Aussteigerin aus dem Alltag, die nicht gefunden werden will. So etwas passiert andauernd, und letzte Woche um diese Zeit hätte man mit dieser Annahme vielleicht sogar recht gehabt.
Ich weiß, dass ich in den Augen der anderen nicht als vermisst gelten werde. Irgendwann werde ich der Kategorie C zugeordnet, in der Leute landen, die zwar verschwinden, aber keine Gefahr für sich selbst oder für ihre Mitmenschen darstellen. Beispielsweise Menschen über achtzehn, die beschlossen haben, ein ganz neues Leben anzufangen. Ich bin vierunddreißig, und nach Meinung meiner Bekannten bin ich bestimmt schon lange, lange scharf darauf, auszusteigen.
Alles läuft darauf hinaus, dass momentan niemand da draußen auf die Idee kommen wird, mich zu suchen.
Wie lange wird das so bleiben? Was passiert, wenn jemand den ramponierten 1991er roten Ford Fiesta am Kanal findet, mit der gepackten Reisetasche im Kofferraum, einer Vermisstenakte auf dem Armaturenbrett, einem bis dahin kalten, aber unberührten Kaffee und einem Handy auf dem Beifahrersitz?
Was dann?
Fünf
Moment mal.
Der Kaffee. Gerade ist mir der Kaffee wieder eingefallen.
Auf der Fahrt von Dublin habe ich an einer Tankstelle gehalten, die noch zu war, und mir aus dem Automaten einen Kaffee geholt; dabei hat er mich gesehen, der Mann, der an seinem Wagen den Reifendruck überprüft hat.
Ich war mitten in der Pampa, morgens um Viertel nach fünf auf dem Land, wo die Vögel sangen und die Kühe so laut muhten, dass ich mich kaum denken hören konnte. Überall roch es nach Mist, zum Glück etwas gemildert vom süßen Duft der Geißblattranken, die in der leichten Morgenbrise schaukelten, als wären sie Lufterfrischer am Autorückspiegel.
Dieser Fremde und ich waren gleichzeitig von allem losgelöst und doch mittendrin. In diesem Augenblick hatten wir beide keinerlei Kontakt zum sogenannten normalen Leben, und das reichte, dass unsere Blicke sich begegneten und wir uns unwillkürlich miteinander verbunden fühlten.
Der Mann war groß, wenn auch nicht ganz so groß wie ich – aber das sind bekanntlich die wenigsten. Um die einsachtzig, mit einem runden Gesicht, roten Wangen, rotblonden Haaren und blauen Augen, die mir irgendwie bekannt vorkamen und schon um diese frühe Stunde müde wirkten. Er trug ziemlich abgewetzte Jeans, das blau-weiß karierte Hemd war von der Fahrt zerknittert, die Haare zerzaust, das Kinn unrasiert, und der Bauch hatte im Lauf der Jahre offenbar eine Tendenz nach vorn entwickelt. Ich schätzte ihn auf Mitte bis Ende dreißig, obwohl er älter aussah. Wahrscheinlich wegen der Falten auf der Stirn und um die Augen … das waren keine Lachfalten, er wirkte eher traurig. Und gestresst. An den Schläfen hatten sich ein paar graue Haare eingeschlichen, noch ganz ungewohnt auf dem jungen Kopf. Vermutlich war jede Strähne das Ergebnis einer harten Lektion, die das Leben ihn gelehrt hatte. Trotz des Bäuchleins wirkte er kräftig und muskulös, wie jemand, der körperlich arbeitet – ein Eindruck, der von den schweren Stiefeln an seinen Füßen noch untermauert wurde. Seine Hände waren groß, vom Wetter gegerbt und konnten ganz offensichtlich zupacken. Als er die Luftpumpe vom Ständer hob, konnte ich sehen, wie die Adern auf seinen Unterarmen hervortraten, denn er hatte die Ärmel seines Hemds unordentlich bis zum Ellbogen aufgekrempelt. Aber in diesem Hemd arbeitete er ganz sicher nicht, das war für ihn Sonntagskleidung.
Ich ging zum Auto zurück, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
»Entschuldigen Sie, Sie haben grade was verloren!«, rief er plötzlich.
Sofort blieb ich stehen und sah mich um. Tatsächlich – hinter mir auf dem Asphalt lag meine Uhr und glitzerte in der Morgensonne. Blödes Ding, murmelte ich, während ich nachsah, ob sie beschädigt war.
»Danke«, sagte ich und lächelte, während ich die zum Glück völlig intakte Uhr wieder ums Handgelenk legte.
»Kein Problem. Schöner Tag heute, was?«
Eine vertraute Stimme, die zu den vertrauten Augen passte. Bevor ich antwortete, inspizierte ich ihn noch eine Weile. Hatte ich ihn in einer Kneipe schon mal gesehen, war ich irgendwann mal betrunken mit ihm ins Bett gegangen, war er ein Ex-Liebhaber, ein Ex-Kollege, Klient, Nachbar oder Schulfreund? Gewissenhaft ging ich die Liste durch, wie ich es mir angewöhnt hatte, wenn ich jemandem begegnete. Falls ich noch nicht mit ihm im Bett gewesen war, zog ich es jetzt durchaus in Erwägung.
»Super«, antwortete ich schließlich anerkennend und erwiderte sein Lächeln.
Seine Augenbrauen hoben sich und senkten sich wieder, dann hatte er meinen Blick anscheinend verstanden, denn sein Gesicht fing vor Freude über das Kompliment an zu strahlen. Aber so gern ich geblieben wäre, so gern ich mit ihm geplaudert und vielleicht für irgendwann demnächst ein Date vereinbart hätte, war das leider nicht möglich, denn ich hatte eine Verabredung mit Jack Ruttle. Mit dem netten Mann, dem ich zu helfen versprochen hatte. Eigens zu diesem Treffen war ich ja von Dublin nach Limerick gekommen.
Oh, bitte, du attraktiver Mann von der Tankstelle, bitte erinnere dich an mich, frag dich, wo ich geblieben bin, suche mich – und finde mich.
Ja, ich weiß, das ist schon wieder ganz schön ironisch. Ausgerechnet ich wünsche mir, dass ein Mann mich sucht und findet? Meine Eltern wären wirklich stolz auf mich.
Sechs
Auf der N69, der Küstenstraße, die von North Kerry nach Foynes im County Limerick führt, hing Jack Ruttle hinter einem Lastwagen fest, der gemächlich vor ihm hertuckerte. Jack wohnte in Foynes, es war fünf Uhr morgens, und dies war die einzige Straße zum Shannon Foynes Port, dem einzigen Seehafen von Limerick. Immer wieder starrte er auf den Tacho und versuchte den Laster telepathisch schneller zu machen, während er das Lenkrad so fest umklammerte, dass seine Knöchel schon ganz weiß waren. Trotz aller gut gemeinten Ratschläge seines Zahnarztes in Tralee, bei dem er erst gestern gewesen war, knirschte er heftig mit den Zähnen. Durch das ständige Zusammenbeißen waren vor allem die Backenzähne und das Zahnfleisch ziemlich lädiert, und sein ganzer Mund schmerzte. Seine Wangen waren gerötet und angeschwollen, und er konnte vor Müdigkeit kaum aus den Augen sehen. Statt bei seinem Freund in Tralee, auf dessen Couch er übernachtete, gründlich auszuschlafen, war er in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und hatte beschlossen heimzufahren, solange es noch dunkel war. Zurzeit konnte er sowieso nicht gut schlafen.
»Stehen Sie unter Stress?«, hatte der Zahnarzt gefragt.
Jack hatte einen Fluch und den Impuls unterdrückt, seinen weit aufgerissenen Mund, mit dem er sowieso nicht antworten konnte, zuzuklappen und seine Zähne in die weißen Medizinerfinger zu schlagen, die beflissen an ihm herumwerkelten. Dass er Stress hatte, war die Untertreibung des Jahrhunderts.
Jacks Bruder Donal war nach einem Kneipenbummel mit seinen Freunden in der Nacht seines vierundzwanzigsten Geburtstags in Limerick City spurlos verschwunden. Die Jungs hatten sich in den frühen Morgenstunden noch Burger und Pommes zu Gemüte geführt, und Donal war einfach aus der Imbissbude spaziert. Da das Etablissement sehr voll war, fiel ein Gast mehr oder weniger nicht auf, und Donals fünf Freunde waren zu betrunken, um überhaupt irgendetwas zu bemerken. Außerdem waren sie stark damit beschäftigt, ein paar Mädchen anzubaggern.
Die Videokamera am Geldautomaten in der Henry Street hatte aufgenommen, wie Donal um 3 Uhr 08 in der besagten Freitagnacht dreißig Euro abhob, eine weitere Kamera, wie er um 3 Uhr 30 Harvey’s Quay hinunterstolperte. Danach verlor sich seine Spur im Nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst oder wäre einfach in den Himmel emporgeschwebt. Inzwischen machte sich Jack mit dem Gedanken vertraut, dass das vielleicht so war. Wenn man einen stichhaltigen Beweis dafür finden würde, dass sein Bruder tot war, könnte er sich irgendwann damit abfinden, das wusste er.
Es war die Unsicherheit, die ihn quälte. Die Sorge um Donal hielt ihn wach, die Angst trieb ihn nachts aus dem Bett, und oft rannte er dann zur Toilette, um sich zu übergeben. Dass die Polizei seinen Bruder nicht finden konnte, spornte ihn auf seiner Suche nur noch weiter an. Er hatte den Zahnarzttermin mit einem Besuch bei einem Freund von Donal verbunden, der in der bewussten Nacht bei ihm gewesen war. Wie die anderen der Gruppe gehörte auch er zu den Leuten, die Jack gleichzeitig gerne verprügelt und in die Arme geschlossen hätte. Er wollte ihn anschreien und gleichzeitig trösten, weil er einen Freund verloren hatte, er wollte ihn nie wiedersehen und gleichzeitig nicht von seiner Seite weichen, für den Fall, dass er sich doch noch an etwas erinnerte, was ihnen weiterhalf. An etwas, was alle bisher vergessen hatten und plötzlich alle offenen Fragen beantwortete.
Er verbrachte die Nächte damit, Landkarten zu studieren, Berichte zum hundertsten Mal durchzulesen, Zeitangaben und Aussagen doppelt und dreifach zu überprüfen. Gloria lag neben ihm, ihre Brust hob und senkte sich sanft, und ihr süßer Atem brachte manchmal die Papiere zum Flattern, während ihre schlafende Welt sich leise an seine heranschlich.
Gloria, die seit acht Jahren seine Freundin war, schlief ständig. Sie hatte dieses ganze grässliche Jahr verschlafen, und doch träumte sie noch und hoffte auf morgen.
Sie war eingeschlafen, nachdem sie stundenlang auf dem Polizeirevier gesessen hatten, jenes erste Mal, als sie sich ernsthaft Sorgen zu machen begannen, weil sie seit vier Tagen kein Lebenszeichen von Donal gehört hatten. Sie war eingeschlafen, nachdem die Polizisten den ganzen Tag den Fluss nach ihm abgesucht hatten. Sie schlief in der Nacht, nachdem sie Fotos von Donal in den Schaufenstern, am Schwarzen Brett im Supermarkt und an Laternenpfählen befestigt hatten. Sie schlief in der Nacht, nachdem man in einer Gasse angeblich Donals Leiche gefunden hatte, und sie schlief auch in der nächsten Nacht, als man herausfand, dass er es doch nicht gewesen war. Sie schlief, nachdem die Polizei verkündet hatte, man könne leider nach mehreren Monaten der Suche nichts mehr für Donal tun. Sie schlief in der Nacht nach der Beerdigung von Jacks Mutter, die an ihrem gebrochenen Herz gestorben war, sie schlief, nachdem der Sarg dieser Frau in die Erde gesenkt worden war, zu ihrem Ehemann, ohne den sie volle zwanzig Jahre ihres Lebens hatte verbringen müssen.
Obwohl Jack genau wusste, dass Gloria nicht deshalb so gut schlief, weil ihr das alles gleichgültig war, irritierte es ihn trotzdem. Ihm war klar, dass sie mit ihm fühlte, das erkannte er daran, wie sie seine Hand gehalten hatte, als sie zusammen auf dem Revier saßen und die ganzen Fragen über sich ergehen ließen, daran, wie sie neben ihm am Fluss stand, während der Wind ihnen den Regen ins Gesicht peitschte und sie voller Entsetzen beobachteten, wie die Taucher wieder an die Oberfläche des trüben grauen Wassers kamen und ihre Gesichter noch finsterer waren als beim Abtauchen. Sie half ihm ganz selbstverständlich beim Verteilen der Fotos von Donal, sie hielt ihn im Arm und ließ ihn weinen, als die Nachricht kam, dass die Polizei die Suche einstellte, und sie wartete in der ersten Reihe auf ihn, während er den Sarg seiner Mutter durch die Kirche zum Altar trug.
Das alles ließ sie nicht kalt, aber trotzdem schlief sie, obwohl Donal nun schon ein ganzes Jahr verschwunden war, schlief in den Stunden, die Jack die längsten seines Lebens zu sein schienen. In den Nächten litt er am meisten. Aber wie hätte Gloria das mitkriegen sollen, wenn sie doch schlief? Jede Nacht spürte er, wie die Distanz zwischen ihrer schlafenden Welt und seiner eigenen immer größer wurde.
Er erzählte ihr nicht, dass er in den gelben Seiten die Adresse einer Agentur für Personensuche gefunden hatte. Auch nicht, dass er dort angerufen und mit einer Frau namens Sandy Shortt geredet hatte. Die Telefongespräche, die sie die ganze letzte Woche oft mitten in der Nacht geführt hatten, ließ er ebenso unerwähnt wie die Tatsache, dass die Entschlossenheit und der unerschütterliche Glaube dieser Frau seinen Kopf und sein Herz mit neuer Hoffnung erfüllt hatten.
Und er sagte ihr auch nichts davon, dass er für den heutigen Tag im Nachbarort Glin mit der Frau verabredet war, weil … nun ja, weil sie eben schlief.
Endlich, kurz bevor er zu Hause war, schaffte Jack es, den Laster zu überholen, und auf einmal war er mit seinem alten rostigen Nissan allein auf der Landstraße. Auch im Auto war es ganz still. Im Lauf des letzten Jahres hatte er gemerkt, dass er gegen unerwünschte Geräusche sehr empfindlich war. Wenn im Hintergrund ein Fernseher oder ein Radio lief, lenkte ihn das nur von seiner Suche nach Antworten ab. In seinem Kopf ging es schon aufgeregt genug zu: Rufen, Schreien, endlose Wiederholungen früherer Gespräche, Phantasien von zukünftigen Unterhaltungen, alles sprang dort herum wie die Affen im Käfig.
Draußen dröhnte der Motor, die Karosserie rappelte, die Räder hüpften über Schlaglöcher und Unebenheiten. Seine Gedanken lärmten im stillen Auto, sein Auto lärmte in der stillen Umgebung. Es war Viertel nach fünf an einem sonnigen Julimorgen, und er musste haltmachen, weil nicht nur seine Vorderreifen, sondern auch seine Lungen frische Luft brauchten.
Also fuhr er an die menschenleere Tankstelle, die dank der frühen Morgenstunde noch geschlossen war, und parkte neben der Luftpumpe. Während er die Glieder streckte, die nach der langen Fahrt ganz steif waren, lauschte er dem Vogelgezwitscher, ließ es die Gedanken aus seinem Kopf vertreiben und krempelte die Ärmel auf. Für den Augenblick kamen die Affen etwas zur Ruhe.
Neben ihm hielt ein Auto. Die Gegend war so dünn besiedelt, dass er schon aus einer Meile Entfernung ein fremdes Auto erkennen konnte … und die Dubliner Nummer bestätigte seine Vermutung. Als Erstes erschienen aus der winzigen, ramponierten Blechbüchse zwei lange Beine, gefolgt von einem langen Körper in einem grauen Jogginganzug. Jack bemühte sich, nicht zu starren, beobachtete aber aus dem Augenwinkel, wie die Frau mit weit ausholenden Schritten zum Kaffeeautomaten neben der Tür der verrammelten Werkstatt marschierte. Erstaunlich, dass jemand ihrer Größe überhaupt in das kleine Auto passte, vorausgesetzt, sie war kein Schlangenmensch. Ihm fiel sofort auf, wie hübsch sie war mit ihren schwarzen Locken, und es kam ihm vor, als würde sie ihre Schönheit in dem kleinen Auto verstecken wie ein Juwel in einer rostigen alten Keksdose. Sosehr er sich auch vornahm, nicht zu glotzen, war es, als hätten seine und ihre Augen einander erfasst wie eine Rakete das Ziel, und nun gab es kein Zurück mehr. Dann hörte er, wie Metall auf den Boden klimperte, und sah, dass ihr etwas aus der Hand fiel.
»Entschuldigen Sie, Sie haben da was verloren«, rief er.
Verwirrt schaute sie sich um und ging zu der Stelle zurück, wo das Metall auf dem Boden glitzerte.
»Danke«, lächelte sie, während sie etwas, was aussah wie ein Armband oder eine Uhr, wieder um ihr Handgelenk schlang.
»Kein Problem. Schöner Tag heute, was?« Jack fühlte, wie der Schmerz in seinen geschwollenen Wangen zunahm, als er ihr Lächeln erwiderte.
Er fühlte sich ihrem Blick auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, während sie ihn freundlich, aber durchdringend von oben bis unten musterte, als wollte sie jeden Zentimeter seines Körpers analysieren. Ihre grünen Augen funkelten wie Smaragde, als die Sonne durch die Blätter der hohen Bäume fiel, die porzellanweiße Haut schimmerte, die pechschwarzen Locken bildeten einen perfekten Rahmen für ein Gesicht, aus dem die Energie nur so sprühte.
Schließlich zog sie die Augenbrauen hoch. »Super«, antwortete sie und erwiderte sein Lächeln. Dann verschwanden sie, ihre schwarzen Locken, der Styroporbecher mit dem Kaffee, samt den Beinen und allem anderen in dem winzigen Auto wie in einer Venusfliegenfalle.
Während er dem davonfahrenden Ford Fiesta nachsah, wünschte er sich, sie wäre geblieben. Und wieder spürte er, wie sich die Dinge zwischen ihm und Gloria verändert hatten – oder vielleicht waren es auch nur seine Gefühle für sie. Langsam ging er zu seinem Auto zurück und blätterte als Vorbereitung für das Treffen mit Sandy Shortt noch ein bisschen in seinen Unterlagen.
Jack war nicht religiös, seit zwanzig Jahren hatte er keine Kirche mehr von innen gesehen. In den letzten zwölf Monaten hatte er dreimal gebetet. Einmal darum, dass man Donal nicht tot aus dem Fluss fischte, das zweite Mal, dass es nicht Donals Leiche war, die man in der Gasse gefunden hatte, und das dritte Mal, dass seine Mutter ihren zweiten Schlaganfall innerhalb von sechs Jahren überleben würde. Zwei dieser drei Gebete waren erhört worden.
Heute betete er zum vierten Mal. Er betete, dass Sandy Shortt ihn dort wegholen würde, wo er gestrandet war, und ihm die Antworten geben, die er so dringend brauchte.
Sieben
Um Gloria nicht aufzuwecken, die ihr sonntägliches Ausschlafen offensichtlich sehr genoss, schlich Jack auf Zehenspitzen durch die Wohnung. Behutsam durchwühlte er den Korb mit der Schmutzwäsche, zupfte das am wenigsten zerknitterte Karohemd heraus und tauschte es gegen das aus, das er trug. Er hatte nicht geduscht, weil er Gloria nicht mit dem Rauschen des Boilers und dem Schwirren des Deckenventilators stören wollte. Nicht einmal die Klospülung hatte er betätigt. Zwar war er sich bewusst, dass es nicht nur seine überbordende Großherzigkeit war, die ihn dazu bewog, aber er konnte sich auch nicht wirklich eingestehen, dass er aus genau den entgegengesetzten Beweggründen handelte. Er hielt sein Treffen mit Sandy Shortt nämlich in voller Absicht vor Gloria und dem Rest der Familie geheim.
Allerdings ging es ihm dabei nicht nur um sich selbst. Die anderen begannen sich allmählich von der Trauer um die beiden Familienmitglieder zu lösen, die sie in diesem schrecklichen Jahr verloren hatten, und bemühten sich, ins normale Leben zurückzukehren. Natürlich verstand Jack dieses Bestreben, denn sie waren inzwischen alle an einem Punkt angekommen, wo es bei der Arbeit nicht mehr als selbstverständlich galt, wenn sie sich einfach mal einen Tag freinahmen, und wo das mitfühlende Lächeln immer mehr einer gewöhnlichen Begrüßung Platz machte. Ihre Arbeitgeber hatten lange genug mit flexiblen Arbeitszeiten jongliert, die Gespräche der Nachbarn drehten sich wieder um die üblichen Themen, die Leute stellten keine Fragen und gaben keine gut gemeinten Ratschläge mehr, die tröstlichen Postkartengrüße blieben aus, und alle kümmerten sich wieder um ihr eigenes Leben. Aber für Jack fühlte es sich einfach nicht richtig an, dass das Leben ohne Donal in den alten Trott überging.
In Wahrheit war es nicht so sehr Donals Abwesenheit, die Jack daran hinderte, zusammen mit seiner Familie in den Alltag zurückzukehren. Natürlich vermisste er ihn, aber die Trauer würde er irgendwann überwinden, genau wie den Tod seiner Mutter. Es war das Geheimnis, das Donals Verschwinden umgab, die Unsicherheit, die Fragezeichen, die vor seinen Augen tanzten wie die Lichtpunkte, die zurückbleiben, wenn man fotografiert wird und dabei ins Blitzlicht schaut.
Sacht schloss er die Tür des chaotischen kleinen Bungalows hinter sich, in dem er nun schon seit fünf Jahren mit Gloria lebte. Foynes war ein kleiner Ort mit um die fünfhundert Einwohnern, ungefähr eine halbe Autostunde von Limerick City entfernt. Genau wie sein Vater arbeitete Jack im Shannon Foynes Port, wo er genau wie dieser Fracht verlud.
Für das Treffen mit Sandy Shortt hatte er sich Glin ausgesucht, eine Ortschaft dreizehn Kilometer westlich von Foynes. Glin besitzt einige architektonisch recht interessante Gebäude, unter anderem Glin Castle, in dem bis heute der Knight of Glin residiert. Im Zentrum des Städtchens liegt ein großer Platz, der sich zum Shannon Estuary hin absenkt. Aber für Jack war am wichtigsten, dass kein Mitglied seiner Familie in diesem Dorf wohnte.
Um neun Uhr, eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin, saß er bereits in dem kleinen Café, in dem sie sich verabredet hatten. Am Telefon hatte Sandy erzählt, dass sie zu Verabredungen immer zu früh erschien, und Jack war sowieso schon zappelig und brannte darauf, dieser neuen Suchidee endlich aktiv nachzugehen. Je mehr Zeit sie also miteinander hatten, desto besser. Er bestellte einen Kaffee und starrte auf das letzte Bild von Donal, das vor ihm auf dem Tisch lag. Es war in jeder irischen Tageszeitung veröffentlicht worden und hatte das letzte Jahr sicher an jedem Schwarzen Brett und in jedem Schaufenster des Landes gehangen. Im Hintergrund sah man den weißen Plastikweihnachtsbaum, den seine Mutter jedes Jahr im Wohnzimmer aufstellte; der Schein des Blitzlichts wurde von den Kugeln reflektiert und brachte das Lametta zum Glitzern. Schelmisch grinste Donal zu ihm empor, als wollte er seinen Bruder ärgern, weil er ihn nicht finden konnte. Donal hatte schon als Kind mit Leidenschaft Verstecken gespielt, und um zu gewinnen, manchmal stundenlang in irgendeinem finsteren Loch ausgeharrt. Irgendwann wurden die anderen ungeduldig und erklärten ihn zum Sieger, nur damit er sich endlich zeigte. Die jetzige Suche jedoch war die längste, die Jack je mitgemacht hatte, und er wünschte sich sehr, dass sein Bruder endlich mit dem alten stolzen Lächeln auftauchen und das Spiel beenden würde.
Donals blaue Augen, die einzige Ähnlichkeit zwischen den Brüdern, strahlten ihn so lebendig an, dass Jack fast erwartete, er würde ihm gleich verschmitzt zuzwinkern. Aber ganz gleich, wie lang und intensiv er das Foto anstarrte, er konnte ihm kein Leben einhauchen, er konnte nicht hineingreifen und seinen Bruder herausholen, er konnte das Aftershave nicht riechen, mit dem Donal sich immer einnebelte, er konnte ihm nicht die braunen Haare zerzausen und die Frisur ruinieren, was ihn immer so ärgerte, und er konnte seine Stimme nicht hören, wie sie liebevoll mit ihrer Mutter sprach. Nach einem Jahr erinnerte er sich noch gut an seine Berührung und seinen Geruch, aber diese Erinnerung genügte ihm nicht – im Gegensatz zum Rest der Familie.
Das Foto stammte vom vorletzten Weihnachtsfest, sechs Monate, bevor er verschwunden war. Gewöhnlich besuchte Jack seine Mutter einmal pro Woche zu Hause, wo Donal als Einziger der sechs Geschwister immer noch wohnte. Dann plauderten sie zwar ein, zwei Minuten miteinander, aber an diesem Weihnachten hatte Jack sich das letzte Mal ausführlicher mit Donal unterhalten. Donal hatte ihm die üblichen Socken geschenkt, Jack hatte ihm die Taschentücher überreicht, die er selbst im Jahr davor von seiner ältesten Schwester bekommen hatte, und beide hatten gemeinsam über ihre einfallslosen Geschenke gelacht.
Donal war sehr munter gewesen, denn er hatte seit September einen neuen Job als Computertechniker. Es war seine erste richtige Arbeitsstelle, nachdem er seinen Abschluss an der Limerick University gemacht hatte, und bei der Feier wäre ihre Mutter vor lauter Stolz auf ihren Jüngsten fast geplatzt. Donal hatte selbstbewusst berichtet, wie viel Spaß ihm die Arbeit machte, und auch Jack vermerkte sehr positiv, dass er viel reifer geworden war, sich immer mehr an seine neue Rolle gewöhnte und das Studentenleben allmählich hinter sich ließ.
Jack und Donal hatten sich nie sehr nahegestanden. Die Familie hatte sechs Kinder, und Donal war ein völlig unerwarteter Nachzügler – keiner war überraschter gewesen als ihre Mutter Frances, als sie mit siebenundvierzig von ihrer erneuten Schwangerschaft erfuhr. Jack, der zwölf Jahre älter war als Donal, verließ das Haus, als der Kleine sechs war, so war ihm sein kleiner Bruder nie wirklich vertraut geworden. Die letzten neunzehn Jahre waren sie Brüder, aber nie Freunde gewesen.
Nicht zum ersten Mal fragte Jack sich, ob seine Chancen, Donal zu finden, größer wären, wenn er ihn besser gekannt hätte. Wenn er sich mehr um seinen kleinen Bruder bemüht, ihn öfter besucht oder sich ausgiebiger mit ihm unterhalten hätte, wäre er vielleicht in der Nacht nach seinem Geburtstag zusammen mit ihm durch die Kneipen gezogen. Vielleicht hätte er ihn daran hindern können, den Imbissschuppen zu verlassen, oder er hätte ihn begleiten und sich mit ihm zusammen ein Taxi nehmen können.
Vielleicht wäre Jack dann aber auch zusammen mit Donal verschwunden und dort gelandet, wo er jetzt war. Wo immer das sein mochte.
Acht
Jack schüttete die dritte Tasse Kaffee hinunter.
Viertel nach zehn.
Sandy Shortt war spät dran. Nervös zappelte er mit den Beinen unter dem Tisch herum, seine linke Hand trommelte aufs Holz der Tischplatte, und mit der rechten signalisierte er der Kellnerin, dass er noch einen Kaffee brauchte. Trotzdem bemühte er sich, positiv zu denken. Sie würde kommen. Er wusste es.
Um elf versuchte er es zum fünften Mal auf ihrem Handy. Es klingelte und klingelte, dann kam die Ansage: »Hallo, hier ist Sandy Shortt. Tut mir leid, aber ich bin im Moment nicht erreichbar. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen, rufe ich so bald wie möglich zurück.« Biep.
Jack legte auf.
Halb zwölf. Jetzt war sie schon zwei Stunden überfällig. Jack hörte sich noch einmal die Nachricht an, die Sandy am Vorabend auf seine Mailbox gesprochen hatte.
»Hi, Jack, hier ist Sandy Shortt. Ich wollte nur schnell unseren Termin morgen um 9 Uhr 30 in Kitty’s Café in Glin bestätigen. Ich fahre heute Nacht«, erklärte sie und fügte mit weicherer Stimme hinzu: »Wie Sie wissen, schlafe ich ja für gewöhnlich sowieso nicht.« Ein leises Lachen. »Deshalb werde ich sicher schon früh da sein, und ich freue ich mich sehr, Sie endlich persönlich kennenzulernen, nachdem wir so oft miteinander telefoniert haben. Und Jack« – sie machte eine Pause –, »ich verspreche Ihnen, dass ich mein Bestes tun werde, um Ihnen zu helfen. Wir lassen Donal nicht im Stich.«
Um zwölf hörte Jack die Nachricht noch einmal ab.
Um eins hörten seine Finger nach zahllosen Tassen Kaffee zu trommeln auf und ballten sich stattdessen zur Faust, auf die er sein Kinn stützte. Im Verlauf der letzten Stunden hatte er wiederholt den Blick des Cafébesitzers im Rücken gespürt, während er nervös auf seinem Stuhl herumrutschte und die Uhr beobachtete, statt endlich seinen Tisch für eine Gruppe frei zu machen, die bestimmt mehr Geld ausgegeben hätte als er. Um ihn herum füllten und leerten sich die Tische, und jedes Mal, wenn das Türglöckchen klingelte und einen neuen Gast ankündigte, fuhr sein Kopf in die Höhe. Er wusste nicht, wie Sandy Shortt aussah; sie hatte nur in halb scherzhaftem Ton gesagt, sie sei nicht zu übersehen. So füllte sich sein Herz bei jedem Bimmeln mit neuer Hoffnung und wurde schwer, wenn der Blick des Neuankömmlings ihn achtlos streifte und sich jemand anderem zuwandte.
Um halb zwei klingelt das Glöckchen wieder einmal.
Nach vier Stunden Warten schloss sich die Tür hinter Jack.
Neun
Fast zwei Tage blieb ich im Wald, joggte hin und her und versuchte, meinen Weg zurückzuverfolgen und meine Anwesenheit hier irgendwie rückgängig zu machen. Ich rannte den Berg hinauf und hinunter, probierte verschiedene Geschwindigkeiten aus, während ich mich zu erinnern versuchte, wie schnell ich gelaufen war, welchen Song ich gerade gehört, woran ich gerade gedacht hatte und wo genau ich gewesen war, als mir der Ortswechsel zum ersten Mal aufgefallen war. Als hätte das irgendeine Rolle gespielt. Hinauf und hinunter, hinunter und hinauf. Wo war der Eingang – und noch viel wichtiger, wo war der Ausgang? Ich wollte mich beschäftigen, ich wollte mich hier nicht niederlassen wie die überall verstreuten persönlichen Gegenstände. Ich wollte nicht enden wie die kaputten Ohrringe, die im langen Gras glitzerten.
Es ist ziemlich seltsam, zu dem Schluss zu kommen, dass man verschwunden ist, und ich landete beileibe nicht überstürzt bei dieser Erkenntnis, das könnt ihr mir glauben. Anfangs war ich total verwirrt und frustriert, aber mir war ziemlich schnell klar, dass ich nicht einfach nur falsch abgebogen war, sondern dass mir etwas Außergewöhnliches zugestoßen war. Schließlich konnte nicht innerhalb von ein paar Sekunden ein Berg oder ein Wald aus dem Boden schießen, und das auch noch mit Bäumen, die in Irland gar nicht heimisch sind. Das Shannon Estuary konnte nicht von jetzt auf nachher ausgetrocknet und verschwunden sein. Kein Zweifel, ich war irgendwo anders.
Natürlich überlegte ich, ob ich vielleicht träumte oder ob ich gestürzt war, mir den Kopf angeschlagen hatte und jetzt im Koma lag. Mir ging auch der Gedanke durch den Kopf, die seltsame Beschaffenheit meiner Umgebung könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Ende der Welt nahte, und ich stellte kurz auch meine geographischen Kenntnisse über West Limerick in Frage. Nummer eins auf der Liste der möglichen Lösungen war jedoch, dass ich schlicht und einfach den Verstand verloren hatte.
Aber als ich eine Weile allein dagesessen hatte, fing ich wieder an, rational zu denken, und erkannte, dass ich nicht nur von der schönsten Landschaft umgeben war, die ich je gesehen hatte, sondern auch ganz eindeutig noch am Leben war, dass die Welt außerdem nicht untergegangen, keine Massenpanik ausgebrochen und ich nicht auf einem Müllplatz gelandet war. Doch ich begriff, dass meine Suche nach einem Fluchtweg mir die Sicht darauf versperrte, wo ich mich eigentlich befand. Ich beschloss, mich nicht länger der Illusion hinzugeben, dass ich einen Weg hinaus finden würde, indem ich den Berg hinauf und hinunter rannte. Keine Ablenkungen mehr, die nur die optimale Funktionsfähigkeit meines Verstands blockierten. Ich bin ein logischer Mensch, und die logischste Erklärung unter all den unglaublichen Möglichkeiten war die, dass ich am Leben und gesund, aber schlicht verloren gegangen war.
Die Dinge sind, wie sie sind.
Als es an meinem zweiten Tag dunkel zu werden begann, beschloss ich, die außergewöhnliche Umgebung zu erkunden und tiefer in den kiefernnadligen Wald vorzudringen. Zweige knackten unter meinen Turnschuhen, der Boden war weich und federnd, bedeckt von vermoderten Blättern, Baumrinde, Kiefernzapfen und samtigem Moos. Über meinem Kopf waberte Wattenebel um die Baumwipfel. Die hohen dünnen Stämme reckten sich zum Himmel wie Buntstifte – tagsüber malten sie den Himmel hellblau mit Federwölkchen und einer Spur Orange, und jetzt bei Nacht färbten ihre von der heißen Sonne verbrannten Spitzen das Firmament fast schwarz. Millionen Sterne zwinkerten mir zu, und alle kannten sie das Geheimnis dieser Welt. Nur ich nicht.