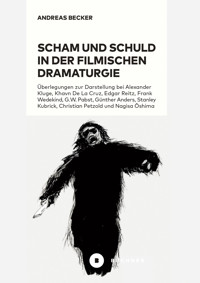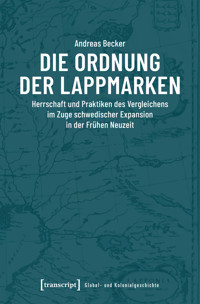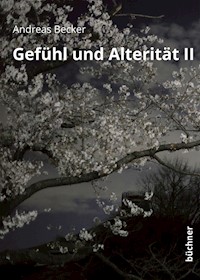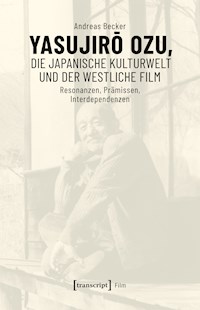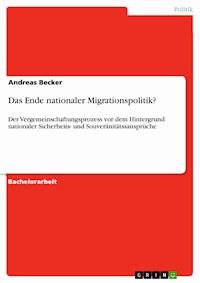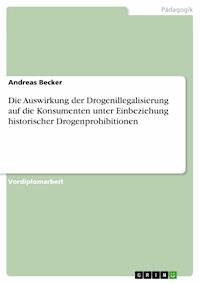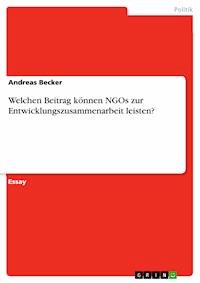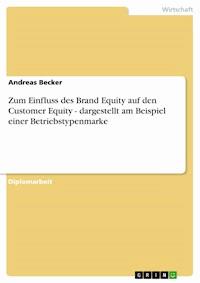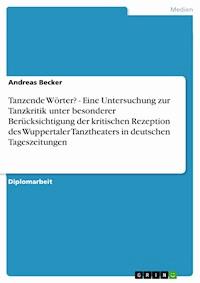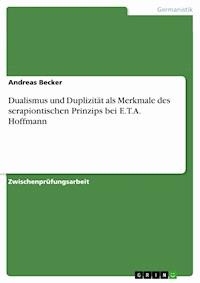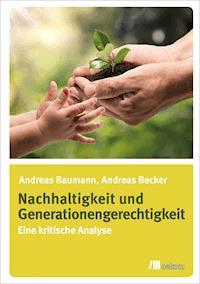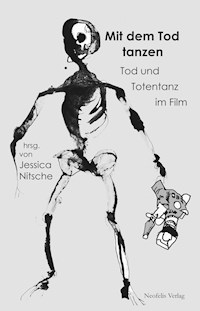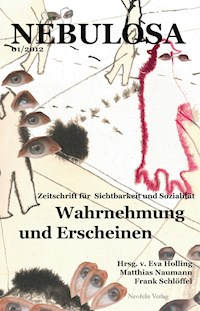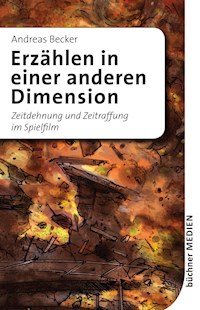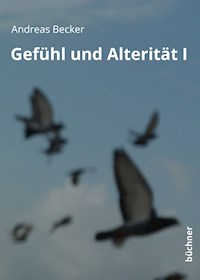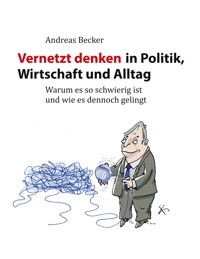
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ist die Gesellschaft mit unzähligen kleinen wie großen Problemen konfrontiert? Die Grundursache liegt in einem falschen Umgang mit komplexen Themen. Fatal sind die Folgen, wie sich den Medien täglich entnehmen lässt: schlechte «Lösungen», hohe Kosten und neue Schwierigkeiten. Auch in Wirtschaft und Alltag findet sich diese Problematik. Will man kleine und große Herausforderungen meistern, führt an vernetztem Denken kein Weg vorbei. Unterhaltsam vermittelt dieses Buch ein Verständnis für Komplexität sowie vernetztes Denken und Handeln. Es zeigt die wichtigsten Fehler im Umgang mit komplexen Situationen und Problemen an Beispielen auf und erläutert ausführlich, wie vernetztes Denken gelingt. Eine Vielzahl an Abbildungen, Anleitungen, Checklisten und Werkzeugen unterstreicht den praktischen Nutzen dieses Buches. 2., korrigierte Auflage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Der Irrsinn linearen Denkens und Handelns
1 Warum vernetzt denken und handeln?
2 Falsche Ursachen — falsche Schlussfolgerungen — falsches Handeln
3 Über den Unsinn und Sinn von Prognosen
4 Dauerhaftes Wachstum — sinnvoll oder gefährlich?
5 Vernetztes Denken
Teil 2: Komplexität verstehen
6 Warum es so schwer ist, ein Geschehen zu beeinflussen
7 Was passiert, wenn man in ein Geschehen eingreift?
8 Die Macht der Selbstorganisation
9 Im Spannungsverhältnis von Steuerung und Selbstorganisation: das Wirken der Politik
10 Wie sich Systeme durch Selbstregulation stabil halten
Teil 3: Werkzeuge für vernetztes Denken
11 Die wichtigen Themen erkennen und vorausschauend handeln
12 Ziele wirkungsvoll setzen
13 Erfolgsfaktoren im Umgang mit komplexen Situationen und Problemen
14 Wie man sich auf die immer ungewisse Zukunft vorbereiten kann
15 Simulation: wie sich Zukunft und Handeln ausprobieren lassen
16 Visualisierung: komplexe Zusammenhänge veranschaulichen und verstehen
17 Wie sich Aufbau und Verhalten komplexer Systeme verstehen lassen
18 Fragen, die für Durchblick sorgen
19 Mit Kreativität und Intuition zu vernetztem Denken und Handeln
Schluss
20 So geht es weiter
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Neu ist die Problematik nicht: Schon seit Jahrzehnten handelt die Gesellschaft kurzsichtig, reagiert auf Schwierigkeiten oft erst, wenn der Leidensdruck hoch ist, kuriert an Symptomen herum und schafft durch ihr Handeln neue Probleme, ohne die alten in den Griff zu bekommen. Sie bereitet sich über Prognosen, die nicht eintreten, auf die falsche Zukunft vor und blendet Zusammenhänge gerne aus — es ist so viel einfacher, isoliert zu handeln anstatt die Vernetzung von Aspekten und Themen zu berücksichtigen. Doch die Folgen sind verhängnisvoll, wie sich täglich den Medien entnehmen lässt: schlechte Lösungen, hoher Aufwand bei geringem Nutzen und neue Probleme.
Für jeden Misserfolg lässt sich im Einzelnen immer eine spezifische Ursache finden. Übersehen bleibt dabei jedoch: Den Schwierigkeiten liegt ein grundsätzliches Problem zugrunde — ein falscher Denkansatz. Er ist nicht auf gesellschaftliche Themen und die Politik beschränkt. Auch in der Wirtschaft und im Alltag findet sich das sogenannte lineare Denken (und in der Folge lineares Handeln).
Dieses Buch verdeutlicht zum einen an einer Vielzahl an Beispielen verständlich, worin die Fehler genau liegen und welche Folgen sie nach sich ziehen. Dabei schafft es ein Verständnis für Komplexität und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten. Zum anderen zeigt es die Erfolgsfaktoren im Umgang mit komplexen Situationen und Problemen auf. Sein praktischer Nutzen für Beruf und Alltag ergibt sich unter anderem aus zahlreichen Anleitungen, Checklisten und Werkzeugen zu vernetztem Denken.
Insgesamt ermöglicht das Buch einen neuen Blick auf die Welt — einen Blick, der das eigene Handeln verändert. Und bietet dem Leser obendrein einen Maßstab, mit dem sich Pläne und Aktivitäten von Politikern, Parteien und Interessensverbänden bewerten lassen.
Ursprünglich erarbeitet wurden die Inhalte im Rahmen des Projekts Wandel vernetzt denken, das Lehrern, Schulen und anderen Interessierten Unterrichtsmaterial kostenlos zum Download zur Verfügung stellt. Die Buchinhalte bilden die Basis für das didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterial.
Ohne Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, dieses Buch zu erstellen. Würdigen und danken möchte ich an dieser Stelle zuallererst Stefanie Schwenk. Drei Jahre lang hat sie sich zusammen mit dem Autor mit einer bewundernswerten inhaltlichen Konsequenz in die Tiefen der Komplexität begeben und mitgeholfen, ein rundes, in sich stimmiges Konzept zu vernetztem Denken mit verständlichen Inhalten zu schaffen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit finden sich auch in diesem Buch. Des Weiteren haben Nadine Götz, Jürgen Hardt und Philip Obergfell über ihre Mitarbeit am Schulprojekt zu diesem Buch beigetragen; auch ihnen gilt mein Dank. Sabine Sommer erstellte all die informativen und anschaulichen Grafiken dieses Buches; keine Anforderung und kein Wunsch waren ihr zu kompliziert. Gleiches lässt sich für den Cartoonisten Matthias Kiefel sagen: Auch schwierigste Themen setzte er überzeugend humorvoll um. Auch ihnen einen herzlichen Dank.
Ihnen, werte Leserin oder werter Leser, wünsche ich eine anregende Lektüre!
Freiburg, im Frühjahr 2017
Andreas Becker
Teil 1
Der Irrsinn linearen Denkens und Handelns
1
Warum vernetzt denken und handeln?
Regenwürmer sollten es richten. Um den zu festen Untergrund im Stadion der Stadt Bergen auf Rügen zu lockern, engagierte die Stadtverwaltung 200.000 Würmer für das Spielfeld.1 Eifrig arbeiteten die Tiere, ohne dass sich die Situation deutlich verbesserte. Ihr Einsatz zeigte dennoch Wirkung: Die Ausscheidungen der Würmer bildeten auf dem Spielfeld Häufchen, die die Bespielbarkeit des Platzes beeinträchtigten. Das Spielfeld wurde uneben und bei Regen glitschig. »Die Regenwürmer haben versagt«, stellte der Leiter des Bauamts fest.2 So beschloss die Stadt, die Würmer wieder einzusammeln.3 Offensichtlich hatten sowohl die beauftragten Experten als auch die Verantwortlichen nicht weit genug gedacht. Schließlich ist es kein Geheimnis: Regenwürmer fressen sich nicht nur durch die Erde, sondern setzen an der Oberfläche auch Hinterlassenschaften ab.
Ein Einzelfall ist die gescheiterte Wurmkur nicht. Ob in Politik, Verwaltung, Wirtschaft oder Alltag — immer wieder werden Maßnahmen ergriffen, die zu kurz gedacht sind. In diesen Fällen denken und handeln die Verantwortlichen nicht vernetzt. Es handelt sich um ein grundsätzliches Problem mit weitreichenden Folgen, wie die weiteren Beispiele zeigen.
Später zahlen, früher kassieren
»Verlegung des Termins für die Zahlung der Renten an den Rentenzugang auf das Monatsende« — so lautet der schwer verständliche zentrale Satz in einem Gesetzesentwurf der SPD- und Grünen-Bundestagsfraktionen im Herbst 2003.4 Die Folge: Rentner, die neu in Rente gehen, erhalten seit dem 1. April 2004 ihre Rentenzahlung erst zum Monatsende anstatt zum Monatsanfang. Mehrere hundert Millionen Euro sollen auf diese Weise jährlich »gespart« werden — auf Kosten der Rentner.
Am grundsätzlichen Finanzierungsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung hat sich durch diese Maßnahme nichts geändert. Es werden Symptome angegangen — zu wenig Geld vorhanden — statt der Problemursachen. Dafür erleiden die Krankenund Pflegeversicherungen Verluste, da die betroffenen Rentner ihre Beiträge dort eben auch erst zum Monatsende statt zum Monatsanfang zahlen.
Zwei Jahre später beschließt der Deutsche Bundestag eine weitere Maßnahme, die nur an Symptomen ansetzt5: Seit Januar 2006 müssen Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter die Beiträge zur Rentenversicherung fast drei Wochen früher als bisher abführen — noch im laufenden Monat, also bevor die Höhe von Lohn, Gehalt und Rentenversicherungsbeitrag endgültig feststeht. Im Monat darauf sind die Beitragszahlungen anhand der realen Werte zu korrigieren, was Aufwand und Kosten erzeugt.
Ganz bewusst haben Regierung und eine Mehrheit im Parlament an den Symptomen der Finanzprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung angesetzt. Ganz bewusst wurde dadurch auch der Druck verringert, die Problemursachen anzugehen. Mittel- und langfristig wird das negative Folgen haben: Probleme wachsen weiter an, wenn nur die Symptome kuriert werden. Staatsfinanzen, gesetzliche Rentenversicherung und Euro bieten dafür reichlich Anschauung, die den Rahmen dieses Buches sprengen würde.
Terroristen benebeln
Kernkraftwerke in Deutschland sind nicht grundsätzlich gegen den Absturz großer Verkehrsflugzeuge ausgelegt.6 Die mehrheitlich staatliche Gesellschaft für Anlagenund Reaktorsicherheit soll 2002 in einer unveröffentlichten Studie sogar festgestellt haben:7 »Keiner der deutschen Atommeiler ist so gegen einen Flugzeugabsturz gesichert, dass eine Atomkatastrophe als Folge ausgeschlossen werden kann.« Nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001, als Terroristen mit zwei Verkehrsflugzeugen die beiden Türme des World Trade Center in New York zum Einsturz gebracht hatten, gerieten diese Fakten in die öffentliche Diskussion.
Im Jahr 2005 einigten sich das Bundesumweltministerium und die Betreiber der Kernkraftwerke auf ein Konzept, das den Schutz der Kraftwerke bei einem gezielt herbeigeführten Absturz eines großen Verkehrsflugzeuges sicherstellen soll.8 Im Mittelpunkt stehen dabei Nebelgranaten, die sich zünden lassen, wenn sich ein entführtes Verkehrsflugzeug einem Kernkraftwerk nähert. Auf diese Weise soll es Terroristen erschwert werden, ein Flugzeug auf das Reaktorgebäude stürzen zu lassen.
Viele praktische Argumente sprechen gegen die Wirksamkeit dieser Maßnahme. Funktioniert die Vernebelung überhaupt? Sie wurde offensichtlich an keinem Kernkraftwerk getestet. Würde die Zeit reichen, das Gelände zu vernebeln, nachdem erkannt wurde, dass ein Verkehrsflugzeug auf ein Kernkraftwerk zusteuert? Könnten Terroristen nicht so lange warten und Schleifen fliegen, bis der Nebel sich verzogen hat?
Eine ganz entscheidende Frage lautet: Was hilft die Vernebelung, wenn Terroristen die an Bord befindlichen Navigationssysteme nutzen? Im ursprünglichen Sicher heitskonzept war zwar vorgesehen, an Kernkraftwerken Störsender für die Satellitennavigation einzusetzen. Aufgestellt wurden solche Störsender aber offensichtlich nicht.9Selbst wenn es diese Sender gäbe, könnten Entführer die weiteren Navigationssysteme an Bord zum Zielanflug nutzen.
Ausgereift und zu Ende gedacht scheint dieses Schutzkonzept nun wirklich nicht zu sein. Wie schon bei den geänderten Zahlungsfristen bei der gesetzlichen Rentenversicherung ging es ausschließlich darum, Symptome zu bekämpfen, mit hilflos wirkenden Ansätzen. Die eigentlichen Probleme blieben ignoriert:
♦ Eine Technologie mit äußerst folgenreichen Gefahren wird in dicht besiedelten Gegenden betrieben;
♦ durch die Vielzahl an Kernkraftwerken in Europa ergibt sich eine nicht zu vernachlässigende Gesamtwahrscheinlichkeit für einen großen Unfall;
♦ gegen Angriffe in einem Krieg oder durch Terroristen lassen sich Kernkraftwerke nicht ausreichend schützen.
Schnell aussteigen statt verlängerter Laufzeiten
In der Risikobeurteilung von Kernkraftwerken brachte ein Ereignis in Japan von einem auf den anderen Tag die Wende. Am 11. März 2011 kam es im Kernkraftwerk im japanischen Fukushima zu einem GAU, d. h. zum Größten Anzunehmenden Unfall mit extremen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Hatten noch im Oktober 2010 die schwarz-gelbe Bundesregierung und eine Mehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen, Kernkraftwerke länger betreiben zu lassen als bis dahin geplant — trotz Warnungen von Experten, dass mit zunehmendem Alter der Kraftwerke die Sicherheitsrisiken ansteigen —, setzte Bundeskanzlerin Merkel nach dem Ereignis in Fukushima einen relativ schnellen Ausstieg aus der Kernenergie durch. Sieben ältere Kraftwerke ließ sie sofort vom Netz nehmen und einer dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung unterziehen; nach deren Ende wurden die Kraftwerke endgültig stillgelegt. Die restlichen Kernkraftwerke in Deutschland werden bis zum Jahr 2022 nach und nach außer Betrieb gesetzt.10
Es ist legitim, seine Meinung zu ändern, und ehrenhaft, einzusehen, dass man falsch lag. Doch wenn erst ein großes Unglück passieren muss, um Realitäten anzuerkennen, dann gilt auch wieder: Zu Ende gedacht waren die Konzepte und Maßnahmen nicht.
Finanzierung in die Zukunft verschieben
Ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene: Neue öffentliche Gebäude und Straßen werden gerne geplant, gebaut und feierlich eröffnet. Finanziert sind sie in Deutschland bislang meist über Schulden, die nur in wenigen Ausnahmefällen wieder abgebaut werden. Vielmehr zahlt der Staat fällig werdende Schulden üblicherweise mit Geld zurück, das er über neue Schulden eingenommen hat. Folglich steigen die Kosten einer Investition über die Zeit wegen Zins und Zinseszins immer weiter an.11 Zur Kasse gebeten werden somit nicht zuletzt die heute jungen Menschen und zukünftige Generationen. Ob diese einen großen Nutzen von den Bauten haben werden, ist in vielen Fällen fraglich. Schließlich besitzen moderne Bauten die Lebensdauer etwa einer Generation (30 bis 35 Jahre). Anschließend ist meist eine umfassende Generalsanierung nötig oder Abriss und Neubau.
Sind die Bauten eröffnet, unterbleibt vielmals der ausreichende Erhalt der Bausubstanz — d. h. regelmäßige Instandhaltung und Reparaturen. Auch sie kosten Geld. Die Folge des Nichtstuns: Zu viele öffentliche Gebäude, Straßen, Brücken und Wege sind in schlechtem Zustand, der teils Nutzungseinschränkungen erfordert. Der Sanierungsstau nimmt zu: Auch auf diese Weise werden Lasten in die Zukunft verschoben.
Sperrung von Teilen der Europabrücke in Koblenz wegen Brückenschäden im Jahr 2010 (Foto: Holger Weinandt CC BY-SA 3.0 DE)
Die Schuldenbremse: Bundestag und Bundesrat haben sie im Jahr 2009 im Grundgesetz verankert.12 Bis 2020 soll sie vollständig wirksam sein. Die Bundesländer dürfen sich dann in Normalsituationen nicht mehr weiter verschulden, der Bund nur noch in vermindertem Maße.
Ziel der Schuldenbremse ist, die Finanzpolitik generationengerechter als bisher auszugestalten, also die Kosten heutiger Leistungen nicht weiter in Teilen zukünftigen Generationen aufzubürden. Zwei große Fragen bleiben: Werden Regierungen und Parlamente in der Lage sein, ihre Finanzpolitik entsprechend zu verändern, oder werden sie bald mit »außergewöhnlichen Notsituationen« argumentieren, für die die Schuldenbremse die Aufnahme von Krediten erlaubt? Der Umgang der Länder des Euro-Währungsraums einschließlich Deutschlands mit den gemeinsam vereinbarten Schuldengrenzen rechtfertigt diese Frage.13 Und zweitens: Werden Regierungen und Parlamente die Schuldenbremse einhalten können, ohne zugleich mit ihrer Politik anderweitig gegen die Generationengerechtigkeit zu verstoßen?
Zwei Beispiele: Überträgt der Staat seine Autobahnen einer staatlichen Gesellschaft, kann diese Kredite aufnehmen, ohne dass sie den öffentlichen Schulden zugerechnet werden. Eine solche Maßnahme würde helfen, die Schuldenbremse einzuhalten, würde aber zusätzliche Belastungen in der Zukunft schaffen. Oder sollte der Staat an Bildung oder Sozialarbeit sparen, so könnte dies ebenfalls negative Auswirkungen in der Zukunft nach sich ziehen. Generationengerecht wäre dies nicht. Die Schuldenbremse erlaubt also, Generationengerechtigkeit in einem Bereich durch Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit in einem anderen Bereich zu erzielen.
Widersprüchliche Maßnahmen
Butter-, Milchpulver- und Fleischberge — wo seid ihr geblieben? Die Agrarpolitik der Europäischen Union mit ihren hohen Subventionen führt zu gewaltigen Produktüberschüssen: Die Landwirtschaft produziert größere Mengen an Lebensmitteln als die Menschen innerhalb der EU benötigen. Diese Überproduktion wurde insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren gelagert und teils vernichtet.
Später drückte Europa die Überschüsse in den Weltmarkt. Dank neuerlicher Zahlungen der EU (Exportsubventionen) wurden die Lebensmittel weltweit verbilligt angeboten. Diese doppelt subventionierten Produkte hatten in manchen Entwicklungsländern verheerende Folgen: Einige landwirtschaftliche Sektoren waren nicht mehr wirtschaftlich und Bauern wurden ruiniert. Somit nahmen Eigenproduktion und Selbstversorgung in diesen Ländern weiter ab, die Abhängigkeit von Lebensmitteleinfuhren aus dem Ausland wuchs.14 Zwischenzeitlich hat die EU ihre Exportsubventionen weitgehend eingestellt. Dank gestiegener Weltmarktpreise und effizienter Produktion reicht es mittlerweile aus, die landwirtschaftliche Produktion zu subventionieren, um die Exporte zu ermöglichen.
Während die Europäische Union durch landwirtschaftliche Subventionen die Selbstversorgung in armen Ländern beschneidet, leisten sie und ihre Mitgliedsstaaten in den gleichen Ländern Entwicklungshilfe. Ziel ist dabei nicht zuletzt, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und die Selbstversorgung zu stärken. Europa schädigt und fördert die Selbstversorgung in Entwicklungsländern also zugleich.
Jahrelang unterstützte die Agentur für Arbeit nicht nur Menschen finanziell, die vorzeitig in Rente gingen, ohne dass gesundheitliche Gründe dies erforderten, sondern auch die Einstellung und Beschäftigung Älterer. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Welches Ziel verfolgten die damaligen Regierungen denn nun?
Und noch ein Beispiel: Eine Schweizer Kirchengemeinde besitzt eine Kirche aus den 1960er-Jahren. Auf der Empore entspricht das Geländer an der Brüstung nicht mehr den aktuellen Vorschriften — es ist zu niedrig. Dauerhaft erhöhen darf es die Kirchengemeinde aber nicht, weil das Bauwerk unter Denkmalschutz steht. Auch an solchen kleinen Beispielen zeigt sich die Problematik der Widersprüchlichkeit.15
Wirkungsarme Maßnahmen
Trotz großen Aufwands zeigen manche Projekte nur geringen Erfolg. Die Abwrackprämie für Autos — offiziell Umweltprämie genannt — im Jahre 2009 symbolisiert diese Problematik.
Hauptziel der »Umweltprämie« war es, Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu sichern. Als zusätzliches Ziel sollte die Umwelt geschont werden.16 Wer im Jahre 2009 ein mindestens neun Jahre altes Auto verschrotten ließ, erhielt für den Neukauf eines Wagens einen stattlichen staatlichen Zuschuss von 2.500 Euro. Mit einem Budget von 5 Milliarden Euro wurde die Vernichtung von knapp 2 Millionen Autos und ein Fahrzeugneukauf gefördert.
Funktionierende Produkte und damit volkswirtschaftliche Werte zu zerstören, um neue Produkte verkaufen zu können — dies ist ein grundsätzlich fragwürdiges Konzept. Hinzu kommt: Indem die Prämie dazu motivierte, den Kauf eines Autos vorzuziehen, fiel die Nachfrage in den Folgejahren geringer aus (im Vergleich zu einer Situation ohne Prämie).
Aufgrund der Koppelung der »Umweltprämie« an einen alten Pkw wurden insbesondere Bürger angesprochen, die vergleichsweise wenig liquide waren. Deshalb wurde mit der »Umweltprämie« in erster Linie der Kauf von Kleinwagen gefördert. Tatsächlich nahmen die Verkäufe der Mini- und Kleinwagen 2009 im Vergleich zum Vorjahr stark zu, während die meisten der anderen Fahrzeugtypen weniger Absatz fanden.17 Die Kleinwagen stammten vorwiegend aus Fabriken in Frankreich, Tschechien, Polen, Italien, Rumänien und Asien. Selbst die deutschen Autohersteller hatten damals viele ihrer hierzulande verkauften Kleinwagentypen im Ausland produziert.18 Schlussendlich unterstützte die »Umweltprämie« nicht zuletzt Autofabriken im Ausland und die Konkurrenten der deutschen Autoindustrie.
Der Effekt der »Umweltprämie« auf die Auslastung der Autofabriken in Deutschland erwies sich zwar als vorhanden, allerdings in geringem Maße. Insbesondere im Vergleich zur Wirkung der Prämie im Ausland und den hohen Kosten der Maßnahme muss das Instrument als kritisch angesehen werden.
Und wie steht es mit dem zweiten Ziel der Prämie, die Schadstoffbelastung der Luft zu reduzieren? Der Schadstoffausstoß im Verkehr mag sich durch den von der »Umweltprämie« angeregten Ersatz alter durch neue Pkws ein wenig verringert haben. Denn die modernen Neufahrzeuge weisen im Betrieb geringere Schadstoffemissionen auf als die ersetzten älteren Fahrzeuge. Es ist allerdings ein Musterbeispiel ungenügenden Denkens und Handelns, sich nur auf einen kleinen Bereich zu stürzen — hier den Schadstoffausstoß bei der Autonutzung. So wurden ja auch bei der vermehrten Autoherstellung Schadstoffe in die Luft freigesetzt, wo immer das erfolgte. Dieses Faktum wurde bei der ökologischen Betrachtung ebenso wenig berücksichtigt wie die weiteren Umweltbelastungen durch die Autoherstellung, der hohe Rohstoffbedarf und die großen Mengen an Abfall, die bei der Produktion entstehen.
Die Phasen eines Produktes, in denen Umweltbelastungen auftreten.
Nebenwirkungen
»Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker«: Diese Warnung stammt aus der Werbung für Medikamente. Doch nicht allein Medikamente weisen Nebenwirkungen und Risiken auf, sondern auch das Handeln fast jeglicher Art. So wurde die »Umweltprämie« über Schulden finanziert und belastet somit junge Menschen und zukünftige Generationen. Darüber hinaus wurden Arbeitsplätze bei Gebrauchtwagenhändlern und Autoexporteuren gefährdet, da durch die Verschrottung die Zahl der Gebrauchtwagen zurückging.
Die großen Produktüberschüsse der europäischen Landwirtschaft erkaufen wir u. a. durch Umweltbelastungen als Nebenwirkung. Starke Düngung der Böden und das Ausbringen von Gülle auf landwirtschaftliche Flächen führen zu einer Nitratbelastung des Grundwassers. Infolge dessen weist bei vielen Trinkwasserbrunnen das geförderte Grundwasser eine höhere Nitratbelastung auf als zulässig.19 Seit Jahrzehnten ist das Problem bekannt. Doch weiterhin setzt die Gesellschaft auf die Grundwasser belastende Intensivlandwirtschaft statt auf umweltverträglichere Methoden. Da bleiben den Wasserwerken nur Symptom bekämpfende Maßnahmen: Teils mischen sie stark nitrathaltiges mit unbelastetem Wasser, sodass der Grenzwert eingehalten wird.20
Überhaupt die Umwelt: Die moderne Industriegesellschaft hat einen enormen Hunger nach nicht-regenerierbaren Rohstoffen, beispielsweise Metallen, Erdöl und Kohle. Außerdem schädigt sie die Lebensgrundlage der Menschen, die Umwelt, immens — der Klimawandel ist lediglich ein Beispiel von vielen. Auch dieses kurzsichtige Handeln resultiert aus linearem Denken. Schließlich lassen sich die Bedürfnisse der Menschen und der heutige materielle Lebensstandard mit deutlich weniger Rohstoffen und Umweltbelastungen decken als es momentan der Fall ist.
Lineares Denken und Handeln
Geänderte Zahlungsfristen bei der gesetzlichen Rentenversicherung — Nebelgranaten an Kernkraftwerken zur Abwehr von Terrorangriffen und ein Hin und Her in Bezug auf die Laufzeiten der Kernkraftwerke — öffentliche Bauten ausschließlich über die Zukunft finanzieren — widersprüchliche oder wirkungsarme Maßnahmen ergreifen und Nebenwirkungen ignorieren:
Denken und Handeln erweist sich in der politischen Praxis oft als kurzsichtig, als linear und unvernetzt. Dass die aufgezeigten Beispiele keine Ausnahmen sind, zeigen Renten- und Wirtschaftspolitik, Energiewende sowie die Geschichte der gemeinsamen europäischen Währung.
Die handelnden Politiker betrachten häufig nicht das Gesamte, sondern lediglich einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit. Als Konsequenz bekämpfen sie oft Symptome, statt an den Ursachen von Problemen anzusetzen, und verschieben die Probleme in die Zukunft.
»Vordergründige Lösungen sind bestechend. Man ist begeistert, eine Lösung gefunden zu haben, ein Problem beseitigen zu können, und man schirmt sich, um diese Lösung nicht zu gefährden, gegenüber Hinweisen auf die reale Komplexität ab […].«
Frederic Vester (1925—2003), Biochemiker und Biokybernetiker21
Wenn politische Maßnahmen nicht wie gewünscht wirken oder zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, bleibt es nur selten beim bereits unbefriedigenden Status quo. Aufgrund der jeweils aktuellen Erfahrungen passen die Verantwortlichen ihre Maßnahmen an — und machen die Situation dabei meist noch komplexer. Neue Schwierigkeiten entstehen. Bei alldem droht der Aufwand ständig größer und die Effizienz des Handelns geringer zu werden.
»Zu den langfristigen und besonders heimtückischen Konsequenzen von unsystemischen Lösungen gehört, dass man immer mehr und mehr davon braucht.«
Peter Senge, Luft- und Raumfahrtingenieur, Systemwissenschaftler, Organisationsberater und Autor22
Auch wenn in diesem Kapitel bislang ausschließlich das Handeln von Politikern als Beispiel angeführt wurde, bleibt festzuhalten: Lineares Denken und Handeln ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Auch in Wirtschaft und anderen Bereichen arbeiten viele Verantwortliche linear. Allerdings betreffen die Folgen zumeist nicht die gesamte Gesellschaft, wie es bei politischen Entscheidungen häufig der Fall ist.
Lineares Denken und Handeln in Unternehmen
Die Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen präsentieren immer wieder beeindruckende Pläne zum Wachstum von Umsatz und Gewinn, zur Umorganisation ihres Unternehmens sowie zum Aufkauf anderer Firmen. Nicht immer sind diese Pläne realistisch. So zeigt sich, dass Firmenaufkäufe häufig nicht die gewünschte Wirkung haben.23
Woran kann es liegen, dass geplante Strategien und Handlungen in der Praxis nicht zum Ziel führen? Auch mancher Manager neigt zum linearen Denken, zum Herausgreifen von Einzelaspekten unter Vernachlässigung der Gesamtzusammenhänge, zum Ausblenden von Nebenwirkungen. Zum anderen führt das unvernetzte Denken dazu, Kulturen, Werte und Führungsstile in Unternehmen zu übersehen. Diese sogenannten weichen Faktoren sind nicht in Zahlen zu fassen. Das unterscheidet sie von den harten Faktoren wie Umsatz, Gewinn, Zahl der Mitarbeiter und Marktanteile. Im Umgang mit weichen Faktoren tun sich viele Unternehmenslenker schwer.
Die lineare Denkweise bleibt in Unternehmen nicht auf die großen strategischen Themen beschränkt. So senken Unternehmen immer wieder ihre Kosten, indem sie preisgünstigere Teile in ihren Produkten verbauen. Dauerhaft funktioniert das kaum ohne Qualitätseinbußen. Zunehmende Kosten für Garantieleistungen und enttäuschte Kunden, die das nächste Mal ein Produkt des Konkurrenzherstellers kaufen, können die Folgen sein. Solche Einsparungen bergen die Gefahr, den Unternehmen teuer zu stehen zu kommen: Einen angekratzten Ruf wieder aufzubauen und abgewanderte Kunden wiederzugewinnen, erweist sich als langwierige und kostspielige Aufgabe.
Manche Unternehmen wollen profitabler werden, indem sie ihre Personalkosten senken. Eine viel genutzte Strategie ist, frei werdende Stellen eine gewisse Zeit nicht wieder oder überhaupt nicht mehr zu besetzen. Es mag kurzfristig Geld sparen, eine frei werdende Stelle unabhängig von der Notwendigkeit, Wichtigkeit und Dringlichkeit ihrer Aufgaben nicht direkt wieder zu besetzen. Allerdings bremst dies die Aufgabenerfüllung im Unternehmen.
Die Zahl der Beispiele für lineares Denken in Unternehmen ist groß. Jahrelang haben die deutschen Lebensversicherungsunternehmen ihren Neukunden relativ hohe Renditen versprochen und vertraglich garantiert. Sie bedachten nicht, dass sie vergleichsweise hohe Zinsen nicht mehr zahlen können, wenn das Zinsniveau deutlich sinkt — wenn sie also mit den Beitragseinnahmen nur noch geringere Erträge erzielen können.
Banken beschäftigen sich täglich mit Risiken. Das betrifft einzelne Kredite ebenso wie grundsätzliche volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die Entwicklungen, die zur Finanzkrise 2008 führten, hatten die meisten Geldhäuser in ihrem Optimismus jedoch nicht berücksichtigt. Ihre Risikobetrachtungen bezogen sich auf »normale« Zeiten und klammerten außergewöhnliche Ereignisse aus. In der Folge standen 2008 in der Finanzkrise Banken in vielen Ländern vor immensen wirtschaftlichen Problemen. Der Staat rettete einige Bankhäuser vor der Zahlungsunfähigkeit.
Lineares Denken und Handeln im Privaten
In Politik und Wirtschaft wird häufig linear gedacht, so die bisherige Erkenntnis. Doch das Phänomen ist nicht auf einzelne gesellschaftliche Bereiche begrenzt. Ein jeder denkt linear — mehr oder weniger. Einige Beispiele:
So kaufen viele Verbraucher manches Mal billige Produkte, die teils schnell zu Müll mutieren. In vielen Fällen erweisen sich teurere, qualitativ höherwertige Produkte als preisgünstiger. Diese Erkenntnis setzt allerdings einen längeren Betrachtungszeitraum voraus.
Tausende Häuslebauer haben zur Finanzierung Kredite in Schweizer Franken aufgenommen. Sie wollten von günstigen Zinsen in der Schweiz profitieren. Im Januar 2015 wurde der Schweizer Franken gegenüber vielen Währungen deutlich stärker, sodass es mehr Euros als zuvor brauchte, um die gleiche Höhe an Zinsen in Franken zu zahlen und solche Kredite zurückzuzahlen. Aus vermeintlich billigen Krediten wurden sehr teure, die manchen Kreditnehmer in wirtschaftliche Schwierigkeiten brachten.
Weniger essen und dadurch abnehmen — auf diesem Prinzip basieren viele Diäten. Der Körper stellt sich während der Diät auf die geringere Nahrungszufuhr ein und kommt nach Ende der Diät mit weniger Nahrung aus. Dann isst die Person jedoch wieder mehr. Die Folge: Das Körpergewicht nimmt wieder zu.
Die Zähne gut zu pflegen erspart Schmerzen und Zahnarztbesuche. Nicht jedem gelingt dies. Oder man schiebt es vor sich her, am Fahrrad den abgefahrenen Mantel zu wechseln. Ereilt einen jedoch unterwegs einen Platten, so ist der Aufwand deutlich höher als bei rechtzeitigem Mantelwechsel zuhause.
Lineares Denken
Dem in diesem Kapitel geschilderten Handeln liegt ein Denkmuster zugrunde, das als linear bezeichnet wird. Andere verwandte Begriffe sind unvernetzt oder nichtsystemisch.
Bei der linearen Denkweise wird die Komplexität von Situationen und Prob lemen weitgehend übersehen, d. h. die vielfältigen Zusammenhänge und die Dynamik.
Dabei wird in vielen Fällen fälschlicherweise angenommen, ein Problem habe lediglich eine isolierte Ursache, und eine Handlung hätte nur eine einzige Wirkung.
Lineares Denken führt zu scheinbar einfachen Lösungen. Diese erweisen sich meist als Scheinlösungen, also als vermeintliche Lösungen, die jedoch nicht funktionieren.
Aus linearem Denken ergibt sich lineares Handeln.
Nicht in allen Fällen ist klar: Haben die Handelnden Zusammenhänge und Probleme nicht erkannt oder ignorierten sie sie wissentlich, um Problemen aus dem Weg zu gehen oder bestimmte Interessen zu verfolgen? Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche: Es kommen die problematischen Folgen zum Tragen. In beiden Fällen liegt lineares Denken vor.
Zum Umgang mit toten Pferden
Wie viele Denkstrukturen noch aufzubrechen sind auf dem Weg zu einer vernetzt denkenden und handelnden Gesellschaft: Eine im Internet in vielen Fassungen kursierende Parabel mag es sehr überspitzt verdeutlichen.24 Indianer im Wilden Westen handelten nach diesem Grundsatz: Wenn dein Pferd tot ist, besorge dir ein neues. In unserer komplexen und zugleich von linearem Denken geprägten Welt geht das so einfach nicht. Ganz im Gegenteil. Im Falle eines toten Pferdes,
♦ besorgen wir uns eine dickere Peitsche,
♦ trainieren noch mehr als bisher, um noch besser reiten zu können,
♦ wechseln die Reiter aus,
♦ erklären das Reiten toter Pferde zur Normalität,
♦ beschließen, nur noch tote Pferde zu halten, da die Futter- und Unterhaltskosten deutlich geringer als bei lebenden Pferden sind,
♦ schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden,
♦ ändern die Kriterien für den Tod eines Pferdes, sodass tote Pferde noch leben,
♦ verbieten lebenden Pferden zu sterben,
♦ spannen einen Rettungsschirm über unsere toten Pferde,
♦ strukturieren um, damit unsere toten Pferde in eine andere Abteilung kommen,
♦ outsourcen die toten Pferde: Der Subunternehmer kann sie sicherlich besser reiten und effizienter am Leben halten als wir,
♦ kooperieren oder fusionieren, um die toten Pferde noch besser nutzen zu können,
♦ und erklären: Von Anfang an war ein totes Pferd unser Ziel.
Warum vernetzt denken und handeln?
Kommen wir auf die Ausgangsfrage des Kapitels zurück: Warum sollten wir vernetzt denken und handeln?
Um bestehende Probleme in den Griff zu bekommen. Um mögliche zukünftige Probleme zu vermeiden. Um Ziele zu erreichen. Um den Aufwand dafür gering zu halten. Um das Wichtige zu tun, anstatt uns um Unwichtiges zu kümmern. Um die gegenwärtigen sowie die zukünftigen Herausforderungen meistern zu können. Um nicht weiter auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben.
2
Falsche Ursachen — falsche Schlussfolgerungen — falsches Handeln
»Mehr Sex im Schlafzimmer bedeutet mehr Gehalt auf dem Konto? Absolut!« Das verspricht ein Artikel auf der deutschen Webseite der Zeitschrift Cosmopolitan.1 Eine Studie, für die 7.500 Personendaten ausgewertet wurden, sei zum Ergebnis gekommen: Je mehr Sex wir hätten, desto mehr würden wir verdienen.
Wie ist das Leben doch einfach und schön. Leidige Kämpfe mit dem Chef um eine Gehaltserhöhung? Vorbei sind diese Zeiten! Ein bisschen mehr Sex, und schon steigt der Kontostand.
Doch vielleicht sind diese Interpretationen zu sehr unter statischer Sichtweise erfolgt. Schließlich wurden in der zugrunde liegenden Studie ja keine Feldversuche durchgeführt, in denen sich feststellen ließ, ob eine Zunahme an Sex auch eine Zunahme der Gehaltszahlung zur Folge hat. Die Wissenschaftler untersuchten lediglich, ob es einen statistischen Zusammenhang zwischen Einkommen und Sexualleben gibt — offensichtlich basierend auf der Befragung von Personen zu jenen zwei Themen, zu denen in Umfragen sicherlich mit am häufigsten gelogen wird: Einkommen und Liebesleben.
Für eine Wirkung die Ursache zu finden, ist gar nicht so einfach. Anschließend die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen ebenfalls nicht. Täglich konfrontieren uns die Medien mit den Ergebnissen aus Studien, in denen angeblich Zusammenhänge zwischen zwei Faktoren bewiesen und weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Doch nicht immer sind diese Zusammenhänge und die Schlussfolgerungen korrekt. Diese Problematik betrifft nicht allein Meldungen in den Medien. Auf Basis derartiger Studien — wenn auch zu anderen Themen — ergreifen Regierungen Maßnahmen. Solches Denken und Handeln ist symptomatisch für den verbreiteten linearen Ansatz.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Faktoren als real angesehen werden kann und sich entsprechende Schlussfolgerungen ziehen lassen?
Sterbende Doktortitel?
Eine überraschende Erkenntnis machte der US-Amerikaner Tyler Vigen: Die Zahl der durch blutverdünnende Medikamente ausgelösten Todesfälle verläuft parallel zur Zahl der vergebenen Doktortitel im Fach Soziologie.2 In Jahren, in denen viele Doktortitel in Soziologie zuerkannt werden, sterben auch viele Menschen aufgrund von blutverdünnenden Medikamenten. Werden hingegen weniger Doktortitel vergeben, liegt die Zahl der Todesfälle als Folge der Einnahme blutverdünnender Medikamente in etwa gleichem Maße niedriger.
Lässt sich nun schlussfolgern, es gäbe einen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren? Innerhalb der betrachteten neun Jahre besteht zwar ein statistischer Zusammenhang. Aber weder hat die Zahl der Doktortitel einen realen Einfluss auf die Zahl der Todesfälle, noch verhält es sich umgekehrt. Dass die beiden Faktoren statistisch parallel verlaufen ist reiner Zufall; es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den zwei betrachteten Faktoren. Würde ein längerer Zeitraum betrachtet, wäre das offensichtlich.
Zuer kannte Doktortitel im Fach Soziologie und Todesfälle aufgrund von blutver dün nenden Medikamenten (Quelle: www.tylervigen.com)
Gesundheitsgefahr durch Eiscreme?
Wer schon einmal im Hochsommer einen Strand im Süden besucht hat, kann bestätigen: Je mehr Speiseeis verkauft und gegessen wird, desto mehr Sonnenbrände treten auf. Lässt sich daraus die Schlussfolgerung ziehen, der Verkauf oder der Konsum von Speiseeis würde zu Sonnenbränden führen?
Sonnenbrände treten zwar vermehrt in Zeiten auf, in denen große Mengen an Speise eis verkauft und gegessen werden. Doch stellt der Verkauf nicht die Ursache für die Sonnenbrände dar. Es besteht folglich kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Speiseeisverkauf und Sonnenbränden.
Die Ursache sowohl für Speiseeisverkauf als auch für Sonnenbrände ist Sonnenschein.
Ursachengrafik zu Speiseeisverkauf und Sonnenbränden
Statistisch lässt sich hingegen ein Zusammenhang zwischen allen drei Größen feststellen:
♦ Je mehr Sonnenschein, desto mehr Speiseeisverkauf.
♦ Je mehr Sonnenschein, desto mehr Sonnenbrände.
♦ Je mehr Speiseeisverkauf, desto mehr Sonnenbrände.
Von Korrelation zu Kausalität
Für Veröffentlichungen aus der Wissenschaft, in Presseartikeln oder in Publikationen von Interessensverbänden gilt häufig: Findet sich für zwei oder mehrere Merkmale, Zustände oder Ereignisse (Faktoren) ein auffälliger Zusammenhang (Korrelation), werden oft weitreichende Rückschlüsse gezogen. Einer dieser Faktoren gilt dann als Ursache, ein anderer als Folge (Wirkung). Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bestimmen nicht selten das Handeln und ziehen teils aufwendige Maßnahmen nach sich — unabhängig davon, ob es wirklich einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang gibt.
Korrelation
Auffälliger Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Faktoren (Merkmalen, Zuständen oder Ereignissen). Die Stärke einer Korrelation wird anhand von statistischen Daten mathematisch ermittelt.
Im Beispiel zu Speiseeisverkauf und Sonnenbränden haben wir gesehen: In Zeiten hohen Speiseeisverkaufs entstehen viele Sonnenbrände. Hingegen besteht keine direkte Beziehung in Form von Ursache und Wirkung (kausaler Zu sam men hang): Vielmehr ist die Sonne Ursache sowohl für den Speiseeisverkauf als auch für die Zahl der Sonnenbrände.
Kausaler Zusammenhang
Direkte Beziehung von Ursache und Wirkung. Beispielsweise besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen Sonnenschein (Ursache) und Sonnenbränden (Wirkung).
Es kann aber auch vorkommen, dass zwei Merkmale nicht direkt miteinander zu tun haben, auch wenn ein auffälliger Zusammenhang besteht. Im Beispiel von Einkommen und Lebenserwartung spielt ein dritter Faktor eine Rolle, der zwischen den beiden betrachteten Faktoren steht — der Lebenswandel. Bei den Doktortiteln in Soziologie und den Todesfällen als Folge blutverdünnender Medikamente gibt es auch keine indirekte Verbindung; die Korrelation hat sich zufällig ergeben.
»Korrelation und Kausalität verhalten sich zueinander wie zwei Zwillingsschwestern, die von vielen verwechselt werden, die nicht mit beiden gleichermaßen gut bekannt sind.«
Sophia Amalie Antoinette Infinitesimalia, Bloggerin3
Kriminell und ledig oder verheiratet und unbescholten?
Doch wie lässt sich in einem konkreten Fall feststellen, ob eine Korrelation auch mit einem kausalen Zusammenhang verbunden ist? Diese Frage sei im folgenden Schritt geklärt.
Mehrere Studien kommen zu dem Schluss: Unter verheirateten Menschen gibt es anteilig weniger Kriminelle als unter Unverheirateten.4 Es besteht also eine Korrelation zwischen Verheiratetsein und Kriminalität.
Doch ob die Menschen heiraten (Ursache) und dann eher nicht kriminell werden (Wirkung) oder kriminell werden und dann eher nicht heiraten, ist keine leicht zu klärende Frage. So lassen sich in Bezug auf Ursache und Wirkung zwei Interpretationen finden:
♦ Interpretation 1:
Verheiratet zu sein senkt das Risiko, kriminell zu werden.
♦ Interpretation 2:
Kriminell zu sein (und womöglich im Gefängnis zu sitzen) verringert die Möglich keit, verheiratet zu sein (d. h. Partner zu finden bzw. Beziehung aufrechtzuerhalten).
Letztlich kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Beispiel zu Verheiratetsein und Kriminalität beide Interpretationen korrekt sind. Es lässt sich mathematisch zwar feststellen, ob es einen starken Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren gibt, aber nicht, welcher Faktor wie stark auf den anderen Einfluss nimmt. Die ermittelte Korrelation hat dann nur eine eingeschränkte Aussagekraft.
Beide Größen wirken aufeinander
Zusammenfassender Überblick zu den Erklärungsmöglichkeiten
Die bisherigen Erkenntnisse, welche prinzipiellen Erklärungsmöglichkeiten es für statistisch ermittelte Zusammenhänge zwischen zwei Faktoren gibt, zeigt die folgende Abbildung.
Erklärungsmöglichkeiten für den statistischen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren (Korrelation)
Prinzip
Beispiel
Es besteht kein Ursache-Wirkung-Zusammen- hang: Der Zusammenhang zwischen den Faktoren A und B ist zufällig. →
Keine Kausalität zwischen A und B sowie B und A
Doktortitel in Soziologie und Todesfälle als Folge blutverdünnender Medikamente
Die Faktoren A und B haben aufeinander keine Wirkung, sondern werden beide durch den Faktor C (Ursache) beeinflusst. →
Keine Kausalität zwischen A und B sowie B und A
Sonnenschein (Ursache); Speiseeisverkauf und Sonnenbrand (jeweils Wirkung)
Faktor A (Ursache) beeinflusst Faktor B (Wirkung). →
Kausalität zwischen A und B
Einnahme eines blutdrucksenkenden Medikaments (Ursache); verringerter Blutdruck (Wirkung).
Faktor B (Ursache) beeinflusst Faktor A (Wirkung). →
Kausalität zwischen B und A
Ursache-Wirkung-Richtung ist umgekehrt als zunächst angenommen.
Faktor A (Ursache) beeinflusst Faktor B (Wirkung) und Faktor B (Ursache) beeinflusst Faktor A (Wirkung). →
Kausalität zwischen A und B sowie zwischen B und A
Familienstand und Kriminalität
Erklärungsmöglichkeiten für den statistischen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren (Korrelation)
Wann man von einer Korrelation auf einen kausalen Zusammenhang schließen darf
Aus den Erklärungsmöglichkeiten für einen statistisch ermittelten Zusammenhang zwischen zwei Faktoren ergibt sich die grundsätzliche Frage: Wann darf man von einer Korrelation auf eine Kausalität schließen? Es sind die folgenden Bedingungen einzuhalten:
1. Logische Erklärung mit korrekter zeitlicher Reihenfolge
Es muss eine logische Erklärung für den Zusammenhang der beiden Faktoren vorliegen, wobei die Ursache vor dem Effekt stattfindet.5
Forscher entwickeln ein neues Medikament, das den Blutdruck senken soll. Sie erwarten diese Wirkung aufgrund ihres Wissens aus Chemie, Biologie und zu den Abläufen im menschlichen Körper. Bei ihrer Erklärung stimmt die zeitliche Reihenfolge von Ursache und Wirkung: Zuerst schluckt der Patient das Medikament, erst später zeigt sich die Wirkung in Form eines verringerten Blutdrucks.
In anderen Fällen von Korrelationen lässt sich keine logische Erklärung finden. Das gilt etwa für das Beispiel zu den Doktortiteln in Soziologie und den Todesfällen als Folge blutverdünnender Medikamente.
2. Erklärung ist eindeutig
Alle anderen plausiblen Erklärungen, wie es zum Effekt kommen kann, müssen ausgeschlossen werden können.6
Beim Beispiel des blutdrucksenkenden Medikaments ist die Erklärung für die Wirkung eindeutig. Auf die Frage, warum bei Patienten, die das neue Medikament einnehmen, der Blutdruck absinkt, findet sich keine andere Erklärung als die Medikamenteneinnahme. In anderen Fällen sind zusätzlich zur aufgestellten logischen Erklärung auch andere Begründungen einleuchtend. Warum verheiratete Menschen weniger Straftaten begehen als unverheiratete, könnte z. B. auch folgende Ursachen haben:
♦
Die Tatsache, dass ein Mensch mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebt, könnte die Ursache für die geringere Kriminalitätsneigung sein — und nicht der Status der Ehe.
Studien zeigen allerdings, dass das Zusammenleben die Kriminalitätsneigung deutlich geringer bremst als die Ehe (es sei denn, die Zusammenlebenden sind verlobt).7 Erklärt wird dieses Ergebnis für Verheiratete mit einem größeren Einfluss auf den Partner, einer größeren Verantwortung für den Partner, einem anderen Lebensstil und mit weniger frei verfügbarer Zeit.
♦
Jugendliche und Twens begehen zum einen altersbedingt mehr Straftaten als Ältere
8
— zum anderen ist in diesen Altersgruppen der Anteil der Verheirateten viel geringer als bei den älteren Menschen.
Zwar begehen Jugendliche und Twens bezogen auf ihren Anteil an der Bevölkerung tatsächlich mehr Straftaten als ältere Menschen — also in einem Alter, in denen viele (noch) nicht verheiratet sind. Doch die Tatsache, dass Verheiratete in weniger Fällen kriminell werden als Unverheiratete9, zeigt sich grundsätzlich wohl unabhängig vom Alter — zumindest, wenn in jungem Alter geheiratet wurde.
Zwar gibt es im Beispiel zu Kriminalität und Ehestand auch andere Erklärungen als die ursprünglich angenommene; sie sind aber nicht relevant. Beschränken wir uns an dieser Stelle beispielhaft auf die zwei gerade genannten Alternativerklärungen, so lässt sich feststellen: Die ursprüngliche Erklärung ist eindeutig — verheiratet zu sein senkt das Risiko, kriminell zu werden; zugleich verringert Kriminalität die Möglichkeit, eine Ehe zu führen.
3. Wissenschaftliche Standards sind eingehalten
Drei wichtige Standards sind: Wurde das Richtige betrachtet? Wurde eine ausreichende Menge betrachtet? Wurde die betrachtete Ursache ausreichend von anderen Ursachen isoliert?
a.) Das Richtige betrachten
Im Beispiel zu Kriminalität und Ehe würden falsche Ergebnisse entstehen, wenn nur junge Menschen betrachtet oder lediglich in Gefängnissen Untersuchungen durchgeführt würden. Die Auswahl der betrachteten Bereiche muss mit der Fragestellung übereinstimmen. In unserem Beispiel sind also Menschen im heiratsfähigen Alter aller Altersklassen zu berücksichtigen. Gibt es mehr alte Menschen als junge, muss eine entsprechend größere Zahl alter Menschen befragt werden. Sind diese Bedingungen eingehalten, sagt man: Die Untersuchung ist repräsentativ.
b.) Eine ausreichende Menge betrachten
Um zu einer aussagekräftigen Erkenntnis zum Thema Kriminalität und Ehe zu kommen, ist es nicht ausreichend, in jeder Altersklasse zwischen einer Person und fünf Personen zu betrachten — entsprechend ihres Gesamtanteils an der Gruppe der heiratsfähigen Menschen. Diese Anzahl wäre zu gering, als dass sich die gewonnene Erkenntnis verallgemeinern ließe. Wie groß die betrachtete Menge sein muss, hängt davon ab, welche Sicherheit das Ergebnis bieten soll: Soll es mit einer Sicherheit (Wahrscheinlichkeit) von 100 % korrekt sein, muss im Beispiel zu Kriminalität und Ehe die gesamte heiratsfähige Bevölkerung betrachtet bzw. befragt werden. Reichen als Sicherheit 99 % oder 90 % aus, können aus der Menge der heiratsfähigen Bevölkerung deutlich weniger Personen einbezogen werden.
Wie viele Fälle zu analysieren sind, damit die gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden können, muss im Einzelfall mathematisch ermittelt werden. c.) Die betrachtete Ursache ausreichend von anderen Ursachen isolieren In der komplexen Welt haben nur wenige Effekte eine einzige Ursache. Beispiel Kriminalität: Neben dem Nichtverheiratetsein beeinflussen vor allem Vorstrafen im Elternhaus und schlechte Bildung die Neigung zu Kriminalität.10 Deshalb ist in Studien sicherzustellen, dass nur jeweils eine einzelne vermutete Ursache-Wirkung-Beziehung untersucht wird.
Mehrere Ursachen eines Effektes in Studien voneinander zu isolieren, um nur den Effekt einer einzelnen Größe zu analysieren, ist teils sehr aufwendig. Ein Grund dafür: Die einzelnen Ursachen wiederum können sich untereinander beeinflussen. Statistische Rechenmethoden helfen hierbei. Ob die unterschiedlichen Ursachen einer Wirkung in einer Studie ausreichend voneinander isoliert wurden, steht in Meldungen über Studienergebnisse nicht. Das lässt sich nur den Studien selbst entnehmen und bleibt Fachleuten vorbehalten.
In Pressemeldungen wird häufig von einer Korrelation auf eine Kausalität geschlossen, ohne dass diese Bedingungen ausreichend geprüft wurden. In den zugrunde liegenden Studien hingegen weisen die Autoren nicht selten darauf hin, dass sie eine Korrelation zwischen zwei Größen gefunden haben, nicht aber einen kausalen Zusammenhang. Doch auch in wissenschaftlichen Studien selbst unterbleibt manchmal die umfassende Prüfung, ob die Bedingungen erfüllt sind.
Nochmals zum Liebesleben und dem Gehalt
Und was ist nun mit der Studie zum Einfluss der Häufigkeit von Sex auf die Höhe des Gehalts — wie lässt sich das Ergebnis interpretieren? Sex hat keinen Einfluss auf das Gehalt, das lässt sich sicher sagen. Die ersten beiden Bedingungen für das Schlussfolgern von einer Korrelation auf Kausalität sind nämlich nicht erfüllt:
Zum Einen hat die Studie nicht aufgezeigt, dass die angebliche Ursache (der Sex) vor der Wirkung (höheres Gehalt) steht — es wurde ja lediglich eine statische Betrachtung vorgenommen. Zum Anderen haben die Studienersteller keine eindeutige Erklärung für den statistisch ermittelten Zusammenhang liefern können.
Eine plausible Erklärung des Studienergebnisses könnte so lauten: Sex führt zu persönlicher Zufriedenheit, was auf die Leistungen bei der Arbeit eine Auswirkung hat. Die berufliche Leistung wiederum hat Einfluss auf die Höhe des Gehalts.11
Eine Interpretation zum Zusammenhang von Sex und Gehalt
Oder: Zufriedenheit im Beruf fördert den beruflichen Erfolg mit positiven Auswirkungen auf das Gehalt. Berufliche Zufriedenheit kann auch zu höherer privater Zufriedenheit führen, was wiederum die Häufigkeit von Sex verstärken mag.
Eine weitere Interpretation zum Zusammenhang von Sex und Gehalt
Beiden Interpretationen ist gemein, dass sie keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Sex und Gehalt beinhalten. Im ersten Fall sind zwei weitere Faktoren zwischengeschaltet. Im zweiten Fall führt die berufliche Zufriedenheit sowohl zu höherem Gehalt als auch zu vermehrten Sex, jeweils mit einem dazwischen wirkenden Faktor. Weitere Erklärungsmöglichkeiten bestehen.
Problem bei gesellschaftlichen Fragestellungen
In den Naturwissenschaften fällt es zumeist leicht, aus Experimenten eindeutige und immer wiederholbare Ergebnisse zu erhalten. Das liegt an den Naturgesetzen von Physik und Chemie. Bei gesellschaftlichen Fragestellungen ist es hingegen oft schwer, eindeutige und verallgemeinerbare Ergebnisse zu erhalten. Denn:
♦ Die Welt ist sehr komplex: Vieles hängt mit Vielem zusammen, und alles ist immer in Veränderung.
♦ In komplexen Systemen gibt es immer wieder Überraschungen und Störungen.
♦ Indem Wissenschaftler aus den Ergebnissen ihrer Experimente oder Analysen allgemein gültige Erkenntnisse aufstellen, schreiben sie die Vergangenheit in die Zukunft fort. Es wird vorausgesetzt, dass das Ergebnis eines Experiments aus der Vergangenheit auch in der Zukunft gelten würde. Das ist bei gesellschaftlichen Themen aufgrund von Veränderungen, Wandel und Umbrüchen aber nicht zwangsläufig der Fall.
Der Einfluss von Korrelationen auf politisches Handeln
Politische Maßnahmen basieren bisweilen auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien, die Korrelationen beschreiben. Es ist dann zu hören, dass dieses mit jenem korrelieren würde oder bestimmte Zusammenhänge empirisch belegt seien. Nicht immer ist für Außenstehende klar, ob auch ursächliche Zusammenhänge vorliegen. Besteht lediglich eine Korrelation und keine Kausalität, dann kann darauf ausgerichtetes politisches Handeln zu Symptombekämpfung, sich vergrößernden Problemen und ineffizientem Mitteleinsatz (d. h. Geldverschwendung) führen.
Eine 2010 veröffentlichte Studie zu Staatsschulden und Wirtschaftswachstum beeinflusste die Diskussion über öffentliche Haushalte, Staatsausgaben und Sparpolitik in vielen Ländern. Die renommierten Wirtschaftswissenschaftler Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff hatten in ihrer aufwendigen, auf historischen Daten basierenden Studie aufgezeigt: Hohe Staatsschulden bremsen das Wirtschaftswachstum. Wenn die Schulden 90 % der Jahreswirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) eines Landes erreichen, würde das Wirtschaftswachstum abnehmen.12
Der Ökonom Randall Wray hingegen vertritt die Meinung, der Zusammenhang sei gerade umgekehrt: Ein niedriges Wirtschaftswachstum führe zu höheren Staatsschulden.13 Mit dieser Interpretation ergeben sich völlig andere politische Ziele und Maßnahmen.
Welche Interpretation ist nun richtig? Darüber streiten die Fachleute noch heute — lange nachdem die erstgenannte Interpretation politisches Handeln beeinflusst hat.
Unabhängig von der Interpretation haben sich die von Reinhart und Rogoff errechneten Prozentwerte zur Korrelation von Staatsschulden und Wirtschaftswachstum als fehlerhaft erwiesen.14 2013 zeigte ein Wirtschaftsstudent in einer Aufsehen erregenden Arbeit, dass für manche Länder einige Werte nicht in die Berechnung einbezogen worden waren. Daraufhin gab es starke Kritik, die Forscher hätten methodisch unsauber gearbeitet und auf diese Weise ihre deutlichen Ergebnisse erst erhalten. So zeigt dieses Beispiel auch: Studienergebnisse sind nicht zwangsläufig korrekt, nur weil sie von renommierten Wissenschaftlern oder Organisationen durchgeführt wurden.
Ursachen von Ursachen von Ursachen
Korrelationsanalysen lenken die Aufmerksamkeit auf eine einzige Ursache einer Situation oder eines Problems. Das birgt die Gefahr, andere Ursachen zu übersehen oder zu vernachlässigen. Bevor aufgrund der Ergebnisse einer Korrelationsanalyse Maßnahmen ergriffen werden, sollten auch die anderen Ursachen betrachtet werden.
Ursachengrafik für große Abfallmengen
Dabei gilt es zu beachten: Jede Ursache hat wiederum ihre Ursachen. Auch für diese Unterursachen gibt es wiederum Ursachen. Wie soll es gelingen, Probleme in den Griff zu bekommen, wenn die Ursachen von Ursachen gar nicht betrachtet werden?
Anhand eines Beispiels aus einem Industrieunternehmen lässt sich das veranschaulichen:15
»Auf dem Werkstattboden befindet sich eine Öllache. Warum?
Weil aus der Maschine Öl ausläuft. Warum?
Weil die Dichtung verschlissen ist. Warum?
Weil wir Dichtungen gekauft haben, die aus mangelhaftem Material bestehen.
Warum?
Weil es ein gutes Geschäft für uns war. Warum?
Weil die Einkaufsmanager nach Kosteneinsparungen beurteilt werden.«
In diesem einfachen Fall liegt eine lineare Abfolge von Ursachen vor — ein Problem hat eine Ursache, die wiederum auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist etc. Trotz der einfachen Abfolge von Ursachen ist das Ergebnis äußerst aufschlussreich und verdeutlicht: Um die grundsätzliche Ursache des Problems anzugehen, sind größere Änderungen erforderlich als nur das Öl aufzuwischen und die Dichtung zu wechseln — ein höheres Budget für Maschinenteile und Wartungsarbeiten sowie ein anderes Vergütungssystem für Einkaufsmanager.
Bei komplexeren Themen hat eine Ursache nicht allein eine einzige Ursache, sondern selbst schon mehrere Ursachen. Diese haben abermals ihre eigenen Ursachen. Überdies steht die Vielzahl an Ursachen nicht voneinander isoliert unter- und nebeneinander — sie beeinflussen sich zum Teil auch gegenseitig.
Warum fallen in den Industriestaaten große Abfallmengen an? Es wird zu viel konsumiert und zu viel weggeschmissen, lautet eine einfache Antwort. Schaut man genauer hin, ergibt sich ein ganzes Geflecht an Ursachen und Unterursachen. Im Rahmen des Projekts Wandel vernetzt denken hat der Autor mit seinem Team eine umfassende Analyse zu den Ursachen großer Abfallmengen durchgeführt. Ermittelt wurden 33 sich teils untereinander beeinflussende Faktoren als Ursachen (siehe Abbildung). Damit verdeutlicht die Grafik, dass einfache Lösungen kaum dazu führen können, komplexe Probleme in den Griff zu bekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die vorgeblichen Lösungen lediglich an Symptomen ansetzen, nicht an den Ursachen.
Ursachengrafiken können auch in einfacheren oder alltäglichen Fällen helfen, einem Problem auf den Grund zu gehen. Das betrachten wir später im Kapitel zum Visualisieren komplizierter und komplexer Zusammenhänge näher.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
♦ Immer wieder wird in den Medien, aber zum Teil auch in Studien selbst, von einem statistischen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren auf einen ursächlichen Zusammenhang geschlossen, obwohl die dafür notwendigen Bedingungen nicht erfüllt sind.
♦ Werden auf Basis solcher Studien Maßnahmen mit dem Ziel durchgeführt, ein Problem in den Griff zu bekommen, so ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass lediglich Symptome angegangen werden, nicht aber die Problemursachen. Die Folge: Probleme werden verschoben und vergrößern sich, die eingesetzten (Finanz-)Mittel sind ineffizient verwendet.
♦ Statt allein eine einzige Ursache für komplexe Fragestellungen herauszugreifen und anzugehen, ist das gesamte Netz an Ursachen mit ihren Unterursachen in notwendiger Tiefe zu betrachten — einschließlich der Wirkungen aller Ursachen untereinander.
Checkliste zu Ursachen
Gibt es für eine Wirkung, eine Situation oder ein Problem lediglich eine Ursache oder bestehen mehrere Ursachen?Welche Ursachen haben die Ursachen?Beeinflussen sich die Ursachen einschließlich der Unterursachen untereinander? Falls ja: wie?Wenn eine Situation geändert oder ein Problem angegangen werden soll: An welchen Ursachen muss angesetzt werden, um das Ziel erreichen zu können?Checkliste zur Beurteilung von Meldungen zu Ursache und Wirkung
1. Ist eine Korrelation oder eine Kausalität erkennbar?